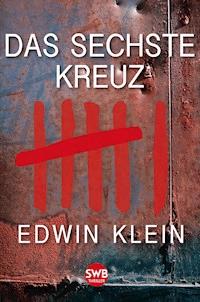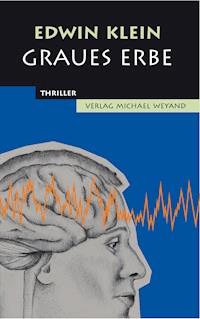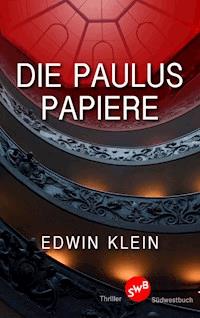
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SWB Media Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Während der Recherche für eine Paulusschrift wird dem jungen Priester Thomas Simmerling im Vatikan von Pater Bonifaz, einem ehemaligen Studienkollegen seines Trierer Bischofs, eine Datei zugespielt. Aufgeführt sind in ihr Personen, deren Väter hochrangige Kirchenfürsten sein sollen. Bonifaz stirbt durch einen Unfall, Thomas glaubt nicht daran.Durch den Besitz der brisanten Unterlagen des Paters gerät er in große Gefahr und stört Kreise im Vatikan, die selbst nicht vor einem Mord an einem Geistlichen zurückschrecken. Eher zufällig stößt Thomas im weiteren Verlauf auf seine eigene,mysteriöse Vergangenheit und stellt überrascht fest, dass auch sein Name in dieser Datei aufgeführt sein müsste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Paulus-Papiere
Edwin Klein
Umwelthinweis:
Dieses Buch wurde auf chlor- und
säurefreiem Papier gedruckt
1. Auflage 2010
© 2010 SWB-Verlag, Stuttgart
Lektorat und Korrektorat: Catrin Stankov, Bernau
Titelfoto: © tommyS / PIXELIO
www.digitalfotovision.de
Titelgestaltung: Heinz Kasper, Frontera
Satz: Heinz Kasper, www.printundweb.com
Druck und Verarbeitung: E. Kurz + Co., Druck und
Medientechnik GmbH, Stuttgart www.e-kurz.de
Printed in Germany
ISBN: 978-3-945769-20-1
www.swb-verlag.de
Prolog
Man fragt sich später schon mal, was der eigentliche Impuls gewesen ist. Ein Lächeln, die Art, wie sie das Glas gehalten hat, der kokette Blick, oder wie er sich an den Türrahmen lehnte, lässig die Hände in den Hosentaschen, als könne man auch so die Welt erobern. Eine Kette von kleinen, scheinbar nebensächlichen Ereignissen, die dazu führen, dass irgendwann der gewisse Funke überspringt.
Er dagegen wusste noch genau, wann sich seine Welt verändert hatte. Und zwar an einem Donnerstag im November kurz nach zwanzig Uhr, auf einer Vernissage in Luxemburgs neuem futuristischen Stadtteil Kirchberg.
Während einer der Redner sich abmühte, mit kunstvoll gewählten Worten Sinn und Wahrnehmung neu zu definieren, warf er einen Blick auf seine Uhr und verspürte dabei einen leichten Stoß am Arm.
„Pardon.“
Er drehte den Kopf und sah in die dunklen Augen einer Frau mit langen, braunen Haaren. Sie lächelte, und er hatte das Gefühl, als offenbarten sich ihr all seine intimen Geheimnisse.
„Würden Sie mir bitte ein Glas Champagner reichen?“, fragte sie leise auf Französisch.
Er nahm ein Glas vom Tablett, gab es weiter an die schöne Unbekannte und wandte sich schnell ab, um seine Verlegenheit zu verbergen. Kurz darauf löste er sich aus der Gruppe der Zuhörer und schlenderte an den Gemälden vorbei, die sich gegenseitig durch viele Farbkleckse und absonderliche Bezeichnungen zu übertrumpfen versuchten.
„Durch redliches Bemühen ist noch nie einer zum Genie geworden“, hörte er eine Frauenstimme. Ein Schauer lief ihm über den Rücken, da stand sie und betrachtete ihn. Ein spöttischer Zug lag um ihre leicht nach oben gezogenen Mundwinkel, auf ihren Wangen hatten sich Grübchen gebildet.
„Aber ein mittelmäßiger Handwerker kann dadurch zu einem guten werden“, entgegnete er. Sie lachten beide. Einige Bilder weiter und abseits der übrigen Kunstinteressierten hielt sie ihn fest und schaute ihn an. Er konnte ihren Augen nicht ausweichen, die jeden Winkel seines Innersten auszuleuchten schienen. Wie zuvor hätte er sich einfach abwenden können. Wenn da nicht dieser Blick gewesen wäre, dieses Strahlen, diese Wärme und diese … Verlockung.
Als vor knapp zwei Jahren alles begann, unerwartet, impulsiv und ohne Überlegung, ein Gefühlsrausch, wie er ihn bis dahin noch nicht kennen gelernt hatte, stellte er sich keine Fragen. Und er stellte auch nichts in Frage.
Er war wie ein Schwamm, der alles aufsaugte, ein riesiger Schwamm voller Nachholbedarf und unerfüllter Wünsche und Träume. Und einmal all die erregenden Momente aufgesaugt und kennengelernt, machte sich seine Fantasie selbständig und malte ihm ständig wunderschöne Bilder, die ihm über die Zeit der Trennung hinweghelfen sollten. Bilder, die ihn lächeln und erschauern ließen, seinen Puls beschleunigten, ihm eine Gänsehaut bescherten und auf die höchsten Wolken hoben. Aber längst nicht hoch genug, um seinen Berg der Empfindungen zu erklimmen, den Gipfel der Liebe zu erreichen.
Es war nicht viel Verkehr an diesem Vorweihnachtsabend. Keine Urlaubszeit, kein verlängertes Wochenende, keine Ausstellung in Deutschlands ältester Stadt. Er hielt sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung, überquerte die Mosel, nur noch wenige Kilometer bis Trier. Musik aus dem Radio – er hörte nicht hin. Die Nachrichten – sie interessierten ihn nicht. Er wirkte abwesend. In seinem Kopf jedoch eine permanente Unruhe, immer wieder die gleichen Fragen. Warum tust du das? Was fasziniert dich so an dieser Frau? Setzt so viel aufs Spiel. Beruf, Karriere, einfach alles. Ist sie das wert? Aber allein schon die Tatsache, dass er, in Abwägung aller möglichen Konsequenzen, schon wieder auf dem Weg zu ihr war, zeigte ihm, sie war es ihm wert.
Wenige Minuten später bog er auf einen Parkplatz, rollte an einem polnischen LKW vorbei und stoppte. Sonst war kein Fahrzeug zu sehen. Es begann das gleiche Ritual wie all die Male zuvor auch. Er parkte sein Auto in Fahrtrichtung, um gleich wieder auf die Straße fahren zu können, schaltete das Licht aus und beobachtete im Rück- und Seitenspiegel den vorbeifließenden Verkehr. Nach einer Weile stieg er aus, schaute scheinbar gelangweilt in alle Richtungen, machte dabei einige Dehnübungen, öffnete den Kofferraum und zog sich um. Es war nicht kalt, der Winter hatte sich noch nicht richtig angemeldet – oder würde er sich, wie im vergangenen Jahr, von seiner milden Seite zeigen? In Jeans, einem Pulli und mit einer Baseball-Mütze verschwand er hinter einem Busch und hatte auch von dort alles im Blick.
Erleichtert, nichts Auffälliges entdeckt zu haben und sich wieder einmal einen Narren scheltend wegen seiner Übervorsicht, setzte er die Fahrt fort. Wer sollte ihn schon verfolgen? Es wusste doch niemand von seinem Doppelleben. Oder doch? Vor vier Wochen war es, als er an gleicher Stelle parkend, sich plötzlich von Polizei umgeben sah und in die Mündung einer Maschinenpistole blickte. Sie hatten einen LKW gestoppt, um ihn nach geschmuggelten Zigaretten zu filzen. Auch er musste sich ausweisen. Allerdings hatte niemand seine Personalien notiert.
Eine halbe Stunde später erreichte er die Stadt Luxemburg und schwenkte vom Boulevard Royal in eine Nebenstraße ein. Hier, im Dunstfeld der großen Banken, fand er um diese Tageszeit, inzwischen war es 19 Uhr, immer einen Parkplatz. Sorgfältig, wie alles was er tat, verschloss er das Auto und schlenderte in die Fußgängerzone. Die Geschäfte waren bereits geschlossen, einige Passanten hasteten mit gesenktem Kopf einer imaginären Spur folgend an ihm vorbei. Er stellte sich vor ein Schaufenster und beobachtete, was hinter ihm geschah. Ihm schien nichts verdächtig. Trotzdem umrundete er, die Hände in den Hosentaschen vergraben, noch zwei Blocks, bevor er unweit des Justizministeriums auf einen renovierten Altbau zusteuerte und klingelte. Nachdem er sich zu erkennen gegeben hatte, wurde die Eingangstür geöffnet und er schwebte mit dem Aufzug in den vierten Stock.
Auch heute hatte er das Gefühl, seine Beine seien schwer und er müsse sich zur angelehnten Wohnungstür schleppen. So ganz im Gegensatz dazu, wie es in ihm aussah. Innerlich fühlte er eine erwartungsvolle Anspannung und ein Zittern und Begehren, wenn er an all das dachte, was noch kommen würde: liebevolle Worte, sanfte Berührungen, eindeutige Gesten, verliebte Blicke, elektrisierender Hautkontakt, der Geruch ihrer Haare, ihres Parfüms. Er hätte deswegen rennen, vor Freude lachen und alle Widerstände einreißen können.
Er drückte die Tür ins Schloss, sah die dunkelhaarige Frau mit dem erwartungsvollen Lächeln dicht vor sich stehen, zog sie an sich und küsste sie. Warm die Lippen, die sich auf seine drückten, weich ihre Zunge, die seine suchte. Er genoss den fraulichen Körper, spürte den Druck ihres Beckens und der Beine. Ihre Arme, fest um seinen Nacken geschlungen, signalisierten ihm: Ich lasse dich nie mehr los. Und er wollte für immer festgehalten werden, so fest, dass niemand ihn ihr je würde entreißen können.
Nach einer Weile löste sie sich von ihm und schaute ihn an. Ihre Augen fragten: Wie geht es dir? Was gibt es Neues? Hat sich was getan? Seine Augen sagten: Stelle mir bitte keine Fragen.
Sie nahm ihm die Mütze vom Kopf, legte sie an der Garderobe ab, fuhr ihm mit gespreizten Fingern durch das dichte Haar und ging voran ins Wohnzimmer. Er folgte ihr, ließ sich mit einem Seufzer in einen Ledersessel fallen, streckte die Beine, fühlte sich irgendwie unsicher auf diesem immer noch fremden Terrain und lauschte der Musik.
„Ist das von Chopin?“
Sie nickte. „Genau das Richtige für Verliebte.“
„Ja, genau das Richtige. Ich wünsche uns für alle Zeit die gleiche Harmonie.“
„Cognac?“, fragte sie und überspielte damit ihre Verlegenheit. Es war seine Art, die Dinge so einfach und glaubwürdig auszudrücken, dass es nie einen Zweifel gab an deren Aufrichtigkeit und Bedeutung. Damit umzugehen, hatte sie nach all ihren Erfahrungen im Leben noch zu lernen.
„Ja, bitte.“
Er beobachtete die schlanke dreißigjährige Frau im Hosenanzug, wie sie in natürlicher Anmut zur Hausbar schritt. Die langen Haare fielen nach vorn und verdeckten ihr Gesicht, während sie die Flasche öffnete. Mit dem Glas in der Hand trat sie zu ihm. Er schaute zu ihr auf.
„Du bist wunderschön.“
Wie er es sagte, leise und mit gebrochener Stimme, ließ sie erröten. Kein plattes Kompliment, keines mit dem Hintergedanken, eine bestimmte Absicht auszudrücken oder den Weg ins Schlafzimmer vorzubereiten. Würde nicht sein Gesicht strahlen, wären da nicht die verliebten Augen, für sich allein hätte es trotz der Stimme zu nüchtern geklungen, fast wie eine Feststellung, und es wäre vielleicht auch ohne Wirkung geblieben. So jedoch saugte sie die Worte auf, fühlte ihre einhüllende, wärmende Wirkung und setzte sich ihm gegenüber.
„Bubu, ich möchte heute Abend nicht ausgehen.“ Sie nannte ihn Bubu, weil er sie an ihren Bären erinnerte, den sie als kleines Kind hatte. So weich und auch mit braunen Augen. Sie hatte eine schöne Kindheit.
„Nein?“ Er trank und spürte das leichte Brennen des Alkohols. „Und warum nicht, Brigitte?“
Sie stammte aus Lyon und arbeitete für die Europäische Union in Luxemburg. Deshalb sprach er ihren Namen französisch aus.
„Ich habe gekocht.“
Er lächelte, denn ihr Deutsch war lustig anzuhören. Aber immer noch um Klassen besser als sein seit Ende der Schulzeit eingemottetes Französisch, welches mehr als nur renovierungsbedürftig war.
„Was gibt es denn?“
„Sauerkraut mit Schweinshaxe.“
„Wie bitte?“ Er glaubte sich verhört zu haben.
Sie amüsierte sich. „Spargelsuppe, gefüllte Ente und Creme Andaluse.“
Unvermittelt sprang sie auf und lief in Richtung Küche. „Entschuldige, Bubu, ich muss nach die Ente gucken.“
Er stellte sich, das Cognacglas in der Hand, ans Fenster, blickte auf einen gepflasterten Vorplatz und das angestrahlte Justizministerium mit den wuchtigen gelben Mauern aus Sandstein. Die dunklen Fenster blickten zurück, er fühlte sich beobachtet und zog die Vorhänge zu.
Als sei er zum ersten Male hier, wanderte er im Wohnzimmer umher und betrachtete die Bilder, welche Brigitte immer wieder umhängte oder gegen andere austauschte. Vor einem kleinen niedrigen Tisch mit einer brennenden Kerze blieb er einige Sekunden stehen und beobachtete die tänzelnde Flamme, gleich daneben in einer schlichten Vase ein Strauß roter Rosen von seinem letzten Besuch. An der gegenüberliegenden Wand ein Schrank aus hellem Birkenholz mit kunstvoll eingelegten Intarsien aus Mahagoni, auf einer Anrichte Fotos ihrer Familie, von Brigitte allein oder mit Freundinnen, und daneben auch eines von ihm. Etwas verloren kam er sich vor, so wie auf dem Foto. Als gehörte er nicht hierher. Als hätte sein Foto ein Ablaufdatum. Als hätte er …
„Bubu, kannst du mir bitte einen Gefallen tun?“
„Ja, gerne.“
„Ich habe den Wein vergessen. Gehst du bitte um die Ecke in die Pizzeria und kaufst Wein?“
„Kein Problem. Rot oder Rosé?“
„Bubu, wie vergesslich du bist. Ich trinke keine Rot.“
„Pardon, ich weiß.“
Die Pizzeria befand sich im gleichen Gebäude im Erdgeschoss um die Ecke. Er kaufte zwei Flaschen Rosé aus der Bourgogne, verließ das Lokal und versuchte auf dem Bürgersteig im Licht der Straßenbeleuchtung das Etikett zu lesen.
Ein Mann hastete vorbei, rempelte ihn an und entschuldigte sich. Wenige Meter später blieb Bubu stehen, schaute dem Fremden hinterher und sah gerade noch, wie er um eine Ecke bog. Bubu lief die wenigen Schritte zurück, aber von ihm war nichts mehr zu sehen.
Sie hatten gegessen, Wein getrunken, der Musik gelauscht, sich nette Dinge gesagt, sich geküsst und liebkost. Brigitte stand auf und geleitete ihn ins Schlafzimmer. Als wolle sie ihn verführen, entkleidete sie ihn, setzte ihn auf das Bett und zog langsam ihren Hosenanzug aus. Bis auf BH und Slip stand sie nackt vor ihm. Mit zittrigen Fingern hakte er den BH auf, roch den betörenden Duft ihrer Haut, schob den Slip nach unten, und streichelte die glatten Innenseiten ihrer Oberschenkel.
Erschöpft lag er neben ihr und atmete heftig. Schweiß stand ihm auf der Stirn, sein Puls normalisierte sich allmählich und er blickte aus dem Fenster in die Nacht. Die Wolken hatten sich verzogen und der Mond schien ihn mahnend anzugrinsen: Was hast du denn schon wieder angestellt!
Er drehte sich zur Seite und betrachtete ihr Gesicht. Die gerade Nase, die vollen Lippen, ihre Augenbrauen, die unvermittelt nach oben hüpfen konnten, wenn sie die Stirn runzelte. Mit dem Zeigefinger zeichnete er ihr Profil nach. Als er die Lippen berührte, schnappte sie zu.
„Brigitte, du bringst für mich den Himmel auf die Erde“, sagte er immer noch etwas kurzatmig. „Es war wie in einem Traum.“
„Und du gibt’s mir Gefühle, die ich noch nicht kenne“, antwortete sie. „Ich habe ein bisschen Angst.“
„Wovor?“
„Bubu, man muss immer haben ein bisschen Angst, wenn etwas so schön ist wie unsere Liebe. Angst davor, sie zu verlieren.“
„Du verlierst mich nicht.“
Er bemerkte dies wieder in einer ruhigen und nüchternen, fast unromantischen Art. Allerdings klang es für sie wie ein Gelübde. Ein Schwur für die Ewigkeit.
„Verliere ich dich wirklich nicht?“
Er schüttelte den Kopf. „Nie und nimmer.“
Sie kuschelte sich an ihn. Auch heute fragte sie nicht, wie er alles regeln wolle, damit sie zukünftig zusammenbleiben konnten. Offiziell und ohne Versteckspiel. Denn seine Familie würde darüber wenig erbaut sein. Du und deine Familie, hatte sie geantwortet. Es muss doch eine Lösung geben. Bei manchen Familien, so seine Entgegnung, dauere es eben etwas länger.
Langsam ließ er seine Finger über ihre Scham und etwas höher bis zum Bauchnabel gleiten.
„Bubu, ich muss dir etwas sagen.“
„Du brauchst nichts zu sagen, ich weiß es auch so. Es gibt keinen Irrtum. Habe ich Recht?“
Sie nickte. „Ich bin jetzt Ende des dritten Monats.“
„Ich werde eine Lösung finden.“
Brigitte fragte nicht nach. Sie hatte sich das Fragen längst abgewöhnt, denn sie wusste, wie es um ihn stand, welchen Kampf er innerlich ausfocht. Sie spürte seine innere Zerrissenheit, weil er ein Versprechen brechen musste, um ihr ein neues zu geben.
Gegen vier stand er auf, ging ins Bad, zog sich an und kam zurück ins Schlafzimmer. Brigitte hatte einen Bademantel angezogen und begleitete ihn zur Tür. Sie umarmten sich kurz, ein letzter Kuss, dann wandte er sich ab. In vier Tagen würde er wiederkommen, versprach er, ging zu seinem Auto, startete und fuhr langsam aus der Stadt, die allmählich erwachte. Auf einem Parkplatz, unweit des ersten, nun jedoch auf der gegenüberliegenden Straßenseite, hielt er an und beobachtete den Verkehr. Um 5 Uhr 30 war er zu Hause. Niemand schien etwas mitbekommen zu haben.
New York, die Stadt der Superlative, beansprucht auch jedes Jahr für sich den größten Weihnachtsbaum der Welt. Ein ähnlich großes Ungetüm beherrscht den Times Square, das eigentliche Zentrum der Stadt an der Ecke der 42. Straße und Broadway. Aber die vorbeihastenden Menschen schienen weder Notiz von den vielen blinkenden, bunten Lichterketten noch von den übrigen Passanten zu nehmen. Bepackt mit Geschenken hatten sie zwei Tage vor dem Fest nur noch eines im Sinn: schnell aus dem Trubel nach Hause zu kommen.
Bereits in wenigen Tagen würden sie und eine Million Besucher sich wieder hier versammeln, um an Silvester in einem Regen aus Konfetti und Goldlametta die größte Party der Welt zu feiern. Schon jetzt waren Arbeiter damit beschäftigt, aus Sicherheitsgründen die Kanaldeckel zu verschweißen. Anschließend würden sie auch noch aus Angst vor Bombenanschlägen alle Papierkörbe abschrauben und an Silvester Scharfschützen auf den Dächern postieren. Falls diese in Aktion treten müssten, man würde nichts von ihnen hören.
Die beiden Männer, die in einem Restaurant am Fenster saßen, interessierte nicht, was draußen vor sich ging. Obwohl der Dunkelhaarige gelegentlich hinausschaute, als erwarte er jemanden. Nach vorne gebeugt, unterhielten sie sich leise.
„Ich fasse noch einmal zusammen“, sagte der Dunkelhaarige, der sich vor vier Tagen bei ihrem ersten Treffen als Jim vorgestellt hatte. „Ihr gebt ihm morgen Abend etwas, damit er schläft. Wenig später bringt ihr unsere Dame auf sein Zimmer, zieht sie aus und legt sie neben ihn. Okay?“
Owen Harrison, sein Gegenüber, blond und mit einer Brille, aber gleichfalls nicht älter als fünfunddreißig, nickte.
„Sie ist mit Stoff vollgepumpt“, sprach Jim weiter, „und wird sich die kommenden Stunden ruhig verhalten. Ihn werdet ihr so bearbeiten, dass er eine Ejakulation hatte. Spuren von Lippenstift wären nicht schlecht. Und bei ihr …, du verstehst schon. Das alles ist bis Mitternacht erledigt.“
Harrison nickte erneut. „Verlasse dich darauf, sie hat auch Spuren“, meinte er und grinste anzüglich.
„Am anderen Morgen wird man das Paar entdecken. Bis dahin habe ich Zeit, in das Zimmer zu gehen und Fotos zu machen.“
„Geht in Ordnung“, bestätigte Harrison. „Ich sorge dafür, dass niemand sonst das Zimmer betritt. Um sechs reagiert der Weckdienst, weil keiner antwortet. Man wird nachschauen. Damit wird es offiziell.“
Jim lehnte sich zurück und trank einen Schluck Rotwein. Dabei beobachtete er Harrison mit einem Blick als frage er sich, inwieweit er ihm trauen dürfe. Sie arbeiteten das erste Mal zusammen. Ein Dritter hatte den Kontakt hergestellt. In solchen Fällen war er immer auf einen Mittelsmann angewiesen und musste ihm zwangsläufig vertrauen.
„Dann wäre ja alles geklärt“, meinte Jim nach wenigen Sekunden. „Hier, weitere fünftausend.“ Er schob Harrison, dessen Augen die Gier nicht verbergen konnten, einen Umschlag über den Tisch. „Und noch einmal fünf, wenn alles vorbei ist.“
Harrison schnappte sich den Umschlag, warf einen kurzen Blick hinein und ließ ihn verschwinden. Mit einem Nicken bedankte er sich. Jim bezahlte die Rechnung, die beiden Männer erhoben sich und gingen hinaus. Mit einem knappen Gruß verabschiedeten sie sich und waren wenige Augenblicke später unter den Passanten verschwunden.
Als Jim gegen Mitternacht vorsichtig im Peninsula Hotel die Tür zur Suite öffnete und hineinglitt, sah er zu seiner Zufriedenheit das versprochene und perfekt hergerichtete Arrangement. Auf einem großen Doppelbett lag nackt das Paar. Er schon älter mit vollem, grauem Haar, aber ungewöhnlich heller Haut und weichen, zarten Konturen, sie dagegen eine Farbige mit Tattoos und gepierct und mit Bürstenhaarschnitt. Zwei gegensätzliche Welten schienen sich für die gemeinsame Lust gefunden zu haben. Spuren einer Ejakulation konnte er jedoch auf den ersten Blick nicht feststellen.
Jim, er trug einen Mundschutz und Latexhandschuhe, griff in seine Manteltasche, zog ein Gerät in der Größe einer Zigarettenschachtel hervor und untersuchte damit den Raum. Mikrofone entdeckte er keine, dafür allerdings die Signale einer versteckten Funkkamera.
„Harrison, du Schwein. Habe ich es doch geahnt. Willst mich abkassieren.“
Nach wenigen Augenblicken bemerkte Jim die olivengroße Kamera auf dem Spiegel. Er löste sie von dem dunklen Rahmen, wo sie zwischen den Verzierungen kaum auszumachen war, ging vorsichtig aus der Suite und wurde zwei Türen weiter in einem Materialraum fündig. Versteckt hinter Handtüchern fand er das Aufnahmegerät und verstaute es in seiner Tasche.
Wieder zurück bei dem ungleichen Paar, knöpfte er seinen Mantel auf und schnallte sich das Notebook vom Körper. Er setzte sich neben den Mann auf die Bettkante, warf einen Blick auf dessen zarten Penis, schaltete das Gerät ein, auf dem Monitor baute sich ein Bild auf. Jim ging in die Datei Metronics, gab den umfangreichen Zugangscode ein und wählte einen bestimmten Pfad. Grinsend entrollte er ein dünnes Kabel, an dessen Ende sich eine flache Scheibe mit einem Metallring befand. Das andere Ende steckte er ins Notebook. Jim drehte sich leicht zu dem ruhig atmenden Mann, drückte die Scheibe etwas unterhalb des linken Schlüsselbeines auf eine blasse Narbe und betätigte mit der anderen Hand die Tastatur. Der Grauhaarige schien nach einigen Sekunden zu erwachen, riss die Augen auf, versuchte sich aufzubäumen, sackte aber sogleich in sich zusammen. Sein Oberkörper begann wild und unkontrolliert zu zucken.
Jim nahm Scheibe und Kabel, verstaute beides wieder in der Manteltasche, schaltete das Notebook aus und klappte es zusammen. Immer noch zuckte der Oberkörper des Mannes. Aber die Zuckungen wurden zunehmend schwächer, Speichel rann ihm nun aus dem Mund, seine Finger zitterten und die aufgerissenen Augen rollten ein letztes Mal. Schließlich war der Körper still.
Jim erhob sich, glättete die Stelle, auf der er gesessen hatte, fesselte das Paar mit Handschellen aneinander, verstaute das Notebook, knöpfte den Mantel zu und legte einen dicken Umschlag auf den Nachttisch. Nach einem prüfenden Blick verließ er vorsichtig die Suite.
Niemand würde ihm jemals auf die Spur kommen. Niemand würde auch nur erahnen können, dass er den geheimen Sicherungsmechanismus des Markführers Metronics geknackt, und der als absolut sicher geltende Herzschrittmacher des Mannes dessen Tod durch Kammerflimmern verursacht hatte. Sorgfältig waren von ihm der interne Speicher des Schrittmachers gelöscht und die Batterie entladen worden. Bei der Obduktion würde dies plausibel den Tod des Mannes erklären.
Falls sich die Erben durch einen cleveren Anwalt vertreten ließen, hätten sie die Möglichkeit, den Hersteller des Herzschrittmachers auf etliche Millionen Schadenersatz zu verklagen.
Als Harrison sich gegen fünf Uhr in der Früh vorzeitig auf den Weg zum Hotel machte, um vor Aufdeckung des Arrangements die heimlich angefertigten Aufzeichnungen an sich zu nehmen, kam er nicht allzu weit. Auf dem Weg zur U-Bahn wurde er bereits nach wenigen Metern angesprochen. Harrison erkannte sofort die Stimme von Jim.
„Hier, wie verabredet, die restlichen fünftausend“, sagte Jim und Harrison fragte sich, woher er seine Adresse kannte. Harrison war schon tot, als er auf dem Boden aufschlug. Die Kugel hatte seinen Schädel durchschlagen und beim Austritt ein großes, hässliches Loch hinterlassen. Jim fand noch so viel Zeit, die deformierten Überreste der Kugel zwischen den Spritzern der Gehirnmasse aus dem Putz der Mauer herauszukratzen und an sich zu nehmen.
Die Sommermärchen der Fußball Welt- und Europameisterschaft waren längst Vergangenheit, in der Eifel hatten sie sich aus irgendwelchen Gründen auch nicht bis in die dritte Kreisklasse herumgesprochen. Aber auch hier elf Spieler auf jeder Seite, die um den Ball kämpften, dazu ein Schieds- und zwei Linienrichter. Und auch hier Zuschauer, heute wohl an die ein-hundertundfünfzig, mindestens viermal so viel wie sonst. Rot spielte geben Blau, Olkenbach gegen Kinderbeuren. Und die Roten lagen auf eigenem Platz mit einem Tor zurück.
„Los, nach vorn, beweg deinen Arsch. Wir sind hier nicht bei einer Prozession.“ Mit dieser klaren Anweisung in unverschnörkelter Sportsprache forderte ein Spieler seinen Nebenmann auf, sich mehr einzusetzen. Und der Betreffende, ein großer, kräftig gebauter Spieler mit Wuschelkopf und Vollbart, sprintete nach vorn. Er bekam den Ball zugespielt, lief einige Schritte bis zum Sechzehner, wollte nach rechts ausweichen und wurde unsanft gefoult. Leider noch knapp vor der weißen Linie.
Der Gefoulte sprang hoch und baute sich vor dem Übeltäter auf. „Wenn du das noch einmal machst, dann wirst du bei der nächsten Beichte eine Buße auferlegt bekommen, die sich gewaschen hat.“
„Dann gehe ich eben zu einem anderen“, konterte der Fouler.
„Was, du willst einen Fremden Zeuge deiner Sünden werden lassen?“ Der Kräftige versetzte dem Spieler einen Schups, dass er zwei Schritte nach hinten taumelte.
Zuerst bekamen die Roten einen Freistoß zugesprochen, anschließend der Kräftige die Gelbe Karte gezeigt, was er gegenüber dem Schiedsrichter mit der Bemerkung quittierte: „Der Herr wird diese Ungerechtigkeit trotz seiner unermesslichen Großzügigkeit nicht ungestraft hinnehmen.“
Der Mann mit der Pfeife war versucht, auch die Gelb-Rote Karte zu zücken, erinnerte sich jedoch noch rechtzeitig, dass es sich hier um ein Benefiz- und Freundschaftsspiel handelte. Seine Hand, die schon in Richtung Brusttasche zuckte, setzte ihren Weg weiter fort und zupfte verlegen an einem Ohrläppchen.
Nach neunzig Minuten trennte man sich mit einem gerechten Unentschieden. Anschließend kreisten in den Kabinen die ersten Flaschen und wenig später saß man sich im Vereinssaal gegenüber. Es wurde weiter gekreist.
Ein Mann erhob sich und schlug mit einem Kugelschreiber gegen sein Glas, die Geräusche verstummten. „Wir haben dieses heutige Spiel zum Abschied unseres Pfarrers arrangiert. Und die Einnahmen sind auch für einen guten Zweck bestimmt. Da von der Stirne heiß der Schweiß rinnen muss, war unsere Bedingung, dass Thomas selbst mitzuspielen habe, wie so oft in der Vergangenheit, wenn Not am Mann war. Leider hat er vorhin auf dem Platz die vier Samariterdienste, darunter auch zwei von unseren Gästen, nicht dazu genutzt, ein Tor zu schießen, wir hätten es ihm gerne gegönnt.“
Alle Anwesenden lachten, unter ihnen auch viele Spielerfrauen.
„Lieber Thomas, du weißt, bei uns gibt es nicht viele Worte. Wir haben gesammelt, weil wir deine Idee, anonym Bedürftigen in unserer Gemeine zu helfen, ausgezeichnet finden. Niemand der Bedürftigen weiß, von wem das Geld stammt- und keiner der Spender, an wen es geht. Nur du und der Kirchenvorstand entscheiden über die Verteilung. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Und hier unser Scheck.“
Der Redner ging um den Tisch zum kräftigen, vollbärtigen Wuschelkopf. Der warf einen Blick auf die Summe. „Was, 2.500 Euro?“, entfuhr es ihm erstaunt. „Wie habt ihr denn das angestellt?“ Er klopfte dem Überbringer freudig auf die Schulter.
„Ganz einfach“, antwortete dieser. „Du bist gut sechs Jahre unser Pfarrer gewesen, wir im Verein haben hundertacht Mitglieder. Diese 2.500 Euro entsprechen genau der Summe, die wir über all die Jahre nicht in den Klingelbeutel geworfen haben.“
Thomas Simmerling, in zwei Tagen nur noch Exseelsorger der Gemeinde Olkenbach, etwa zehn Kilometer von der Kreisstadt Wittlich entfernt, saß in seinem Wohnzimmer und kühlte sich das rechte Knie. Vier Aspirin hatte er schon genommen, denn der gestrige Abend wurde erst früh am Morgen beendet. Das Fußballspiel war seine letzte offizielle Verabschiedung gewesen. Kolping, Männergesangverein, Kirchenchor, Kindergarten, Grundschule, der Seniorenstammtisch, Schachclub, nicht zu vergessen die sich stets im Löscheinsatz befindende Feuerwehr, alle hatten sie ihn eingeladen. Und er war erstaunt über den Stellenwert in seiner Gemeinde und das Ansehen, welches er genoss. Er, der anfänglich mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, als er, gerade dreißig geworden, nach zwei Jahren Lehrzeit andernorts, hier seine erste Pfarrstelle annehmen durfte. Besonders die Älteren der Kirchengemeinde waren gegen ihn, weil er noch viel zu jung sei und der Herr Bischof doch wirklich einen Erfahreneren hätte schicken können. Aber Bischof Verhoeven schien geahnt zu haben, dass er sich durchsetzen würde. Und schon bei der ersten Weihnachtsfeier der Gemeinde gaben ihm die Älteren zu verstehen, man sei inzwischen doch sehr froh mit ihm. Und im Beichtstuhl sei es so dunkel, da sei er ja auch überhaupt nicht vom Alter her zu erkennen.
Thomas stand auf, humpelte zum Kühlschrank und trank ein Glas Wasser. Anschließend umrundete er die Kisten, in denen er schon etliches für den Umzug verpackt hatte und ging zur Toilette. Heute Abend noch der inoffizielle Abschied in der einzigen Gaststätte, morgen das letzte Hochamt, seine letzte Predigt, dann war es vorbei.
Er betätigte die Spülung, warf einen kurzen Blick in den Spiegel und betrachtete sein zerknautschtes Gesicht. Irgendwann werde ich mir den Bart doch etwas stutzen, nahm er sich vor. Und die Haare gleich mit.
Wieder im Wohnzimmer bequem in einem Sessel sitzend, machte er zuerst den obligatorischen sonntäglichen Anruf bei seiner Mutter, die seit vielen Jahren allein in Limburg an der Lahn lebte. Ja, er esse genug, achte auf die Vitamine, ziehe sich immer warm an und vermeide Durchzug. Und in der Kirche trage er zuunterst stets ein langärmeliges Unterhemd.
Anschließend nahm er den Brief des Bischofs und las ihn zum x-ten Mal. Aus Kostengründen, das Bistum habe ein Defizit von 60 Millionen Euro, müsse er die drei Gemeinden Olkenbach, Bausendorf und Kinderbeuren zusammenlegen. Lediglich der Seelsorger von Kinderbeuren verbleibe noch vor Ort, Thomas und ein wesentlich älterer Kollege, der bald in den Ruhestand gehe, würden andere Aufgaben erhalten. Diesbezüglich möge er sich bitte am 3. März in Trier melden.
„Du weißt gar nicht, was du damit alles kaputt machst“, murmelte er und schaute hoch zum Kruzifix an der Wand. „Die Leute brauchen mich.“ Nach einigen Sekunden fügte er hinzu: „Und ich brauche sie auch.“
Nun war der letzte Brief nicht der einzige gewesen, den er von der Kirchenführung erhalten hatte. Einige Male war er bereits angeschrieben und ermahnt worden, einmal sogar hatte er in Trier vorsprechen müssen. Jeder der Briefe begann mit: Wie uns zu Ohren gekommen ist … In einem wurde er aufgefordert, die Würde des Herrn besser nach außen zu vertreten, sich seiner hervorgehobenen Stellung als Hirte bewusst zu sein und sich auch in seiner Freizeit dementsprechend zu kleiden, damit man ihn gleich als Vertreter Gottes erkenne. In einem anderen darauf hingewiesen, dass Alkohol in der Öffentlichkeit und der wahre Glaube im Sinne Jesu Christi nicht vereinbar seien. Ein weiterer befasste sich mit der Art, wie er predigte. Er möge seine Worte besser auswählen, in Bildern sprechen, in Parabeln, damit die Gläubigen sich selbst ein Bild machen könnten. Seine direkte Art, seine einfache Sprache und die eigenwillige Interpretation der Bibel und der Apostelbriefe nehme ihnen die Möglichkeit, sich intensiver mit dem Herrn auseinanderzusetzen. Äußerst elegant hatte man damit umschrieben, dass er bitte nicht mehr auf der Kanzel fluchen solle.
Eine Abmahnung war auch unter den Schreiben, weil er sich geweigert hatte, das heilige Sakrament der Ehe zu spenden. Es wurde exakt zitiert, was er zur angehenden Braut gesagt hatte: „Liebe Christine, ich gebe dir den Rat, heirate nicht diesen Trunkenbold und Weiberhelden, der keiner Arbeit nachgeht und sich von dir nur aushalten lassen wird.“
Thomas sah die Situation vor sich und grinste. Heute war Christine glücklich verheiratet, allerdings mit einem anderen Mann, und Mutter eines prächtigen Sohnes. Weil Christine ihn wenige Wochen später in einem Schreiben beim Bistum verteidigt hatte, wonach sie von ihrem Pfarrer Thomas Simmerling frühzeitig darauf aufmerksam gemacht worden sei, durch unüberlegtes Fehlverhalten eventuell später das heilige Sakrament der Ehe zu brechen, war die Angelegenheit stillschweigend unter den Tisch gefallen.
Eine weitere Abmahnung lag noch in der Schwebe. Vor einem Monat hatte er zur Entrüstung besonders der älteren Gläubigen von der Kanzel gepredigt, dass der Herrgott in seiner weisen Voraussicht und uneingeschränkten Allwissenheit wohl nichts gegen Homosexuelle haben könne. Ansonsten gäbe es sie doch sicherlich nicht. Nun würde aus Zeitgründen nichts mehr aus der vom Bistum angedrohten öffentlichen Entschuldigung werden, weil die allgemeine Lehre der Kirche eine so ganz andere wäre.
Thomas drückte sich aus dem Sessel und zog sich an. Blütenweiß der Stehkragen seines Hemdes, darüber ein schwarzer Pulli und eine dunkelgraue Jacke. Als er das Dorfgasthaus betrat, wurde er mit lautem Hallo begrüßt und sofort zur Theke geleitet.
„Herr Pfarrer, ein Bier der Wiedergutmachung?“, fragte ihn sein Gegenspieler von gestern Nachmittag. Bevor Thomas antworten konnte, stand das Bier bereits vor ihm.
Für Thomas und die Mitglieder der Gemeinde gab es ein ungeschriebenes Gesetz: Wenn er sich offiziell und in offizieller Kleidung in der Öffentlichkeit zeigte, dann wurde er auch dementsprechend angesprochen und war der Herr Pfarrer. Und man siezte ihn. Immerhin sei er der Vertreter des Herrn, und man erweise nicht ihm Respekt, sondern Jesu Christi und der Kirche. Privat jedoch, falls er mit ihnen Sport trieb, auch schon mal auf einem Bauernhof aushalf, oder bei der freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz kam, war er als Thomas einer von ihnen.
„Na, Pfaffe, haben sie dich in die Wüste geschickt?“
Ein Mann, dessen Alter irgendwo zwischen 45 und 60 lag, der vor fünf Jahren aufgetaucht war, aber niemand wusste, woher, von Gelegenheitsjobs lebte, dem nichts heilig schien und der vor nichts Respekt hatte, stellte sich neben ihn und schaute ihn provozierend an. Ihn schien das ungeschriebene Gesetz nicht zu interessieren. Einige der Dorfbewohner wollten ihn abdrängen, aber Thomas gab ihnen zu verstehen, es zu unterlassen.
„Willst du dich auch von mir verabschieden?“, passte sich Thomas im Tonfall an.
„Wie kann ich mich von dir verabschieden, wenn ich dich noch nicht einmal begrüßt habe“, erhielt er von Alfons, wie der Mann sich nannte, zur Antwort. Und Alfons war um diese Uhrzeit schon immer etwas angetrunken, was jedoch seiner spitzen Zunge und seiner Schlagfertigkeit und seinem Sarkas-mus nicht zu schaden schien.
„Würdest du nicht auch mal gerne verabschiedet werden?“
Alfons schaute in die Runde. „Von denen hier? Diesen Spießern und Pissern? Nä, nie und nimmer.“ Er schüttelte sich.
„Alfons, Alfons“, tadelte Thomas. „Höre ich da nicht eine heimliche Sehnsucht, auch so sein zu wollen? Spießer und Pisser? In eine Gemeinde aufgenommen zu werden und in der Gemeinschaft zu leben?“
Alfons lachte und zeigte renovierungsbedürftige Zähne. „Das hättest du wohl gerne. Dabei würde dir bestimmt einer abgehen.“
Zwei Männer bauten sich drohend vor Alfons auf, aber Thomas, der sich regelmäßig mit Alfons unterhielt, gab ihnen zu verstehen, ihn in Ruhe zu lassen.
„Aber das mit dem Abgehen ist ja nicht so dein Ding, oder?“, sprach Alfons weiter.
„Deins doch auch nicht mehr, wenn ich dich so anschaue und an deinen Alkoholkonsum denke.“
Alfons schluckte. „Aber immer noch öfter als du.“
„Da hast du bestimmt Recht, deshalb bin ich ja Priester geworden.“
„Und du glaubst den ganzen Scheiß?“ Alfons trank von seinem Bier.
„Ich lebe sogar danach. An was glaubst du denn?“
„An gar nichts.“
Inzwischen waren die Gespräche um sie herum verstummt. So wie sie immer verstummten, wenn er mit Alfons diskutierte. Anfänglich sahen die Gemeindemitglieder in diesen rhetorischen Auseinandersetzungen eine Art Bewährungsprobe, ob er denn der Wirklichkeit in Form eines hergelaufenen Trunkenboldes gewachsen sei. Mittlerweile waren diese Wortgefechte zu einer Samstagabend-Unterhaltung geworden, sozusagen die realistische Einstimmung auf den folgenden Sonntag und seine Predigt von der Kanzel.
„Glaube ist Hoffnung. Wer nicht glaubt, hofft nicht. Und du hoffst wirklich nicht, den heutigen Abend zu überleben?“ So ganz der katholischen Lehre entsprach dieses Argument nicht, darüber war sich Thomas im Klaren.
„Hoffnung, was ist das? Hoffnung auf Geld, auf ein Bier, auf eine Frau? Wenn das so ist, dann glaube ich nicht. Und überleben, pah. Mir ist es gleich, wann ich in die Kiste springe.“
Die seltsame Unterhaltung wogte hin und her. Thomas, der sich nicht den ganzen Abend mit Alfons beschäftigen wollte, bemerkte nebenbei, dass er sich freuen würde, ihn morgen in der Kirche zu sehen.
„Ich und Kirche? Seit mehr als zehn Jahren nicht mehr.“
„Dann wird es wieder mal Zeit. Vielleicht wirst auch du auf die eine oder andere Art erleuchtet.“
Alfons rülpste. „Mein Geist ist hier in diesem Glas, und wenn er da nicht mehr ist, dann in meinem Kopf. Und wenn ich zu viel Geist zu mir genommen habe, brummt mir der Schädel. Mein Geist bestraft mich sofort. Und wenn du morgen die Schellen zur Wandlung klingeln lässt, dann hebe ich hier an diesem Tresen mein Glas und stoße auf deinen Heiligen Geist an, der nirgendwo zu sehen ist, den du nicht greifen kannst, der sich davor drückt, wenn man ihn braucht. Prost.“
„Alfons, du beanspruchst doch für dich ein Mindestmaß an Intelligenz.“ Thomas sagte das ohne Emotion.
Alfons nickte. „Hast du das noch nicht gemerkt?“
„O doch. Und der Geist, an den ich glaube, hat etwas mit deiner Intelligenz gemeinsam.“
„Wie das?“, wollte Alfons wissen.
„Wenn du es schaffst, deine Intelligenz hier vor uns allen auf den Tisch zu legen, damit wir sie sehen können, dann schaffe ich es auch, den Heiligen Geist sichtbar zu machen.“
Die Kirche war brechend voll. In den Gängen standen sie, hinter der letzten Bankreihe bis hinaus in den Vorraum. Als wollten sie sich noch einmal von ihm verabschieden. Und seine wenigen Gegner sich davon überzeugen, dass es auch tatsächlich das letzte Mal war.
Als er die Kanzel hochstieg, seine Augen über die vielen Besucher wandern ließ, glaubte er, sich versehen zu haben. Auch Alfons war in der Kirche. Und neben ihm noch ein Platz frei. Roch er etwa so stark nach Alkohol?
Thomas predigte und verabschiedete sich von seiner Gemeinde. Er bedankte sich für die herzliche Aufnahme und für die schöne Zeit. Zuerst wollte er, um in Harmonie zu scheiden, ein unverfängliches Thema anschneiden, Nächstenliebe und Toleranz. Dann jedoch entschloss er sich spontan, in abgewandelter Form das Gleichnis des verlorenen Sohnes aufzugreifen, den man mit offenen Armen empfangen solle, und dass es sich lohne, um jede Seele zu kämpfen. Er sprach eindringlich und voller Emotion. Zumindest einer in der Kirche verstand ihn sehr gut. Er schloss mit den Worten: „Messet nicht nach der Last der Sünde, sondern der Kraft der Liebe.“
Einige der älteren Damen tupften sich die Augen. Er segnete die Gläubigen, ein letzter Blick in die Runde. Als er sich abwenden und die wenigen Stufen hinuntersteigen wollte, hörte er laut und deutlich jemanden sagen: „Herr Pfarrer, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen.“
Thomas drehte sich in Richtung des Sprechers, den er bereits an seiner Stimme erkannt hatte. Alfons war aufgestanden und alle Gläubigen starrten ihn an, als sei er eine Erscheinung.
„Weil ich Sie in der Öffentlichkeit vor Zeugen oft beleidigt habe, möchte ich mich auch in der Öffentlichkeit“, Alfons machte mit seiner rechten Hand eine Bewegung, welche den gesamten Kirchenraum umschloss, „möchte ich mich auch in der Öffentlichkeit und vor Zeugen entschuldigen. Sie sind ein guter Pfarrer. Ich glaube und vertraue Ihnen, Sie reden keinen Unsinn wie viele andere. Sie haben mich nach vielen Jahren wieder zur Kirche gebracht. Nehmen Sie meine Entschuldigung an?“
Thomas schluckte. Wie war das noch mit der verlorenen Seele? Hatte er womöglich eine gerettet? Mit belegter Stimme sagte er: „Ja, Herr Maximini, ich nehme Ihre Entschuldigung an.“
Alfons stutzte. „Sie kennen meinen Familiennamen?“
„Und auch den Ort im Schwäbischen, wo Sie viele Jahre in einem Haus an einem Weiher gewohnt haben.“
Alfons stand stocksteif. „Wie lange wissen Sie das schon?“
„Seit mehr als vier Jahren.“
Alfons sah ihn mit großen Augen an. „Und Sie haben keinen Gebrauch davon gemacht?“
Thomas lächelte und hob beide Hände. „Der Herr hat es gegeben, er wird es auch wieder nehmen. Aber wir Menschen haben dazu kein Recht. Auch nicht zehn Jahre später, wie in Ihrem Fall. Und wenn Sie das beherzigen, und wenn dann auch noch bei Ihnen die Einsicht kommt, werden Sie erkennen, dass es Sie befreit und Sie endlich die ersehnte Ruhe finden.“
Die übrigen Besucher verstanden nicht den Sinn dieses seltsamen Zwiegesprächs. Ihren verwunderten Gesichtern nach waren sie aber fasziniert von der ungewöhnlichen Entwicklung des Hochamtes. Unentwegt wanderten ihre Augen zwischen ihrem scheidenden Pfarrer und Alfons hin und her, damit ihnen nichts entgehe.
Alfons ließ sich nach einigen Sekunden auf seinen Platz sinken, beugte sich nach vorn und schlug die Hände vors Gesicht. Zuerst war nur das Zucken seines Oberkörpers zu sehen, dann konnten sie es alle hören: Er weinte.
Vor zwei Stunden in Mailand gelandet, hatte er sich ein Auto gemietet. Nun fuhr er, die Frühlingssonne genießend, gemütlich in Richtung der Stadt Gaggiano, die wenige Kilometer westlich der norditalienischen Metropole lag. Er durchquerte das Stadtzentrum, die Navigation führte ihn von der Via Matteotti in die Via Republica, eine Nebenstraße nahe dem Marktplatz. Er parkte, verschloss den Wagen und ging zum Haus Nummer 54. Die Familie Favari wohnte im zweiten Stock, einen Aufzug hatte das ältere, renovierungsbedürftige Gebäude nicht. Dafür jedoch Treppenstufen aus Holz, deren Knarren sich wie Wehklagen anhörte und jede Alarmanlage ersetzte. Aber es ließ sich nun mal nicht vermeiden, er musste nach oben.
Er klingelte. Eine notdürftig geschminkte Frau, irgendwo zwischen vierzig und fünfzig, öffnete die Wohnungstür und ließ ihn eintreten. Sie hatte auf ihn gewartet, er war angekündigt worden. Sie führte ihn in einen spärlich möblierten Wohnraum mit vielen Abbildungen von Maria mit Heiligenschein und strahlenden, weißen Engeln an der Wand. Kruzifixe mit verdorrten gelb-grünen Zweigen sah er auch einige, und an der Stirnseite des Raumes ein kitschiges Bild vom letzten Abendmahl. Auf einer Anrichte brannte unter dem Bild eines Mannes eine Kerze.
„Ihr Ehemann?“
Die Frau nickte und wischte sich die Hände an der Schürze ab. „Der Herr hat ihn viel zu früh genommen.“ Sie verschwieg, dass er sich wohl eher hat nehmen lassen, denn er war im volltrunkenen Zustand über die Schienen der nahe liegenden Staatsbahn marschiert und hatte in seinem Rausch den herannahenden Zug nicht gehört.
„Bitte.“ Sie deutete auf einen Stuhl. „Was darf ich Ihnen zu trinken anbieten?“
„Wasser, wenn es keine Umstände macht. Nur Wasser.“
Die Frau war sichtlich verlegen und verschwand in der Küche. Mit einer Flasche und drei Gläsern kam sie zurück. „Nina kommt gleich“, sagte sie und stellte alles auf den Tisch.
„Hier meine Karte.“ Der gut aussehende Mann von vierzig, der jedoch jünger wirkte, gab ihr seine Visitenkarte. „Wie Sie bereits wissen, vertrete ich als Anwalt in dieser besonderen Mission einen besonderen Klienten.“
Sie füllte sein Glas, er trank in kleinen Schlucken.
„Können wir anfangen oder wollen wir noch auf Ihre Tochter warten?“
„Nina möchte unbedingt dabei sein“, sagte sie und schrie über die Schulter: „Wann kommst du endlich?“
„Wie alt ist Nina jetzt?“, fragte er, obwohl er es genau wusste.
„Siebzehn.“
„Siebzehn.“ Er sprach das Wort gedehnt und verlieh ihm eine gewisse Bedeutung. Seinen Unterlagen nach war sie gerade sechzehn geworden, was die Angelegenheit aus juristischer Sicht wesentlich erschwerte. „Geht sie noch zur Schule?“
„Nein.“
„Arbeitet sie?“
Die Frau schüttelte den Kopf.
„Hat sie überhaupt einen Beruf gelernt?“ Seine Stimme war ungeduldiger geworden.
Erneut verneinte sie und warf einen Blick nach oben, als sei dies von einem anderen so gewollt. „Herr Avvocato, Sie wissen doch, wie die heutige Jugend ist.“
„Ja, das weiß ich wohl“, bestätigte der Besucher, öffnete seine Ledermappe und breitete einige Schriftstücke vor sich aus.
Nina kam in das Wohnzimmer. Noch schlank wie ein Kind, schon etwas gereifter im Gesicht, strahlte sie aber nichts Weibliches aus, obwohl sie sich heftig geschminkt hatte. Verlegen trat sie näher und gab ihm die Hand. Unübersehbar ihr dicker Bauch, der so gar nicht zu ihrem grazilen Körper zu passen schien. Nina war schwanger.
Mutter und Tochter setzten sich ihm gegenüber an den Tisch.
„Sicherlich haben Sie über meinen Vorschlag, den ich Ihnen am Telefon und in zwei Schreiben angedeutet habe, nachgedacht.“
Mutter und Tochter nickten gleichzeitig.
„Signora Favari, seit wann sind Sie Haushälterin von Pfarrer Pascone?“
„Seit mehr als zwanzig Jahren.“
Der Anwalt blätterte in seinen Unterlagen. „Und was arbeiten Sie jetzt?“
„Seitdem der Herr Pfarrer nicht mehr hier ist, bin ich … bin ich ohne Arbeit.“
Er schaute sie an. „Ja, unser lieber Pascone ist nicht mehr hier. Er ist an einem Ort der inneren Einkehr, den er so schnell nicht wieder verlassen wird. Und auf seinen Wunsch hin soll dieser Ort auch geheim gehalten werden. Sie verstehen?“
Erneut nickten Mutter und Tochter gleichzeitig.
„Nina, darf ich dich Nina nennen?“
„Aber ja doch. Ich bin noch so jung.“ Das Mädchen lächelte und ihm kam es vor, als erwarte es eine besondere Wirkung.
„Wann bist du sechzehn geworden?“
„Vor vier Monaten.“
„Und im wievielten Monat bist du …“
„Im achten.“
Der Anwalt warf der Mutter einen strafenden Blick zu, weil sie ihm ein falsches Alter genannt hatte.
„Das heißt demnach, als du schwanger geworden bist, da warst du noch keine sechzehn“, sagte er mehr zu sich selbst. Was bedeutete, dass sich derjenige, der sie schwängerte, nach italienischem Recht strafbar gemacht hatte.
„Es gibt nun zwei Möglichkeiten, meine Damen“, meinte der Anwalt jovial. „Zwei Möglichkeiten, um die Angelegenheit ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Entweder Sie arbeiten mit uns zusammen, oder ich stehe jetzt auf und es gibt keine Hilfe und keine Entschädigung. Wollen Sie mit uns zusammenarbeiten?“
„Ja.“ Die Mutter hatte auch für ihre Tochter gesprochen.
„Das ist gut. Dann bieten wir Folgendes an: Nina, du kannst sofort in ein Haus der Kirche gehen und dort dein Kind zur Welt bringen. Mit voller medizinischer Betreuung. Anschließend kannst du das Kind alleine groß ziehen oder es sofort zur Adoption frei geben. Wenn du es allein groß ziehen möchtest, musst du in die Nähe von Neapel in ein weiteres Haus der Kirche gehen.“
„Und ich, was ist mit mir?“, fragte die Mutter.
„Dazu komme ich gleich. Nina“, wandte er sich an das Mädchen, „hast du mich verstanden?“
„Ja.“
„Was ist dir lieber?“
Nina überlegte nicht lange. „Ich möchte das Kind zur Adoption frei geben.“
„Eine kluge Entscheidung“, lobte der Anwalt, der deutlich registrierte, dass die Mutter auf ihre Tochter massiv eingewirkt hatte, und griff ein Schriftstück. „Du bist noch so jung und würdest dir deine ganze Zukunft verbauen. Und außerdem wird niemand etwas davon erfahren. Wir sind in solchen Dingen sehr hilfsbereit und sehr diskret.“
„Und wie steht es mit dem Geld“, warf die Mutter ein.
„Wir übernehmen die Kosten für die Geburt und Nina erhält von uns zusätzlich bei Freigabe zur Adoption 10.000 Euro.“
„Das ist uns zu wenig“, sagte Signora Favari und setzte ein entschlossenes Gesicht auf. „Mindestens 50.000 Euro, oder wir gehen …“
„Oder was“, fragte der Mann ganz ruhig. Aber seine Stimme signalisierte ein Höchstmaß an Gefährlichkeit.
„Wir gehen an die Presse. Dann wird schon herauskommen, was dieser Dreckskerl von Pascone meiner Süßen angetan hat. Er hat sie verführt und missbraucht, hat dem armen Ding die Unschuld geraubt, sie für alle Zeiten entehrt.“
Der Anwalt deutete ein Lächeln an. „Wir haben mindestens vier Zeugen, die behaupten, schon vor mehr als zwei Jahren mit ihrer Tochter geschlafen zu haben.“
„Alles Lügner“, giftete ihn die Mutter mit zu einer Grimasse verzerrtem Gesicht an. „Wir sind ehrliche und rechtschaffene Leute. Und ehrbare“, fügte sie hinzu, als sei das besonders wichtig.
„Wenn dem so ist, dann werden Sie ja nichts gegen einen Vaterschaftstest einzuwenden haben“, antwortete der Advokat und konnte beobachten, wie die Mutter zusammenzuckte. „Dann wird sich zweifelsfrei herausstellen, ob Pascone der Vater ist. Immerhin ist er schon fast sechzig, und da kann es schon mal in solchen Dingen Schwierigkeiten geben.“
„Bei dem geilen Bock doch nicht“, platzte die Mutter heraus. Sie merkte schnell, dass sie mit dieser Bemerkung einen Fehler gemacht hatte.
„Sie bestehen also auf den 50.000 Euro?“
„Ja.“ Signora Favari nickte, die Tochter war scheinbar ohne Meinung.
Der Anwalt packte seine Sachen zusammen und erhob sich. „Dann darf ich Ihnen noch einen schönen Tag wünschen“, meinte er frostig und wollte gehen.
Signora Favari stellte sich ihm in den Weg. „Wenn Sie jetzt dieses Zimmer verlassen“, geiferte sie, „werde ich sofort alle Zeitungen und Radiostationen und Fernsehsender im Umkreis anrufen. Für die Medien wird das ein Festessen werden. Ein Pfarrer vergeht sich an einem minderjährigen Kind. Das ist strafbar, Herr Avvocato, das müssten Sie doch eigentlich am besten wissen.“
Er schaute auf sie herab und sah dann zur Tochter. Das Mädchen tat ihm leid, es war noch von allen Beteiligten die Unschuldigste, obwohl sie als kleine Lolita schon ihre Erfahrungen gesammelt hatte. Und dass Pascone ein geiler, unbe-lehrbarer Bock war, wusste die Kirche bereits seit Jahren.
„Zum einen werden wir alles bestreiten“, entgegnete der Anwalt ruhig, „und auf einem Vaterschaftstest bestehen. Zum anderen wird Pascone unauffindbar sein. Mit ihm dürfen sie nicht rechnen. Und zum Dritten werden wir etwas die Vergangenheit ans Tageslicht bringen.“
„Was wollen Sie?“ Signora Favari stemmte die Hände auf die Hüften.
Der Anwalt deutete auf einen Stuhl und forderte die Mutter auf, sich wieder zu setzen. Er tat es gleichfalls.
„Darf ich offen vor Ihrer Tochter sprechen“, fragte er.
„Aber selbstverständlich“, entgegnete sie.
Er legte die Ledermappe auf den Tisch und stützte seine Unterarme darauf. „Signora Favari, wenn Sie mich fragen, dann haben Sie Ihre Tochter an Pascone verkuppelt. Und der ist darauf angesprungen.“
„Was erlauben sie sich?“
Er hob beschwichtigend eine Hand. „Es ist mittlerweile von manchen Haushälterinnen zum Sport geworden, solche Dinge anzuleiern mit dem Hinterdanken, die Kirche zu erpressen und sich eine Scheibe vom Geldkuchen abzuschneiden. Und für diese Fälle werde ich eingeschaltet. Wir lassen uns nicht erpressen. Wie viele Jahre arbeiteten Sie für Pfarrer Pascone?“
„Zwanzig. Das sagte ich bereits.“
„Und wer ist der Vater Ihrer Tochter?“
Signora Favari warf einen Blick zur Anrichte, wo die Kerze brannte. „Felice natürlich“, entgegnete sie. „Gott ist mein Zeuge.“ Sie bekreuzigte sich.
„Gott wird nichts bezeugen“, entgegnete der Anwalt. „Gott wird bezeugen, dass Felice im Gefängnis war, und zwar für etwas mehr als zwei Jahre. Zwölf Monate vor Ninas Geburt hat man ihn eingesperrt.“
„Mama“, entrüstete sich Nina. „Stimmt das?“
Signora Favari schien zu schrumpfen, senkte den Kopf, zeigte einen grauen Scheitel im ansonsten dunkelbraunen Haar und antwortete nicht.
„Stimmt das, Herr Avvocato?“, fragte Nina.
Der Anwalt griff in seine Mappe, schob ein Blatt über den Tisch und die Kopie eines Zeitungsausschnittes. Nina konnte sich überzeugen, dass seine Angaben stimmten.
„Warum hast du mir davon nichts erzählt“, wollte sie nach wenigen Sekunden von ihrer Mutter wissen. Tränen standen in ihren Augen. „Und wer ist mein Vater?“
„Dein Vater ist auch der Vater deines Kindes“, kam es trocken vom Anwalt, der sich nicht bemühte, die Tatsache zu umschreiben. „Und Pascone, dein Vater, hat nicht nur mit dir Sex gehabt, sondern in all der Zeit auch noch mit deiner Mutter. Vielleicht habt ihr es sogar zu dritt getrieben“, behauptete er und erkannte an der schuldbewussten Reaktion von Mutter und Tochter, dass er einen Treffer gelandet hatte. Er reichte Signora Favari sein Handy. „Hier, rufen Sie an, wenn Sie wollen.“
Aber Signora Favari wollte nicht mehr anrufen. Sie erkannte, dass sie verloren hatte und ihr Spiel nicht aufgegangen war. Das erkannte sie spätestens dann, als der Anwalt verschiedene Schreiben vorlegte, in denen Pascone seinem vorgesetzten Bischof von der Verfehlung vor vielen Jahren berichtete. Noch mehr erkannte sie es, als ihr Besucher auch noch Überweisungsträger präsentierte, aus denen regelmäßige Zahlungen an eine gewisse Signora Favari hervorgingen. Und weil sie das gleiche Konto hatte wie ihr Mann, war für alle offensichtlich, dass das Ehepaar gemeinsam den Pfarrer über viele Jahre erpresst hatte.
Als der Avvocato kurz darauf das Haus in der Via Republica verließ, war er guter Laune. Selten war es ihm bisher gelungen, eine Angelegenheit so schnell und kostengünstig und zur vollen Zufriedenheit seines Auftraggebers zu lösen. Vor sich hin-pfeifend fuhr er wieder zurück nach Mailand und dort zum privaten Fernsehsender Primuno. Er meldete sich am Empfang, nannte seinen Namen und wurde von einer jungen Frau in den siebten Stock geleitet.
„Hallo, wie geht es dir“, begrüßte ihn eine rothaarige Frau um die dreißig in einem dunklen Hosenanzug, die bereits auf ihn gewartet hatte.
„Ausgezeichnet.“
Sie führte ihn in einen großen Raum, dessen Fensterseite komplett verglast war. In der Mitte stand ein Schreibtisch, gleichfalls aus Glas, und in der Ecke eine Sitzgelegenheit aus transparentem Acryl.
„Francesca, vielen Dank, dass du so schnell Zeit für mich hast.“
„Für dich doch immer“, schmeichelte sie. „Als was bist du heute unterwegs?“
„Ich musste den Avvocato spielen.“
„Und bei mir? Wen spielst du da?“
„Niemanden, für dich bin ich Marco.“
„Nur Marco? Also ganz privat und auch ohne den Monsignore?“
„Ohne den Monsignore“, meinte er freundlich.
„Dann hätte ich heute ja die Gelegenheit, dich zu verführen“, gurrte sie, beugte sich nach vorn, ließ ihn einen Blick in die geöffnete Bluse werfen und spitzte den Mund zu einem Kuss.
„Francesca, mache es mir doch nicht so schwer.“ Marco seufzte gespielt.
Francesca Simeoni, deren Vater zu den reichsten Männern Italiens gehörte, leitete den Sender Primuno, der bekannt war für seine entlarvenden Berichte und Skandalaufklärungen. Sie setzten sich, plauderten über Gott und die Welt, den Ausgang der Wahlen in Italien, die Einschaltquoten und den mehr und mehr voranschreitenden Sittenverfall.
„Du hast es so dringend gemacht, Marco. Womit kann ich dir helfen?“, fragte sie und bestellte telefonisch zwei Espresso.
Er räusperte sich und zog einen Zettel aus seiner Jackentasche. „Ende des vergangenen Monats hatten wir im Vatikan eine Tagung. Neunzig Geistliche waren dazu eingeladen, unter ihnen mehr als vierzig Bischöfe und dreißig Kardinäle. Wie es sich nun mal heute gehört, haben wir jedem der Teilnehmer einen PC oder ein Notebook mit Internetanschluss zur Verfügung gestellt. Als wir anschließend die einzelnen Internetverbindungen überprüften, ist uns etwas aufgefallen. Insgesamt neunzehn der Teilnehmer haben unabhängig voneinander, sie saßen auch nicht zusammen, in den vier Tagen jeweils mindestens zehnmal eine bestimmte Internetadresse angewählt. Und zwar einen Server im Ausland. Alles zusammen über zweihundert Verbindungen. Daraufhin habe ich auch diesen Server angewählt und kam zu einer Adresse, von der aus man anonym weiter im Internet surfen kann, ohne erkannt zu werden.“
„Und nun vermutest du, dass deine gläubigen Mitbrüder sich auf verbotenen Pfaden herumgetummelt und gesündigt haben.“ Francesca schmunzelte.
Marco schüttelte den Kopf. „Noch vermute ich nichts. Allerdings ist es schon seltsam und ich möchte der Angelegenheit nachgehen. Deshalb bin ich heute bei dir.“
Francesca trank ihren Espresso und anschließend etwas Wasser. Sie schlug die Beine übereinander, ein Hosenbein rutschte nach oben und gab den Blick frei auf ihr schlankes Fußgelenk, an dem sie ein feingliedriges Goldkettchen mit einem Anhänger trug. Marco musste gestehen, dass ihn der Anblick irritierte, wozu auch die hochhackigen schwarzen Schuhe beitrugen. Um sich abzulenken, schaute er aus dem Fenster auf die Dächer von Mailand, und Francesca registrierte das mit einem spöttischen Lächeln. Sie war sich ihrer Wirkung auf Männer bewusst.
„Das wird nicht leicht sein, mein Lieber“, meinte sie. „Solche Server sitzen immer im Ausland, eben genau aus dem Grund, um die Anonymität zu wahren. Was kann ich dabei tun?“
Marco lächelte sie an, als hegte er frivole Absichten. „Mir helfen, herauszufinden, wohin die Reise weiter gegangen ist. Welche tatsächlichen Internetadressen haben meine Brüder aufgerufen und wozu benötigen sie die Anonymität.“
Francesca zuckte mit der Schulter. „Hast du einen bestimmten Verdacht?“
Ohne auf ihre Frage einzugehen, sagte Marco. „Welche Seiten würdest du denn anonym aufsuchen wollen?“
Francesca überlegte. „Pornografische eventuell“, sie stieß ihn mit der Schuhspitze an, „auch ausländische Steuerparadiese, wenn ich dort ein Konto hätte, um dem Finanzamt keine Spur zu liefern, sonst fällt mir nichts ein.“
„Pornografische ist schon gut.“
„Marco, heraus mit der Sprache, du hast einen bestimmten Verdacht. Und du weißt, ich bin absolut verschwiegen. Wir haben doch ein Abkommen.“
Marco nickte, und das Abkommen hatte sie bisher stets eingehalten. Francesca half ihm mit ihrem Sender ganz gezielt Nachrichten und Berichte zu lancieren. Hier eine Andeutung, dort ein Foto, dann wiederum ein Augenzeuge oder ein spezieller Kommentar. Die Reaktion darauf waren Zeitungsberichte und Anfragen bei der Kirche. Und die Kirche wiederum sah sich genötigt, von Fall zu Fall äußerst diskret, was bedeutete, ohne zeitliche Nähe zum eigentlichen Ereignis, Versetzungen und Abberufungen von Geistlichen vorzunehmen.
„Meine Vermutung ist, es handelt sich um Pornografie, genauer gesagt um Kinderpornografie. Verstehst du jetzt, dass ich dem nachgehen muss?“
Das Angebot, unentgeltlich eine vom Bistum gestellte Wohnung zu beziehen, lehnte Thomas dankend ab. Mehrfach fragte der Liegenschaftsverwalter nach, ob er auch richtig gehört habe. Bisher sei dies noch nicht vorgekommen, meinte er in einem tadelnden Tonfall und vermittelte den Eindruck, als dürfe man der Kirche niemals etwas ausschlagen.
Stattdessen zog Thomas unweit der Trierer Fußgängerzone in ein notdürftig möbliertes Appartement, die Kisten stapelten sich noch im Flur, auspacken würde er später. In der ersten Nacht konnte er kaum schlafen. Es war nicht die neue Umgebung, sondern der Rapport, der ihn beschäftigte und zu dem er sich bei Bischof Verhoeven bereits am kommenden Morgen um neun melden sollte.
Thomas stand viel zu früh auf und fühlte sich müde. Er frühstückte, las in einem Buch, schaute sich die Nachrichten an und spazierte anschließend durch die noch nicht zum Leben erwachte Innenstadt. Nachdem er im Stehen einen Kaffee getrunken hatte, machte er sich auf den Weg zu seinem Termin. Er überquerte den Domfreihof, klingelte pünktlich in der Liebfrauenstraße und wurde eingelassen. Der Sekretär schaute ihn vorwurfsvoll an, als habe er sich bereits verspätet. Oder wusste er bereits, was der Bischof ihm sagen würde? Welche neue Aufgabe er für ihn hatte?
Wenig später wurde er in das Arbeitszimmer des Bischofs geführt, der lächelnd auf ihn zukam und ihm die Hand reichte. Er war etwas kleiner als Thomas, sah schlank aus für sein Alter von eben über sechzig und wirkte fit und sportlich. Thomas fragte sich, ob die ausgeprägte schwarze Haarfarbe des Bischofs natürlichen Ursprungs war oder ob man nachgeholfen hatte, wie es inzwischen auch bei Männern im reifen, gesetzten Alter immer mehr in Mode zu kommen schien.
„Da sind Sie ja, Pfarrer Simmerling“, meinte Bischof Verhoeven freundlich und deutete auf einen Stuhl. Er selbst setzte sich hinter den massiven Schreibtisch, der Schutz gewährte und aufgeräumt war, bis auf eine Akte. Seine Akte, wie Thomas vermutete.
„Wie geht es Ihnen“, wollte sein Vorgesetzter wissen und verschränkte die Hände.
„Danke, gut, Herr Bischof“, antwortete er. Seit dem letzten Konzil wurden Bischöfe nicht mehr in der alten Form als Hochwürdigste Exzellenz angesprochen. Einige der älteren Herren bedauerten den Wandel, war doch diese privilegierte Anrede ein angestammtes Recht. Allerdings konnte das Konzil nicht die seit Jahrhunderten manifestierte und absolutistisch anmutende strikte Hierarchie innerhalb der Kirche aufweichen und ihr etwas weltliche und zeitgemäße Züge verleihen.
„Man hört ja so einiges von Ihnen.“ Der Bischof warf einen Blick auf die Akte. Thomas wusste nur zu genau, wie er diese Bemerkung einzuordnen hatte, denn innerhalb der katholischen Kirche gab es ein perfekt ausgeklügeltes, freiwilliges Spitzelsystem, auf das die Staatssicherheit der ehemaligen DDR in allen Beziehungen neidisch gewesen wäre. Viele der Gläubigen fühlten sich berufen und inspiriert und noch mehr verpflichtet, dem Bistum alles mitzuteilen, was in den Pfarreien vor sich ging und vergaßen auch nicht, sofort den Schuldigen zu benennen: ihren Pfarrer. Auch wenn das Meiste in den Papierkorb wanderte, wie Thomas gehört hatte, blieb doch einiges übrig, was, wie in seinem Fall, zu Nachfragen, einem regen Schriftwechsel und sogar zu Abmahnungen führen konnte.
„Ich fühle mich schuldig“, sagte Thomas ernst. Der Bischof schien irritiert zu sein.
„Sie fühlen sich schuldig?“
„Ja, in allen Punkten. Wie ich sehe, ist meine Akte seit meinem letzten Besuch angewachsen. Mea culpa.“
Bischof Verhoeven lächelte und verstand nun den Scherz. „Wenn es viele Wege nach Rom gibt, warum nicht auch viele zum Herrn“, philosophierte er. „Allerdings bitten wir schon darum, nicht zu weit vom rechten und von uns vorgegebenen Weg abzuweichen. Das irritiert nur die Gläubigen, die geleitet werden wollen. Sie verstehen?“
„Ja, ich verstehe.“
„Und verlieren Sie nie Aufgabe und nötige Distanz aus den Augen. Sie sind der Vertreter des Herrn und kein Makler des Glaubens. Oder ein Guru“, fügte der Bischof hinzu.
Wenig später kam er auf das Bistum zu sprechen, den Rückgang der Gläubigen durch Kirchenaustritte, mehr als hunderttausend im vergangenen Jahr in Deutschland, die dadurch bedingten Mindereinnahmen der Kirchensteuer, verstärkt durch eine teilweise flaue Wirtschaftskonjunktur. Auf der anderen Seite die steigenden Kosten, die übertriebene Erwartungshaltung, was die Errichtung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen bis hin zu den kirchlich betreuten Altenwohnheimen betraf.
„Und all das, gestiegene Kosten, weniger Einnahmen und übertriebene Erwartungshaltung, die wir teilweise erfüllen müssen, ob wir wollen oder nicht, hat im vergangenen Jahr bei uns im Bistum zu einem Ausfall von etwa 60 Millionen Euro geführt. Ich kann gar nicht anders und muss gegensteuern. Von oben“, Verhoeven deutete zur Decke und ließ dahingestellt, wer gemeint war, das Erzbistum oder der Allerhöchste, „… von oben kann ich nichts erwarten. Mit dem Land Rheinland-Pfalz haben wir uns geeinigt und andere Beteiligungsmo-dalitäten entwickelt, dadurch wird uns in Zukunft ein Teil der finanziellen Last besonders in den Kindergärten und Tagesstätten abgenommen werden. Ungeklärt bleiben immer noch die Krankenhäuser mit ihren explodierenden Kosten. Aber trotz allem: Wir müssen sparen, sparen, sparen. Deshalb, Pfarrer Simmerling, habe ich im gesamten Bistum mehr als zwanzig Pfarreien schließen müssen. Sie verstehen?“
„Selbstverständlich, Herr Bischof.“
„In anderen Bistümern werden bereits Kirchen verkauft. So weit möchte ich es noch nicht kommen lassen. Aber auch dies wird wohl bei weiter anhaltender negativer Entwicklung zu überlegen sein“, meinte er bedauernd. „Und warum ich nicht die beiden älteren Kollegen abberufen habe?“, fragte er nach einigen Sekunden der Bedenkzeit, um Thomas zuvorzukommen. „Ganz einfach, die Sonderaufgabe, die ich Ihnen anvertrauen werde, können meiner Meinung nach nur Sie erfüllen.“
Thomas lächelte und der Bischof ordnete es so ein, dass er sich für die zugedachte Sonderaufgabe geehrt fühle. Aber Thomas bewunderte erneut die Eloquenz seines Vorgesetzten, die er schon oft im Fernsehen in Talkrunden und bei diversen Radiostationen unter Beweis gestellt hatte. Lediglich wenn es um die Evolution ging, geriet er, genau wie seine Kollegen, etwas ins Schwimmen. Wie kann man den Gläubigen weismachen, dass der Herr mit Hilfe seiner unendlichen Möglichkeiten in sechs Tagen – was man mit sechstausend Jahren gleichsetzte – die Erde erschaffen, quasi alles wie Fertigteile aus einem Baukasten zusammengezaubert, und sich am siebten ausgeruht hat? Während ein Darwin und andere Forscher dafür viele Millionen und Milliarden Jahre ansetzen? Vom Urknall ausgehen? Von Urzellen und einem mehr als hundert Millionen Jahre dauernden Prozess der Entstehung des Lebens sprechen und beweisen, dass erst ganz an dessen Ende der Mensch als vom Affen abstammender Primat zu finden ist? Aber das würde schließlich bedeuten, dass in der Genesis, dem ersten Buch Moses, die Unwahrheit stände. Und dies können nicht nur die Kreationisten, die Konservativen innerhalb der katholischen Kirche, zu denen auch Verhoeven zählt, nicht hinnehmen. Ihrer Meinung nach müsse es eine übersinnliche Intelligenz geben, die alles geschaffen hat. Das Chaos könne ihrer Meinung nach wohl kaum der Motor sein, perfekt ineinandergreifende und miteinander verwobene tierische und menschliche Organismen zu bilden.
„Sie haben doch nichts gegen meine Entscheidung einzuwenden?“, fragte Verhoeven prophylaktisch.
„Nein, Herr Bischof.“