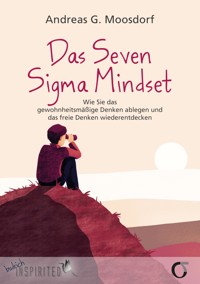
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Barbara Budrich
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Hatten Sie heute schon sechs Gedanken, die Sie noch nie zuvor hatten? Wenn nicht, sind Sie ein Gewohnheitsdenker, wie fast alle anderen Menschen auch. Unser Überlebenstrieb lässt uns mentale Muster wiederholen, die uns in der Vergangenheit hilfreich waren und uns Komfort, soziale Anerkennung und eine stabile Identität bieten. Das bedeutet, dass unser Denken einer Six-Sigma-Verteilung folgt: Nur ein winziger Bruchteil unserer täglichen Gedanken ist wirklich neu und frei. Genau das hindert uns daran, die bahnbrechenden Lösungen zu finden, die wir brauchen, um uns an eine sich schnell verändernde Welt anzupassen. In diesem Buch hilft Ihnen Andreas Moosdorf, Ihr gewohnheitsmäßiges Denken klarer wahrzunehmen und das enorme, ungenutzte Potenzial Ihres eigenen Geistes zu erforschen. Durch Übungen entdecken Sie vergessene Ressourcen, Perspektiven und Wahlmöglichkeiten und übernehmen in Ihrer Arbeit und Ihrem Leben wieder das Steuer. Werfen Sie Ihre mentalen Landkarten über Bord, entdecken Sie Ihren Denkapparat neu und tauchen Sie mit dem Seven-Sigma-Mindset in eine vergessene Welt der Variabilität, Produktivität und tieferen Zufriedenheit ein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas G. MoosdorfDas Seven Sigma Mindset
Andreas G. Moosdorf
Das Seven Sigma Mindset
Wie Sie der Falle des Gewohnheitsdenkens entkommen und das freie Denken wiederentdecken
budrich InspiritedOpladen • Berlin • Toronto 2025
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Titel der englischen Ausgabe: The Seven Sigma Mindset. How to Escape the Habitual Thinking Trap and Rediscover Free Thinking. All Rights Reserved. Authorised translation from the English language edition published by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group LLC.
Alle Rechte vorbehalten
© 2025 Verlag Barbara Budrich GmbH, Opladen, Berlin & Toronto
Stauffenbergstr. 7 | D-51379 Leverkusen | [email protected] | www.budrich.de
ISBN 978-3-8474-3141-1 (Paperback)
eISBN 978-3-8474-3277-7 (PDF)
eISBN 978-3-8474-3278-4 (EPUB)
DOI 10.3224/84743141
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck, Germany
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung: Bettina Lehfeldt, Kleinmachnow – www.lehfeldtgraphic.de
Titelbildnachweis: Alexandra Yoko Hagino – [email protected]
Satz: Ulrike Weingärtner, Gründau – [email protected]
Inhaltsverzeichnis
Über den Autor
Danksagung
Präambel
Struktur dieses Buches
TEIL I: DAS SEVEN SIGMA MINDSET
Kapitel 1 – Von Tauben und Spatzen
Kapitel 2 – Wie spatzig sind Sie?
Kapitel 3 – Das Denken und seine Auswirkungen auf Ihr Leben
Kapitel 4 – Gewohnheitsdenken
Kapitel 5 – Freies Denken
Kapitel 6 – Das Six Sigma Mindset: Ein unausgeglichener, gewohnheitsmäßig trainierter Verstand
Kapitel 7 – Das Seven Sigma Mindset: Die Rückkehr des Gleichgewichts
TEIL II: DIE SECHS GEWOHNHEITSMÄSSIGEN DENKMUSTER (UND IHRE ALTERNATIVEN FÜR FREIES DENKEN)
Kapitel 8 – Muster 1: Gedanken-Verteufelung – Gedanken behandeln, als hätten sie böse Absichten
Kapitel 9 – Muster 2: Gedanken-Unterdrückung – Versuchen, Gedanken zu vermeiden
Kapitel 10 – Muster 3: Gedanken-Identifikation – Gedanken behandeln, als wären sie Sie
Kapitel 11 – Muster 4: Gedanken-Vertrauen – Zusammengesetzten Schlussfolgerungen ungeprüft vertrauen
Kapitel 12 – Muster 5: Gedanken-Fehlausrichtung – Zulassen, dass sich widersprüchliche Gedanken durchsetzen
Kapitel 13 – Muster 6: Gedanken-Anhaftung – An Gedanken festhalten
Kurz und bündig
TEIL III: DIE SIEBEN EBENEN DES FREIEN DENKENS
Kapitel 14 – Erste Ebene: Umgebungen
Kapitel 15 – Zweite Ebene: Aktivitäten und Gewohnheiten
Kapitel 16 – Dritte Ebene: Kompetenzen
Kapitel 17 – Vierte Ebene: Werte und Überzeugungen
Kapitel 18 – Fünfte Ebene: Identitäten
Kapitel 19 – Sechste Ebene: Zugehörigkeit
Kapitel 20 – Siebte Ebene: Selbsterfahrung
Kurz und bündig
TEIL IV: PRAKTIKEN ZUR AUFRECHTERHALTUNG DES SEVEN SIGMA MINDSETS
Kapitel 21 – Praxis 1: Jeden Tag eine neuartige Tat
Kapitel 22 – Praxis 2: Raus aus der Komfortzone
Kapitel 23 – Praxis 3: Üben der sechs alternativen Muster und der sieben Ebenen des freien Denkens
Kapitel 24 – Praxis 4: Meditieren
Kapitel 25 – Praxis 5: Anderen helfen
Kapitel 26 – Praxis 6: Den mittleren Weg gehen
EPILOG
[7] Über den Autor
Andreas Moosdorf ist Professor für Management und Mindset-Coach. Seine Lehr- und Coachingtätigkeit basiert auf der Beobachtung, dass die Grenzen unseres kreativen und produktiven Potenzials, unserer Leistung und Zufriedenheit selbst auferlegte Produkte mentaler Ignoranz sind und dass einige wenige, einfache Erkenntnisse über unser Denken das Tor zu einem neuen, erfüllteren Leben der Teilhabe und Zufriedenheit öffnen können. Andreas hat einen Doktortitel in International Business und einen Master in Chinesisch und Wirtschaft von der University of Leeds, Großbritannien. Er wurde an der Universität Münster zum Spezialisten für Coaching von Hochbegabten, am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim zum Ersthelfer für psychische Gesundheit und beim Deutschen Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren (DVNLP) in Deutschland zum Master Coach für Neuro-Linguistisches Programmieren ausgebildet. Neben seinem Heimatland Deutschland hat Andreas längere Zeit in den Niederlanden, Großbritannien, China und Thailand gelebt, gearbeitet und gelernt. Seine spirituelle Grundlage ist der Dzogchen-Buddhismus. Bevor er sich auf das Unterrichten, Coaching und Schreiben konzentrierte, war er Unternehmensberater bei McKinsey & Company, wo er auch als Trainer und Coach an der McKinsey‘s Alpine University in Kitzbühel tätig war, sowie Direktor bei Amazon. Andreas hatte Lehraufträge an der UIBE in Peking, der Vrije Universiteit Amsterdam, der University of Leeds, der Old Dominion University in Norfolk, Virginia und der FH Aachen University of Applied Sciences inne.
[8] Danksagung
Ich bin zutiefst dankbar für die Begleitung und das Mentoring durch Tom Andreas, systemischer und NLP-Coach und Ausbilder, der mir auch den Zugang zu den Werken von Gregory Bateson, Robert Dilts, Milton Erickson, Erik Erikson, Carl Jung, Carl Rogers und vielen anderen eröffnet hat. Ich habe das große Glück, bereits mehr als zehn Jahre mit dir als Coachee, Lehrling, Supervisand und später als Kollege und Freund verbringen zu dürfen. Diejenigen, die wie ich das Glück hatten, von dir ausgebildet zu werden, werden feststellen, dass dein Geist viele der Übungen in diesem Buch erhellt…
Mein tief empfundener Dank gilt meinem Lehrer James Low. Der Buddhismus hat mich fasziniert, seit ich 2004 zum ersten Mal nach China kam, aber erst durch deine Interpretationen ist meine Lernkurve unvorstellbar steil geworden. Deine ungetrübte Sichtweise hat mir eine neue Perspektive auf die Dinge gegeben. Die Einfachheit und Klarheit deiner Lehren setzen die Messlatte, an der ich in diesem Leben noch zu kratzen hoffe.
Ich habe viele Seven Sigma Denker beobachtet und einige der Reflexionsübungen in diesem Buch entwickelt, während ich für verschiedene globale Institutionen und in meiner eigenen Coaching-Praxis gearbeitet und an spirituellen Veranstaltungen teilgenommen habe. Die Beobachtung von – und die Arbeit mit – begabten und hochkreativen Denkern und Problemlösern wurde zur Grundlage für die Illustration von Aspekten des Seven Sigma Mindset. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich die Gelegenheit hatte und habe, mit solch erstaunlichen Denkern, Kollegen, Klienten und Freunden zusammenarbeiten zu dürfen.
Ich hoffe, den großen Denkern und Vorbildern, auf deren Schultern ich stehe, gerecht zu werden. Sie haben es mir ermöglicht, meine Gedanken so zu formulieren, wie ich sie in diesem Buch dargelegt habe. Mein Dank gilt allen meinen Lehrern. Alles Wissen stammt von ihnen. Alle Fehler sind meine eigenen.
Jean-Marie Schlömer hat mir das ausführlichste, kritischste und dennoch konstruktivste Feedback zu früheren Entwürfen dieses Buches gegeben. Tom Andreas hat zentrale Themen und Überlegungen immer wieder mit mir diskutiert. Ohne die schmerzhaften Fragen und die großartigen [9] Ideen, die mir die beiden gegeben haben, wäre dieses Buch ganz anders ausgefallen. Andreas Bernecker hat mir wichtiges Feedback zu einem früheren Entwurf gegeben. Tom Smets hat mir geholfen, einige wichtige letzte Änderungen vorzunehmen. Taylor Plimpton hat den endgültigen Entwurf akribisch durchgesehen und Dutzende aufschlussreicher Vorschläge gemacht, die die Lesbarkeit des Buches erheblich verbessert haben. Andy Bartlett, Peter Buckley, Terry Clague, Meredith Norwich und Bethany Nelson halfen bei der Navigation durch die Verlagswelt, in der Barbara Budrich und Franziska Deller sich als großartige Partner erwiesen, um meine Ideen auch dem deutschsprachigen Publikum zur Verfügung zu stellen. Mario Turiaux stellte die Illustrationen zur Verfügung. Viele Klienten und Kollegen haben mir hilfreiches Feedback zu den schriftlichen Übungen in diesem Buch gegeben. Allen gilt mein Dank.
[10] Präambel
Das Seven Sigma Mindset basiert auf zwei Denkschulen: Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP) und Dzogchen (eine Tradition des indotibetischen Buddhismus). Obwohl ich das Seven Sigma Mindset als ein Potpourri dieser beiden Denkschulen betrachte, möchte ich nicht behaupten, dass NLP oder Dzogchen etwas fehlt. Es ist nur so, dass NLP meiner persönlichen Erfahrung nach eine Sammlung von (nützlicheren und weniger nützlicheren) Werkzeugen ist, aber keine umfassende Synthese bietet, während die einfache Synthese, die Dzogchen eindeutig bietet, für mich unverständlich war ohne die Trittsteine, die ich in den Beschreibungen des neuro-linguistischen Programms meines Geistes gefunden habe. Trotz intensiver Suche in West und Ost konnte ich über ein Jahrzehnt lang keinen Zugang zu den buddhistischen Lehren finden, weil ich die Wahrheiten der Existenz nicht mit meiner eigenen Erfahrung in der Welt in Einklang bringen konnte. NLP hat mir geholfen, die ersten Schritte auf dieser Reise zu machen. Das Seven Sigma Mindset kombiniert Ideen aus beiden Denkschulen auf eine Weise, die ich brauchte, um zu wachsen. Ich hoffe, es hilft auch Ihnen.
Struktur dieses Buches
Das Buch gliedert sich in vier Teile.
•TEIL I: DAS SEVEN SIGMA MINDSET. In diesem Teil werden Sie einen genaueren Blick darauf werfen, was Denken ist, insbesondere gewohnheitsmäßiges und freies Denken. Sie werden anfangen, Ihr eigenes Denken zu hinterfragen, besser verstehen, woher es kommt, und einige Beispiele meiner Klienten sehen, die gewohnte Denkmuster erfolgreich eingedämmt haben. Das Six Sigma Mindset, das Gewohnheitsdenken fördert, wird dem Seven Sigma Mindset gegenübergestellt, das freies Denken fördert. Letzteres wird als wünschenswerte Veränderung für jeden dargestellt, der aktiver an der Welt teilnehmen und so ein produktiveres, zufriedeneres und freieres Leben genießen möchte.
[11]
•TEIL II: DIE SECHS GEWOHNHEITSMÄSSIGEN DENKMUSTER (UND IHRE ALTERNATIVEN FÜR FREIES DENKEN). Es gibt sechs gewohnheitsmäßige Denkmuster, die uns daran hindern, echte Seven-Sigma-Denker zu sein, darunter die Tendenz, (1) Gedanken zu verteufeln, (2) Gedanken zu unterdrücken, (3) sich mit ihnen zu identifizieren, (4) ihnen zu vertrauen, (5) sie falsch auszurichten und (6) an ihnen festzuhalten. Wir werden untersuchen, wie diese Muster Ihr Denken beherrschen und alternative Muster des freien Denkens erforschen, die es Ihnen ermöglichen, eine ausgewogenere Denkweise zu pflegen. Durch strukturierte Reflexionen werden Sie spüren, wie sich diese Kräfte in Ihnen auswirken. Sie werden lernen, die einschränkende Wirkung, die sie auf Ihr Denken haben, allmählich zu lockern und so Ihre Fähigkeit und Bereitschaft zu freiem Denken zu erhöhen.
•TEIL III: DIE SIEBEN EBENEN DES FREIEN DENKENS. In diesem Teil lernen Sie die sieben Ebenen des freien Denkens kennen, nach denen Ihre mentalen Landkarten gegliedert sind: (1) Umgebungen, (2) Aktivitäten und Gewohnheiten, (3) Fähigkeiten, (4) Werte und Überzeugungen, (5) Identitäten, (6) Zugehörigkeit und (7) Selbsterfahrung. Durch eine Reihe von Reflexionen, gefolgt von Erklärungen und Fallstudien, werden Sie lernen, Ihr freies Denken auf diesen Ebenen zu erweitern. Sie werden lernen, das ganze Gebiet zu sehen, anstatt sich auf die beschränkten, persönlichen, mentalen Landkarten zu verlassen, mit denen Sie Ihr Leben navigieren. Sie werden verlorene Ressourcen zurückgewinnen und Ihre Perspektive auf die Entscheidungen, die Sie in Ihrem Leben treffen, erweitern.
•TEIL IV: PRAKTIKEN ZUR AUFRECHTERHALTUNG DES SEVEN SIGMA MINDSETS. Damit Sie im Laufe der Zeit nicht in alte Gewohnheiten zurückfallen, lernen Sie in Teil IV, neue Praktiken zu entwickeln, die Ihren Blick immer wieder von der Karte auf das Gebiet lenken. Sie lernen Methoden kennen, mit denen Sie das Seven Sigma Mindset dauerhaft beibehalten können.
[12] Eine der Gemeinsamkeiten des Neuro-Linguistischen Programmierens und des Dzogchen-Buddhismus ist der Aufruf zur direkten Erfahrung. Dieses Buch ist voll von Übungen und Reflexionen, die Sie ermutigen, genau das zu tun. Sie erkennen sie daran, dass sie wie dieser Text in separaten Textboxen stehen. Jedes Mal, wenn wir eine wichtige Erkenntnis aus der Welt der Soziologie, Philosophie oder Psychologie vertiefen wollen, finden Sie zunächst eine Reflexion, die Sie einlädt, in Ihre eigene Erfahrungswelt einzutauchen. Diese Übungen und Reflexionen, die ich auf der Grundlage meiner Erfahrungen mit Klienten und Studierenden entwickelt und verfeinert habe, sind eine wichtige Säule des Seven Sigma Mindset, denn die Veränderung und Aufrechterhaltung einer neuen Denkweise erfordert sowohl intellektuelle als auch erfahrungsbezogene Arbeit. Sie können Fragen und Neugierde auslösen, die Ihren Geist erweitern und es Ihnen ermöglichen, die tieferen Einsichten zu erforschen, die im weiteren Verlauf des Buches folgen. Ich hoffe, dass Sie sich die Zeit nehmen werden, sich auf diese Reflexionen einzulassen, auch wenn Sie sich vielleicht vorgenommen haben, das Buch schnell durchzulesen.
[13] TEIL I:DAS SEVEN SIGMA MINDSET
Kapitel 1Von Tauben und Spatzen
Im Frühjahr 2017 saß ich im Pariser Bahnhof Gare de l’Est auf dem Rückweg von einem Six Sigma-Workshop, den ich geleitet hatte. Ich hatte einem Team geholfen, einige der produktivitätssteigernden Arbeitsmethoden anzuwenden, die ich als Six Sigma-Berater bei der globalen Unternehmensberatung McKinsey & Company gelernt hatte. Während meine eigenen Gedanken noch um den Workshop kreisten, den ich gerade beendet hatte, beobachtete ich einen Schwarm Tauben, die sich um ein Stück Brot stritten, das ein Passant fallen gelassen hatte. Ich bin sicher, dass Sie diese Situation schon einmal gesehen haben. Die Tauben hackten mit ihren Schnäbeln auf das Brot ein, in der Hoffnung, dass ein paar Krümel abbrechen würden, die sie dann fressen könnten. Es war eine etwas chaotische Szene, nicht unähnlich kleinen Kindern beim Fußballspielen. Eine Minute lang versuchte eine nach der anderen, das Stück Brot oder wenigstens einen Krümel davon zu ergattern. Dann landete ein Spatz neben seinen vier- oder fünfmal so großen Artgenossen und ihrer Mahlzeit. Er beobachtete das Geschehen eine Weile bis zum richtigen Augenblick: Mit einem schnellen Satz flog er plötzlich in den Schwarm hinein, schnappte sich das ganze Stück Brot, das größer als sein Kopf war, und ließ die verblüffte Taubenschar ahnungs- und brotlos zurück.
Tauben sind wie alle Tiere auf Überleben programmiert. Ihr Verhalten basiert auf dem, was ihr Verstand als maximale Produktivität ansieht – mehr Futter mit weniger Aufwand. Mit zunehmender Erfahrung wird ihr Verstand darauf trainiert, Gedanken zu wiederholen, die in der Vergangenheit „funktioniert“ haben. Das ist durchaus sinnvoll, kann aber auf Kosten der Fähigkeit gehen, frei zu denken, und so die Entstehung neuer Lösungen verhindern. Die Tauben werden zu Experten und als Folge ihres gewohnheitsmäßigen Denkens wird auch ihr Verhalten gewohnheitsmäßiger. Was der Spatz tat, lag außerhalb des Denkrahmens der Tauben. Die [14] Tauben konnten zwar schneller hacken und das Futter mit ihrem Körper vor den anderen Tauben schützen, aber trotz ihrer Fähigkeit, gleichzeitig zu fliegen und Gegenstände im Schnabel zu tragen, hatten sie nicht daran gedacht, dies zu tun, obwohl es die bessere Methode war. Sie waren durch ihr Gewohnheitsdenken eingeschränkt.
Als Strategieberater bei McKinsey und später als Direktor bei Amazon hatte ich fast zehn Jahre damit verbracht, Klienten und Kollegen dabei zu helfen, Fähigkeiten zu entwickeln, die sie in ihrer Arbeit und in ihrem Leben produktiver machten. Ich war Lehrer und Trainer für die Entwicklung von Prozessen und Gewohnheiten; Gewohnheiten, die meinen Klienten halfen, die gewünschten Ergebnisse zuverlässiger zu erzielen (ähnlich wie Tauben, die gewohnheitsmäßig darauf trainiert werden, Brotkrumen im Laufe ihres Lebens immer schneller und genauer zu sammeln). Viele Menschen mit Management- oder operativem Hintergrund kennen dies als „Six Sigma“-Methode – eine Reihe von Techniken und Werkzeugen, die darauf abzielen, durch die Eliminierung von Abweichungen eine nahezu perfekte Leistung zu erzielen. Ein Sigma (σ) ist ein Maß für die Varianz und die Six Sigma Methode lehrt Sie, wie Sie die geringste Varianz, die geringste Sigma-Abweichung, in Ihren Prozessen und Ergebnissen erreichen. Ich habe meinen Klienten geholfen, die Six Sigma-Prinzipien so anzuwenden, dass ihre Produkte weniger variierten, ihre Produktionsprozesse schneller und ihre Reaktionszeiten zuverlässiger wurden. Im Bild der Tauben: Ich habe ihnen geholfen, schneller und genauer zu picken. Nach einem Jahrzehnt des Lernens war Six Sigma meine Lösung für die Probleme der Welt. Zumindest bis zu meiner Begegnung mit dem Spatzen in Paris.
Als ich beobachtete, wie der Taubenschwarm wieder verschwand, um sich eine andere Futterquelle zu suchen, fragte ich mich plötzlich, ob das Six Sigma Mindset, mit dem ich arbeitete, zu dominant geworden war. Obwohl die Six Sigma-Methode sicherlich effektiv ist, um bestimmte Ziele zu erreichen, begann ich mich zu fragen: Inwieweit ging es bei meiner Arbeit darum, taubenhaftes Verhalten zu verbessern, anstatt spatzenhafte Innovationen zu fördern? Verbesserte und kultivierte ich vielleicht Systeme und Lösungen, die nur zweitklassig waren? Und was tat ich mit dem Mindset der Menschen, die ich zu Abweichungsbeseitigern ausbildete? Waren sie vielleicht genauso in ihren Gewohnheiten gefangen wie diese Tauben? Der Spatz wies darauf hin, dass Varianz etwas Gutes ist und dass [15] es für jeden, der nach besseren Antworten sucht, vielversprechend ist, über den Six Sigma Horizont hinauszugehen. Was wäre, wenn wir, anstatt zu versuchen, Varianz zu reduzieren, eine Denkweise fördern könnten, die Unterschiede sucht und nutzt? Wie sähe das Leben aus, wenn wir der Spatz im Taubenschwarm sein könnten?
[16] Kapitel 2Wie spatzig sind Sie?
Zu Beginn jedes neuen Semesters müssen meine Studenten der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre in meiner Vorlesung „Strategische Problemlösung“ eine Reihe von Übungen absolvieren, um sich auf die Art von Arbeit vorzubereiten, die sie im Laufe des Semesters zu erledigen haben, nämlich einem Unternehmen dabei zu helfen, neue und originelle Lösungen für seine realen Probleme zu finden. Mit anderen Worten, sie sollen eine Spatzenstrategie für ein Unternehmen finden, das sich möglicherweise wie eine Taube verhält. Bevor Sie den Rest dieses Buches lesen, möchte ich Sie einladen, einige der Übungen selbst auszuprobieren. Wenn Sie eine Übung bereits kennen, überspringen Sie sie einfach.
Hinweis: Die Lösungen zu jeder Übung finden Sie am Ende dieses Kapitels.
Zeichnen Sie auf ein Blatt Papier neun kleine Kreise, wie in Abbildung 2.1 dargestellt. Die Aufgabe besteht darin, die neun Kreise mit möglichst wenigen geraden Linien zu verbinden. Die Linien können durch einen Kreis gehen und sich kreuzen, aber sie müssen miteinander verbunden sein. Das heißt, Sie müssen alle Linien zeichnen, ohne den Stift dazwischen zu heben. Das Papier darf auch nicht zerschnitten werden. Wie viele Linien brauchen Sie?
Abbildung 2.1: Das Neun-Kreise-Rätsel
Übung 2.1: Das Neun-Kreise-Rätsel
Erläuterungen: Die meisten meiner Studenten finden eine Lösung mit fünf Linien in wenigen Minuten. Weniger finden eine Lösung mit einer bis vier Linien – und wenn sie es tun – dann in der Regel nur, wenn sie darauf hingewiesen werden, dass es eine Lösung mit weniger als fünf Linien gibt (siehe Ende des Kapitels). Die Schwierigkeit, dieses Rätsel mit weniger als fünf Linien zu lösen, liegt in den gewohnheitsmäßigen Annahmen, z. B. dass die neun Kreise eine bestimmte Größe oder Position auf dem Papier haben müssen, dass das Papier eine bestimmte Größe nicht überschreiten darf, dass die Form des Papiers nicht verändert werden darf, dass ein Stift in Standardgröße verwendet werden muss, dass das Rätsel zweidimensional gelöst werden muss, und so weiter. Vielleicht haben Sie einige dieser Annahmen getroffen, auch wenn sie nicht im Text der Übung stehen. Sie stammen aus Ihrem Kopf und nicht aus dem Text, aus Ihrer Interpretation und nicht aus den Fakten. Wenn den Studenten gesagt wird, dass es eine Lösung mit weniger als fünf Zeilen gibt, spüren sie oft das Bedürfnis, anders zu denken und beginnen, einige ihrer eigenen Annahmen in Frage zu stellen. Sobald die Annahmen beseitigt sind und die Studierenden beginnen, kreativer und freier zu denken, können Lösungen entdeckt werden, die nur eine bis vier Linien benötigen.
Lust auf einen weiteren Versuch?
Holen Sie sich Streichhölzer oder gleich lange Gegenstände wie Stifte, Spaghetti oder ähnliches. Die Aufgabe besteht darin, mit möglichst wenigen Streichhölzern vier gleich große und gleich geformte Dreiecke zu bilden.
[17] Übung 2.2: Das Vier-Dreiecke-Rätsel
Erläuterungen: Vielleicht ist die Idee, Ressourcen (Streichhölzer) zu sparen, um das gleiche Produktionsniveau (vier Dreiecke) zu erreichen, für Sie genauso spannend wie für meine Wirtschaftsstudenten. Die meisten kommen auf eine Lösung mit neun Streichhölzern (siehe Ende des Kapitels). Das liegt daran, dass sie offensichtlich davon ausgehen, dass es eine bessere Lösung geben muss, als 12 Streichhölzer zu verwenden, um vier [18] verschiedene Dreiecke zu produzieren. Nur wenige gehen davon aus, dass Streichhölzer nicht Teil von mehr als einem Dreieck sein können. Auf eine Lösung mit sechs Streichhölzern (siehe Ende des Kapitels) kommt aber kaum einer der Studenten, weil sie anscheinend nur an ein zweidimensionales Problem denken (was die Lösung in Abbildung 2.10 verhindert), und daran, dass sie annehmen, dass die Länge der Streichhölzer gleich der Länge der Seiten des Dreiecks sein muss (was die Lösung in Abbildung 2.11 verhindert). Auch hier gilt: Außerhalb des Kopfes der denkenden Person gibt es keine dieser Einschränkungen.
Hier ist mein letztes Problem für Sie:
Sie sind Mechaniker im Zweiten Weltkrieg und reparieren Kampfflugzeuge, die von ihren Einsätzen zurückkehren. Die Flugzeuge wurden schwer beschossen und sind wie in Abbildung 2.2 dargestellt beschädigt. Ihre Aufgabe ist es, sie für den nächsten Einsatz vorzubereiten. Sie haben einen unerschöpflichen Vorrat an Stahl, Schrauben usw., aber die Zeit drängt, denn Sie wollen, dass die Flugzeuge zu den feindlichen Linien zurückkehren. Wie gehen Sie vor?
Abbildung 2.2: Der Abraham Wald Survivorship Bias
[19] Übung 2.3: Der Abraham Wald Survivorship Bias
Erläuterungen: Nur wenige Studenten verstärken die Flugzeuge an den Stellen, wo sie nicht getroffen wurden. Einige tun es nach zwei oder drei Versuchen (ich stelle ihnen Holzmodelle und Klebepapier als „Reparaturset“ zur Verfügung). Wenn sie Runde für Runde Flugzeuge verlieren, wird ihr freies, kreatives Denken angeregt und bricht mit dem gewohnten „Wir müssen die Löcher reparieren“-Ansatz (siehe Ende des Kapitels).
Wie haben Sie sich geschlagen?
Diese Übungen sind weder ein IQ-Test, noch erfordern sie einen hohen IQ, um gelöst zu werden. Wenn ich richtig vermute, dass Sie nicht bei allen Aufgaben die beste Lösung gefunden haben, dann liegt das daran, dass Ihr Verstand gewohnheitsmäßig darauf trainiert ist, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken, die einen eigentlich weit offenen Lösungsraum einschränkt. Sie sind es gewohnt, eine bestimmte Perspektive einzunehmen, die Ihre natürliche Fähigkeit, an dem teilzuhaben, was im Moment und vor Ihnen geschieht, verdeckt. Dies wird als Mindset bezeichnet: eine Reihe von Einstellungen und Überzeugungen, die eine bestimmte Art des Denkens vorprogrammieren, die Teilnahme einer Person im Hier und Jetzt regulieren und damit ihre Produktivität, Zufriedenheit und wahrgenommene Freiheit beeinflussen.
Wenn Sie mehr als eine Übung durchgeführt haben, haben Sie vielleicht festgestellt, dass Ihnen die Lösung einer Übung bei der Lösung der nächsten geholfen hat, auch wenn die Probleme sehr unterschiedlich waren. Das liegt daran, dass sich Ihr Mindset von der Suche nach Antworten innerhalb Ihrer gewohnten Denkweise hin zur Suche nach kreativeren Antworten verändert hat. Ihre Fähigkeit, sich im Hier und Jetzt zu engagieren und einzubringen, hat sich verbessert.
In meinen Seminaren erkenne ich bei den Studierenden, die einige der Probleme lösen können, die Fähigkeit, frei zu denken und über den Tellerrand hinauszuschauen. Dazu gehört z. B., dass sie dreidimensional denken, wenn die ursprüngliche Aufgabenstellung zweidimensional zu sein scheint; dass sie sich keine Beschränkungen auferlegen, die ihrer Erfahrung, aber nicht der Aufgabe entsprechen; dass sie ihre eigene Voreingenommenheit erkennen; dass sie bemerken, was nicht erwähnt wird; und [20] dass sie grundlegende Fragen stellen. Die besten Lösungen finden in der Regel diejenigen, die sich irgendwann von ihren früheren Erfahrungen mit ähnlichen Problemen lösen können. Sie können frei denken und sich dem Problem spielerisch nähern, unbeeinflusst von früheren Lebenserfahrungen, mit großer kindlicher intellektueller Neugier und ohne das Bedürfnis, ihr Wissen oder ihr Ego unter Beweis zu stellen.
Auch wenn Sie alle Übungen mit Leichtigkeit gemeistert haben und sich für einen echten Spatz in einem Taubenschwarm halten, empfehle ich Ihnen, mit diesem Buch weiterzumachen, denn zu wissen, was zu tun ist, ist etwas anderes als zu wissen, wann es zu tun ist. Bei den obigen Übungen haben Sie wahrscheinlich erwartet, dass Sie kreativ denken müssen. In Wirklichkeit sind wir uns des kreativen Potenzials, das vielen unserer Lebenssituationen innewohnt, oft gar nicht bewusst, genauso wenig wie es den meisten Mechanikern im Zweiten Weltkrieg bewusst war, bis jemand ihren Survivorship-Bias entdeckte. In diesem Buch geht es nicht nur darum, neue Denkweisen zu vermitteln, sondern auch darum, Ihre Fähigkeit zu verbessern, zu erkennen, wann sich eine Gelegenheit bietet.
Bei all diesen Übungen haben Sie viel nachgedacht. Werfen wir nun einen Blick darauf, was Denken eigentlich ist.
[21] Übung 2.1: Das Neun-Kreise-Rätsel
Lösungen:
Fünf Linien: Bei dieser offensichtlichen Lösung (siehe Abbildung 2.3) werden drei horizontale Linien gezeichnet, die durch zwei kürzere vertikale Linien verbunden sind. Es gibt mehrere ähnliche Lösungen mit fünf Linien.
Abbildung 2.3: Das Neun-Kreise-Rätsel – Lösung mit fünf Linien
Vier Linien: Bei dieser weniger offensichtlichen Lösung (siehe Abbildung 2.4) verlängern wir die erste horizontale Linie der Lösung mit fünf Linien über das imaginäre Quadrat der neun Kreise hinaus und verwenden 45-Grad-Winkel, um die neun Kreise mit nur vier Linien zu vervollständigen. Eine buchstäbliche „out-of-the-box“-Lösung.
Abbildung 2.4: Das Neun-Kreise-Rätsel – Lösung mit vier Linien
[22] Drei Linien: Die Lösung in Abbildung 2.5 erfordert einen noch größeren gedanklichen „Rahmen“, über den wir hinaus denken müssen. Wir machen uns die Tatsache zunutze, dass wir es mit echten Kreisen zu tun haben, die einen (kleinen) Durchmesser haben und keine einzelnen Pixelpunkte sind. Daher können wir ihre Durchmesser verwenden, so dass wir insgesamt nur drei Linien benötigen, um alle neun Kreise zu berühren. Wenn Ihnen Ihr Papier zu klein erscheint, um Linien auf diese Weise zu zeichnen, zeichnen Sie die neun Kreise einfach noch einmal, aber viel näher beieinander.
Abbildung 2.5: Das Neun-Kreise-Rätsel – Lösung mit drei Linien
[23] Eine Linie (Version A): Werden die Kreise in einem Abstand voneinander gezeichnet, der so klein ist, dass sie von der Dicke eines zweiten, dickeren Stifts abgedeckt werden (siehe Abbildung 2.6), so genügt eine einzige Linie.
Abbildung 2.6: Das Neun-Kreise-Rätsel – Lösung mit einer Linie (Version A)
Eine Linie (Version B): Wenn man das Papier zu einem Zylinder rollt und eine einzelne Helix (Spirale) darum zeichnet (wie in Abbildung 2.7), kann man alle neun Kreise mit einer einzigen geraden Linie verbinden.
Abbildung 2.7: Das Neun-Kreise-Rätsel – Lösung mit einer Linie (Version B)
[24] Übung 2.2: Das Vier-Dreiecke-Rätsel
Lösungen:
Zwölf Streichhölzer: Die unkomplizierte Art ist in Abbildung 2.8 dargestellt. Einfach drei Streichhölzer zu einem Dreieck zusammenlegen und das Ganze noch dreimal wiederholen.
Abbildung 2.8: Das Vier-Dreiecke-Rätsel – Lösung mit zwölf Streichhölzern
Neun Streichhölzer: Eine viel effizientere Art, vier Dreiecke zu erstellen, ist, dieselben Streichhölzer für mehrere Dreiecke zu verwenden (siehe Abbildung 2.9).
Abbildung 2.9: Das Vier-Dreiecke-Rätsel – Lösung mit neun Streichhölzern
[25] Sechs Streichhölzer (Version A): Das Rätsel lässt sich am effizientesten lösen, wenn nur sechs Streichhölzer verwendet werden (siehe Abbildung 2.10). Die Streichhölzer sollen ein Tetraeder bilden. Zuerst werden drei Streichhölzer auf eine Fläche gelegt, so dass ein Dreieck mit drei gleichen Seiten entsteht. Dann werden die restlichen drei Streichhölzer auf jede Ecke des Dreiecks gelegt und nach innen gekippt, bis sich die Spitzen berühren und eine Pyramide entsteht.
Abbildung 2.10: Das Vier-Dreiecke-Rätsel – Lösung mit sechs Streichhölzern (Version A)
Sechs Streichhölzer (Version B): Eine ebenso effiziente Lösung ist die Herstellung eines Davidsterns durch das Übereinanderlegen von zwei Dreiecken aus drei Streichhölzern, wie in Abbildung 2.11 gezeigt. Es entstehen sogar sechs gleich große und gleich geformte Dreiecke an den Spitzen des Sterns.
Abbildung 2.11: Vier-Dreiecke-Rätsel – Lösung mit sechs Streichhölzern (Version B)
[26] Es gibt viele weitere Lösungen mit sechs Streichhölzern, die hier nicht weiter diskutiert werden können.
Übung 2.3: Der Abraham Wald Survivorship Bias
Lösungen:
Reparatur der Löcher: Der gewohnheitsmäßig geschulte Verstand sagt uns, dass wir die Löcher reparieren müssen. Meine Studenten (wie Sie?) sind in der Regel keine Studenten der Luftfahrt oder anderer Ingenieurwissenschaften, aber sie neigen dazu zu denken, dass das Flugzeug an den Stellen, an denen es beschädigt ist, repariert werden muss, um die beste Chance zu haben, die nächste Mission zu überleben. So funktioniert unser gewohnheitsmäßiges Reparaturdenken.
Verstärkung der nicht getroffenen Bereiche (und Reparatur der Löcher, wenn noch Zeit bleibt): Bei dieser Lösung stellt der Problemlösende fest, dass die Flugzeuge zwar getroffen wurden, aber dennoch zurückkehren konnten. Sie sind die Überlebenden. Wie Abbildung 2.2 zeigt, sind die Auswirkungen des feindlichen Feuers auf die zurückkehrenden Flugzeuge unverhältnismäßig stark in Bereichen, die für eine sichere Rückkehr nicht unbedingt erforderlich sind. Mit anderen Worten: Flugzeuge, die in den Bereichen getroffen wurden, in denen das Flugzeug in Abbildung 2.2 nicht getroffen wurde (die Mitte der Tragflächen und der Teil des Rumpfes, in dem sich der Treibstofftank befindet), kehrten überhaupt nicht zurück. Es ist logisch, die Löcher zu reparieren, aber wichtiger ist es, die Teile des Flugzeugs zu verstärken, die nicht vom feindlichen Feuer getroffen wurden: damit sie beim nächsten Einsatz eine bessere Überlebenschance haben, wenn sie an diesen Stellen getroffen werden. Der Fachausdruck für unsere Tendenz, bei diesem Problem eher die Löcher zu reparieren als die nicht getroffenen Bereiche zu verstärken, ist „Survivorship Bias“.
[27] Kapitel 3Das Denken und seine Auswirkungen auf Ihr Leben
Was ist Denken?
Denken ist ein kognitiver Prozess, bei dem wir Informationen, Ideen und Konzepte geistig verarbeiten, um der Welt um uns herum einen Sinn zu geben. Wie erleben Sie Ihr Denken im Alltag? Werfen wir einen Blick darauf…
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, schließen Sie die Augen und denken Sie eine Minute lang an jemanden oder etwas Wichtiges in Ihrem Leben. Entspannen Sie sich bei dieser Übung und beobachten Sie, was passiert, wenn Sie an diese Person oder Sache denken. Nur eine Minute lang. Mit sanft geschlossenen Augen.
Reflexion 3.1: Was ist Denken? Sehen Sie selbst
Was Sie gerade erlebt haben, ist Denken, der Prozess, etwas in Ihrem Kopf darzustellen. Wie die meisten Menschen haben Sie dabei wahrscheinlich Bilder gesehen, Geräusche oder Stimmen gehört und/oder Empfindungen in Ihrem Körper gespürt (z. B. Temperatur, Druck, Bewegung usw.). Vielleicht haben Sie sogar etwas gerochen oder geschmeckt. Das bedeutet, dass Sie die Person oder Sache mit Hilfe Ihres Repräsentationssystems dargestellt haben, das visuelle (Sehen), kinästhetische (Wahrnehmung von Position und Bewegung), auditive (Hören), gustatorische (Schmecken) und olfaktorische (Riechen) Repräsentationen umfasst. Sie erinnern sich, Sie interpretieren, Sie schlussfolgern – alles auf der Grundlage Ihres Repräsentationssystems – und machen so das, was nicht da ist, präsent. Denken ist die Fähigkeit, gedanklich etwas ins Hier und Jetzt zu bringen, das nicht im Hier und Jetzt ist. In der Reflexion 3.1 haben Sie Ihre Augen geschlossen, um die Repräsentation mit weniger Ablenkung zu erleben, aber [28] es spielt keine Rolle, ob Ihre Augen offen oder geschlossen sind, denn Sie können auch etwas repräsentieren, während Sie etwas anderes anschauen. Das Objekt Ihrer Gedanken spielt dabei keine Rolle – es kann ein Raum, ein Land, ein Ereignis, eine Erfahrung, eine schwierige Aufgabe, Ihr Selbst oder etwas anderes sein.
Repräsentation ist die Grundlage eines funktionierenden Verstandes und eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung des Bewusstseins. Sie ist nicht nur die Grundlage für einfaches Abrufdenken, wie in der Reflexion 3.1 oder in einem Tagtraum, sondern auch für viel komplexeres Denken. Selbst die komplexesten Problemlösungen, mit denen Sie z. B. bei der Arbeit oder in Ihrer Partnerschaft konfrontiert werden, beruhen im Wesentlichen auf repräsentativem Denken. Ihre Fähigkeit, sich mit Hilfe Ihres Repräsentationssystems nicht-gegenwärtige Realitäten im Hier und Jetzt vorzustellen, ermöglicht es Ihnen, Informationen zu analysieren, verschiedene Aspekte zu kombinieren, Optionen logisch auszuschließen, zu vergleichen und zu kontrastieren, Schlussfolgerungen zu ziehen und intelligent zu handeln. Im Laufe dieses Buches werden Sie viele Gelegenheiten haben, Ihr Repräsentationssystem besser kennen zu lernen und die Denkweisen zu erforschen, mit denen Sie arbeiten.
Wie beeinflusst das Denken mein Leben?
Wie Sie denken, hat großen Einfluss auf Ihr Wohlbefinden, Ihre Gefühle, Ihre körperlichen Reaktionen und Ihr Verhalten. Ihre Gedanken sind der Beginn einer Kettenreaktion: Ein einziger Gedanke kann weitere Gedanken und dann Gefühle auslösen, die sich wiederum auf Ihr Handeln und Verhalten auswirken.1 Zuversichtliche Gedanken können zu proaktiven Schritten führen, während Selbstzweifel zu Zögern führen können. Diesen Dominoeffekt zu verstehen ist der Schlüssel, um positive Veränderungen in Ihrem Leben herbeizuführen und produktiver, zufriedener und freier zu werden.
Z. B. kann die Überzeugung, dass die eigene Intelligenz entwicklungsfähig ist (das sogenannte Fixed vs. Growth Mindset) und dass Stressreaktionen die eigene Leistung beeinflussen können (das sogenannte Stress-Can-Be-Enhancing Mindset), unsere Produktivität und das Wohlbefinden stark beeinflussen, wie mehrere in Nature veröffentlichte [29] Experimente zeigen: Nach einer kurzen Online-Intervention zu diesen Mindsets zeigten die Probanden eine Verbesserung stressbezogener Kognitionen, eine Verbesserung der kardiovaskulären Reaktivität und des täglichen Cortisolspiegels, eine Verbesserung des psychischen Wohlbefindens, eine Verbesserung des akademischen Erfolgs und eine Verringerung von Angstsymptomen.2 In einer anderen Studie erhielt eine Gruppe von Unternehmern ein Training zum Thema „Growth Mindset“, das ihre Überzeugung förderte, dass sie durch Experimentieren und Scheitern die für den Erfolg erforderlichen Fähigkeiten verbessern können. Eine ansonsten identische Kontrollgruppe erhielt dieses Training nicht. Diejenigen, die an dem Training teilnahmen – und ihre Denkweise änderten – zeigten anschließend mehr Initiative bei der Verfolgung des Unternehmenswachstums.3 Denken beeinflusst unser Verhalten.
Es gibt auch einen oft missverstandenen Zusammenhang zwischen Situationen, Denken und Zufriedenheit. Wir neigen dazu, zu glauben, dass unsere Zufriedenheit direkt von Situationen (z. B. der äußeren Umgebung und Ereignissen) abhängt und konzentrieren uns daher darauf, diese zu optimieren. Wir glauben, dass es darauf ankommt, was wir essen, wo wir arbeiten, wie wir versuchen, Wohlstand und finanzielle Sicherheit aufzubauen, mit wem wir interagieren usw., obwohl es in Wirklichkeit „nichts gibt, was gut oder schlecht ist, aber das Denken macht es dazu“.4 Unsere Wahrnehmung einer Situation – unser Denken – bestimmt weitgehend, wie zufrieden wir sind. Die gleiche Person, der gleiche Ort, das gleiche Essen oder die gleiche Aktivität kann für den einen die Hölle und für den anderen der Himmel sein. Manchmal hat man Lust auf einen Drink, manchmal nicht. Die Bewertung einer Situation als gut oder schlecht, als befriedigend oder unbefriedigend, als notwendig oder nicht notwendig wird nicht durch die Situation selbst verursacht, sondern durch die Interpretation der Situation, die zu unterschiedlichen Emotionen und Verhaltensweisen führt.
Ich führe z. B. regelmäßig interessierte Gruppen zum Eisbaden. Wenn sie sich bewusst und freiwillig dem eiskalten Wasser aussetzen, werden sie trotz des kurzzeitigen Schocks für ihren Körper überwiegend positive Gedanken haben und sich wohlfühlen. Das Gefühl im Körper wird vielleicht nicht einmal als Schmerz sondern als positive Empfindung interpretiert. Im Gegensatz dazu wird jemand, der von einer anderen Person gezwungen [30] wird, in eiskaltes Wasser zu steigen, genau die gleiche körperliche Situation erleben, nämlich sich eiskalt zu fühlen, aber er wird nur negative Gedanken haben und eine insgesamt negative Erfahrung machen. Die Gedanken sind der Schlüssel zur Erfahrung.
Dass es Umgebungen und Ereignisse gibt, die an sich (körperlich) schädlich sind, soll damit nicht bestritten werden. Vielmehr soll erklärt werden, dass die meisten unserer positiven und negativen Erfahrungen in unserem Denken verwurzelt sind. Die überwältigende Mehrheit unserer eigenen Zufriedenheit und Frustration mit unserem Leben und die Auswirkungen, die dies auf unsere Produktivität und geistige Freiheit hat, sind auf unser Denken zurückzuführen. Der Schlüssel zu einem zufriedenen, produktiven und freien Leben liegt in der Art und Weise, wie Sie denken.
Nachdem wir uns angesehen haben, was Denken ist, werden wir nun die Welt des Denkens in Gewohnheitsdenken und freies Denken unterteilen.
[31] Kapitel 4Gewohnheitsdenken
Was ist Gewohnheitsdenken?
Gewohnheit bezieht sich auf die Regelmäßigkeit, mit der Sie etwas tun oder auf eine beständige Weise handeln. Gewohnheitsdenken ist die wiederholte, regelmäßige Repräsentation, die mit Ihrer Vergangenheit in Verbindung gebracht werden kann. Es erzeugt die vertrauten Gedanken, die Ihnen ein Gefühl der Kontinuität geben. Gewohnheitsdenken stammt per Definition aus der Vergangenheit, denn alles Gewohnte war schon einmal da. Gewohnheitsdenken ist daher niemals neu oder originell, sondern eine Kopie des bisherigen Denkens. Was die Häufigkeit betrifft, so ist der größte Teil Ihres Denkens Gewohnheitsdenken.





























