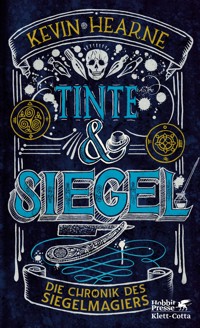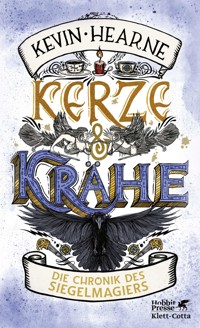9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Fintans Sage
- Sprache: Deutsch
Das neue High-Fantasy-Meisterwerk von Kevin Hearne, dem Autor der »Chroniken des eisernen Druiden«, entführt in eine Welt voller wilder Magie, epischer Schlachten und wahrer Helden. Sechs Kennings sind in den Reichen des Kontinents Teldwen bekannt: magische Fähigkeiten, die Macht über die Elemente verleihen – für einen hohen Preis: Lebenszeit. Die Erzählungen des Barden Fintan führen bald zu einem Gerücht von einem siebten Kenning, das allen anderen überlegen sein soll. Auf der Suche danach fällt eine gigantische Armee bleicher Knochenriesen in die nördlichen Reiche Teldwens ein. Der Barde und seine Verbündeten geraten mitten in den alles verschlingenden Strudel eines Krieges, der ihre Welt zu vernichten droht – sollte es ihnen nicht gelingen, die letzten Geheimnisse der Kennings zu ergründen. New York Times-Bestsellerautor Kevin Hearne fesselt mit einem neuen Fantasy-Epos über die Macht der Erzählung, finstere Magie und vernichtende Schlachten. Der Auftakt zur High-Fantasy-Trilogie "Fintans Sage".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1150
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Kevin Hearne
Das Spiel des Barden
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Urban Hofstetter
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Sechs Kennings sind in den Reichen des Kontinents Teldwen bekannt: magische Fähigkeiten, die Macht über die Elemente verleihen – für einen hohen Preis: Lebenszeit. Nun geht das Gerücht von einem siebten Kenning um, das allen anderen überlegen sein soll. Auf der Suche danach fällt eine gigantische Armee bleicher Knochenriesen in die nördlichen Reiche Teldwens ein. Der Barde Fintan und seine Verbündeten geraten mitten in den alles verschlingenden Strudel eines Krieges, der ihre Welt zu vernichten droht – sollte es ihnen nicht gelingen, die letzten Geheimnisse der Kennings zu ergründen.
Inhaltsübersicht
Widmung
Dramatis Personae
Erster Tag
Tallynd
Zweiter Tag
Nel
Gorin Mogen
Kallindra
Dritter Tag
Abhi
Nel
Gondel
Vierter Tag
Kallindra
Nel
Gorin Mogen
Melishev
Abhi
Fünfter Tag
Abhi
Gorin Mogen
Nel
Sechster Tag
Melishev
Abhi
Siebter Tag
Nel
Abhi
Achter Tag
Gorin Mogen
Melishev
Abhi
Neunter Tag
Gondel
Zehnter Tag
Fintan
Abhi
Melishev
Elfter Tag
Kallindra
Culland
Gondel
Zwölfter Tag
Gondel
Kallindra
Dreizehnter Tag
Fintan
Abhi
Tallynd
Vierzehnter Tag
Meara
Fünfzehnter Tag
Melishev
Kallindra
Gondel
Sechzehnter Tag
Abhi
Culland
Siebzehnter Tag
Meara
Culland
Meara
Gondel
Achtzehnter Tag
Abhi
Gorin Mogen
Nel
Neunzehnter Tag
Gorin Mogen
Nel
Gorin Mogen
Nel
Abhi
Fintan
Gondel
Anhang
Jereh-Tabelle
Kaurischer Kalender
Danksagungen
Für Kimberly,
die Erste, die fand, dass der raelische Barde einige gute Geschichten zu erzählen hätte.
Wie immer danke für deine Liebe und Unterstützung.
Dramatis Personae
Erster Tag
Der Barde beginnt
Wenn wir eine Stimme hören, die uns berührt, die uns im einen Moment die Tränen in die Augen treibt und schon im nächsten so weit hat, dass wir uns vor Lachen die Bäuche halten, dann lässt sich ihre Kraft nur schwer beschreiben. Wir wissen bloß, dass wir ihren Klang mögen und ihr weiter lauschen wollen. Wenn wir dagegen eine Stimme hören, die wir abscheulich finden, können wir normalerweise mühelos sagen, was uns an ihr stört – ob wir sie zu nasal finden, zu weinerlich, zu schrill vor Zorn oder zu triefend vor Melancholie.
Die Stimme des Barden war von der schwer zu beschreibenden Sorte.
Er stellte sich auf die Festungsmauer, die die Halbinsel umgab, wo ein Meer aus Flüchtlingen um unzählige Zelte herumwogte, und hob die Hände, als wollte er alle umarmen, die der Krieg hier angespült hatte. Als er zu sprechen begann, drehte er sich leicht zur Seite, um auch die Bewohner der Stadt in seinen Vortrag mit einzubeziehen. »Ihr guten Leute von Pelemyn, ich bin Fintan, Barde der Dichtergöttin Kaelin.«
Zu allen Seiten hoben sich die Blicke und blieben an seiner Gestalt hängen. Währenddessen reckten die Menschen in den weiter entfernten Winkeln der Stadt die Hälse, um seine körperlose Stimme besser verstehen zu können. Überall verstummten die Gespräche, und ein Zauber schien zu wirken: Wer immer sein strahlendes Gesicht erblickte, fühlte sich ihm verbunden und geriet in freudige Stimmung. Der Krug, den ich in der Hand hatte, enthielt wässriges Bier aus einem namenlosen Fass, aber auf einmal schmeckte es wie das legendäre spritzige Gebräu aus Forn. Die Wohlgerüche frischer Speisen wehten noch duftender im Wind, während sich die weniger angenehmen Aromen von ungewaschenen Körpern und stinkendem Abfall verzogen.
»Geschichten zu erzählen ist meine Lebensaufgabe«, fuhr der Barde fort. Das Lächeln, das gerade noch aus seiner Stimme geklungen hatte, war nun einem ernsten Tonfall gewichen. »Und kein anderer kann euch berichten, was ich gesehen habe. Dieser große Krieg unserer Zeit ist in der Tat fürchterlich verlaufen, und ich bin immer noch erschüttert von seinen Schrecken. Wie oft wache ich nachts schweißgebadet auf und … Nun, das muss ich euch wohl nicht erzählen.«
Nein, das musste er nicht. Die meisten auf dem Feld der Überlebenden trugen immer noch dieselben Kleidungsstücke, in denen sie aus der Heimat geflohen waren. Inzwischen waren sie allesamt dreckig und zerschlissen. Die Leute hatten dunkle Ringe unter den Augen, die von Schlafmangel, verlorenen Angehörigen … kurz und gut, von Verlust zeugten.
»Aber ebenso bewegt bin ich von dem unerwarteten Heldenmut der Leute überall. Denn ihr müsst wissen, ich komme von der anderen Seite des Kontinents, von der Westfront, wo ich an der großen Schlacht unter den Götterzähnen teilgenommen habe.« Seinen Worten folgte vielstimmiges Rufen, das, wie ich staunend bemerkte, sowohl in den Straßen der Stadt erklang als auch weit draußen auf der Halbinsel. Der Barde sprach nur so laut, als brächte er bei einer größeren Abendgesellschaft einen Trinkspruch aus. Doch jedermann schien ihn problemlos hören zu können.
»Ja, all das habe ich erlebt – und noch einiges mehr. Ich kann euch schildern, was im Granittunnel geschehen ist …« Erneuter Jubel. »Und ich kann euch von einem friedliebenden Bürger aus Kauria berichten. Auf Geheiß von Mistral Kira – möge sie noch lange regieren – hatte er in diesem Krieg eine geheime Rolle zu spielen. Vielleicht hat er sogar eine Möglichkeit gefunden, ihn zu beenden. Deswegen bin ich jetzt hier.« Dafür erntete er das bislang lauteste Gebrüll, und er nickte zum Feld der Überlebenden hinüber, um ihnen zu versichern, dass er die Wahrheit sagte. »Freunde, der Pelenaut hat mir gestattet, euch mitzuteilen, dass sich in diesem Moment eine Flotte aus Kauria auf dem Weg hierher befindet. Unterwegs werden sich ihr noch zwei weitere verbündete Armeen anschließen, die über die Berge zu uns marschieren – eine aus Rael und eine aus Forn. Gemeinsam mit euren eigenen Streitkräften werden sie über das Meer segeln und dem Feind angemessen vergelten, was er uns angetan hat!«
Daraufhin schrien die Versammelten ihre Gefühle so laut heraus, dass sie sogar das mächtige Kenning des Barden übertönten. Zuerst war es Zorn, der sich jedoch nicht gegen ihn, sondern gegen weit entfernte Küsten richtete. Diese zahllosen Menschen hatten fast alles verloren und sehnten sich nun nach ausgleichender Gerechtigkeit. Ein paar Augenblicke später brachen sie jedoch in Jubel aus, weil sie zum ersten Mal seit Monaten wieder Hoffnung schöpften. Die Leute fielen einander in die Arme und tanzten im Schlamm herum. Mit tränenüberströmten Gesichtern reckten sie die Fäuste gen Himmel. Das waren endlich mal wieder gute Neuigkeiten, anstelle der andauernden Schreckensmeldungen.
Auch ich war nicht immun gegen diese Gefühle. Ein paar Minuten lang ließ ich den Barden aus den Augen, während ich das Feld der Überlebenden betrachtete und dann den Blick auf die andere Seite der Mauer wandern ließ, wo sich in den Straßen der Stadt die gleichen Freudenszenen abspielten.
Die Menschen stürmten aus den Gebäuden, um sich zu umarmen, und genossen es, lächelnde Gesichter zu sehen anstatt immer nur vor Wut und Trauer gebleckte Zähne. Mein eigenes Haus konnte ich von der Stadtmauer aus zwar nicht erkennen, aber ich stellte mir das Grinsen vor, das in diesem Moment auf Elyneas Gesicht liegen musste, und bedauerte, es zu verpassen. Seit sie mit ihren Kindern zu mir gezogen war, hatte ich sie nur bedrückt erlebt.
Als der Barde erneut die Stimme erhob und den Freudenlärm der Menschen übertönte, stand er nicht mehr halb verborgen hinter den Zinnen auf der Mauer, sondern auf einer improvisierten Bühne, die ein paar Matrosen rasch aus Kisten zusammengezimmert hatten. »Aber rechnet nicht schon morgen mit unserer Befreiung und dem Sieg über unsere Feinde, und auch übermorgen wird es noch nicht so weit sein. Es wird eine Weile dauern, bis unsere Verbündeten hier eintreffen, und noch etwas länger, bis die Fahrt über das Meer beginnen kann. Bis zu sechzig Tage, hat man mir gesagt. In der Zwischenzeit wünscht der Pelenaut in seiner Weisheit, dass ihr erfahrt, was andernorts geschehen ist. Denn es ist zweifelhaft, dass ihr bislang mehr als nur Gerüchte gehört habt. Er hat mich gebeten, euch mitzuteilen, was ich weiß, und er selbst hört auch zu. So stehe ich jetzt in euren Diensten. Ich werde euch die Geschichte auf die althergebrachte Weise erzählen und jeden Nachmittag bis Sonnenuntergang vor euch auftreten. Ich hoffe, die kleinen Siege, die wir allen Widrigkeiten zum Trotz erringen konnten, werden euch ebenso ermutigen, wie sie mich ermutigt haben. Denn sie sind der Grund, warum wir heute noch hier sind und warum wir auch morgen noch da sein werden. Und wenn es den Göttern gefällt, werden wir diese Geschichten noch an viele nachfolgende Generationen weitergeben können.«
An dieser Stelle musste der Barde erneut innehalten und abwarten, bis der tosende Applaus der Menge verklang. Währenddessen stieg eine junge Frau auf die Kistenbühne und hielt ihm einen riesigen Krug hin. Dabei sagte sie ihm ein paar Worte ins Ohr, doch ihre Stimme trug nicht so weit wie die des Barden. Fintan nickte ihr dankbar zu, ehe er wieder zu sprechen begann.
»Anscheinend wird Brynlön seinem Ruf, gastfreundlich zu sein, vollauf gerecht! Meister Yöndyr, der Eigentümer und Braumeister eines hiesigen Gasthauses namens Sirenengesang, überlässt mir einen Krug voll Nebelmaid-Bier – sicherlich aus rein medizinischen Gründen. Außerdem gewährt er mir für die Dauer meines Aufenthalts Unterkunft! Ich danke Euch, mein Herr!«
Aus der Menge ertönten Beifallsrufe für Yöndyrs hervorragenden Einfall, und ich konnte mir vorstellen, dass sich andere Gastwirte derweil Vorwürfe machten, weil sie nicht selbst darauf gekommen waren. Das Gasthaus mit dem Namen Sirenengesang war gerade auf die bestmögliche Weise beworben worden.
Lächelnd ergriff Fintan die Gelegenheit und trank einen Schluck. Anschließend wischte er sich den Schaum von der Oberlippe. Dann reichte er der Frau den Krug zurück, nahm eine düster-dramatische Pose ein und sagte: »Hört mir zu.«
Zu beiden Seiten der Stadtmauer standen, soweit ich sehen konnte, alle in gespannter Erwartung da, und viele grinsten aufgeregt. Zwar hatte Fintan uns nur weitere Einzelheiten über einen Krieg versprochen, von dem wir ohnehin schon viel zu viel wussten. Aber das machte nichts, weil wir alle wie Kinder waren, die darauf warteten, dass man ihnen eine Geschichte erzählte. Und jetzt durften wir sogar hoffen, dass sie gut ausgehen würde.
»Wie alle Geschichten, die es wert sind, gehört zu werden, erzähle ich auch diese von Anfang an. Doch es ist euer Anfang, nicht der von Kauria oder Forn oder von irgendeinem anderen Ort. Zu denen kommen wir später noch. Zuallererst werden wir uns mit eurer Tidenhüterin beschäftigen, denn ihr allein haben wir es zu verdanken, dass diese Stadt noch steht! Also, meine lieben Freunde, wo immer ihr seid, füllt eure Becher und geht zum Abort. Nehmt euch die Zeit und tut alles, was nötig ist, damit ihr meiner Geschichte in ein paar Minuten eure volle Aufmerksamkeit schenken könnt. Wenn ihr zu weit von der Mauer entfernt seid, dann rückt ein Stück näher, damit ihr mich besser seht! Und wenn ihr Durst habt, dann seid versichert, dass nichts ihn so gut löschen wird wie Yöndyrs Nebelmaid-Bier! Ich beginne in Kürze!«
Ein unterhaltsamer Nachmittag, bei dem eine von uns als Heldin präsentiert werden würde? Und dazu noch etwas zu essen und Bier? Wir konnten kaum erwarten, dass es losging! Alle setzten sich gleichzeitig in Bewegung und begannen, sich auszutauschen. Diesseits und jenseits der Stadtmauer waren sämtliche anderen Erledigungen vergessen. Stattdessen kam es zu einem regelrechten Ansturm auf Speisen und Getränke. Meister Yöndyr war zweifellos entzückt.
»Lasst uns anfangen«, sagte Fintan ein paar Minuten später. Seine Stimme erfüllte mühelos die Stadt und die gesamte Halbinsel. »Ich möchte jemand ganz Besonderen zu mir auf die Bühne bitten, Pelemyns Tidenhüterin, Tallynd du Böll. Tallynd, kommt bitte hoch zu mir.«
Unter donnerndem Applaus stieg eine Frau in Militäruniform zu Fintan auf die improvisierte Bühne. Dabei schonte sie merklich das linke Bein. Sie trug Abzeichen, die ich noch nie gesehen hatte. Zuerst dachte ich, sie hätten mit ihrer Segnung zu tun, später fand ich jedoch heraus, dass sie für einen neu eingeführten militärischen Rang standen. Tallynd hatte freundliche Augen, ein zurückhaltendes Lächeln und kurz geschorene Haare, die an den Schläfen zu ergrauen begannen.
Während sie den Flüchtlingen auf dem Feld der Überlebenden zuwinkte, sagte Fintan: »Sprecht ein paar Worte. Ich sorge dafür, dass sie Euch hören können.«
»Oh. Also dann … Hallo?« Dank Fintans Kenning war sie noch in drei Meilen Entfernung zu verstehen und erntete erneut Beifall. »So was! Na gut. Nur damit ihr’s wisst: Ich habe Fintan zur Vorbereitung mein Dienstbuch zu lesen gegeben und ihm alles erzählt, woran ich mich erinnere. Ich bin sicher, dass er das alles viel besser in Worte fasst, als ich es je könnte. Aber das Wichtigste ist: Es ist alles wahr, und ich bin froh, dass er es euch berichten wird. Die Geschichte verlief nicht ganz so, wie ihr glaubt. Und ihr solltet die Wahrheit kennen.«
Während sie sprach, zog Fintan aus einem Beutel an seinem Gürtel einen Gegenstand, der wie ein kleines schwarzes Ei aussah. Er hielt ihn zwischen Daumen und Zeigefinger in die Höhe und warf ihn dann zu Boden, worauf eine schwarze Rauchsäule aufstieg und seinen Körper vollständig einhüllte. Als seine Gestalt kurz danach wieder zum Vorschein kam, war er mit der Uniform und auch in allem anderen das exakte Ebenbild von Tallynd du Böll. Bei der Verwandlung war er sogar um ein paar Zoll gewachsen.
Fintan war ein relativ kleiner, dunkelhäutiger Mann – wenn auch nicht so dunkel wie wir Brynter – mit einem schmalen Gesicht, einer auffällig großen Nase und vollen Lippen. Daher war es ein ziemlicher Schock, als er sich vor aller Augen in die hoch angesehene Retterin unserer Stadt verwandelt hatte. »Ich danke Euch, Tidenhüterin«, sagte er zu ihr, mit ihrer eigenen Stimme.
Tallynd du Böll rang wie alle anderen nach Luft. »Da ertränk mich doch einer«, brachte sie schließlich heraus. »Sehe ich wirklich so aus? Und das soll meine Stimme sein?« Die Menge lachte. »Na, egal. Ich habe Euch zu danken, Fintan.«
Nachdem sie uns noch einmal zugewunken hatte und von der Bühne gestiegen war, erzählte uns der Barde in Gestalt von Tallynd, was wirklich in jener Nacht geschehen war, als die Giganten kamen.
Tallynd
Bevor mein Mann vor fünf Jahren starb, fragte er mich mal, welchen Preis wir alle meiner Ansicht nach für den Frieden würden zahlen müssen, in dem wir bereits so viele Jahre lebten.
»Was meinst du damit?«, fragte ich ihn. Wir hatten etwas getrunken und dampfende fornische Kürbissuppe gegessen und saßen nun in dem kleinen Brunnenhof hinter unserem Haus. Ich spielte mit meinem Kenning und verdrehte die Wasserfontänen, sodass sie spiralförmig ins Auffangbecken unter dem Brunnen zurückfielen.
Er beugte sich vor, stützte die Ellbogen auf die Knie und nahm die Pfeife aus dem Mund. Mit zusammengekniffenen Augen betrachtete er mich durch den Rauch und deutete mit dem Pfeifenstiel auf mich. »Wie lange bist du jetzt schon beim Militär? Seit vier Jahren? Und trotzdem hast du noch in keiner einzigen Schlacht gekämpft. So etwas hat immer seinen Preis.«
»Wie kommst du darauf, dass wir ihn zahlen müssen?«, wandte ich ein. »Kann doch sein, dass das bereits unsere Vorfahren für uns übernommen haben.«
Er nickte bedächtig. »Vielleicht hast du recht«, sagte er. »Wir alle kennen diese alten Geschichten, die wir in der Schule gehört haben. Ich bezweifle nicht, dass unsere Altvorderen viel Blut gelassen und Schlimmes durchgemacht haben. All das Schreckliche, was Familien wie der unseren widerfahren sein muss, wird in diesen Erzählungen in zwei oder drei mageren Sätzen abgehandelt. Stattdessen geht es seitenweise nur darum, was dieser Herrscher gegessen hat und was jene reiche Person anhatte.« Er schnaubte, und Rauch quoll ihm aus der Nase. »Aber ich glaube trotzdem, dass da etwas auf uns zukommt, mein Liebling. Und darüber mache ich mir Sorgen. Weil du die Erste sein wirst, die es betreffen wird.«
Ich lachte ihn aus. Ja, wirklich! An dieses Gespräch kann ich mich noch sehr deutlich erinnern, obwohl es mir zu jener Zeit ganz unwichtig erschien. Er sah so gut aus, und ich wünschte mir noch ein weiteres Kind von ihm. Als ich damals sein schönes dunkles Gesicht betrachtete, das in der untergehenden Sonne bronzefarben schimmerte, konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass jemals ein Krieg ausbrechen würde.
Ehrlich gesagt, konnte ich es mir so lange nicht vorstellen, bis ich schließlich die Erste war, die in diesen Krieg verwickelt wurde – genau wie mein Mann es prophezeit hatte. Aber als er ausbrach, war mein Geliebter bereits lange in den Ozean zurückgekehrt. Unsere beiden Jungs waren damals acht und neun Jahre alt, und dass sie sich kaum noch an ihn erinnern konnten, war für mich das Allerschlimmste überhaupt. Bis zu dem Zeitpunkt, als die Knochengiganten über meinen Kopf hinwegsegelten.
Normalerweise tue ich tagsüber Dienst, aber die Fischerzunft hatte mich darum gebeten, die Krabbenbänke zu vermessen und die Fressgewohnheiten nachtaktiver Meeresbewohner nördlich der Halbinsel zu erkunden. Dabei hielt ich wie gewöhnlich auch nach Raubtieren Ausschau, die Schiffen gefährlich werden könnten. Und so befand ich mich gerade ein ganzes Stück vor der Küste in tiefem Gewässer, als ich hörte, oder besser fühlte, wie im Licht des aufgehenden Mondes Schiffskiele die Wasseroberfläche durchschnitten.
Das kam mir merkwürdig vor, da in dieser Gegend während meiner Kartierungsarbeiten gar keine Boote hätten unterwegs sein dürfen. Selbst wenn ein paar Fischer die Begrenzungsbojen ignoriert hätten, wären die Turbulenzen für ein oder zwei unerlaubte Fangschiffe viel zu stark gewesen. Also tauchte ich auf, um der Sache nachzugehen.
Während ich aufstieg, wurde mir angesichts der zahlreichen Kiele klar, dass ich es nicht nur mit ungewöhnlichem Schiffsverkehr, sondern mit einer gewaltigen Flotte von Transportschiffen unbekannter Herkunft zu tun hatte. Nachdem ich die Oberfläche durchbrochen hatte, sah ich, dass sie auf keinen Fall aus Brynt stammten. Sie waren auch nicht von raelischer oder kaurischer Machart noch von irgendeiner anderen Bauweise, die ich kannte.
Es waren Segelschiffe mit breiten Rümpfen. Und sie verfügten über Ruder, doch in diesem Moment wurden sie allein vom starken Ostwind angetrieben. Auf den Decks konnte ich keine Harpunen oder andere montierte Waffen sehen, dafür waren sie dicht bemannt mit großen schlanken Gestalten. Um den Oberkörper und an den Armen trugen sie Rüstungen, die aus Rippenknochen zu bestehen schienen.
Außerdem sah ich so etwas wie Schwerter in ihren Händen. Sie blickten geradeaus zu den Feuerschalen auf den Stadtmauern von Pelemyn und den kleineren Lampen entlang der Hafenanlagen. Zu diesem Zeitpunkt war ich mir nicht sicher, ob mir das Mondlicht einen Streich spielte, aber ihre Haut wirkte fahl, und sie hatten Totenschädel auf ihre Gesichter gemalt.
Als ich den Kopf nach rechts wandte, bemerkte ich, dass bereits einige Schiffe an mir vorbeigesegelt waren und gerade in den Hafen einfuhren. Aus dieser Entfernung und im Mondlicht sah ich nur die Segel und nicht die Besatzungen, sodass ich nicht mit letzter Sicherheit sagen konnte, ob sie eine Invasion planten. Mir war jedoch klar, dass dies keine friedliche Handelsgesandtschaft sein konnte. Schließlich würde man Frachtschiffe nicht vom Bug bis zum Heck mit bemalten Bewaffneten vollpacken.
Ich schwamm auf einer eng gebündelten Strömung zu einem der Schiffe hinüber. »Heda!«, rief ich. »Wer seid ihr? Ich bin die Tidenhüterin von Pelemyn und verlange eine Antwort.«
Jemand antwortete in einer fremden Sprache, und im nächsten Augenblick fand ich heraus, dass sie auch mit ein paar Wurfgeschossen bewaffnet waren. Dicht um meinen Kopf herum schossen drei Speere ins Wasser, und ich glaube, ich hätte nicht entsetzter sein können, wenn sie mich damit getroffen hätten. Sie waren ganz eindeutig Feinde und hatten soeben den Kriegszustand ausgelöst. Im Angesicht einer Invasionsflotte war ich dazu berechtigt – oder besser gesagt, verpflichtet –, mit den Kräften, die mein Kenning mir verlieh, Zwangsmaßnahmen und tödliche Gewalt anzuwenden.
Ich gebe zu, dass ich einen Moment brauchte, um die Situation zu verarbeiten. Ich musste noch einmal zu den Docks hinüberblicken und die wuchtigen Umrisse der Schiffe auf mich wirken lassen, um zu begreifen, was sie vorhatten. Und erst als ich mir die Worte selbst laut vorsagte, begann ich zu glauben, was hier geschah: »Das ist eine Invasionsflotte. Sie überfällt uns. Und zwar genau jetzt.«
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mein Kenning immer nur zu friedlichen Zwecken eingesetzt. Ich hatte die Laichgründe vor der Küste beaufsichtigt, die Krabbenbänke für die Fischerzunft kartiert und dafür gesorgt, dass die Strömungen die Korallenriffe mit ausreichend Nahrung versorgten. Das waren meine Aufgaben gewesen.
Doch hier und jetzt musste ich möglichst viele dieser Fremden töten, um meine Stadt zu beschützen. Es ist ein wirklich verwirrender Schritt vom Frieden hin zum Krieg. Vor allem, wenn man ihn innerhalb eines so kurzen Augenblicks vollziehen muss. Aber irgendwie half es mir, meinen Verteidigungsauftrag ebenso sehr als meine »Pflicht« zu betrachten wie meine zivilen Aufgaben.
Dadurch wurde das Ganze zwar nicht leichter für mich, aber immerhin machbar. Wenn man den »Mord« mit »Pflicht« überdeckt, wirkt er kaum noch wie ein Verbrechen. Und wenn man dann noch die Floskel »im Krieg« hinzufügt, ist der »Mord« gar nicht mehr zu sehen.
Nur auf welche Weise sollte ich diese Pflicht erfüllen? Große Wellen heraufzubeschwören und die Männer über Bord zu spülen, würde ineffizient sein und meine Kräfte zu sehr beanspruchen. Dabei würde ich sehr rasch altern und bald nutzlos sein. Besser wäre es, wenn ich konzentrierte und gezielte Strömungen verwendete, ähnlich wie die, mit denen ich mich durchs Wasser vorwärtsbewegte.
Mein erster Versuch, eines der Schiffe zum Kentern zu bringen, jagte der Besatzung zwar einen Schrecken ein, blieb jedoch ergebnislos. Im nächsten Anlauf bot ich das Dreifache der Kraft auf, die ich benötigte, um meinen eigenen Körper durchs Wasser zu bewegen, und richtete sie mittschiffs auf die rechte Seite des Kiels. Daraufhin schlug das Schiff um, und die Männer stürzten ins kalte Wasser.
Zwischen meinen Augen fühlte ich einen leichten Schmerz. Folglich kostete es mich etwas, einen derart starken Druck zu erzeugen, aber nicht sehr viel.
Während ich mich von einer Strömung vorwärtstragen ließ, zückte ich mein Messer aus schwarzem Vulkangestein. Es stammte aus der Glaswüste, wo ich es aus einem der erkalteten Magmaströme herausgebrochen hatte, und eignete sich ideal für den Gebrauch im Wasser. Auf dem Weg zur anderen Seite des Rumpfes, wo bereits das nächste Schiff auf mich wartete, schwamm ich zwischen den unnatürlich groß gewachsenen Invasoren hindurch und schnitt ihnen tief in Arme und Beine. Den Rest würden die Schwertflossen für mich erledigen, die das Blut im Wasser unweigerlich anlockte. Ich rechnete mit einer wahren Fressorgie.
Während ich die hünenhafte Besatzung des nächsten Schiffes ins Meer kippte, wurde ich mir der wahren Größe dieser Streitmacht bewusst. Dass ich zitterte, hatte nichts mit dem kalten Wasser zu tun. Das hier war kein kleiner Stoßtrupp, sondern eine ausgewachsene Armee, die aus mehreren Tausend Kriegern bestand. Genug, um die Stadt dem Erdboden gleichzumachen.
Wäre ich nicht hier im Wasser, sondern zu Hause im Bett gewesen, hätten es die meisten oder vielleicht sogar alle von ihnen an Land geschafft, bevor ich etwas gegen sie hätte unternehmen können. Ich konnte nur hoffen, dass die Matrosen, die heute Nacht Wache schoben, mit sämtlichen Angreifern fertigwerden würden, die an mir vorbeischlüpften.
Nach dem zweiten Schiff schoss ich durch die Wellen zum Hafen von Pelemyn zurück, wo ich mich um die Vorhut der Flotte kümmerte. Je weniger anlandeten, desto besser. Von dort aus arbeitete ich mich nach hinten durch, wobei ich immer das jeweils vorderste Schiff versenkte. Selbst wenn ein paar der Invasoren ans Ufer schwimmen könnten, wären sie bei der Erstürmung der Stadtmauern unterkühlt, geschwächt und entmutigt. Außerdem würden sie nicht mehr in einer geschlossenen Front, sondern nur noch einzeln oder bestenfalls in kleinen Gruppen angreifen können.
Als ich mich dem Hafen näherte, sah ich, dass drei Schiffe angelegt hatten und gerade eine kleine Horde Knochengiganten mit erhobenen Schwertern an Land stürmte. Damit bestand nicht mehr der geringste Zweifel an ihren Absichten. Am liebsten wäre ich an Land gegangen und hätte bei der Verteidigung geholfen oder zumindest Alarm geschlagen, aber ich wusste, meine wichtigste Aufgabe würde es sein, die restlichen Giganten von der Küste fernzuhalten.
Jedes Schiff, das ich zum Kentern brachte, verschlimmerte den Schmerz zwischen meinen Augen, und nach dem dritten war ich bereits ziemlich ausgelaugt. Nach dem fünften hatten die Schwertflossen und andere Räuber die Witterung des Blutes aufgenommen und führten zu Ende, was ich begonnen hatte. Das Blut, das sie dabei vergossen, lockte wiederum weitere Artgenossen an. Sie würden sämtliche Krieger auffressen, die ich ins Wasser befördern konnte.
Auch ich musste ein paar Schwertflossen ausweichen, aber keines der Tiere unternahm einen zweiten Angriffsversuch, wo es doch jede Menge leichtere Opfer gab, die im Wasser herumzappelten und förmlich darum bettelten, gefressen zu werden.
Und sie wurden gefressen. Die meisten der Invasoren schrien unter Wasser, aber ich konnte sie dennoch hören. Ihr verzerrtes Kreischen drang an meine Ohren, wenn sie zwischen die Kiefer der Schwertflossen gerieten. Ihre abgebissenen Gliedmaßen und Eingeweide trieben in roten Wolken. Jeder einzelne Blutstropfen war ein Lockruf für alle Meeresgeschöpfe mit mehr Zähnen als Verstand. Was ich sah und hörte, tat mir weh, weil ich sogar zu diesem Zeitpunkt noch Zweifel hatte, ob ich das Richtige tat. Ob wir diesen Konflikt wohl hätten vermeiden können, wenn wir dieselbe Sprache gesprochen hätten?
Sie waren nicht gekommen, um zu reden. Das sagte mir meine Disziplin, die so stark und unerschütterlich wie die Klippen von Setyrön war. Doch allmählich drohte ich unter meinen Schuldgefühlen zu zerbrechen, während ich ein Schiff nach dem anderen umwarf und immer mehr wild um sich schlagende Männer japsend im Meer versanken – und starben.
Zudem kostete es mich jedes Mal Tage meines Lebens, wenn ich dem Wasser meinen Willen aufzwang. Der Verlust geschah so unsichtbar wie der Sog der Gezeiten – aber auch spürbar und furchterregend, wie es sich für Naturgewalten gehört.
Beschleunigte Alterung ist der Preis, den ich für meine Gabe zahlen muss, und als ich zum ersten Mal aus Bryns Lunge herausgeschwommen war, hatte ich mir geschworen, dass ich es niemals bereuen würde, wenn ich mein Kenning zur Verteidigung meines Landes einsetzen musste. Aber die siebenundneunzig versenkten Schiffe und der stechende Schmerz in meinem Kopf quälten mich.
Meiner Schätzung nach hatten sich an Bord eines jeden Schiffes mehr als hundert Krieger befunden. Wer immer diese hochgewachsenen Fremden waren, sie hatten uns ohne jede Vorwarnung mit zehntausend Mann angegriffen. Und soweit ich wusste, auch ohne vorhergehende Provokation. Wenn ich nicht zufällig gerade im Dienst gewesen wäre, hätten sie uns vernichtend geschlagen.
Schließlich kenterte das letzte Schiff, und die blassen Gestalten an Deck schrien auf, weil sie wussten, was all den anderen vor ihnen zugestoßen war. Und was in der Tiefe auf sie lauerte. Danach trat ich einen Moment lang mit bloßer Muskelkraft Wasser, weil ich all mein Kenning aufgebraucht hatte und nun erschöpfter war als je zuvor in meinem Leben.
Allem Anschein nach war ich ganz schön weit draußen, da ich nicht mal mehr die Feuerschalen von Pelemyn erkennen konnte. Um zum Hafen zurückzugelangen, würde ich mir einen Weg durch das Fressgelage der Schwertflossen bahnen müssen. Aber das war immer noch besser, als den Kraken auszuweichen, die es ebenfalls zu all dem Blut hinzog. An dieser Stelle war das Meer so tief, dass ich mir wegen dieser Ungeheuer Sorgen machen musste. Tatsächlich erkannte ich an den Strömungen unter mir, dass bereits einer auf dem Weg herauf war.
Während ich darüber nachdachte, fragte ich mich, wie eine derart große Flotte den Ozean hatte überqueren können, ohne den Kraken zum Opfer zu fallen. Wenn ich die Schiffe an der Oberfläche hatte spüren können, dann dürften sie den Kraken doch wohl kaum entgangen sein.
Auf dem Weg zurück zur Küste hielt ich mich dicht über dem Meeresgrund, um unter dem Gelage der Raubtiere wegzutauchen. Dennoch stieß ich dort unten immer wieder auf Spuren des Gemetzels. Wie zum Beispiel eine Krabbe, die mit einer blassen abgebissenen Hand in den Scheren über den Boden huschte. Diese Hand hatte einem Mann gehört, der Freunde mit ihr begrüßt hatte. Und seine Mutter berührt. Vielleicht hatte er mit dieser Hand auch seiner Liebsten Geschenke gegeben oder sie jemandem zur Entschuldigung gereicht. Jetzt diente sie nur noch als Nahrung für ein krabbelndes Meerestier. Und dafür trug ich die Verantwortung. Für insgesamt neuntausendsiebenhundert Tote, wenn meine Schätzung stimmte. Alles im Namen der Pflicht. Und damit war es kein Mord.
Laut Protokoll musste ich umgehend dem Pelenauten Bericht erstatten, nachdem ich tödliche Gewalt angewendet hatte. Also würde ich die unter Wasser gelegenen Lungenschleusen durchqueren, um vom Hafen zur Quelle der Stadt zu gelangen. Als ich kurz den Kopf aus dem Wasser reckte, um zu sehen, was im Hafen passierte, fiel mein Blick sofort auf ein paar tote Matrosen und Bürger, die auf den Holzstegen lagen.
Im Licht der Feuerschalen beobachtete ich den Kampf um die Stadtmauern … Die Angreifer benötigten keine Belagerungstürme oder Leitern, um sie zu erstürmen. Stattdessen kletterten die dämonischen Giganten beängstigend schnell wie Schneespinnen aneinander hoch. Nur dass sie im Gegensatz zu Spinnen Schwerter hielten.
Als ich sah, wie sie oben auf den Zinnen unsere Matrosen attackierten, bekam ich es mit der Angst zu tun. Was, wenn allein diese dreihundert Angreifer ausreichten, um unsere Stadt einzunehmen? Einer von ihnen, der nichts als Knochen und Lumpen am Leib trug, streckte einen Matrosen nieder, indem er ihm mit einem einzigen Schlag erst den Schild durchhackte und dann den Schädel unter dem Helm zerschmetterte.
So etwas war mir noch nie untergekommen. Was für eine Kraft! Ihre Waffen erinnerten an Schwerter, weil sie aus Klingen bestanden, die an Griffen befestigt waren. Doch Schwerter wie diese hatte ich noch nie zuvor gesehen. Die Klingen waren an einer Seite scharf und verbreiterten sich zur Spitze hin. Im Profil ähnelten sie Bergen auf Kinderzeichnungen, mit flach auslaufenden Hängen. Diese Waffen aus solidem Stahl und die überlegene Reichweite ihrer Arme verschafften ihnen einen tödlichen Vorteil. Bislang hatten es nur ein paar von ihnen die Mauer hinaufgeschafft, aber diese wenigen mähten die Matrosen nieder wie Weizenhalme. Und es strömten immer mehr von ihnen nach.
Ich war drauf und dran, aus dem Wasser zu steigen und nach Kräften bei der Verteidigung zu helfen, aber anscheinend hatte inzwischen irgendjemand in der Garnison Alarm geschlagen, denn nun sah ich, wie an der südlichen Mauer ein Trupp Bogenschützen in Stellung ging. Sie feuerten eine Salve ab, und die Giganten, deren dürftige Rüstungen wenig Schutz gegen Pfeilspitzen boten, gingen zu Boden. Eine zweite Salve bohrte sich in den Fuß der lebenden Leiter und ließ sie in sich zusammenstürzen. Diese Giganten würden die Mauer nicht mehr erklimmen. Voller Zuversicht, dass die Verteidiger die Lage nun im Griff hatten, tauchte ich ab und schlüpfte durch die Lungenschleusen.
Als ich das nächste Mal die Oberfläche durchbrach, befand ich mich in der Quelle hinter dem Korallenthron – in einer relativ ruhigen Ecke des Pelenautbeckens. Am Ausstieg des Beckens hielt eine Matrosin Wache. Obwohl alle, die nicht von Bryn gesegnet waren, beim Versuch, die Schleusen zu überwinden, ertrinken würden. Im ersten Moment erkannte sie mich nicht und richtete ihren Speer auf mich. Als ich sie zur Begrüßung erschöpft anlächelte, hob sie jedoch die Waffe und entschuldigte sich.
»Wir stehen hier alle unter großer Anspannung, Gerstad«, sagte die Wächterin. Sie sprach mich mit meinem militärischen Rang anstelle meines Kenning-Titels an.
»Und das ist auch gut so«, entgegnete ich und tropfte einen Augenblick lang den Boden voll, bis ich mit einem Gedanken das Wasser von meiner Haut abgleiten und ins Becken zurückfallen ließ. »Ich muss entweder dem Pelenauten oder der Lunge Bericht erstatten. Kann ich einen oder sogar beide sprechen?«
»Selbstverständlich. Ich darf im Moment leider meinen Posten nicht verlassen, aber geht bitte einfach durch.«
»Danke sehr. Eine Frage noch: Wie alt bin ich?«
»Wie bitte?«
»Wie alt sehe ich aus?«
Die Matrosin zuckte unsicher mit den Schultern. »Mitte dreißig?«
Ich war erleichtert. Wie Mitte dreißig hatte ich auch schon zu Beginn meiner Schicht ausgesehen. Nun, vielleicht eher wie Anfang dreißig, aber Mitte dreißig war nicht schlimm. Allerdings fühlte ich mich älter und langsamer und sehnte mich nach einer Tasse Tee und zwei oder drei Tagen ungestörten Schlafs. Aber das würde noch warten müssen.
Ich ging den kurzen Gang entlang. Der Zulauf des Beckens lag zu meiner Rechten. Als ich um die Ecke bog, sah ich den Pelenauten unruhig vor seinem Thron und der Wasserwand auf und ab laufen. Auch die Lunge war da sowie ein paar Militärs, die im Rang über mir standen – darunter sogar der Könstad. Die restlichen Anwesenden kannte ich nicht.
Der Pelenaut bemerkte mich, ehe ich etwas sagen oder salutieren konnte. »Ah! Gerstad Tallynd du Böll«, schnitt er der Lunge, die gerade gesprochen hatte, das Wort ab. »Ich bin froh, dass Ihr hier seid! Was habt Ihr uns zu berichten?«
Ich beschrieb, was ich getan hatte – und auch die Gründe für meine Entscheidung. Dabei achtete ich in den Gesichtern der Anwesenden auf Zeichen von Missbilligung. Aber ich konnte nicht feststellen, ob ich mich in ihren Augen richtig verhalten hatte. Ihre Mienen glichen steinernen Masken, und ich wusste nicht genau, was draußen los war. Waren ein paar der Giganten in die Stadt eingedrungen?
»Ich danke Euch, Gerstad«, sagte Pelenaut Röllend, als ich fertig war. Dann wandte er sich zur Seite. »Könstad du Lallend?«
»Ja?«
»Bitte beschafft mir die neuesten Gefallenenzahlen und schickt die Schnellen los. Die Gerstad und ich werden uns derweil einen Moment unterhalten.«
Er bedeutete mir, ihm zu folgen, und führte mich auf dem Weg, den ich herein genommen hatte, zu seinem Becken hinter dem Thron. Die Matrosin, die dort Wache hielt, ließ er wegtreten und wartete ab, bis wir ungestört waren. Dann nahm er mich zu meiner großen Überraschung in die Arme.
»Ihr allein habt Pelemyn heute gerettet«, sagte er. »Ich danke Euch. Ich selbst war bis gerade eben im Bett und hätte sie nicht aufhalten können.«
»Normalerweise hätte ich auch geschlafen.«
»Wir hatten ohne Frage großes Glück. Ihr seid sicher müde, Tallynd, aber darauf kann ich im Moment leider keine Rücksicht nehmen. Es gibt noch so viel zu erledigen.«
Von der Aussicht auf noch mehr Wassergewirk bekam ich rasende Kopfschmerzen, aber ich versuchte, keine Miene zu verziehen und mir auch nichts an der Stimme anmerken zu lassen. »Natürlich, Pelenaut Röllend. Was kann ich tun?«
»Ich befürchte, wir waren nicht das einzige Ziel. Ich muss möglichst rasch erfahren, ob noch weitere Städte überfallen wurden. Und falls sie bis jetzt verschont geblieben sind, müssen wir sie vor einem möglichen Angriff warnen.«
»Soll ich nach Gönerled?«
»Nein, dorthin schicke ich ein paar Schnelle. Ihr müsst nach Festwyf, und zwar so schnell wie möglich.« Er sah, wie ich bei diesen Worten vor Angst schluckte. »Ich weiß, dass ich sehr viel von Euch verlange.«
Er bat mich, so schnell durchs Wasser zu schlüpfen, dass ich eins mit dem Element werden würde. Dabei würde ich Jahre meines Lebens verlieren. Ich hatte meinen Söhnen zwar oft gesagt, dass dieser Tag einmal kommen könnte, dennoch bezweifelte ich, dass sie es wirklich verstanden hatten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits einiges an Lebenszeit eingebüßt, und niemand vermochte zu sagen, wie viel älter ich bei meiner Rückkehr sein würde.
»Es ist Euer Recht, das von mir zu verlangen«, antwortete ich. Und sobald ich den ersten Schock überwunden hatte, sah ich ein, dass es unumgänglich war. Vermutlich war die Stadt nur zu retten, wenn ich sie rechtzeitig vorwarnte. »Darf ich Euch im Gegenzug um einen kleinen Gefallen bitten?«
»Natürlich.«
»Kümmert Euch bitte um meine Söhne, solange ich weg bin. Wir haben ausgemacht, dass ich rechtzeitig zurückkomme, um sie in die Schule zu bringen, und wenn ich nicht da bin …« Die beiden hatten bereits aufwachen und erfahren müssen, dass ihr Vater gestorben war. Ein weiteres Erlebnis dieser Art wollte ich ihnen ersparen. Sie würden sich so oder so Sorgen machen, aber vielleicht konnte sie ja jemand beruhigen.
»Wird gemacht«, sagte er.
»Ich danke Euch. Und …« Ich brachte die Worte nicht über die Lippen. »Egal. Wir haben keine Zeit zu verlieren.«
»Nein, sprecht weiter. Eine zusätzliche Frage habt Ihr Euch allemal verdient. Und auch eine Beförderung, sobald wir wieder Zeit für so etwas haben.«
»Wisst Ihr, wer sie sind? Oder warum sie uns angegriffen haben?«
Der Pelenaut schüttelte den Kopf. »Ich habe noch nie von ihnen gehört. Bislang habe ich sie noch nicht einmal mit eigenen Augen gesehen, aber nach allem, was ich höre, sind es ganz bestimmt keine Hathrim.«
»Nein. Sie ähneln keinen der Giganten, die wir kennen.«
Der Pelenaut zuckte ratlos mit den Schultern. »Ich hatte keine Ahnung, dass es sie gibt. Daher frage ich mich, woher sie kommen und wie sie von unserer Existenz erfahren haben.«
»Dann versiegle ich meine Fragen in einem Krug und öffne ihn nach meiner Rückkehr. Mögen Euch die Strömungen gewogen sein, Pelenaut Röllend.«
»Das wünsche ich Euch auch, Gerstad du Böll.«
Wenige Minuten später war ich bereits wieder im Meer und hielt mich in nördlicher Richtung. Wie üblich schlüpfte ich durchs Wasser, indem ich es vor mir zur Seite schob und es an meinem Körper entlang nach hinten gleiten ließ. Aber diesmal stieß ich so fest, dass aller Widerstand verschwand und ich selbst zu einem Teil des Meeres wurde. Meine Uniform entglitt mir und blieb trudelnd in meinem Kielwasser zurück. Ich wurde zur Flut, die auf die Stadt Festwyf zurollte, wo sich der Fluss Grabwasser durch den neu gebauten Schleusenkanal in den Ozean ergießt.
Diese Art zu reisen kostete mich sehr viel Lebenszeit – und auch andere, weniger wichtige Dinge wie mein Glasmesser. Erst als ich auf Süßwasser stieß, erwachte ich aus meiner Gezeiten-Trance. Während ich langsamer wurde, spürte ich in meinen Organen und den Knochen das schmerzhafte Ziehen eines verlorenen Jahres – vielleicht auch mehrerer – und tauchte auf.
Festwyf lag so ruhig da, dass ich einen Moment lang hoffte, hier wäre alles in Ordnung. Auf den Mauern und am Hafen brannten die Feuerschalen. Ganz so, wie es sein sollte. Als ich jedoch genauer hinsah, entdeckte ich Leichen, die in der Nähe dieser Lichtquellen über den Zinnen hingen. Der Fluss war dunkel von Blut, und nicht weit vom Hafen entfernt schaukelten Leichen in den Strömungswellen. Als ich zu den Anlegestellen blickte, sah ich dort eine Flotte der Gigantenschiffe, die in einer langen Reihe bis zum offenen Meer vor Anker lagen.
Aber ich vernahm keine Schreie oder Kampfgetöse und hörte auch nichts, was auf eine Siegesfeier hindeutete. Genau genommen drangen überhaupt keine Geräusche aus der Stadt. Nur das Plätschern der Wellen war zu hören, und zum allerersten Mal in meinem Leben empfand ich es nicht als tröstlich.
An der Hafenmauer zog ich mich aus dem Wasser. Da hier alle tot waren, musste ich mir über Sitte und Anstand wohl kaum den Kopf zerbrechen. Überall um mich herum lagen die Leichen von Bryntern und Giganten. Die Brynter waren jedoch deutlich in der Überzahl. Die Giganten hatten Festwyf ebenso überrascht wie Pelemyn, nur dass hier kein Tidenhüter stationiert war, der sie am Anlegen hatte hindern können. Von Pelenaut Röllend abgesehen, gab es im Süden bloß noch zwei weitere Tidenhüter, in Setyrön und Hillegöm, und ich konnte nur hoffen, dass sie wie ich zur rechten Zeit auf dem Posten sein würden.
Ich kniete mich neben einen Eindringling, dem drei Pfeile aus der Brust ragten, und begann, ihn und seine Kameraden eingehender zu mustern. Bislang hatte ich dazu noch keine Gelegenheit gehabt. Sie waren teigig aussehende Männer, allesamt zwischen sieben und neun Fuß groß, und hatten sehnige Muskeln. An den Beinen trugen sie weder Rüstungen noch Hosen, was ich ein wenig obszön fand. Unter ihre Fußsohlen war irgendein grobes Fasermaterial geschnürt. Um ihre Lenden hatten sie Stoffstreifen gewickelt, und darüber trugen sie einfache, an der Taille gegürtete Unterhemden. Vor Brust und Rücken hatten sie sich Matten aus flachen Rippenknochen geschnallt. Diese Rippen waren zu groß und zu breit, um von Menschen zu stammen, wie ich ursprünglich befürchtet hatte. Über ihre Schultern und um die Oberarme hatten sie ähnliche, wenn auch kleinere Knochen gebunden.
Sie trugen keine Helme, aber nicht, weil es ihnen an Stahl mangelte. Ihre Schwerter waren solide gefertigt. Bis auf die Griffe, die nicht mit Leder, sondern mit fadenscheinigem Stoff umwickelt waren. Da erst fiel mir auf, dass sie überhaupt kein Leder trugen. Sogar ihre Gürtel bestanden aus geflochtenen Fasern.
In Gedanken setzte ich das auf die wachsende Liste der Dinge, die mir an diesen Giganten widersprüchlich erschienen: Obwohl sie lediglich über grob gezimmerte Schiffe verfügten, waren sie so versierte Seefahrer, dass sie im Verlauf einer einzigen Nacht an verschiedenen Orten einen koordinierten Angriff durchführen konnten. Aber wieso ließen sie ihre Schiffe verwaist an den Ankertauen liegen? Wo waren die Invasoren jetzt?
Ich hob das Schwert des Giganten auf. Es war zwar ein wenig schwer für mich, aber vielleicht würde es sich noch als nützlich erweisen. Dann ging ich barfuß über den Holzsteg auf die Stadtmauer zu. Niemand stellte sich mir in den Weg. Die Tore standen weit offen und gaben den Blick auf die Leichen frei, die aufgehäuft dalagen und in den Himmel hinaufstarrten – viele von ihnen in unnatürlich verrenkten Posen, die kein lebender Mensch einnehmen konnte. Und ich wusste, dass sich mir überall in der Stadt der gleiche Anblick bieten würde.
Hin und wieder stieß ich auf beleuchtete Gebäude, von denen ich ein paar untersuchte. Aber anstelle von Überlebenden fand ich jedes Mal nur die niedergemetzelten Bewohner im Schein unbeaufsichtigter Kerzen oder herunterbrennender Feuer. Die Oberhäupter dieser Stadt trieben dicht an dicht in der Quelle.
Mir fiel auf, dass viele Menschen in ihren Betten erschlagen worden waren. Bryn steh uns bei, sie hatten selbst die Kinder ermordet. Die Giganten hielten also nichts davon, die Bevölkerung mit Kriegsgeheul aufzuwecken. Gut möglich, dass die Bewohner Pelemyns, die weit entfernt von der Hafenmauer lebten, vom Angriff auf unsere Stadt noch gar nichts mitbekommen hatten.
Ich überlegte, was ich bislang in Pelemyn und Festwyf gesehen hatte: Die Giganten griffen jeden an, den sie sahen. Darüber hinaus schienen sie jedoch keine klaren militärischen Ziele zu verfolgen. Sie beluden ihre Schiffe nicht mit Plündergut, also waren sie nicht hinter unserem Wohlstand her. Aber genauso wenig wollten sie erobern und uns beherrschen. Stattdessen waren sie gekommen, um uns auszulöschen. Und es hatte weder Drohgebärden noch wütendes Toben oder auch nur einen Hauch von Diplomatie gegeben, bevor sie anfingen, uns mit ihren Klingen das Fleisch zu zerschneiden und die Knochen zu zertrümmern.
»Womit haben wir das verdient?«, fragte ich mich fassungslos. »Warum wollen sie uns alle abschlachten?« Ich stellte die Frage laut, aber die Toten gaben mir keine Antwort.
Vielleicht gab es ja irgendwo noch ein paar Verstecke mit Überlebenden – ich hoffte inständig, dass dem so war –, aber ich befand mich nicht auf einer Rettungsmission. Meine Aufgabe war es, die Giganten aufzuspüren, und die waren bereits weitergezogen. Also musste auch ich weiter, obwohl ich im Moment nichts lieber getan hätte, als hierzubleiben und um die Toten zu weinen.
Ich kehrte zum Grabwasser zurück, wo ich mitsamt dem Gigantenschwert in die Fluten sprang und flussaufwärts schlüpfte. Unterwegs hielt ich den Kopf über Wasser und ließ das südliche Ufer nicht aus den Augen. Auf dieser Seite verlief die Handelsstraße. Sie war so breit, dass eine Armee in zügigem Tempo auf ihr vorankommen konnte.
Ungefähr sechs Meilen weiter entdeckte ich die Giganten. Sie waren gerade dabei, im Mondlicht und Fackelschein ein Lager aufzuschlagen, und ich sah, dass sie die Speisekammern der Stadt geplündert hatten und einen beeindruckenden Tross aus Wagen hinter sich herzogen, die sie ebenfalls aus Festwyf gestohlen hatten.
Es war mir nicht möglich, sie zu zählen, aber ich war sicher, dass es viele Tausende sein mussten, und sie erstreckten sich ein ganzes Stück am Flussufer entlang. Offenkundig hatten sie vor, in hohem Tempo die Handelsstraße entlangzumarschieren und nacheinander alle Städte am Fluss zu überfallen. Sie führten keine Belagerungswaffen mit und benötigten sie auch nicht, da sie sich auf das Überraschungsmoment und ihre Überzahl verlassen konnten.
Meine Befehle lauteten, die Lage in Festwyf zu erkunden und herauszufinden, wo die Armee war. Streng genommen hatte ich meinen Auftrag also bereits erledigt und hätte nun heimkehren sollen. Doch der Pelenaut hatte mich auch angewiesen, Festwyf, wenn möglich, zu alarmieren. Das war nun zwar nicht mehr möglich, aber dafür war ich im Moment die Einzige, die Fornyd eventuell noch rechtzeitig vor der heranrückenden Armee warnen konnte.
Ich hatte keine Ahnung, wer Fornyd im Namen des Pelenauten verwaltete, doch er oder sie würde wahrscheinlich Beweise für meine Behauptungen einfordern – trotz meines Kennings und der Tatsache, dass der Pelenaut mich schickte. Hoffentlich würde das Schwert, das ich aus Festwyf mitgenommen hatte, genügen.
Ich schwamm vom Ufer weg und in die Mitte der Strömung, wo ich schneller vorankommen würde. Aber als ich gerade damit beginnen wollte, wieder flussaufwärts zu schlüpfen, hörte ich einen überraschten Aufschrei.
Ich fuhr herum und erspähte einen dieser Unholde, der mit offenem Mund an der Uferböschung stand und in das fließende Wasser urinierte. Sein Gesicht mit dem aufgemalten Totenschädel glotzte mich ungläubig an. Ich hätte einfach weiterschwimmen können – und vielleicht wäre das auch besser gewesen –, doch stattdessen wurde dieser Feind zur Zielscheibe meiner aufgestauten Wut über alles, was ich in Festwyf gesehen hatte. Ich wollte dafür jemanden zur Rechenschaft ziehen, und er war dort gewesen. Er hatte sich an dem Gemetzel beteiligt, und jetzt stand er hier vor mir.
»Du hast so viel Blut vergossen«, knurrte ich ihm durch zusammengebissene Zähne zu, obwohl ich nicht wusste, ob er mich überhaupt verstand. »Jetzt wirst du darin ertrinken!«
Sein Körper bestand zum größten Teil aus Wasser, so wie der aller Lebewesen. Also konzentrierte ich mich auf die kleinen Flüssigkeitseinlagerungen zu beiden Seiten seiner Brust und zog ein kleines bisschen an ihnen. Im nächsten Moment ergoss sich Blut aus den Gefäßen in seine Lungenflügel und füllte sie mit jedem Schlag seines Herzens. Er versuchte noch einmal zu schreien, brachte jedoch nur ein feuchtes Husten zustande. Zuletzt gab er einen gurgelnden Laut von sich und brach tot zusammen. Ich wartete darauf, dass ich mich nun besser fühlen würde … dass mein Hunger nach Gerechtigkeit befriedigt sein würde. Aber vergeblich. Es war nicht meine Pflicht gewesen, dieses Leben im Zorn auszulöschen. Und ich bereue es noch heute, auch wenn er den Tod wahrscheinlich verdient hatte.
Auf dem Weg flussaufwärts bewegte ich mich langsamer als zuvor, da ich die Umgebung erkunden wollte. Unterwegs hielt ich dreimal an, um Händler in ihren Zeltlagern am Ufer aufzuwecken. Ich rief ihnen zu, dass sie sich sofort nach Fornyd begeben sollten, weil sie andernfalls von einer Armee niedergemetzelt würden. Sie stellten meine Autorität nicht infrage. Immerhin trieb ich im Fluss, ohne von seiner Strömung bewegt zu werden oder sichtbar gegen die Fluten anzuschwimmen. Und sie wussten, dass eine Tidenhüterin nur wegen eines echten Notfalls aus dem Wasser auftauchen würde.
Im Morgengrauen erreichte ich schließlich den Hafen von Fornyd. Als ich die Stadt mit den Augen eines Eroberers betrachtete, sah ich in ihr einen fetten Fisch, der fast widerstandslos in meinen Suppentopf springen würde. Im Vergleich zu den Befestigungen der Küstenstädte waren die Mauern hier weder besonders hoch noch dick. Bei einem Überraschungsangriff würde Fornyd rasch fallen. Vielleicht sogar, wenn die Stadt vorgewarnt war. Die Giganten würden die Mauern im Nullkommanichts einnehmen, und ihre Armee zählte vermutlich mehr Krieger, als insgesamt Bürger in der Stadt lebten. Fornyd war eher ein aufstrebender Marktflecken als eine richtige Stadt, ein Warenumschlagplatz für die Bauern aus dem Süden, Osten und Westen.
Die Lungenschleusen waren schon seit Jahren nicht mehr benutzt worden – vielleicht seit meinem letzten Besuch nicht mehr, als ich eine junge Tidenhüterin gewesen war und meine Antrittsrunde durch den Fluss gemacht hatte. Sie waren mit Sedimenten verkrustet, und es erforderte einige Kraft, die äußere Luke zu öffnen. Im Inneren waren die Schleusen jedoch ungewöhnlich sauber. Auf jeden Fall sauberer als die von Pelemyn, die häufig benutzt wurden. Der schläfrige Matrose, der am anderen Ende der Schleuse Wache hielt, war sehr überrascht, als ich vor ihm erschien. Er sprang auf und stieß einen wenig würdevollen Laut aus, ehe er sich daran erinnerte, dass er angemessen reagieren sollte, falls jemals ein Tidenhüter auftauchte.
»Ich, ähm. Verzeihung, Matrosin. Äh, Tidenhüterin, wollte ich natürlich sagen. Entschuldigung. Was kann ich für Euch tun?«
»Ich bin so schnell geschlüpft, wie ich konnte, und bringe wichtige Neuigkeiten. Könntest du mir bitte einen Umhang reichen?«
»Oh! Ja! Selbstverständlich! Entschuldigt bitte!« Er drehte sich zur Wand um, wo für genau solche Gelegenheiten ein Umhang hing. Dann nahm er ihn vom Haken und reichte ihn mir, wobei er den Blick höflich abgewandt hielt. Nachdem ich aus dem Becken gestiegen war und mir das Kleidungsstück übergestreift hatte, führte er mich zur Quelle und bat mich zu warten, während er die Quartiermeisterin der Stadt verständigte. Da es recht früh war, vermutete ich, dass sie noch schlief.
Doch kaum eine Minute später war sie bereits da. Eine Frau in den Vierzigern, die das Haar so kurz trug wie ich. Sie hatte sich hastig einen blauen Morgenrock übergeworfen und rieb sich den Schlaf aus den Augen, neugierig, was ich zu sagen hatte. Sie war mir sofort sympathisch. Andere hätten mich warten lassen.
»Um was geht es?«
»Ich bin Gerstad Tallynd du Böll und komme auf Befehl des Pelenauten«, stellte ich mich vor.
»Quartiermeisterin Farlen du Canym. Welche Nachrichten bringt Ihr uns?«
Ich hielt die Klinge in die Höhe. »Während wir sprechen, befinden sich ungefähr zehntausend Giganten mit solchen Schwertern auf dem Weg hierher. Festwyf ist bereits gefallen, und Ihr seid als Nächstes dran.«
Sie erschauderte und sah mich kurz mit geweiteten Augen an, ehe sie sich wieder fasste und die Hände verschränkte. »Die Hathrim sind hierher unterwegs?«
»Nein, das sind keine Hathrim. Sie sind nicht größer als neun Fuß und stammen von jenseits des Meeres. Solche wie sie haben wir noch nie zuvor gesehen.«
Ich schilderte ihr, was während der Nacht geschehen war, und schlug vor, dass sie außer den Bürgern von Fornyd auch die anderen Flussstädte und vielleicht sogar Rael alarmierte. Pelemyn würde für alle, die nicht bleiben wollten, eine sichere Zuflucht sein. Da die Lage noch unübersichtlich war, konnte ich nicht für die anderen Städte sprechen, aber ich war davon überzeugt, dass Pelenaut Röllend in meiner Abwesenheit in Pelemyn für Sicherheit sorgte.
»Setzt Bogenschützen und, wenn nötig, auch Speerträger ein«, sagte ich. »Haltet sie auf Distanz, da sie euch im Nahkampf mit ihrer Kraft und diesen Waffen überlegen sind. Dieses Schwert hier lasse ich Euch da, damit Eure Matrosen es sich ansehen können.«
»Ihr lasst es da? Ihr geht weg?« Ich glaubte fast, einen Anflug von Panik in ihrer Stimme zu hören. Allerdings hatte ich nicht den Eindruck, dass sie jemand war, der sich schnell erschüttern ließ. Vielleicht war es ja auch nur Stress, wofür ich großes Verständnis hatte.
»Ich muss dem Pelenauten Meldung erstatten und von Festwyf berichten. Ich werde ihm sagen, dass ich Euch gewarnt habe und dass Ihr hoffentlich die anderen Flussstädte benachrichtigen werdet.«
»Natürlich, darauf könnt Ihr Euch verlassen. Aber … ich habe hier nur sehr wenige Matrosen, und kaum einer von ihnen ist gesegnet – abgesehen von einer Handvoll Schnellen. Gegen zehntausend Angreifer haben wir nicht den Hauch einer Chance.«
»Ich weiß, Quartiermeisterin. Aber diesen Krieg müsst ihr auch nicht allein gewinnen. Pelenaut Röllend würde das nie von euch erwarten. Die Ereignisse überschlagen sich gerade, sodass euch niemand helfen kann, und ich bin sicher, dahinter steckt Absicht. Sie rücken so schnell vor, um die einzelnen Städte unvorbereitet zu treffen. Aber Ihr habt jetzt die Chance, viele Menschen zu retten. Tötet ein paar Angreifer, wenn Ihr könnt. Meiner Meinung nach solltet Ihr aber ernsthaft über eine Evakuierung nachdenken. Wenn die Giganten hier genauso vorgehen wie in Festwyf, werden sie die Stadt intakt lassen und lediglich die Lebensmittelvorräte plündern. Sie haben keine Reiterei und kennen die Umgebung nicht so gut wie Ihr. Sie marschieren bloß die Straße entlang und töten jeden, der sich ihnen entgegenstellt. Ich rate Euch also, ihnen aus dem Weg zu gehen.«
Sie nickte und stieß den angehaltenen Atem aus. »Ich verstehe, Gerstad. Wenn die Flut kommt, sollte man sich auf eine Anhöhe begeben.«
Da wusste ich, dass Fornyd in guten Händen war. »Genau. Und eine Flut ist nichts anderes als Bryns Ermahnung, dass wir solider bauen müssen. Sobald sie wieder abgeflossen hat, werden wir alles neu errichten.« Ich verbeugte mich. »Und wenn ich einen Vorschlag machen darf: Tarnt alle Brunnen. Lasst sie aus dem Grabwasser trinken. Da sie nicht von hier sind, haben sie vermutlich keine Ahnung, woher der Fluss seinen Namen hat. Wahrscheinlich wissen sie noch nicht mal, wie er heißt.«
Sie sah mich überrascht an. »Oh! Ja, das werden wir tun.«
»Mögen Euch die Strömungen gewogen sein.«
»Das wünsche ich Euch auch.«
Noch bevor ich den Raum verließ, rief sie nach ihren Bogenschützen und Brandungsleuten. Ich hängte indes den Umhang wieder an den Haken und tauchte durch die Schleusen zum Grabwasser, wo ich erneut meine fleischliche Gestalt aufgab und zu einem Teil der Strömung wurde, mit der ich nach Pelemyn zurückfloss.
Es war Vormittag, als ich die Lungenschleusen zum zweiten Mal an diesem Tag durchquerte. Die Matrosin, die bereits in der Nacht Wache gehalten hatte, war immer noch da. Sie wirkte besorgt, als sie mir aus dem Becken half.
»Was ist los?«, fragte ich mit rauer Stimme. »Wie schlimm ist es?« Während ich das Wasser von meiner Haut abperlen ließ und die Matrosin mir einen Umhang um die Schultern legte, bekam ich einen Hustenanfall. Alles tat mir weh. Ein stechender Schmerz schoss durch meinen Bauch, als steckte eine Harpune in meinen Eingeweiden. Meine Finger und Zehen fühlten sich wie Nadelkissen an, und mein Rückgrat schien von einem Schraubstock zusammengepresst zu werden. Ich hatte nicht mehr genug Kraft im Rücken und den Beinen, um aufrecht zu stehen. Zunächst kniete ich noch, aber als mir auch das zu viel wurde, kippte ich zur Seite und rollte mich zu einer Kugel zusammen.
»Ich … Ach, nichts, Gerstad«, sagte sie. »Vergebt mir. Willkommen zu Hause. Kommt erst mal wieder zu Atem.« Sie tätschelte mir die Schulter, als wäre ich ein kleines Kind. Es war uns beiden peinlich, aber offenkundig wusste sie nicht, was sie sonst tun sollte.
»Sag es mir«, keuchte ich, noch immer auf dem Boden zusammengekrümmt. Wir befanden uns hinter dem Korallenthron, und wenn mein Hustenanfall nicht zu laut gewesen war, hatte bislang niemand sonst meine Ankunft bemerkt. »Ich muss es wissen, bevor ich mein Spiegelbild sehe. Und auch bevor mich die anderen sehen, damit ich mich auf ihre Gesichter gefasst machen kann. Deines sieht freundlich aus.« Sie presste die Lippen aufeinander und schüttelte den Kopf. »Bitte, du tust mir damit einen großen Gefallen.«
Die Matrosin verzog das Gesicht. »Ihr scheint inzwischen Mitte vierzig zu sein, Gerstad«, sagte sie. »Na ja, oder Ende vierzig. Es tut mir leid.«
Fast fünfzig also. Als ich am Vortag aufgewacht war, hatte ich noch wie Mitte dreißig ausgesehen. In Wahrheit war ich jedoch neunundzwanzig.
Ob mich meine Jungs überhaupt noch erkennen würden, wenn ich heimkam? Um nicht weiter über diese Frage nachdenken zu müssen, bedankte ich mich rasch mit einem Nicken und streckte den Arm aus. Die Matrosin ergriff ihn und half mir hoch. Dann wartete sie geduldig ab, während ich mich auf sie stützte und versuchte, zu Kräften zu kommen.
»Gut«, sagte ich schließlich und richtete mich mit geballten Fäusten gerade auf. »Ich muss zur Quelle und Bericht erstatten. Mögen dir die Strömungen gewogen sein.«
»Euch auch.«
Von meinem eigentlichen Bericht ist mir wenig im Gedächtnis geblieben. Ich erinnere mich an den Schrecken und das Mitleid in den Gesichtern des Pelenauten und der Lunge, als sie mich sahen. Und ich weiß noch, wie sie sagten, Gönerled sei ebenfalls gefallen, weil ich daran denken musste, dass meine Schwester dort lebte. Das war natürlich nicht alles, aber den Rest habe ich vergessen.
»Ich möchte, dass Ihr nach Hause geht und Euch ausruht«, sagte Pelenaut Röllend. »Kommt morgen früh wieder.«
Der Heimweg über die Kopfsteinpflasterstraßen war mühsam, und mir taten die Knie weh. Obwohl die Sonne schien, zog ich die Kapuze meines Umhangs tief ins Gesicht und hielt den Kopf gesenkt, um von niemandem gesehen zu werden, den ich kannte. Auf keinen Fall wollte ich darüber sprechen, was geschehen war und warum ich so alt aussah.
Die Leute taten die gleichen Dinge wie an jedem anderen Vormittag. Sie kauften Äpfel auf dem Markt und feilschten um Küchengewürze. Lehrlinge erledigten Besorgungen für ihre Meister und lachten über unanständige Witze. Noch ahnten sie nicht, dass in der vergangenen Nacht ganze Städte ausgelöscht worden waren, und wussten vielleicht noch nicht einmal, dass Pelemyn diesem Schicksal nur knapp entronnen war. Aber in diesem Moment war die glückselige Normalität wie eine gelebte Erinnerung daran, was Brynlön gerade verloren hatte. Am nächsten Tag würde es nicht mehr so sein, und auch nicht in absehbarer Zukunft. Für mich war es, als blickte ich in die Vergangenheit. Diese Menschen wirkten wie Geistererscheinungen aus besseren Zeiten.
Und als ich sie so glücklich sah und wusste, dass sich das bald ändern würde und wie viele bereits gestorben waren – darunter auch meine Schwester –, begann ich zu weinen.
Bislang hatte ich keine Gelegenheit dazu gehabt, da ich mit meinen Pflichten beschäftigt gewesen war und das Ausmaß des Ganzen noch gar nicht erfasst hatte. Natürlich war ich wütend gewesen, aber als ich jetzt allein nach Hause ging und als Einzige begriff, dass dies die letzten Stunden unseres alten Lebens waren, übermannte mich die Trauer, bis ich kaum noch Luft bekam. Ich versuchte, nicht laut zu schluchzen, weil ich nicht die Aufmerksamkeit der Leute auf mich ziehen und sie um ihre letzten glücklichen Momente bringen wollte.
Doch als ich zu Hause war und die Tür hinter mir geschlossen hatte, brachen sämtliche Dämme. Ich ließ mich auf den Boden sinken und weinte – um Festwyf, Gönerled und die anderen Städte. Um meine Schwester, die Matrosen, die auf den Mauern von Pelemyn gestorben waren, und um die Gefallenen unten beim Hafen. Um meine verlorene Zeit und weil ich wusste, dass sich mein Leben noch weiter verkürzen würde, ehe das hier vorüber war. Um die Jahre, die ich nicht mehr mit meinen Söhnen verbringen würde. Mir war klar, dass ich die Geburt meiner Enkelkinder nicht mehr erleben würde. Und auch das beweinte ich. Aber gleichzeitig wusste ich, dass weder ich noch irgendwer sonst Enkelkinder haben würde, wenn ich nicht meinen Pflichten nachkam.
Das Schlimmste waren jedoch die vielen Dinge, die ich nicht wusste. Wer waren diese Giganten, und weshalb hatten sie uns angegriffen? Und wie hatten sie es geschafft, mit einer so großen Flotte den Ozean zu überqueren?
Nach einer Weile stand ich mühevoll auf und schleppte mich in die Küche, wo ich eine Nachricht meiner Nachbarin fand: Den Jungs geht es gut. Sie sind in der Schule. Schlaf gut! – Perla
Und darunter stand: Ich habe persönlich nach ihnen gesehen. Sie sind in Sicherheit. – Föstyr
Den Strömungen sei Dank. Ich fragte mich, wie lange der Schulbetrieb noch weitergehen würde. Gut möglich, dass heute auch für meine beiden Jungs der letzte glückliche Tag war. Ich hoffte, dass sie sich gern an ihn erinnern würden. Und dass meine Söhne, wenn sie heimkehrten, ihre alte Mutter genauso lieb haben würden wie die junge Frau, von der sie sich gestern verabschiedet hatten.
Ich wischte mir die Tränen von den Wangen und hoffte, dass niemand meine Gefühlsanwandlung bemerkt hatte. Aber dann erkannte ich, dass ich nicht als Einziger weinte. Anscheinend erinnerten wir uns gerade alle an die letzten glücklichen Stunden, bevor wir von der Invasion erfuhren, und daran, wie schön und friedlich unser Leben zu diesem Zeitpunkt noch gewesen war. Und als der Barde sein Scheinbild auflöste, brach das Feld der Überlebenden in Jubel aus, der allerdings nicht so sehr ihm, sondern vielmehr Tallynd galt, die nun winkend auf die Bühne zurückkehrte und uns Kusshände zuwarf.
Sie weinte ebenfalls, und ich verstand nun, warum der Barde die Geschichte an ihrer Stelle hatte erzählen müssen. Niemand hätte von ihr verlangen können, diese Erinnerungen vor Publikum wiederaufleben zu lassen. Ihre grauen Schläfen waren mir schon zuvor aufgefallen, doch ich hatte sie in meiner Unwissenheit für ein Zeichen ihres wahren Alters gehalten. Wie die meisten Menschen hatte auch ich gehört, dass die Tidenhüterin uns in der Nacht der Invasion gerettet hatte. Aber ich hatte keine Ahnung gehabt, welchen Preis sie dafür bezahlen musste und dass sie eine neunundzwanzigjährige Witwe mit zwei kleinen Söhnen war.
Soweit ich weiß, sind mit allen Segnungen gewisse Bürden verbunden. Die Hygieniker altern zwar nicht wie die Tidenhüter, aber sie entwickeln einen regelrechten Zwang, wenn es um Verunreinigungen und Infektionen geht. Ständig schrubben sie sich die Haut ab, da sie beinahe alles als unrein empfinden.