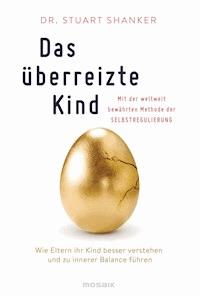
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
Dr. Stuart Shanker revolutioniert die Erziehung unserer Kinder: Seine Methode der Selbstregulierung ermöglicht Kindern aller Altersstufen – und deren Eltern – zu einer besonderen inneren Balance zu finden, einem Zustand von ruhiger Wachsamkeit. Von klein an wirken zu viele Reize auf sie ein, spätestens ab dem Schulalter sind sie einem oft unvorstellbaren Stress ausgesetzt. Das macht unruhig, unkonzentriert, aggressiv und hyperaktiv. Erwachsene reagieren meist mit einer Forderung nach Gehorsam – was leider nur dazu führt, dass der Druck weiter erhöht wird. Dr. Shankers Methode geht an die Wurzeln und bietet eine wirkliche Lösung. So kann Kindern – vom Kleinkind bis zum Teenager – geholfen werden. Jedem einzelnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Dr. Stuart Shanker revolutioniert die Erziehung unserer Kinder: Seine Methode der Selbstregulierung ermöglicht Kindern aller Altersstufen – und deren Eltern –, zu einer besonderen inneren Balance zu finden, einem Zustand von ruhiger Wachsamkeit. Von klein an wirken zu viele Reize auf sie ein, spätestens ab dem Schulalter sind sie einem oft unvorstellbaren Stress ausgesetzt. Das macht unruhig, unkonzentriert, aggressiv und hyperaktiv. Erwachsene reagieren meist mit der Forderung »beruhig dich, komm runter« –, was leider nur dazu führt, dass der Druck weiter erhöht wird. Dr. Shankers Methode geht an die Wurzeln und bietet eine wirkliche Lösung. So kann Kindern – vom Kleinkind bis zum Teenager – geholfen werden. Jedem einzelnen.
Autor
Dr. Stuart Shanker ist Professor für Psychologie und Philosophie an der York University, Toronto, sowie Gründer von The MEHRIT Centre. Er ist ein international gefragter Experte auf dem Gebiet der frühkindlichen Entwicklung sowie führender Vertreter der vielfach bewährten Methode der Selbstregulierung. Als wissenschaftlicher Direktor der staatlich geförderten Canadian Self-Regulation Initiative etablierte er seine Methode an öffentlichen Schulen. Nun trägt Dr. Shanker sein Wissen mit diesem Buch an alle Eltern und Erzieher heran.
Teresa Barker ist Journalistin und Autorin zahlreicher sehr erfolgreicher Bücher zu den Themen Erziehung, kindliche Entwicklung, Psychologie. Unter anderem ist sie Co-Autorin des New York Times Bestsellers Raising Cain (dt. Was braucht mein Sohn?).
DR. STUART SHANKER
mit Teresa Barker
Wie Eltern ihr Kind besser verstehen und zu innerer Balance führen
Aus dem kanadischen Englisch von Karin Wirth
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags für externe Links ist stets ausgeschlossen.
Die Ratschläge in diesem Buch wurden von den Autoren und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autoren bzw. des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
1. Auflage
Deutsche Erstausgabe August 2016
Copyright © 2016 Wilhelm Goldmann, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
© 2016 der Originalausgabe: V. and S. Corp., Inc.
Originaltitel: Self-Reg
Originalverlag: Penguin Press, New York
Umschlaggestaltung: *zeichenpool
Umschlagmotiv: shutterstock/Fedorov Oleksiy
Redaktion: Dagmar Rosenberger
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
KW · Herstellung: IH
ISBN 978-3-641-18385-1V001
www.mosaik-verlag.de
Für meine Frau und meine Kinder
Inhalt
Einleitung
Teil 1
Selbstregulierung – entscheidend für Leben und Lernen
Die Kraft der Selbstregulierung
Mehr als Marshmallows:
Der Unterschied zwischen Selbstregulierung und Selbstkontrolle
Keine Kleinigkeit:
Erregungsregulierung und die Gehirnbrücke
Unter dem Boab-Baum:
Das Fünf-Domänen-Modell der Selbstregulierung
Teil 2
Die fünf Domänen
Essen, Spielen, Schlafen:
Die biologische Domäne
Monster unter dem Bett:
Die emotionale Domäne
Ruhig, aufmerksam und lernbereit:
Die kognitive Domäne
Ein neuer Blick auf die soziale Entwicklung:
Die soziale Domäne
Das bessere Ich:
Die prosoziale Domäne
Teil 3
Teenager, Versuchungen und Eltern unter Druck
Chancen und Risiken der Pubertät
Gelüste, Dopamin und Langeweile
Wie geht es jetzt weiter?
Anhang
Dank
Quellenangaben
Literatur
Über den Autor
Register
Einleitung
Ich weiß nicht mehr, mit wie vielen Kindern ich bei meiner Arbeit in Kanada, den USA und auf der ganzen Welt schon zu tun hatte. Nicht nur Tausenden, sondern wahrscheinlich Zehntausenden. Und unter all diesen Kindern war kein einziges »schwieriges« Kind.
Kinder können egoistisch, unsensibel und trotzig sein; sie können sich weigern, aufmerksam zu sein, viel schreien und andere herumschubsen oder ungehorsam und geradezu feindselig sein. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Ich weiß, wovon ich rede – ich bin selbst Vater. Aber ein »schwieriges« Kind? Niemals.
Wir haben alle Momente, in denen wir Kinder als »böse« bezeichnen. Vielleicht sprechen wir von »schwer erziehbar« oder »unmöglich« oder einem »Problemkind« oder verwenden klinische Bezeichnungen wie »ASHS/ADS« oder »ODD« (Oppositionelles Trotzverhalten), aber wie immer wir es auch nennen – unsere Schlussfolgerungen können sehr abwertend sein.
Eines Tages traf ich auf der Straße einen Nachbarn, der mit seinem vierjährigen Sohn und dem jungen Hund der Familie unterwegs war. Als ich mich hinunterbeugte, um den Hund zu streicheln, schnappte er nach mir, worauf der Vater entschuldigend lächelte und meinte: »Alfonse ist ja noch ein Welpe.« Als aber der kleine Junge mit dem Hund schimpfte und ihm einen Klaps auf die Nase gab, reagierte der Vater sehr wütend. Offenbar war es für den jungen Hund in Ordnung, spontan zu reagieren, aber nicht für seinen vierjährigen Sohn. Wir waren alle schon mal dieser Vater und haben situationsbedingt in einer Weise auf unsere Kinder reagiert, wie wir es in einer ruhigeren Verfassung nicht tun würden.
Problematische Verhaltensweisen sind Ausdruck der Unfähigkeit eines Kindes, in diesem Augenblick auf alles, was um es herum vor sich geht – Geräusche, Lärm, Ablenkungen, unangenehme Empfindungen, Gefühle –, zu reagieren. Doch wir bewerten diese Verhaltensweisen als Teil seines Charakters oder Temperaments.[1] Schlimmer noch: Auch die Kinder selbst sehen es irgendwann so.
Es gibt kein Kind, das nicht mit Verständnis und Geduld auf den Weg zu einem erfüllten Leben geführt werden kann. Aber Stereotypen in Bezug auf »schwierige Kinder« trüben unseren Blick ebenso wie unsere eigenen Hoffnungen, Träume, Frustrationen und Ängste als Eltern. Verstehen Sie mich nicht falsch: Manche Kinder können eine deutlich größere Herausforderung darstellen als andere. Aber oft sind unsere negativen Urteile über ein Kind einfach nur Selbstverteidigungsmechanismen, eine Möglichkeit, die Probleme, die wir mit dem Kind haben, auf seine »Natur« zu schieben. Das kann zu noch stärkeren Gegenreaktionen, Abwehrmechanismen, Ängsten oder Rückzugstendenzen des Kindes führen. Aber so muss es nicht sein. So muss es nie sein.
Als ich darüber einmal vor einem Publikum sprach, das aus 2000 Erzieherinnen bestand, meldete sich im Hintergrund jemand zu Wort: »Also, ich habe in meiner Gruppe ein schlechtes Kind. Und sein Vater war auch ein schlechter Kerl. Und sein Großvater war durch und durch schlecht.« Alle lachten, aber ich fand das spannend. Ich dachte: »Na, es gibt immer eine Ausnahme von der Regel. Ich würde dieses Kind wirklich gern kennen lernen.« Ich vereinbarte mit der Erzieherin einen Termin, bei dem ich den kleinen Jungen im Kindergarten treffen konnte. Und in dem Augenblick, als er ins Zimmer kam, war sofort klar, dass das, was die Erzieherin als bösartiges Benehmen einstufte, in Wirklichkeit Stressverhalten war.
Der Junge war sehr geräuschempfindlich. Bevor er sich hinsetzte, wurde er zweimal von Geräuschen draußen im Flur erschreckt. Außerdem kniff er die Augen zusammen, was darauf schließen ließ, dass ihn das grelle Licht im Raum störte, oder dass er möglicherweise ein Problem mit der Verarbeitung visueller Eindrücke hatte. Als ich ihn da so auf seinem Stuhl herumrutschen sah, fragte ich mich, ob es dem Jungen vielleicht schwerfiel, aufrecht zu sitzen oder sich auf dem harten Holzstuhl bequem hinzusetzen. Das wirkliche Problem war biologischer Natur. Unter diesen Umständen würden ihm erhobene Stimmen oder strenge Mienen nur noch mehr Unbehagen und Stress bereiten. Im Lauf der Zeit kann diese Art der gewohnheitsmäßigen Interaktion bei einem Kind zu Ungehorsam und Trotz führen.
Das gilt besonders für Probleme, die seit mehreren Generationen in einer Familie auftreten, wie es hier der Fall zu sein schien. Hatten sein Vater und sein Großvater schon dieselben biologisch bedingten Empfindlichkeiten? Waren sie mit denselben strafenden Reaktionen von Seiten der Erwachsenen in ihrem Leben konfrontiert gewesen, die ein Kind so leicht auf den problematischen Weg führen, der letztlich die eigene Einschätzung nur zu bestätigen scheint (»Siehst du, ich hab doch gesagt, dass er ein schlechtes Kind ist«)?
Ich fragte mich sofort, wie ich das Kind unterstützen und der überforderten Erzieherin helfen könnte, seine Verhaltenssignale zu sehen und zu deuten. Ich schloss sanft die Tür, schaltete das Deckenlicht aus (das nicht nur stark blendete, sondern auch einen permanenten Summton erzeugte) und sprach leiser. Als die Erzieherin sah, wie sich der Junge plötzlich entspannte, bekam sie einen sanfteren Gesichtsausdruck und flüsterte: »Oh, mein Gott.«
Das war die Art von Reaktion, die ich bisher bei jedem Erwachsenen beobachten konnte, der entdeckte, dass das Problem eines Kindes nicht unlösbar war. Es war so einfach gewesen, diesen Jungen als erblich vorbelastet abzustempeln. Das änderte sich in dem Augenblick, als die Erzieherin seine Geräusch- und Lichtempfindlichkeit bemerkte. Und die hatte er sich nicht ausgesucht.
Von einem Augenblick zum andern änderte sich das Verhalten der Erzieherin gegenüber dem Jungen. Davor war sie grimmig gewesen, jetzt lächelte sie bis in die Augenwinkel. Ihr Tonfall veränderte sich von kurz angebunden zu melodisch, ihre Gesten von hektisch zu langsam und rhythmisch. Sie schaute das Kind direkt an, nicht mich. Zwischen den beiden war eine Verbindung entstanden, und alles an seiner Körperhaltung, seinem Gesichtsausdruck und seinem Tonfall spiegelte ihre eigenen Veränderungen wider.
Diese Art der Veränderung basiert nicht nur darauf, dass das Kind anders gesehen wird (oder als ein anderes Kind betrachtet wird), sondern auf einer Veränderung der gesamten Dynamik zwischen dem Kind und dem Erwachsenen. In diesem Fall hatte die Erzieherin ihr Bedürfnis nach Gehorsam– wenn man so will, sogar ihr Ego – hintangestellt und das Kind wirklich zum ersten Mal richtig wahrgenommen. Jetzt konnte sie anfangen, es zu unterrichten. Und was den Jungen anging, so hatte er selbst keine Ahnung von seiner Geräusch- und Lichtempfindlichkeit gehabt oder gar davon, dass sie den Umgang mit ihm erschwerte. Es war seine Realität, das, was für ihn »normal« war. Jetzt konnte die Erzieherin ihm helfen zu lernen, wann und warum er hyperaktiv und abgelenkt war, und was er tun konnte, um ruhig und aufmerksam zu bleiben.
Vom richtigen Standpunkt aus betrachtet
Kein Elternteil, der dieses Buch liest, war im Leben seines Kindes nicht schon einmal selbst an diesem Punkt. Wahrscheinlich sogar mehrmals! Wir bemühen uns so sehr, unseren Kindern zu helfen, ihnen nicht nur materiellen Komfort zu bieten, sondern ihnen auch die Kompetenzen zu vermitteln, die sie für ein erfolgreiches Leben brauchen. Und doch gelingt es uns oft nicht, eine Verbindung zu unseren Kindern herzustellen, und dann sind wir verständlicherweise frustriert und wütend. Wir wissen, dass das Verhalten unserer Kinder nicht zielführend oder nicht gut für sie ist, und fragen uns, warum es uns nicht gelingt, ihnen das klarzumachen. Genau wie die Erzieherin aus meinem Beispiel haben wir die besten Absichten, aber das genügt nicht. Selbstregulierung beginnt damit, das Verhalten eines Kindes und letztlich auch unser eigenes Verhalten in einen neuen Bezugsrahmen zu stellen und die Bedeutung des kindlichen Verhaltens vielleicht zum ersten Mal wirklich zu sehen.
Während meines Studiums bot mir mein Dozent, Peter Hacker, der Kunstliebhaber war, einmal an, mit ihm eine Rembrandt-Ausstellung zu besuchen. Ich traf vor ihm in der Galerie ein und betrachtete zwanzig Minuten lang ein Selbstporträt, bei dem sich mir beim besten Willen nicht erschließen wollte, warum so viel Aufhebens darum gemacht wurde. Als Peter dazustieß, fragte er mich nach meinem Eindruck, und ich sagte, dass das Bild auf mich einfach nur verschwommen wirke. Peter lächelte und entfernte sich einige Schritte von dem Bild, wobei er konzentriert auf den Boden starrte. Er zeigte auf einen kleinen Punkt am Boden und forderte mich dann auf, mich dorthin zu stellen und das Gemälde von diesem Punkt aus zu betrachten. Das Ergebnis war erstaunlich: Plötzlich war das Gemälde perfekt fokussiert, und ich verstand und spürte in diesem Augenblick die volle Wirkung von Rembrandts Genialität.
Ich hatte mir so sehr gewünscht zu verstehen, weshalb dieses Gemälde als überragende künstlerische Leistung eingestuft wurde. Ich hatte die Anmerkungen zu seiner Entstehung gelesen. Ich wusste, wann und wo Rembrandt es gemalt hatte. Und dennoch hätte ich wohl jahrelang täglich das Museum besuchen und das Gemälde betrachten können, ohne je sein Geheimnis zu entdecken. Ich hätte immer am falschen Punkt gestanden.
Durch Selbstregulierung lernen Sie, wo Sie stehen müssen, um Ihr Kind richtig sehen und verstehen zu können. Sie lernen, wie Sie das Verhalten Ihres Kindes in den Fokus rücken, auf seine Bedürfnisse eingehen und ihm helfen, sich selbst zu helfen. Selbstregulierung stärkt Ihre Beziehungen. Dabei geht es nicht darum, Ihr Kind dazu zu bewegen, sich »gut zu benehmen«, also Verhaltensweisen abzulegen, die Sie oder andere als störend empfinden oder durch die es sich selbst Probleme schafft. Bei dem Konzept der Selbstregulierung geht es um erstaunliche Veränderungen in Bezug auf Stimmung, Konzentration, die Fähigkeit, Freundschaften einzugehen, Einfühlungsvermögen und die Entwicklung der Tugenden und Werte, die für das langfristige Wohlergehen Ihres Kindes wichtig sind.
Diese Technik ist das Ergebnis umwälzender wissenschaftlicher Erkenntnisse in Bezug auf die Selbstregulierung.[2] Der Begriff »Selbstregulierung« wird mit sehr vielen unterschiedlichen Bedeutungen verwendet, aber die ursprüngliche psychophysiologische Bedeutung bezieht sich auf die für die Reaktion auf Stress und die anschließende Erholung aufgewendete Energie.[3] Und unter »Stress« versteht man dabei alle Stimuli, die uns dazu bewegen, Energie aufzuwenden, um eine Art von Gleichgewicht zu wahren. Dazu gehören nicht nur die psychosozialen Stressfaktoren, die wir alle kennen, wie berufliche Anforderungen oder die Frage, was andere von uns denken, sondern wie bei dem kleinen Jungen, von dem ich oben berichtet habe, zählen dazu auch Faktoren in der Umgebung, wie akustische oder visuelle Stimulation, unsere Gefühle (positiver oder negativer Art), Muster, mit denen wir schwer umgehen können, die Notwendigkeit, mit dem Stress anderer umzugehen, und für viele Kinder gehören dazu heutzutage auch die Dinge, die sie in ihrer Freizeit tun oder nicht tun.[4] Wenn die Stressbelastung eines Kindes konstant zu hoch ist, erholt es sich möglicherweise nicht mehr vollständig davon, und seine Anfälligkeit selbst gegenüber geringfügigen Stressfaktoren steigt.
Selbstregulierung ist eine fünf Schritte umfassende Methode, die Erwachsenen hilft,
zu erkennen, wann ein Kind zu großem Stress ausgesetzt ist,die Stressfaktoren zu identifizieren undzu reduzieren sowiedas Kind dabei zu unterstützen, wahrzunehmen, wann es das für sich selbst tun muss, undSelbstregulierungsstrategien zu entwickeln.Zu erkennen, wann ein Kind zu hohem Stress ausgesetzt ist oder was als Stressfaktor zählt, ist nicht einfach, weil Kinder heute mit so vielen versteckten Stressfaktoren umgehen müssen.[5] Oft meinen wir einem Kind nur sagen zu müssen, dass es sich beruhigen soll, obwohl das nie funktioniert. Es gibt kein einfaches Rezept dafür, was einem Kind hilft, sich selbst zu regulieren. Kinder sind sehr verschieden und ihre Bedürfnisse ändern sich ständig, und zwar so sehr, dass das, was letzte Woche geholfen hat, heute womöglich schon nicht mehr funktioniert. Aber mithilfe der ersten vier Schritte lernen Sie zu experimentieren und herauszufinden, was bei Ihrem Kind funktioniert und was nicht. Und vor allem lernt Ihr Kind es auch.
Seit Platos Zeiten wurde Selbstkontrolle als Ausdruck der Persönlichkeit gepriesen.[6] Diese Annahme beeinflusste unsere Wahrnehmung von Kindern sowie ihre Entwicklung zu seelisch, körperlich und charakterlich stabilen Erwachsenen. Auch in Bezug auf Erwachsene ging man davon aus, dass man vor allen Dingen Willenskraft brauche, um Versuchungen zu widerstehen und problematische Situationen zu bewältigen. Was die klassischen Philosophen und die nachfolgenden Generationen nicht wussten, ist, dass es um etwas sehr viel Grundlegenderes geht.
Selbstkontrolle bedeutet, Impulse zu unterdrücken; Selbstregulierung hingegen bedeutet, die Ursachen von Impulsen zu erkennen und ihre Intensität zu verringern und, wenn nötig, die Energie aufzubringen, ihnen zu widerstehen.[7] Dieser Unterschied wird oft nicht genau verstanden, häufig werden die beiden Begriffe sogar gleichgesetzt. Doch Selbstregulierung unterscheidet sich nicht nur grundlegend von Selbstkontrolle, sondern macht Selbstkontrolle überhaupt erst möglich – oder in vielen Fällen überflüssig. Wenn wir diesen wesentlichen Unterschied nicht verstehen, laufen wir Gefahr, die Faktoren, die zur schlechten Selbstkontrolle eines Kindes beitragen, zu verstärken, statt ihm zu helfen, die grundlegenden Fähigkeiten zu erwerben, um in der Schule und auf seinem weiteren Lebensweg erfolgreich zu sein.
Im Zusammenhang mit Selbstregulierung sind »problematische« Verhaltensweisen wertvolle Hinweise darauf, dass ein Kind zu viel Stress hat. Man denke nur an Kinder, die sehr impulsiv oder unbeherrscht sind, ihre Gefühle nicht unter Kontrolle haben, zu Wutanfällen neigen oder sprunghaft sind, Frustration nicht aushalten können, beim kleinsten Hindernis aufgeben, eine geringe Aufmerksamkeitsspanne haben oder sich leicht ablenken lassen, nicht gut mit Beziehungen umgehen können oder wenig Mitgefühl haben. Verhaltensweisen, bei denen wir automatisch denken, dass ein Kind »böse« oder »faul« oder »langsam« ist, sind oft ein Zeichen dafür, dass sein Stressniveau viel zu hoch ist und es »kein Benzin mehr im Tank« hat. Selbstregulierung lehrt uns, die Stressfaktoren eines bestimmten Kindes zu erkennen und zu reduzieren. Im nächsten Schritt müssen wir dem Kind helfen, all das allein zu schaffen.[8]
Selbstregulierung fängt damit an, unsere eigenen Stressfaktoren zu identifizieren und zu reduzieren und bei der Interaktion mit dem Kind ruhig und aufmerksam zu bleiben. Wie die Erzieherin, die sich bei meinem Vortrag zu Wort meldete, müssen wir, wenn wir im Umgang mit einem Kind wütend, besorgt oder mit unserem Latein am Ende sind, lernen, uns zu fragen, worum es eigentlich geht und was wir gerade übersehen. Manchmal müssen wir uns auch eingestehen, dass wir uns geirrt haben. Das ist nicht einfach. Niemandem fällt das leicht.
Ich bin mit jener Erzieherin in Kontakt geblieben. Einmal hat sie mir gesagt, dass sich seit dem Tag meines Besuches in ihrem Kindergarten viel mehr verändert habe als nur ihre Interaktion mit dem kleinen Jungen und den anderen Kindern in ihrer Gruppe. Ihr ganzes Leben, ihr Umgang mit ihrer eigenen Familie, ihren Freunden und vor allem mit sich selbst – all das, so behauptete sie, habe sich in dieser einen Sekunde verändert.
Warum? War sie vorher hartherzig, ausgebrannt oder der Arbeit mit diesem Jungen überdrüssig gewesen? Wollte sie ihn schon aufgeben? Nein, absolut nicht. Tatsächlich war sie eine leidenschaftliche und engagierte Erzieherin. Dennoch war sie zu der Überzeugung gelangt, dass mit diesem Jungen »etwas nicht stimmte«. Eine solche Überzeugung ist immer falsch. Natürlich ist immer etwas im Gange, aber nichts »Falsches«. Sondern etwas Anderes. In diesem Buch geht es darum herauszufinden, was dieses Andere bei Ihrem Kind ist.
Es gibt eine Methode dafür, diese Probleme an der Wurzel zu packen. Sie heißt Selbstregulierung, und in diesem Buch erfahren Sie, wie sie funktioniert, und wie Sie Ihrem Kind helfen können, sie selbst anzuwenden. Es ist nicht nur eine Methode zur Unterstützung von »Problemkindern«, sondern eine Methode für alle Kinder. Selbstregulierung ist etwas, das wir alle brauchen. Heute mehr denn je.
Die Kraft der Selbstregulierung
Streng dich mehr an!
Das hört man ständig. Man sagt es zu sich selbst: Du musst willensstärker sein, mehr Selbstkontrolle darüber haben, was du isst oder trinkst, zu deinem Chef sagst oder in deiner Freizeit tust.[9] Du musst Sport treiben. Weniger Geld ausgeben. Den endlosen Versuchungen widerstehen. Und wenn du scheiterst, dann streng dich mehr an!
Das ist die Botschaft, die wir täglich unzählige Male hören, und wenn wir uns darüber unterhalten, wie wir unseren Kindern helfen können, erfolgreich zu sein, läuft es immer wieder darauf hinaus. Aber für sie und für viele von uns scheint Selbstkontrolle umso schwieriger zu werden und das Ziel in immer weitere Ferne zu rücken, je mehr wir uns anstrengen. Wir werfen uns selbst Schwäche vor. Kinder tun das auch, und Selbstbezichtigungen und Scham untergraben all das Gute, das wir uns für sie in der Schule und im Leben erhoffen.
Durch neue Erkenntnisse der Neurowissenschaften werden die Geheimnisse unseres Verhaltens entschlüsselt – warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten, und warum es manchmal so schwer ist, uns so zu verhalten, wie wir wollen. Aus diesen neuen Erkenntnissen lässt sich auch ableiten, wie wir unser Verhalten ändern können und dass Selbstkontrolle sehr wenig damit zu tun hat. Die Forschungsergebnisse zeigen sogar, dass Selbstkontrolle und positive Verhaltensänderungen umso schwieriger werden, je mehr wir uns auf die Selbstkontrolle konzentrieren und je mehr wir uns anstrengen.
Verstehen Sie mich nicht falsch: Selbstkontrolle ist wichtig. Wir kennen alle Menschen, die auf ihrem Gebiet sehr erfolgreich sind und über eine mustergültige Selbstkontrolle zu verfügen scheinen. Aber viel wichtiger ist die Stressbelastung, unter der wir stehen, und wie gut wir damit umgehen: Wie gut wir uns selbst regulieren können. Und wenn man sich diese »Erfolgsgeschichten« genauer anschaut, wird deutlich, dass das, was diese Menschen auszeichnet, vor allem eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Selbstregulierung ist.
Der Begriff »Selbstregulierung« bezieht sich darauf, wie das autonome Nervensystem (ANS) mit energieintensiven Stoffwechselprozessen auf Stress reagiert und anschließend ausgleichende Prozesse in Gang setzt, die Erholung und Wachstum fördern. Je höher unsere Stressbelastung, desto weniger Ressourcen stehen uns für die Selbstkontrolle zur Verfügung und desto stärker werden unsere Impulse. Sobald man den natürlichen Prozess der Selbstregulierung verstanden hat und die ersten einfachen Schritte unternimmt, um mit ihm statt gegen ihn zu arbeiten, verschwindet oft der Drang, Selbstkontrolle auszuüben.
Warum wir tun, was wir tun: Mythen und neue Erkenntnisse der Forschung
Die Verbindung von schlechter Selbstkontrolle und Schwäche ist der fatalste Aspekt der traditionellen Auffassung, dass Selbstkontrolle eine Frage von Stärke und Charakter ist. Diese Vorstellung hat sich jahrtausendelang gehalten. Der unterstellte Mangel an Selbstkontrolle hat bei vielen Betroffenen zu Schuldgefühlen und Selbstanklagen geführt. Die moderne Wissenschaft lehrt uns, dass diese Vorstellung nicht nur archaisch, sondern von Grund auf falsch ist.
Einer der großen Durchbrüche in der Wissenschaft der Selbstregulierung war die Entdeckung der Funktionsweise des limbischen Systems, das von Joseph LeDoux als das »emotionale Gehirn« bezeichnet wurde.[10] Dieser subkortikale Gehirnbereich liegt unterhalb des präfrontalen Cortex (PFC), und seine Hauptstrukturen sind die Amygdala, der Hippocampus und der Hypothalamus. Das limbische System, insbesondere die Amygdala, ist der Ursprung unserer starken Emotionen und Antriebe. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Erinnerungen und damit verknüpften (positiven oder negativen) emotionalen Assoziationen. Liebe, Begehren, Angst, Scham, Wut und Trauma haben hier ihre gemeinsame neurologische Basis.
Das limbische System
Früher betrachtete man das Gehirn als eine Art Hierarchie, innerhalb derer die »höheren« Systeme im präfrontalen Cortex die vom »niedrigeren« limbischen System ausgehenden Impulse beherrschen und unterdrücken.[11] Man ging davon aus, dass unser präfrontaler Cortex zu schwach ist, wenn wir diesen Impulsen nachgeben. Die alte und unangefochtene Vorstellung von der Willensstärke und Selbstkontrolle als einer Art mentalem Muskel passte sehr gut dazu.[12] Wie schon zu Sokrates’ Zeiten glaubte man, das Heilmittel bestünde darin, die für die Selbstkontrolle zuständigen höheren Systeme wie einen Muskel durch hartes Training und Disziplin zu stärken. In dieser Vorstellungswelt wird das Ausüben von Selbstverleugnung (indem man der Versuchung und den niederen Impulsen widersteht) zu einer Art »Bankdrücken« für die Selbstkontrolle.
Aber die Fortschritte in der Gehirnforschung haben in den letzten 20 Jahren ein völlig anderes Bild entstehen lassen. Besonders wichtig ist dabei unser neues Verständnis des Hypothalamus, den wir jetzt aufgrund seiner wichtigen Rolle bei der Regulierung zahlreicher Systeme (Immunsystem, Körpertemperatur, Hunger, Durst, Müdigkeit, Schlaf-Wach-Rhythmus, Herzschlag und Atmung, Verdauung, Stoffwechsel, Zellreparatur und sogar wichtige Aspekte des Hörens, Sprechens und Interpretierens sowie des Erziehungs- und Bindungsverhaltens) als die »Hauptschaltstelle« des Gehirns betrachten.
Alle diese verschiedenen komplexen Funktionen sind mit der primitiven Reaktion des Gehirns auf Stressfaktoren verknüpft – von relativ geringfügigem Stress bis hin zu regelrechten Bedrohungen (oder dem, was unser limbisches System dafür hält). Wenn wir diese Reaktion abmildern können, beginnen wir, alle anderen Selbstregulierungsprozesse wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Selbstkontrolle ist wichtig, aber sie ist nicht die zentrale, organisierende Funktion eines starken, gesunden Geistes und eines erfolgreichen Lebens. Das ist die Selbstregulierung.
Dreifache Harmonie – das »dreieinige« Gehirn
In den 60er Jahren entwickelte Paul MacLean, Neurowissenschaftler in Yale, ein bis heute sehr nützliches theoretisches Modell des Gehirns.[13] Nach diesem »dreieinigen« Modell besitzen wir drei deutlich voneinander abgegrenzte Gehirne, von denen sich jedes zu einem anderen Zeitpunkt in unserer evolutionären Vergangenheit entwickelt hat und die übereinandergeschichtet sind. Obenauf und vorn liegt, wie schon der Name sagt, das »neueste« Gehirn, der Neocortex. Es unterstützt komplexe Funktionen wie Sprache, Denken, die Interpretation sozialer Signale und die Selbstkontrolle. Darunter liegt das viel ältere Paläo-Säugetierhirn, auch paläo-mammalisches Gehirn genannt, in dem das limbische System sowie starke emotionale Assoziationen und Antriebe ihren Sitz haben. Und ganz unten befindet sich das älteste und primitivste, das sogenannte »Reptiliengehirn«, das in enger Zusammenarbeit mit dem limbischen System unsere Erregung und Wachsamkeit reguliert.
Das dreieinige Gehirn
MacLeans Modell stellt eine starke Vereinfachung dar, ist aber dennoch hilfreich beim Verständnis des neurophysiologischen Unterschiedes zwischen Selbstkontrolle und Selbstregulierung: Die Selbstkontrolle ist vor allem ein »neocortikales« Phänomen, das von wenigen Systemen im präfrontalen Cortex unterstützt wird, während die Selbstregulierung von tief im Säugetier- und Reptiliengehirn liegenden Systemen beeinflusst wird – von Systemen, die nicht nur unabhängig von präfrontalen Funktionen aktiviert werden, sondern die Funktionsweise dieser präfrontalen Systeme auch deutlich einschränken können.
Das wachsame Gehirn: Schutz und Verteidigung rund um die Uhr
Der Hypothalamus überwacht unser »inneres Milieu«, indem er beispielsweise dafür sorgt, dass unsere Körpertemperatur ungefähr bei 37 Grad liegt, dass die richtige Menge an Natrium und Glukose im Blut vorhanden ist und dass sich im Schlaf bestimmte Systeme erholen, während andere wichtige Reparaturen und Heilungsprozesse im Körper durchführen. Wenn die Außentemperatur plötzlich sinkt, löst der Hypothalamus eine Stoffwechselreaktion zur Erzeugung von Körperwärme aus: Atmung und Puls beschleunigen sich, wir zittern und unsere Zähne klappern. Alle diese Prozesse verbrauchen eine beträchtliche Menge Energie.
Kälte ist ein klassisches Beispiel für einen umgebungsbedingten Stressfaktor, den das autonome Nervensystem überwacht und auf den es reagiert.[14] Wenn zu viele dieser extern verursachten »Kosten« (zusätzlich zu den üblichen emotionalen, sozialen und kognitiven Stressfaktoren) entstehen, kann das limbische System hyperempfindlich auf das kleinste Anzeichen von Gefahr reagieren. Dann stuft es etwas als Bedrohung ein, bevor der präfrontale Cortex die Chance hat zu beurteilen, ob das wirklich zutrifft, und löst einen Alarm (ähnlich einem durch Bewegung oder Erschütterungen ausgelösten Autoalarm) aus, der zur Ausschüttung von Neurochemikalien und damit zur Aktivierung des Kampf- oder Fluchtmodus führt. Wenn das nicht funktioniert, greift das Gehirn auf den »Erstarrungsmodus« zurück – ähnlich dem Totstellen, das manche Tiere praktizieren, wenn sie bedroht werden. Der älteste Teil des »dreieinigen Gehirns«, das Reptiliengehirn, reagiert auf die Gefahr mit der Ausschüttung von Adrenalin und dem Anstoßen einer komplexen neurochemischen Kettenreaktion, die zu einer Freisetzung von Kortisol führt.
Durch diese Neurochemikalien werden Herzschlag, Blutdruck und Atemfrequenz erhöht, um wichtige Muskeln mit Glukose und Sauerstoff zu versorgen (Lunge, Kehle und Nase weiten sich).[15] Das Energieniveau steigt. Fett aus Fettzellen und Glukose aus der Leber werden verstoffwechselt. Wachsamkeit und Reaktionsfähigkeit steigen: Die Pupillen erweitern sich, die Haare stellen sich auf (wodurch unsere hominiden Vorfahren größer und bedrohlicher wirkten), die Schweißdrüsen werden im Rahmen eines Kühlprozesses geöffnet, und zur Erhöhung der Schmerztoleranz werden Endorphine ausgeschüttet.
Dieses »Alarmsystem« ist, zumindest auf unser modernes Leben bezogen, sehr primitiv. Es macht keinen Unterschied zwischen einem echten Feind und beispielsweise dem imaginären Feind aus einem Rollenspiel: Beide lösen die Freisetzung von Adrenalin aus. Diese Systeme wurden für Reptilien und Säugetiere in freier Wildbahn entwickelt und können den Schweregrad einer Bedrohung oder ihre mögliche Dauer nicht beurteilen. Der Alarm bleibt aktiviert und das System bleibt in einem Kampf-oder-Flucht-Status.
Um die dafür erforderliche Energie aufzubringen, fährt unser Körper alle Funktionen herunter, die Energie verbrauchen, aber in diesem prekären Augenblick nicht überlebensnotwendig sind. So kann die Natur die maximale Energiemenge zu denjenigen Systemen lenken, die zur Bekämpfung der akuten Bedrohung erforderlich sind. Die Liste dieser Funktionen, die verlangsamt oder deaktiviert werden, ist sehr lang, und sie ist der Schlüssel zur Antwort auf die Frage, warum es so schwierig ist, Selbstkontrolle auszuüben, wenn wir sie am dringendsten brauchen.
Die ständige Alarmbereitschaft erschöpft unsere Reserven
Im »Kampf-oder-Flucht-Modus« wird Energie von Systemen abgezweigt, die im Notfall als unwichtig gelten, beispielsweise von der Verdauung. Die Trägheit, die wir nach einer üppigen Mahlzeit spüren, ist ein Zeichen dafür, wie viel Energie die Verdauung erfordert – etwa 15 bis 20 Prozent der Gesamtenergie des Körpers, dieselbe Menge, die auch das Gehirn braucht, um im Normalbetrieb alles am Laufen zu halten. Die Verdauung kann zwischen vier Stunden und zwei Tagen in Anspruch nehmen und ist so energieaufwändig, weil viel Energie erforderlich ist, um das richtige chemische Milieu im Magen zu erzeugen und die Enzyme zu produzieren, die im Körper die Nährstoffe zerlegen und verteilen. Weitere Stoffwechselfunktionen, die unter Stress verlangsamt oder ausgesetzt werden, sind das Immunsystem, die Zellreparatur und das Zellwachstum, die Durchblutung der Kapillaren (um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass man im Fall einer Verletzung beim Kampf verblutet) und die Reproduktion.[16]
Vielleicht fragen Sie sich, was all das damit zu tun hat, dass Sie die Geduld verlieren oder das dritte Tortenstück verzehren, das Sie eigentlich auf dem Teller lassen wollten, oder mit den Trotzanfällen und der Matheangst Ihres Kindes. Die Antwort hängt mit der Wirkung des Kampf-oder-Flucht-Modus auf unsere vom präfrontalen Cortex unterstützten »rationalen« Funktionen zusammen.
Erinnern Sie sich doch bitte einmal an eine Situation, in der Sie sehr wütend auf Ihre achtjährige Tochter waren, weil sie etwas getan hatte, das Sie ihr schon tausendmal verboten hatten. Wie rational waren Sie da? Wie gut hatten Sie Ihre sprachlichen Funktionen, ganz zu schweigen von Ihrem Denken, unter Kontrolle? Wir neigen zum Stottern, wenn wir wütend sind, weil die linke Hälfte unseres präfrontalen Cortex außen vor bleibt, wenn Säugetier- und Reptilienhirn die Kontrolle übernommen haben. Das geht auf Kosten all der wunderbaren höheren Funktionen, die der präfrontale Cortex unterstützt: Sprache, rationales Denken, Interpretieren der sozialen und emotionalen Signale anderer Menschen, Empathie und natürlich auf Kosten der Selbstkontrolle!
Die Molekularbiologen haben faszinierende Entdeckungen im Hinblick auf die im Kampf-oder-Flucht-Modus ausgeschalteten Funktionen gemacht.[17] Beispielsweise ziehen sich bei plötzlichem heftigem Stress die Muskeln im Innenohr zusammen, wodurch menschliche Stimmen gedämpft und unsere auf tiefe Töne abgestimmten Hörfunktionen verstärkt werden. Das ist aus der Sicht des Säugetier- und Reptilienhirns äußerst sinnvoll: Diese tiefen Töne könnten von einem im Gebüsch lauernden Raubtier stammen. In unserem modernen Kontext erklärt es, weshalb unser gestresstes oder abgelenktes Kind uns zu ignorieren scheint, wenn wir nicht direkt vor oder über ihm stehen. Und wenn wir direkt über ihm stehen, wird es unseren Tonfall und unsere Körpersprache wahrscheinlich als umso bedrohlicher wahrnehmen.
Im Kampf-oder-Flucht-Modus wird unser modernes, sprachorientiertes Gehirn außer Kraft gesetzt, und wir fallen in einen archaischen, vorsprachlichen Zustand zurück, in dem die primitiven Überlebensmechanismen eines in die Enge getriebenen Tieres zum Zuge kommen.
Selbstregulierung – eine Frage der richtigen Balance
Das autonome Nervensystem reguliert die Übergänge zwischen unterschiedlichen Erregungszuständen, vom tiefen Schlaf – unserem niedrigsten Erregungsniveau – bis hin zur höchsten Erregung, wie wir sie bei einem Kind sehen, das gerade einen Trotzanfall hat.[18]
Die Erregungsregulierung versteht man am besten als Funktion der komplementären Kräfte des sympathischen Nervensystems (SNS), das unsere Erregung steigert, und des parasympathischen Nervensystems (PNS), das alles verlangsamt und unsere Erregung dämpft. Oder anders ausgedrückt: eine Funktion des Gehirns, das auf Gaspedal oder Bremse tritt. Wie viel Aktivierung oder Beruhigung für eine bestimmte Aufgabe erforderlich ist, hängt von der Situation und natürlich von unseren Reserven ab. Jeden Tag bewegen wir uns auf dieser »Erregungsskala« auf und ab.[19] Mit steigender Erregung steigt natürlich auch der Energieverbrauch; bei abnehmender Erregung füllen wir unsere Reserven wieder auf.
Je größer der Stress ist, dem ein Kind ausgesetzt ist, desto schwerer fällt es seinem Gehirn, diese Übergänge zu steuern. Die »Erholungsfunktion« verliert an Wirksamkeit, und das Kind kann in der Über- oder Untererregung »steckenbleiben«.[20] Man denke zum Beispiel an ein Kind, dem es schwerfällt, »in die Gänge zu kommen«, oder das immer aktiv ist und nicht still sitzen kann.
Am gravierendsten ist es, wenn sich die Kampf-oder-Flucht-Reaktion »einschleift« und das Kind viel leichter und daher ständig erschrickt. Wenn das eintritt, zieht sich das Kind von uns zurück. Eltern deuten dieses Verhalten oft als Ablehnung, obwohl es in Wirklichkeit die Funktion einer anderen Art von »Gehirnhierarchie« ist – einer Reihe natürlicher biologischer Antworten auf Bedrohung:
Soziale InteraktionKampf oder Flucht (sympathische Erregung)Erstarren (parasympathische Erregung)Dissoziation (der »außerkörperliche« Zustand, in dem der Betreffende das, was mit ihm geschieht, beobachtet, als ob es mit jemand anderem geschehen würde)Diese »Hierarchie der Stressreaktionen«[21] entspricht MacLeans »dreieinigem« Gehirnmodell – vom jüngsten Gehirnsystem im präfrontalen Cortex (soziale Interaktion) bis hin zu archaischen Mechanismen als Reaktion auf Bedrohungen. Wenn soziale Interaktion nicht möglich oder nicht ausreichend ist, schaltet das Gehirn auf Kampf oder Flucht um. In diesem Zustand wird soziale Interaktion nicht nur gemieden, sondern wird selbst zum Stressfaktor, das heißt, das Kind flieht vor uns oder bekämpft uns, obwohl wir genau die Ressource sind, die es am meisten braucht. Wenn die vermeintliche Gefahr bzw. der Stress weiter besteht, schaltet das Gehirn auf »Totstellen« um, um die schwindenden Energiereserven für einen letzten Rettungsversuch aufzubieten. Die letzte Phase, Dissoziation, ist eher ein Mechanismus zur Reduzierung psychischer und physischer Schmerzen als ein Überlebensmechanismus.
Bei chronischer Unter- oder Übererregung findet eine Verschiebung vom sogenannten »lernenden Gehirn« zum »Überlebensgehirn« statt.[22] Das Kind hat dadurch große Schwierigkeiten, zu verfolgen oder zu verarbeiten, was in seiner Umgebung oder in ihm selbst vor sich geht. Es ist jetzt sehr empfänglich für den »Abschaltmodus« oder für impulsive Handlungen und/oder Aggressionen (gegen sich selbst oder andere). Kinder, die sich in einer Art chronischem »Betäubungszustand« befinden oder hyperaktiv sind, sind nicht »schwach« oder »nicht bereit, sich genug anzustrengen«, sondern sie erleben zu viel Stress.
Man kann Kinder nicht zwingen, sich zu beruhigen, und die Androhung von Strafen kann den Stress, dem sie ausgesetzt sind, sogar noch erheblich verstärken. Die Kinder entscheiden sich ebenso wenig dafür, über- oder untererregt zu sein, wie sie sich dafür entscheiden können, sich zu beruhigen, wenn sie nicht wissen, wie das funktioniert. Durch Selbstregulierung erhalten sie die dafür erforderlichen Werkzeuge und Fähigkeiten.
Im Krieg gegen uns selbst: Der hohe Preis des inneren Kampfes
Ein chronischer Zustand der Übererregung macht das limbische System so stressempfindlich, dass es schon durch Kleinigkeiten in Alarm versetzt wird.[23] Die Wahrnehmung als solche verändert sich, wenn das System darauf programmiert ist, nach Bedrohungen Ausschau zu halten, auch wenn keine vorhanden sind. In Experimenten hat sich auf eindrucksvolle Weise gezeigt, dass chronisch unter- oder übererregte Kinder Bilder von Gesichtern mit neutralem Ausdruck viel häufiger als feindselig einschätzen.
Das ist in einer gefährlichen Umgebung (evolutionär betrachtet) durchaus sinnvoll. Das Problem ist, dass der Alarm immer leichter ausgelöst wird, je öfter er ausgelöst wird. Und leider werden unsere inneren Alarme im Alltag viel zu oft und zu leicht ausgelöst, sodass wir es oft nicht einmal mehr bemerken, wenn es der Fall ist.
Stellen wir uns einen typischen Arbeitstag vor: Der Wecker klingelt, wodurch wir schlagartig in einen Zustand der Übererregung katapultiert werden, insbesondere wenn wir in der vorausgegangenen Nacht schlecht geschlafen oder nicht genug Schlaf bekommen haben. Wir müssen unsere Kinder bei der Morgenroutine antreiben, sie vielleicht zur Schule und dann selbst zur Arbeit fahren, wobei wir mit Menschenansammlungen, Verkehrsstaus, Lärm und Verspätungen zu tun haben. Unsere Stressbelastung ist schon hoch, bevor wir an unserem Arbeitsplatz ankommen.
Vielleicht beruhigt uns eine Tasse Kaffee mit einem süßen Teilchen in der Pause. Es gibt physiologische Gründe dafür, dass eine solche Leckerei beruhigend wirkt, einschließlich positiver emotionaler Assoziationen. Aber vielleicht haben wir Schuldgefühle, wenn wir uns mal wieder etwas Süßes gönnen, und fangen an, uns gegen die Versuchung zu wehren. Schon das Ankämpfen gegen diese Bedürfnisse kann uns in einen Kampf-oder-Flucht-Modus versetzen. Und hinterher (wenn der präfrontale Cortex wieder aktiv ist) auf uns selbst wütend zu sein, weil wir nicht genügend Selbstkontrolle hatten, macht uns umso empfänglicher dafür, in den bekannten und gefürchteten Kampf-oder-Flucht-Zyklus zu geraten.
Die 2500 Jahre alte Vorstellung, dass wir eine Art »Krieg« zwischen unseren höheren Funktionen und unseren Impulsen führen, erweist sich als treffende Metapher für den Zustand, in dem wir uns befinden, wenn wir uns selbst mangelnde Selbstkontrolle vorwerfen.[24] Hinter dem Begriff der Selbstkontrolle steht die Vorstellung, dass man die nötigen »Muskeln« (den »Mumm«, die »Entschlossenheit« oder die »Selbstdisziplin«) entwickeln muss, um in diesem Krieg zu gewinnen. Genauso versuchen wir, wenn es mit dem Kind, dem Partner oder bei der Arbeit hart auf hart geht, unseren Impuls, klein beizugeben, zu unterdrücken. Im Grunde lernt man also, mit einem unangenehmen Gefühl umzugehen, ohne ihm »nachzugeben«. Aber der Preis einer derartigen Auseinandersetzung ist immer hoch, und in diesem Fall fordert er einen hohen Tribut im Hinblick auf unsere Energiereserven.
Dieser Tribut macht sich irgendwann bemerkbar, wenn nicht sofort, dann später, bei einem noch heftigeren Ausbruch negativer Gefühle, einem Anfall von Selbstbelohnung oder in Form eines tiefer gehenden körperlichen oder seelischen Problems. In wissenschaftlichen Experimenten hat sich gezeigt, dass durch die Erhöhung des Stresspegels die Impulse der Versuchspersonen verstärkt werden und ihre Selbstkontrolle abnimmt. Die Selbstregulierung lehrt uns, diese Gefühle als Zeichen einer zu hohen Stressbelastung (das heißt eines im Alarmmodus feststeckenden Systems) zu erkennen, statt sie zu ignorieren. Und was wir deshalb lernen müssen, ist, das Alarmsystem zu deaktivieren.
Der Stresszyklus: Wenn Stressfaktoren das System in die Übersteuerung treiben
Bei der Selbstregulierung geht es nicht darum, eine Reaktion oder ein Verhalten als etwas zu betrachten, gegen das man ankämpfen oder das man unterdrücken muss. Die Frage, die wir uns immer stellen müssen, lautet nicht: »Warum gelingt es mir nicht, diesen Impuls unter Kontrolle zu bekommen?«, sondern »Warum spüre ich diesen Impuls? Warum jetzt?«. In diesem Kontext ist die Selbstregulierung ein wirksames Werkzeug für eine positive und bleibende Veränderung.
Wir reden hier nicht nur von Gelüsten. Vielleicht ist es auch eine dauernde Sorge oder etwas Unspezifisches: ein unbestimmtes Angstgefühl oder eine schwelende Wut, ein aufdringlicher Gedanke oder eine pessimistische Grundstimmung. Die Liste ließe sich fortsetzen: starke Assoziationen, die eine plötzliche Kampf-oder-Flucht- oder Erstarrungsreaktion auslösen, plötzliche Impulse, heftige Emotionen, starke Bedürfnisse.
ENDE DER LESEPROBE





























