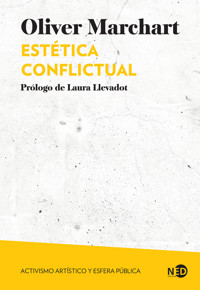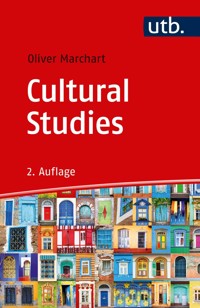25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Anschluss an sein vielbeachtetes Buch Die politische Differenz legt Oliver Marchart nun die komplementäre Studie zum Begriff der Gesellschaft vor. Es gibt schlechterdings kein Konzept, das unter Sozialwissenschaftlern umstrittener wäre als der eigene Grundbegriff. Gilt er den einen als unverzichtbar, so halten ihn die anderen für überflüssig oder gar schädlich. Entlang der Kämpfe um dieses so notwendige wie unmögliche Objekt »Gesellschaft« präsentiert der Autor eine alternative Geschichte der Sozialwissenschaften von Durkheim bis in die Gegenwart. Zugleich wird erstmals eine systematische Zusammenschau der jüngsten »poststrukturalistischen« Sozialtheorien von Foucault über Latour bis Laclau geleistet. Vor diesem Hintergrund präsentiert das Buch ein engagiertes Plädoyer für die Neubelebung der Gesellschaftstheorie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 763
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Im Anschluss an sein vielbeachtetes Buch Die politische Differenz legt Oliver Marchart nun die komplementäre Studie zum Begriff der Gesellschaft vor. Es gibt schlechterdings kein Konzept, das unter Sozialwissenschaftlern umstrittener wäre als der eigene Grundbegriff. Gilt er den einen als unverzichtbar, so halten ihn die anderen für überflüssig oder gar schädlich. Entlang der Kämpfe um dieses so notwendige wie unmögliche Objekt »Gesellschaft« präsentiert der Autor eine alternative Geschichte der Sozialwissenschaften von Durkheim bis in die Gegenwart. Zugleich wird erstmals eine systematische Zusammenschau der jüngsten »poststrukturalistischen« Sozialtheorien von Foucault über Latour bis Laclau geleistet. Vor diesem Hintergrund präsentiert das Buch ein engagiertes Plädoyer für die Neubelebung der Gesellschaftstheorie.
Oliver Marchart ist Professor für Soziologie an der Kunstakademie Düsseldorf. Im Suhrkamp Verlag erschien: Die politische Differenz. Zum Denken des Politischen bei Nancy, Lefort, Badiou, Laclau und Agamben (stw 1956)
Oliver Marchart
Das unmögliche Objekt
Eine postfundamentalistischeTheorie der Gesellschaft
Suhrkamp
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2055
© Suhrkamp Verlag Berlin 2013
© Oliver Marchart 2013
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
eISBN 978-3-518-78700-7
www.suhrkamp.de
5Inhalt
Vorwort: No such thing
1. Einleitung: Gesellschaft ohne Grund? Postfundamentalistische Sozialtheorien zwischen Soziologie und Philosophie
I.Das Soziale und das Ding: vom Objektivismus zum Objekt
2. Gespenstischer Objektivismus Die »spektrale Soziologie« und das überzählige Ding: von Durkheim zu Derrida
3. Das Geheimnis dualistischer Gesellschaften und die Null-Institution Der Strukturalismus überholt sich selbst: von Lévi-Strauss zu Deleuze
4. Das Verschwinden der Gesellschaft in der Flut der Dinge Die Soziologie der Assoziationen: von Tarde zu Latour
5. Gesellschaft als paralogisches Objekt Der Widerstreit und die Extimität von Gesellschaft: Lyotard, Luhmann, Lacan
II.Die Negativität des Sozialen: vom agon zum Antagonismus
6. Kontingenz und Konflikt Konflikttheorie als Gesellschaftstheorie: Nietzsche, Simmel und die Konfliktsoziologen
7. Die Schlacht am Grund der Gesellschaft Zwischen Polemologie und Agonistik: von Weber zu Foucault
68. Gesellschaft als antagonistische Totalität Negativität im Neomarxismus: von Adorno zu Althusser
9. »Gesellschaft existiert nicht« – Figuren des Antagonismus Der Postmarxismus: von Bourdieu zu Laclau und Mouffe
III.Diesseits und jenseits von Gesellschaft Das Soziale und das Politische
10. Postfundamentalistische Sozialtheorien Die Hängung des Mobile: Totalität, Negativität, Ding
11. Die Seinsblockade des Sozialen Gesellschaftstheoretische Grundbegriffe: Macht, Staat, Hegemonie, Praxis
12. Panoramen der Gesellschaftskritik Zeitdiagnostische Konsequenzen: Prekarisierungsgesellschaft und Bewegungsgesellschaft
13. Vom Sozialen zum Politischen Die Entfaltung des Antagonismus: Theorie, Affekt, Protest
Literatur
Namenregister
7Vorwort:No such thing
»There is no such thing as society.« Manchmal findet sich der Commonsense einer Epoche in einem einzigen Sinnspruch verkapselt. Margaret Thatchers berühmter Satz (vgl. Kingdom 1992) bringt die Epoche neoliberaler Deregulierung – samt katastrophischer Folgen, die inzwischen zu besichtigen sind – auf den Punkt. Auf den ersten Blick mag dieser Satz wenig Sinn ergeben. Und doch findet sich in ihm die Ideologie verdichtet, mit der wir heute mehr noch als zu Thatchers Zeiten zu kämpfen haben. Wenn Thatcher nämlich bestreitet, dass so etwas wie Gesellschaft existiert, dann soll dies umgekehrt bedeuten, dass sich die soziale Welt ausschließlich aus Individuen (und bürgerlichen Familien) zusammensetzt, die sich am Markt zu bewähren haben. Soziale Verhältnisse sind nach den Kriterien des betriebswirtschaftlichen Nutzenkalküls und der Wettbewerbsorientierung zu reorganisieren. Schranken und Hemmnisse, die der Bewegung des Kapitals im Wege stehen könnten, müssen abgebaut werden – insbesondere die sozialen Sicherungssysteme. Das Individuum wird freigesetzt, nur um der höheren Macht der Marktgesetzte unterstellt zu werden. Hinter der Formel vom Individuum verbirgt sich im Neoliberalismus – mit Pinochet, Thatcher und Reagan zu Regierungsmacht gekommen und inzwischen zum Einheitsdenken nahezu aller politischen Parteien des Westens avanciert – nichts anderes als der Markt.
Mit Thatchers Satz, »So etwas wie Gesellschaft gibt es nicht«, soll daher gesagt sein: »Es gibt nur Marktakteure.« Die sozialen Verhältnisse sind nach Maßgabe der Gesetze des Marktes und der Bewegungsfreiheit seiner Akteure umzugestalten. Nun besitzt diese Behauptung ein notwendiges Komplement, einen zweiten und nicht weniger berüchtigten Sinnspruch Thatchers: »There is no alternative.«[1] Bis heute hallt dieser Satz in den Verlautbarungen der politischen Funktionseliten nach. Er hat es zu solch negativer Prominenz gebracht, dass er als »TINA-Prinzip« Eingang in den Sprachge8brauch der kapitalismuskritischen Bewegungen fand. Man erkennt sofort, wie er gar keinen zweiten, sondern nur die andere Seite ein und desselben Sinnspruchs darstellt. Denn natürlich gibt es für Thatcheristen genau deshalb keine Alternative, weil jede Entscheidung durch die eisernen Gesetze des Marktes, denen sich niemand entziehen kann, bereits determiniert ist. Der politisch-strategische Gewinn dieser Behauptung ist evident: Die eigene partikulare Politik lässt sich mit Verweis auf höhere Mächte gegen Kritik immunisieren. Aber was sind die theoretischen Implikationen dieses Prinzips? Zunächst impliziert es, dass wir uns die neoliberale Welt als kontingenzlose Welt vorzustellen haben. Kontingent ist, was auch nicht oder anders sein könnte. Das beinhaltet die Möglichkeit von Alternativen. Wo solche nicht möglich sind, dort beginnt das Reich der Notwendigkeit und endet das der Kontingenz. Und weiter bedeutet es, dass jeder Konflikt aus dieser Welt verbannt ist. Denn wo es ohnehin keine Alternativen gibt, dort muss man sich auch nicht um Alternativen streiten. Kontingenz ist an Konflikt gebunden, provoziert Konflikt. Und umgekehrt führt Konflikt zu Kontingenzerfahrung, denn im Zusammenstoß von Alternativen wird erfahrbar, dass die Dinge auch anders liegen könnten. Daher entspricht Thatchers Verleugnung der Gesellschaft der Verleugnung des Politischen. »So etwas wie Gesellschaft gibt es nicht«, heißt zugleich: »Es gibt nichts Politisches.« Oder genauer: Es gibt nicht das Politische – vorausgesetzt, wir verstehen unter dem Politischen die gleichursprüngliche Erfahrung von Kontingenz und Konflikt im Moment des Antagonismus, des Aufeinanderprallens gesellschaftlicher Alternativen.
Eine Epoche, deren Politik in der Verleugnung des Politischen besteht, macht sich daran, gleich die Gesellschaftstheorie mit abzuwickeln. Alles »Soziale« ist aus der Mode gekommen, so Elliott und Turner, die von einem globalen »anti-society sentiment« sprechen (Elliott/Turner 2012: 6). Das trifft nicht zuletzt die Gesellschaftstheorie. Was sollte man auch mit einer Theorie anfangen, deren Gegenstand nicht existiert, oder genauer: nicht existieren darf. Man wird daher auf die Frage, wo die Sozial- beziehungsweise Gesellschaftstheorie heute stehe, wohl mit Heinz Bude antworten müssen: »Sie steht mit dem Rücken zur Wand« (Bude 2001: 66). Das mag eine ganze Reihe von Ursachen haben,[2] die wesentliche Ursache aber, so 9scheint mir, liegt in der Schwächung ihres Grundbegriffs, ist doch die Verdrängung des Konzepts der Gesellschaft durch das ökonomische Modell des Marktes keineswegs auf den politischen Diskurs beschränkt, sondern wiederholt sich in den intellektuellen Operationen sozialwissenschaftlicher Disziplinen. So reduziert sich Gesellschaft etwa für die Rational-Choice-Theorie auf unterschiedliche Märkte, deren Referenzeinheit der seinen Nutzen rational kalkulierende Akteur ist – nicht die Gesellschaft. Aufgrund der Verdrängung gesellschaftstheoretischer Modelle durch das Marktmodell könnten manche sozialwissenschaftliche Disziplinen wie Soziologie und Politikwissenschaften, wo sie überhaupt noch theoretisch interessiert sind, bald in Gefahr geraten, zu Subdisziplinen theoretischer Ökonomie abzusinken oder zu angewandter Mathematik. Mit der Austreibung des Sozialen aus den Sozialwissenschaften wäre deren Schicksal besiegelt. Daher sehen manche Soziologen das Schicksal ihrer Disziplin an deren Grundbegriff gekoppelt: »Ob sie will oder nicht, ›Gesellschaft‹ ist der Grundbegriff der Soziologie, mit dem sie aufgestiegen ist und mit dem sie fallen kann« (Bude 2001: 70).
Aber hat es nicht immer schon Soziologen gegeben, die ohne den Grundbegriff Gesellschaft auskamen, am bekanntesten wohl Simmel und Weber? Und in der Tat, wenn wir unter Grundbegriff einen Begriff von unhinterfragter Gültigkeit oder allgemeiner Akzeptanz verstehen, dann war der Gesellschaftsbegriff ohnehin niemals ein Grundbegriff. Immer schon hatte er einen ausgesprochen prekären Status. Niemals war er das stabile Fundament, auf dem sich die neue Disziplin der Soziologie hätte bauen lassen. Wenn er trotz seiner Ambivalenz und Instabilität den Status eines Grundbegriffs geltend machen kann, dann, so die These, die uns im Folgenden begleiten wird, weil er noch in seiner Abwesenheit anwesend bleibt, das heißt weil selbst die »Soziologien ohne Gesellschaft« Spuren der Vermeidung, der Verleugnung oder gar Verwerfung des von ihnen Ausgeschlossenen zeigen.[3] Der Begriff 10löst sich nicht einfach auf und wird obsolet, weil der wissenschaftliche Fortschritt über ihn hinweggeschritten wäre. Er erweist seine Funktion als Grundbegriff gerade in seiner Persistenz. Und er ist deshalb so persistent (und so prekär), weil er nach wie vor umkämpft ist. Noch die Spuren seiner Abwesenheit sind in Wahrheit Narben, die den Sozialwissenschaften von sozialen Kämpfen beigebracht wurden. Wenn also Thatchers Sinnspruch eine politische Aussage mit theoretischen Implikationen ist, dann ist die sozialwissenschaftliche Umstellung vom Gesellschafts- auf das Marktmodell eine theoretische Operation mit politischen Implikationen. Beide werden – bei aller Spezifik der Felder Politik und Wissenschaft – verbunden durch einen feldüberschreitenden hegemonialen Kampf um die Ausdeutung des Sozialen. Welche Perspektive auf das Soziale, verkörpert in welchem Vokabular, gilt als legitim, als zustimmungs- und konsensfähig, als sagbar und denkbar?
Das Grundvokabular der Sozialwissenschaften ist alles andere als neutral. Es ist politischer Einsatz in einem feldübergreifenden hegemonialen Spiel. In den frühen Zeiten ihrer Durchsetzung ist man sich dieser umkämpften Natur einer Vokabel noch durchaus bewusst. Der Staatsrechtler Robert von Mohl hat von der enormen politischen Aufladung des Gesellschaftsbegriffs in der 1848er-Revolution berichtet. Das vormals unbekannte Wort »Gesellschaft« hallte von den Rednerbühnen und begann – wie ein »Medusenhaupt« (zitiert in Riedel 1975: 842) – Angst und Schrecken zu verbreiten.
Dass von dem Schrecken nichts mehr zu spüren ist, bedeutet nicht, dass die politischen Kämpfe um die Existenz oder Nicht-Existenz von Gesellschaft als Dimension eigenen Rechts vergangen wären. Sie ziehen sich subkutan fort im politischen Diskurs wie in den Debatten um das Selbstverständnis der Sozialwissenschaften. Es soll im Folgenden daher nicht darum gehen, den Begriff der Gesellschaft an einem vermeintlich angestammten Platz in der Sozialtheorie wieder einzusetzen. Einen solchen Platz gibt es nicht und hat es nie gegeben. Es wird vielmehr darum gehen, Gesellschaft als explizit politischen Begriff für die Sozialtheorie zu exponieren, wenn nicht sogar als notwendigen Komplementärbegriff des Politischen. Was zugleich heißt: ihn politisch zu exponieren in einer Weise, die den eigenen Einsatz innerhalb der hegemonialen Kämpfe der Zeit bewusst hält.
Mit dieser Absicht schließe ich an Die politische Differenz, meine 11Studie zu den Begriffen des Politischen und der Politik an (Marchart 2010a). Die kategoriale Differenzierung zwischen la und le politique ist vor allem mit den Arbeiten der französischen »heideggerianischen Linken« zu Prominenz gekommen, so etwa bei Autoren wie Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe, Claude Lefort, Alain Badiou, Jacques Rancière, Ernesto Laclau und Chantal Mouffe. Bei allen individuellen Unterschieden verfolgen sie ein postfundamentalistisches Denken des Politischen. Der Begriff des Postfundamentalismus, im Englischen als post-foundationalism wesentlich geläufiger, verweist darauf, dass die moderne Abwesenheit letzter Gründe (wie Gott, Vernunft oder Geschichte) nicht mit der Abwesenheit aller Gründe verwechselt werden darf – das wäre ein bloßer Antifundamentalismus. Stattdessen trägt der Begriff des Postfundamentalismus dem Umstand Rechnung, dass notwendig kontingente Gründe immer wieder aufs Neue gefunden und gelegt werden müssen, auch wenn sie sich als noch so temporär, partiell und instabil erweisen sollten. In besagter Studie ging ich von der Hypothese aus, dass die in der aktuellen Theorie markierte politische Differenz – das Spiel zwischen Politik und dem Politischen– als ein Symptom dieser ultimativen Abgründigkeit des Sozialen verstanden werden muss. Der Begriff des Politischen war eingeführt worden, so meine Vermutung, weil die Frage der Institution des Sozialen nicht länger einem einzigen sozialen Funktionssystem – der Politik – überlassen werden konnte. Alle sozialen Verhältnisse sind, einmal als kontingent erkannt, auf ihre (Re-)Fundierung angewiesen. Um dies zu bezeichnen, erwiesen sich herkömmliche Politikbegriffe als unzureichend, da zu eng gefasst. Ein Begriff des Politischen war erforderlich geworden, um auf die Dimension der Gründung aller Bereiche des Sozialen – unter Bedingungen ultimativer Ungründbarkeit – hinzuweisen.
Diese Überlegungen warfen freilich die Frage nach dem »Gegenstück« der Politik und des Politischen, nämlich nach dem Sozialen beziehungsweise der Gesellschaft auf. Reicht es hin, einfach die Ungründbarkeit des Sozialen und damit auch die Unmöglichkeit von Gesellschaft als Totalität und Fundament zu postulieren? Oder erfordern die postfundamentalistischen Theorien des Politischen nicht vielmehr eine sozial- und gesellschaftstheoretische Ergänzung? Denn was genau ist dieses Etwas, die Gesellschaft, das von ihnen als ungründbar vorausgesetzt wird? Von den oben 12genannten Denkern des Politischen kann (mit Ausnahme von Laclau) keine Antwort auf diese Frage erwartet werden.[4] Diese Vernachlässigung der Gesellschaftstheorie ist kein Zufall. Gerade bei den französischen Autoren ist seit den späten 1970er Jahren eine innertheoretische Umorientierung vom Sozialen zum Politischen feststellbar. Denn nachdem es, wie Kari Palonen bemerkt, in der Nachkriegszeit innerhalb der meisten theoretischen Traditionen – nicht nur der marxistischen – als Selbstverständlichkeit gegolten hatte, Politik als ein soziales Phänomen zu definieren und somit der Kategorie der Gesellschaft unterzuordnen, begann seit den späten 1970er Jahren mit der Rede vom »Ende des Sozialen« (Baudrillard 2010) wie auch in historischen Studien (Donzelot 1984) die »Abwehr eines substantiellen und totalisierenden Begriffs der Gesellschaft beziehungsweise des Sozialen, den man bis dahin als die große Errungenschaft der Sozialwissenschaften gefeiert hatte« (Palonen 1998: 18). Die Emanzipation von totalisierenden Figuren der Gesellschaft war Voraussetzung für die darauf folgende Emanzipation der Kategorie des Politischen.[5] Palonen spricht von »Entgesellschaftung« als »Herausforderung zum Entwerfen eines neuartigen Begriffs des Politischen« (ebd.).
So nachvollziehbar diese historische Absetzungsbewegung von fundamentalistischen Sozial- und Gesellschaftstheorien – etwa vom deterministischen Basis-Überbau-Modell des Marxismus – sein mag, sie übersieht doch, dass der Gesellschaftsbegriff ein notwendiges Komplement des Begriffs des Politischen bleibt. Die Theorien der Politik und des Politischen sind durch ihre, wenn man so will, andere Seite, also hinsichtlich des Sozialen und der Gesellschaft zu ergänzen. Sozial- und Gesellschaftstheorie zu ignorieren oder gar zu bekämpfen, wie dies bei prominenten Autoren wie Jacques Rancière oder Alain Badiou der Fall ist, ist keine produktive Option. Vielmehr muss es darum gehen, einen gemeinsamen Resonanzraum herzustellen für postfundamentalistische Theorien des Politischen und solche des Sozialen und der Gesellschaft. Zu diesem Zweck werde ich im Folgenden eine ganze Reihe von sozialwis13senschaftlichen Ansätzen hinsichtlich ihres Beitrags zu einer postfundamentalistischen Theorie der Gesellschaft und des Politischen evaluieren: Unter ihnen, um nur die prominentesten zu nennen, die strukturale Anthropologie Claude Lévi-Strauss’, die Soziologie der Assoziationen Bruno Latours, die Sozialtheorie des Widerstreits Jean-François Lyotards, die soziologische Systemtheorie Niklas Luhmanns, die lacanianische Sozialtheorie, wie man sie etwa bei Slavoj Žižek oder Yannis Stavrakakis findet, die nietzscheanischen Traditionen der soziologischen Konflikttheorie einschließlich der Genealogie Michel Foucaults, sowie im Besonderen die neo- und postmarxistischen Ansätze von Theodor W. Adorno über Louis Althusser und Pierre Bourdieu bis Ernesto Laclau, dessen gemeinsam mit Chantal Mouffe entwickelte Hegemonietheorie noch am ehesten das missing link zwischen politischer Theorie und Sozial- und Gesellschaftstheorie beisteuern kann.
Viele dieser Ansätze teilen ein auffälliges Merkmal: Ihre Kritik der fundamentalistischen Gesellschaftskonzeptionen führt weder zur völligen Verabschiedung eines jeglichen Gesellschaftsbegriffs noch zu seiner auftrumpfenden Wiedereinführung. Die Gesellschaft kehrt zurück, aber sie kehrt nicht zurück mit pomp and circumstances, sondern in paradoxer Gestalt: als ein unmögliches Objekt. Die aktuellen Theorieangebote, einige jedenfalls, haben die Furcht vor einem solch unmöglichen Objekt verloren. Frühere Soziologien hatten den Kollektivsingular Gesellschaft zurückgewiesen als Hypostasierung, Fiktion und metaphysische Altlast, die von Rechts wegen nicht existieren dürfe (was diesen Gegenstand dennoch nicht daran hinderte, immer wieder zurückzukehren). Inzwischen ist es möglich geworden, in Gesellschaft eine Figur der Ungründbarkeit zu sehen, die dennoch – oder deshalb – zum paradoxen Fundament des Sozialen taugt. Denn wie gesagt: Im Postfundamentalismus verschwindet die Frage nach den Fundamenten des Sozialen nicht spurlos. Ihre kontingent-konflikthafte Natur tritt in den Vordergrund. Als Figur der ultimativen Ungründbarkeit des Sozialen verhilft Gesellschaft einem Grund zur Anwesenheit, der immer wieder – wenn auch nur partiell und vorübergehend – im Konflikt mit konkurrierenden Fundierungsversuchen instituiert werden muss. Wie wir sehen werden, klinkt an genau dieser Stelle das postfundamentalistische Konzept des Politischen ein.
Die vorliegende Untersuchung begibt sich also auf die Spuren 14des unmöglichen Objekts Gesellschaft. In der Sequenz der Argumente folgt sie daher nicht auf meine frühere Studie Die politische Differenz, sondern ist, was man in Hollywood ein prequel nennt: die nachgelieferte Vorgeschichte.[6] Sie untersucht die gesellschaftstheoretischen Voraussetzungen für die These von einer an Heideggers ontisch-ontologischer Differenz orientierten politischen Differenz, wie sie viele aktuelle Theorien des Politischen bestimmt. Damit antwortet sie zugleich auf ein deutlich wahrnehmbares Desiderat nicht nur im Denken des Politischen. Denn in den letzten Jahren wurden poststrukturalistische Ansätze auch intensiv in den Sozialwissenschaften rezipiert (vgl. einführend Stäheli 2000a; Moebius 2003; Reckwitz 2006, 2008). Inzwischen liegen ausgezeichnete Einzelstudien vor und sogar ein Sammelband, der Grundbegriffe und Forschungsfelder der poststrukturalistischen Sozialwissenschaften vorstellt (Moebius/Reckwitz 2008). Was bislang allerdings fehlt, ist eine vergleichende Zusammenschau der wichtigsten Ansätze. Das soll hier nicht im Sinne einer bloßen Einführung geleistet werden, und schon gar nicht mit dem Anspruch umfassender Darstellung. Eher wird eine symptomale Lektüre dieser Ansätze erprobt. Das heißt: Wir werden jene neuralgischen Punkte aufsuchen, an denen sich Gesellschaft dem theoretischen Zugriff – und das schon bei den Klassikern – entzieht.[7] Jene Punkte, an denen Gesellschaft zwischen An- und Abwesenheit zu oszillieren beginnt – und sich damit zu erkennen gibt als Symptom der ultimativen Grundlosigkeit wie Gründungsbedürftigkeit des Sozialen.
151. Einleitung: Gesellschaft ohne Grund? Postfundamentalistische Sozialtheorien zwischen Soziologie und Philosophie
1.1. Der gestrandete Wal: Die Monstrosität von Gesellschaft
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die Gesellschaft. Aber um welche Art von Gegenstand handelt es sich hier? Die Sozialwissenschaften bieten auf diese Frage keine eindeutige Antwort; offenbar ist ihr Verhältnis zu dem Begriff überaus gespannt.[1] An ihm haftet etwas vom Odeur der Scharlatanerie, die achtbare Empiriker und selbst viele Sozialtheoretiker auf Distanz gehen lässt. Deshalb waren Sozialwissenschaftler, wie Bruno Latour anmerkt, immer schon bestrebt, ihre Untersuchungen aus dem Schatten der Gesellschaft zu rücken. Nur gelungen sei es ihnen nie. Obwohl sie immer wieder behauptet hätten, »daß Gesellschaft eine virtuelle Realität, eine cosa mentale, eine Hypostase, eine Fiktion sei«, hätten sie sich doch nur ihre eigene Nische eingerichtet in diesem »virtuellen und totalen Körper, von dem sie behaupteten, er existiere nicht wirklich«. Gesellschaft wurde zu etwas, »was stets als eine Fiktion kritisiert wurde und was gleichwohl immer da war als unüberschreitbarer Horizont aller Diskussionen über die soziale Welt« (Latour 2007: 282f.). Gesellschaft wurde, mit anderen Worten, zu einem unmöglichen Objekt. Nun sei die Zeit gekommen, so Latour, dieses Objekt endgültig zu verabschieden:
Was immer die Lösung war, die Gesellschaft lag, gestrandet wie ein Wal, wie ein Leviathan, an einem Meeresstrand, wo liliputanische Sozialwissenschaftler versuchten, eine passende Bleibe für ihn zu graben. Seit kurzem ist der Gestank dieses verwesenden Monsters unerträglich geworden. Es gibt keine Möglichkeit, die Sozialtheorie zu erneuern, solange der Strand nicht gesäubert und der unselige Gesellschaftsbegriff nicht vollständig aufgelöst ist. (Ebd.: 283)
16Nun ist Latour, wie wir in Kapitel 4 sehen werden, in Wahrheit weit davon entfernt, den Gesellschaftsbegriff, wie hier angekündigt, aus seiner eigenen Sozialtheorie zu verbannen. Doch mit seinem Hang zu drastischen Formulierungen hat er ein deutliches Bild dieses Gegenstands gezeichnet, der im Regelbetrieb empirischer Sozialwissenschaften als ein überflüssiger Fremdkörper aufscheint. Als »gestrandeter Wal«, um bei Latours Metaphorik zu bleiben, ist Gesellschaft nämlich ein Ding anderer Natur und anderen Ausmaßes als alle positiv beschreibbaren Gegenstände des Sozialen. Zum Monster wird es zunächst aufgrund seiner bloßen Monumentalität und also seines Totalitätsanspruchs. Die Zeiten sind vorbei, in denen man mit einem solchen Großobjekt noch ungehindert operieren konnte. Latour begnügt sich allerdings nicht mit der Kritik am Totalitätsanspruch des Begriffs. In der Szene, die er beschreibt, verströmt Gesellschaft einen unerträglichen Gestank der Verwesung. Das Objekt stört und irritiert. Man gewinnt den Eindruck, Aasvögel würden bereits über ihm kreisen. Sein ekelerregender Zustand lässt die Sozialwissenschaft nach Abtransport rufen. Der Strand soll gesäubert, die Seuchengefahr gebannt, der geregelte normalwissenschaftliche Badebetrieb wieder aufgenommen werden.
Der Begriff der Gesellschaft, so das Fazit dieser Fabel, hat sich nach seinem Ableben nicht einfach in Luft aufgelöst. Ulrich Beck spricht von einer dem Erfahrungshorizont des 19.Jahrhunderts entstammenden »Zombie-Kategorie«, die als »lebend-tote« Kategorie nach wie vor herumspukt (Beck 2000: 16). Auch bei Latour macht sich ihr Kadaver unangenehm bemerkbar – und wir werden im Folgenden einige Hypothesen aufstellen, warum er das tut. Selbst für jene, die ihn verleugnen, gleicht er dem, was man im Englischen als »elephant in the room« bezeichnet. Ein Objekt enormen Ausmaßes, dessen Existenz ostentativ ignoriert wird, während ihm zugleich alle auszuweichen bemüht sind. Man fühlt sich an Margaret Thatchers Sinnspruch »There is no such thing as society« im politischen Diskurs erinnert, die damit ein Monster zu begraben aufruft, das doch angeblich gar nicht existiert. Bei solchen Formeln handelt es sich, wie wir sehen werden, um eine Art Exorzismus, das heißt um die spiritistische Beschwörung dessen, was man auszutreiben vorgibt. In dieser Hinsicht ist Latour der letzte in einer langen Reihe von Sozialwissenschaftlern, die sich an diesem Objekt stoßen; er ist aber nicht der erste, der auf dessen unheimlichen Charakter 17aufmerksam wird. Bereits in den 1920er Jahren hat Leopold von Wiese den Objektbereich seiner um Anerkennung kämpfenden Disziplin, die Gesellschaft, als ein »Ungeheuer und Riesenrätsel« bezeichnet (zitiert in Müller-Doohm 1991: 48).[2] Wenige Jahre zuvor hatte Max Scheler diagnostiziert, dass Gesellschaft – basierend auf vertragsförmigen Vereinbarungen – »nur der Rest, der Abfall ist, der sich bei den inneren Zersetzungsprozessen der Gemeinschaften ergibt« (Scheler 1978 [1912]: 106).[3] Die tönniessche Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft wird von Scheler so weit radikalisiert, dass Gesellschaft als bloßes Verfallsprodukt einer sich zersetzenden organischen Ganzheit erscheint. Verglichen mit dem Idealbild der verlorenen Gemeinschaft wird Gesellschaft zum Abjekt im Sinne Kristevas (1980), zu einem Ekel oder gar Schrecken auslösenden Gegenstand (das noch harmloseste Beispiel Kristevas für ein Abjekt ist die Haut auf der Milch).
Dieses Abjekt Gesellschaft hat immer wieder, wenn nicht Ekel oder Schrecken, so doch Irritationen hervorgerufen. Etwas näher an unserer Zeit treffen wir auf Ralf Dahrendorf, der es in Anlehnung an Durkheim wiederholt mit der Formel vom »Ärgernis der Tatsache der Gesellschaft« belegt (Dahrendorf 1974: 48; vgl. die Kapitel 2 und 7 in diesem Band). Im Alltag erfahren wir unsere soziale Umwelt nicht immer als stabil und verlässlich. Allzu oft stößt unsere Primärerfahrung an etwas Widerständiges: »Gesellschaft ist so allgegenwärtig und zugleich so resistent, daß wir uns ständig an ihr stoßen und reiben« (Dahrendorf 1974: 50). Sie setzt uns im Alltag Grenzen, wie etwa Grenzen der sozialen Mobilität, die erst zu Bewusstsein kommen, sobald wir sie erfolglos überschreiten wollen. Die soziologische Analyse müsse an genau dieser Primärerfahrung der »ärgerlichen Tatsache« namens Gesellschaft anknüpfen:
18[I]mmer sind es soziale Widerstände, die zwischen uns und die Verwirklichung unserer Wünsche treten: die Tatsache der Gesellschaft als Ärgernis. Dies ist keine Floskel. Gesellschaft ist nicht darum schon Ärgernis, weil wir uns gelegentlich über sie ärgern oder weil ihre Normen uns unbequem sind. Gesellschaft ist Ärgernis, weil sie uns zwar durch ihre Wirklichkeit entlastet und vielleicht überhaupt erst die Ausdrucksmöglichkeiten des Lebens gibt, weil sie aber andererseits uns stets und überall mit unüberschreitbaren Wällen umgibt, in denen wir uns einrichten, die wir bunt bemalen und bei geschlossenen Augen fortdenken können, die jedoch unverrückbar stehen bleiben. Gesellschaft ist eine ärgerliche Tatsache, weil wir an sie anrennen wie an eine Mauer – und dies nicht aus Starrköpfigkeit oder Dummheit, sondern im normalen Gang des Lebens. Ihre Unausweichlichkeit macht die Tatsache der Gesellschaft zum Ärgernis. (Ebd.: 50)
Es ist erstaunlich, dass Soziologie und Sozialtheorie kaum Augenmerk darauf gelegt haben, dass sich die von Durkheim bis Dahrendorf immer schon beschriebene Primärerfahrung der Resistenz des Sozialen innerhalb der Sozialwissenschaften an deren Gegenstand wiederholt. Der theoretische Begriff Gesellschaft – ein »verwesendes Monster« – löst nämlich in der Soziologie kaum geringere Irritationen aus als die »ärgerliche Tatsache« der Gesellschaft in unserem Alltagserleben. Niemals konnte sich ein Konsens darüber etablieren, ob die Soziologie überhaupt ein Konzept von Gesellschaft benötigt. Kaum ein soziologischer Begriff, der auf schwächeren Beinen stünde als ihr Grundbegriff. Die Klassiker Weber und Simmel kommen weitgehend ohne ihn aus. Für Sozialphänomenologie, symbolischen Interaktionismus, Ethnomethodologie oder andere Formen der Mikrosoziologie ist Gesellschaft allenfalls ein peripheres Konzept, da das Soziale »von unten« her durch eine Unzahl einzelner Interaktionen aufgebaut ist und sich nie zu einem überwölbenden Kollektivbewusstsein à la Durkheim totalisieren kann.[4] Für die »Neo-Positivisten« der 1960er Jahre ist Gesellschaft ein Konzept, das sich nicht zweckmäßig abgrenzen lässt, in einer empirischen Einzelwissenschaft folglich nichts verloren hat und bestenfalls Sozialphilosophen überlassen werden kann (Scheuch 1969). Gegen Hans Albert, René König und Helmut Schelsky ver19wies die kritische Theorie freilich auf die Unentbehrlichkeit des Konzepts. Doch als »antagonistische Totalität«, wie von Adorno theoretisch gefasst, hält sich Gesellschaft nur durch ihre Widersprüche hindurch am Leben und ist nie anders greifbar als in den Entfremdungserfahrungen, die ähnlich auch Durkheim und Dahrendorf beschreiben.
Es hat sich somit als schwierig, wenn nicht unmöglich erwiesen, das irritierende Ding Gesellschaft sozialtheoretisch auf den Begriff zu bringen. Während die einen dessen Notwendigkeit schlicht abstritten, konnten die anderen den Begriff nur um den Preis seiner Paradoxierung zentral stellen. Denn der Begriff der »antagonistischen Totalität« ist letztlich eine paradoxe, ihre paradoxale Struktur als »dialektisch« missverstehende (und damit deparadoxierende) Formel, und wir werden einer Vielzahl weiterer paradoxer Formeln begegnen, da Gesellschaft sozialtheoretisch nach wie vor als ein zugleich notwendiges und unmögliches, zugleich überzähliges und unterzähliges Objekt konstruiert wird. Weil Soziologen aber, abgesehen von wenigen Ausnahmen wie etwa Luhmann, nur selten ein entwickeltes Organ für die Paradoxien besitzen, die ihrer eigenen Unternehmung zugrunde liegen, blieb auch der paradoxe Charakter dieses Grundbegriffs lange Zeit unbemerkt. Zwar wurde die ärgerliche Primärerfahrung der ontologischen Resistenz sozialer Verhältnisse immer wieder diagnostiziert, die eigene Primärerfahrung der theoretischen Resistenz des soziologischen Grundbegriffs rückte als solche jedoch kaum in den Blick.
1.2. Soziologie als Kampfplatz
Die theoretische Resistenz des Gesellschaftsbegriffs steht in direktem Verhältnis zu seiner Umstrittenheit. Gewiss, umstritten war der sozialwissenschaftliche Gesellschaftsbegriff immer schon. Aber erst in jüngerer Zeit tritt der strittige und prekäre Charakter des Gegenstands überhaupt in den Blick. Erst jetzt fällt auf, dass im Zuge der disziplinären Etablierungsgeschichte der Sozialwissenschaften, insbesondere der Soziologie, die Absage an eine Gesellschaftstheorie, die womöglich gar den (sozial-)philosophischen Anspruch auf umfassende Erkenntnis der Natur des Sozialen erheben würde, eine wiederkehrende Konstante bildet (so Lichtblau 2001: 17; 20siehe auch Tyrell 1994; Stäheli 1995; Schwinn 2011). Es ist wohl kein Zufall, dass der durchgängige Streit um den Grundbegriff der Gesellschaft erst im Zuge der gegenwärtigen Selbstverständigungskrise der Soziologie thematisch wird. Stefan Müller-Doohm hat in seinen »Notizen zum Gegenstandsverlust einer Disziplin« die Vermutung geäußert, die Soziologie könnte letztlich zu Irrelevanz verdammt sein, sollte sich ihr Gegenstand Gesellschaft verflüchtigen (Müller-Doohm 1991: 70). Angetrieben werde die soziologische Gegenstandsverflüchtigung durch Parzellierung der Disziplin in Bindestrichsoziologien und voneinander abgeschottete Sektoren der Theorie, Methodologie, Empirie und Zeitkritik. Weite Teile der empirischen Sozialforschung seien auf die anwendungsfixierte Anhäufung von Planungswissen eingeschworen. Daher gelte der empirischen Sozialforschung »das Begreifen der Gesellschaft als ganzer, ihrer Struktur und Funktionsweise als ebenso suspekt, wie sie eine Theorie der Gesellschaft als Theorie des Zeitalters für reine Spekulation hält und von vornherein Abstand davon nimmt« (ebd.: 52).
Das von Müller-Doohm und anderen diagnostizierte »Unbehagen an der Soziologie« (Rehberg 2010) ist natürlich so alt wie die Disziplin selbst. Auch die Rede von der Krise der Soziologie ist keineswegs neueren Datums, hatte doch Alvin Gouldner eine solche Krise bereits 1970 konstatiert – dabei sollte die Soziologie damals ihr goldenes Jahrzehnt erst vor sich haben (Gouldner 1974). Spätestens ab diesem Punkt war Soziologie – vielleicht nicht zuletzt aufgrund ihres vorübergehenden Erfolges – sich selbst zum Ärgernis geworden. In der Bundesrepublik ließen in den 1970er und frühen 1980er Jahren selbsternannte »Anti-Soziologen« wie Schelsky (1975; 1981) und Tenbruck (1980) mit ihrer Radikalkritik der Soziologie und des Gesellschaftsbegriffs aufhorchen. Kaum eine andere wissenschaftliche Disziplin, so wird heute konstatiert, sei »so uneins mit sich selbst, keine andere geht so hart mit sich ins Gericht, bis hin zur Proklamation von Anti-Soziologien« (Merz-Benz/Wagner 2001: 17).[5] Wenn vor diesem Hintergrund verallgemeinerter Un21einigkeit der Begriff der Gesellschaft überhaupt noch den Status eines Grundbegriffs geltend machen kann, dann jedenfalls nicht im Sinne eines gemeinsamen Fundaments, noch nicht einmal im Sinne eines kleinsten gemeinsamen Nenners. So ist es nur konsequent, wenn Georg Kneer und Stephan Moebius letztendlich vorschlagen, jede Idee von einer positiv bestimmbaren Identität der Disziplin aufzugeben (Kneer/Moebius 2010). Die Soziologie gründe in keiner überwölbenden Problematik und in keinem vereinheitlichenden Paradigma (oder einer Folge von Paradigmen), zerfalle aber umgekehrt auch nicht in gänzlich unverbundene Sektoren, Konzeptionen oder Schulen. Was hält dann die Soziologie als Disziplin zusammen? Der überzeugende Vorschlag von Moebius und Kneer lautet, dass die Verbindungen zwischen ihren auseinanderstrebenden Momenten in beträchtlichem Ausmaß gerade durch innersoziologische Kontroversen geknüpft werden. Es sind entsprechend dieser an Simmels Konflikttheorie angelehnten Perspektivumkehr gerade die grundlagentheoretischen Debatten (des Werturteilsstreits, der Rollendebatte, des Positivismusstreits, der Habermas-Luhmann-Debatte usw.), die zur Identität der Disziplin beitragen und sie nicht etwa gefährden; es ist die Uneinigkeit, die ein minimales Maß an Einigung produziert.
Die disziplinäre Identität der Soziologie kann somit bestimmt werden als Schnittmenge von Konfliktkonstellationen – Moebius und Kneer sprechen von »agonalen Diskursformationen« (Moebius/Kneer 2010: 8).[6] Wenn wir uns diesem Perspektivwechsel anschließen wollen, wird sich auch die Perspektive auf den Gesellschaftsbegriff verschieben. Er dient der Soziologie, und in geringerem Maße den anderen Sozialwissenschaften, nicht deswegen als Grundbegriff, weil er ein stabiles, unumstrittenes Fundament bereitstellen würde, sondern gerade weil sich deren disziplinäre Identität wesentlich im Streit um seine Konturen, ja um seine Notwendigkeit oder Überflüssigkeit herausgebildet hat. Mit seiner Verleugnung oder Verteidigung ist daher immer ein bestimmter Einsatz verbunden, eine Verschiebung oder Verfestigung der 22Frontlinien im Konfliktraum der Sozialwissenschaften. Und zwar mehr noch, so meine These, als mit jedem anderen Begriff. Betrachten wir nur beispielhaft die Konfliktkonstellation, wie sie sich am Höhepunkt der bundesrepublikanischen Auseinandersetzung um den Gesellschaftsbegriff darstellt. Alex Demirovic hat darauf hingewiesen, wie sehr mit dem Auftritt Luhmanns in den späten 1960er Jahren die Karten neu gemischt und die Kräfteverhältnisse innerhalb der Soziologie in Form einer unwahrscheinlichen Allianz verschoben wurden, die sich letztlich selbst wiederum in einen Streit kleidete. Historische Ausgangslage war folgende: Die »Soziologensoziologie« der 1950er und 1960er Jahre hatte gegen die Kritische Theorie mobil gemacht bis hin zu dem Vorwurf, diese würde auf den Bürgerkrieg in der Soziologie (und wohl nicht nur in der Soziologie) hinarbeiten. Festmachen ließen sich die vorgeblich totalitären Ziele der Kritischen Theorie an deren Gesellschaftsbegriff. Dass die Frankfurter Schule auf einen hegel-marxistischen Begriff von gesellschaftlicher Totalität zurückgriff, galt als unwissenschaftlich, metaphysisch, ja potenziell totalitär, da Spekulationen über das Ganze der Gesellschaft sich der Falsifikation entziehen (Demirovic 2001: 23). Mit Luhmann erwuchs der Kritischen Theorie in dieser Hinsicht ein unerwarteter Verbündeter. Mit ihm begann ein Soziologe am Projekt der Gesellschaftstheorie zu arbeiten, der, wie Demirovic unterstreicht, gerade aus der »revolutionär-konservativen Theorietradition, die von Freyer, Gehlen und Schelsky repräsentiert wurde« (ebd.), hervorgegangen war, die dieses Projekt bekämpfte. So konnte über die offen ausgestellten Differenzen hinweg im soziologischen Debattenraum eine gesellschaftstheoretische und philosophieaffine Achse gebildet werden.
An diesem Beispiel lässt sich erkennen, dass mit dem Konflikt um den Gesellschaftsbegriff ein größerer und nicht nur innerwissenschaftlicher Einsatz verbunden ist. Was in der Debatte mitlaufend verhandelt wurde, war nichts weniger als die politische Konstellation der Bundesrepublik – darauf deutet schon die von konservativer Seite lancierte Bürgerkriegsmetaphorik hin. Schließlich umfasste das Feld debattierender Akteure ehemalige Nazis wie Freyer und Gehlen genauso wie ehemalige Emigranten, darunter wiederum neo-marxistische wie Horkheimer und bürgerliche wie König, die jeweils sehr unterschiedliche Vorstellungen von gesellschaftlicher Ordnung hatten. Zwischen den ungleichen Gesell23schaftsverteidigern Habermas und Luhmann wurde – zum späteren Verdruss Luhmanns – erneut eine Konfliktlinie eingezogen: diesmal zwischen kritischer Gesellschaftstheorie und »Sozialtechnologie« (Habermas/Luhmann 1971; Füllsack 2010). Verbunden blieben sie dennoch durch die gemeinsame Distanz gegenüber soziologischen Ansätzen, die jegliche Gesellschaftstheorie verabschieden wollten. Im umkämpften Theorieobjekt Gesellschaft, an dem letztlich alle irgendwie zerrten, verdichteten sich so im Feld der Soziologie soziale und politische Kämpfe um die Ausdeutung der ärgerlichen Tatsache – in diesem Fall des ungreifbaren »Objekts« bundesrepublikanischer Nachkriegsrealität, dessen Konturen, je nach Standpunkt, konservativ, positivistisch, kritisch oder funktionalistisch modelliert werden konnten.
Wir müssen also die Beobachtung von Moebius und Kneer ergänzen. Es trifft zu, dass die Soziologie, wie jede andere Sozialwissenschaft (und natürlich auch die Philosophie), letztlich ein Kampfplatz ist. Sie findet ihre disziplinäre Identität in keinem stabilen Kern, sondern in den Auseinandersetzungen, die sie bestimmen. Aber sie ist dies nur als Teil eines größeren Kampfplatzes, da die gesellschaftlichen Konflikte nicht vor den Toren von Soziologieinstituten haltmachen. Dieselben Antagonismen durchziehen das Soziale und die Soziologie, nur brechen sie sich an den feldspezifischen Grenzen und werden den systemspezifischen Logiken, Programmen oder Codes entsprechend abgelenkt und reformatiert, weshalb kein Antagonismus eine gerade Linie durch den sozialen Raum zieht, sondern immer nur eine frakturierte. Vielleicht liegt es an nachlassenden gesellschaftsdiagnostischen Fähigkeiten, dass wir solche Konfliktlinien immer weniger lesen und nachzeichnen können, vielleicht liegt es aber auch an der zunehmenden Frakturierung, Multiplizierung und wechselseitigen Durchkreuzung der Konfliktlinien, dass wir heute, wie Klaus Lichtblau zu Recht anmerkt, das Bewusstsein um die Tatsache verloren haben, »daß die Grundbegriffe der modernen Soziologie einstmals politische Kampfbegriffe innerhalb der Konfrontation der großen weltanschaulichen Lager waren, mit denen zugleich zentrale Richtungsentscheidungen bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Sozialwissenschaften verbunden gewesen sind« (Lichtblau 2011: 12). Kein Begriff der Sozialtheorie, der nicht zugleich Gegenstand sozialer Kämpfe wäre.
24Im historischen Rückblick wird dies womöglich deutlicher. Man muss sich nur vor Augen führen, dass der moderne Gesellschaftsbegriff seine Anfänge im Kampf des Bürgertums um eine autonome Sphäre des Geschäftsverkehrs nimmt. So besitzt auch das wissenschaftliche Konzept der Gesellschaft seine Wurzeln nicht zufällig in der Nationalökonomie. Und doch wird sehr bald der bürgerlichen Konfliktlinie eine erste Fraktur beigebracht. In Folge der Französischen Revolution und mit den sozialrevolutionären Bewegungen der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts wird der Gesellschaftsbegriff auch durch nicht-bürgerliche Schichten in Anspruch genommen. Seine Natur als Kampfbegriff tritt damit umso deutlicher in den Vordergrund.
Wie begriffsgeschichtliche Studien zeigen, wird Saint-Simons und Fouriers Idee der Assoziation, die auch im Marxschen Vokabular eine wichtige Rolle spielen wird, in den 1830er Jahren mit dem Begriff der »Vergesellschaftung« in den deutschen Sprachraum überführt. In den 1840er Jahren fasst der Hegel-Schüler Moritz Veit in der Sprache der aufbrechenden sozialen Bewegung Gesellschaft als den »gährende[n], keimende[n], treibende[n] Inhalt« des Staates, »die lebendige Materie, die ewig die Form aus sich gebiert« (zitiert in Riedel 1975: 839). Damit war Gesellschaft nicht länger Begriff für eine Zone ungehinderten Kommerzes; Gesellschaft war zum sozialen Bewegungsbegriff geworden.
Historisch erstmalig treffen wir hier auf das Bild des monströsen Abjekts: Als revolutionäres Synonym sozialer Bewegung wird Gesellschaft zur gärenden, keimenden und treibenden, zu einer lebendigen Materie. In Form »gebärender« Zersetzung ist sie materieller Inhalt der Staatsform und droht zugleich die überkommene Ordnung zu überwuchern und zu sprengen. Zum ersten Mal treffen wir folglich auch auf jenes typische Unbehagen, das solche Monstrosität bei der gegnerischen Seite auslöst und die um Anerkennung kämpfende Soziologie bis hinein ins 20.Jahrhundert begleiten wird.[7] Denn sofern mit der Soziologie »›die Gesellschaft‹ nun auch theoretisch Priorität beansprucht vor den traditionellen Mächten der Familie, des Staates und der Kirche« (Rehberg 2010: 217), wur25de in ihr eine Bedrohung der Ordnung vermutet. Noch war man sich nämlich der politischen Seite des Begriffs durchaus bewusst. Das Unbehagen an ihm konnte sich bis hin zu einer wahren Gesellschaftspanik steigern. Das ist mit unüberbietbarer Deutlichkeit bei Robert von Mohl ausgedrückt, in dessen Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften von 1855 es mit Bezug auf die 1848er-Revolution heißt:
Da wurde denn endlich das Wort Gesellschaft ausgesprochen. Zuerst von Schwärmern und ihren Schülern; dann aber allmählich auf der Rednerbühne, in der Schenke und in den heimlichen Versammlungen Verschworener; es ward in entsetzlichen Straßenschlachten als Banner vorangetragen. Jetzt öffneten sich plötzlich die Augen. Die gänzliche Nichtbeachtung schlug in maßlosen Schrecken um, so daß nun das früher ganz unbekannte Wort als Medusenhaupt dient, welches die Freiheitsgewohnheiten und Forderungen der Gebildeten und Gemäßigten versteinert. (Zitiert in Riedel 1975: 842)
Nichts ließ zu jenem Zeitpunkt erahnen, dass die Gesellschaft, deren Medusenhaupt »maßlosen Schrecken« verbreitete, eineinhalb Jahrhunderte später als lebloser Kadaver an den Strand der Sozialwissenschaften gespült werden wird. Heute scheint das Wort – nicht zuletzt durch ubiquitären Gebrauch – domestiziert. Es scheint seine Sprengkraft verloren zu haben. Und doch ist der latoursche Ekel, der sich angesichts des leblosen, verwesenden Objekts breitmacht, nur die andere Seite des Schreckens, den der Leviathan einst verbreitet hatte. In diesem gespenstischen Objekt – tot und lebendig zugleich – bleibt die Geschichte disziplinärer wie politischer Kämpfe aufgespeichert und kann jederzeit aktualisiert werden. Einerseits sank »die Gesellschaft« tatsächlich zum umgangssprachlichen Passepartout-Begriff ab und ist damit effektiv tot; doch andererseits lebt sie spukhaft fort. Nicht zuletzt dort, wo man meint, ihren Schrecken bannen zu müssen. Zeugt nicht Thatchers Bannspruch von dem Einsatz, der nach wie vor mit dem Begriff der Gesellschaft verbunden ist? Und wird nicht Gesellschaft nach wie vor zugunsten anderer Mächte verleugnet? Vielleicht heute weniger zugunsten der Mächte des Staates und der Kirche, aber deutlich zugunsten der Mächte des Individuums, gelegentlich der Familie, vor allem aber des Marktes. Wird sie daher nicht umgekehrt auch nach wie vor verteidigt? Wo immer im öffentlichen Diskurs um die Definition des Gemeinwohls gestritten wird – von den 26Auseinandersetzungen um Sozial-, Wirtschafts- oder Finanzpolitik innerhalb des politischen Systems bis hin zu den Protesten sozialer Bewegungen –, steht immer auch die Bestimmung der Referenzgröße, das heißt die legitime Definition dessen, was als Gesellschaft gelten darf, auf dem Spiel. Noch der in den US-amerikanischen Occupy-Protesten des Jahres 2011 geprägte Slogan »Wir sind die 99%« rief die Gesamtgesellschaft an gegen das illegitime Einzelinteresse des einen Prozents. In vielfacher Abwandlung wird das Fahnenwort immer noch vorangetragen in den »entsetzlichen Straßenschlachten«, die schon von Mohl beschrieb – und wohl immer noch »zuerst von Schwärmern und Schülern«.
1.3. Ungewissheitsgewissheit
Nun bricht sich der Lärm der sozialen Kämpfe – Foucault spricht in einer berühmten Wendung vom »Donnerrollen der Schlacht« (Foucault 1977: 397)[8] – an den Wänden der Institution. Im Streit um den wissenschaftlichen Begriff von Gesellschaft treten nicht nur wissenschaftliche Paradigmen und Schulen gegeneinander an, in ihm werden außerwissenschaftliche Kämpfe nach den Spielregeln des Wissenschaftsfelds moduliert. Welche Konsequenzen lassen sich daraus für den sozialwissenschaftlichen Gesellschaftsbegriff ziehen? In welches Verhältnis lässt er sich zu dem »Realobjekt« Gesellschaft, sollte es ein solches geben, setzen? In Abgrenzung von einem radikal konstruktivistischen Zugang werde ich, wie sich aus Gesagtem wohl schon erschließen lässt, nicht unterstellen, dass das wissenschaftliche Bild sozialer Realität gänzlich nach Maßgabe systemspezifischer Protokolle der Wissenschaft konstruiert ist – ohne dass ich damit gleich die unproduktive Alternative eines positivistischen, empirizistischen oder schlicht abbildrealistischen Theoriedesigns vertreten wollte oder gar müsste. Selbstverständlich folgt das Theorieobjekt Gesellschaft den Logiken und Protokollen wissenschaftlicher Theoriebildung und nicht etwa jenen der Politik, der Kunst oder der sozialen Bewegungen. Dass Theorieobjekte weitgehend wissenschaftsförmig konstruiert werden, bedeutet aber nicht, dass sie nicht vom »Realobjekt«, also der »ärgerlichen Tatsa27che der Gesellschaft« zugleich destruiert werden können. Auf diesen Umstand – und darauf, dass an ihm nichts zu bedauern ist – will, denke ich, Ernesto Laclau hinaus, wenn er zu bedenken gibt, dass jede Theorie verschmutzt und deformiert wird durch eine Wirklichkeit, die sie transzendiert, worin aber gerade die »Würde« des Denkens und nicht etwa dessen Überflüssigkeit besteht (Laclau 1990: 205).
Die Pointe eines, wenn man so will, post-radikalkonstruktivistischen Ansatzes besteht darin, dass das ärgerliche »Realobjekt« der Gesellschaft weder in seiner unterstellten Objektivität abbildbar noch aber umgekehrt beliebig konstruierbar ist, sondern sich gerade in den Widerständen, die es der Konstruktion entgegensetzt, bemerkbar macht. Yannis Stavrakakis hat darauf hingewiesen, dass der Sozialkonstruktivismus bereits bei Berger und Luckmann durchaus eine Ahnung besitzt von einem die »soziale Konstruktion der Wirklichkeit« unterlaufenden Moment der »Krise« oder des »Problems«, ohne allerdings die Bedeutung dieses Moments zu erfassen (Stavrakakis 1999: 67). Solch Irritationen unterhöhlen die sozialkonstruktivistische Arbeitshypothese, die soziale »Wirklichkeit« sei in ihrer Gesamtheit konstruiert.[9] Der Sozialkonstruktivismus registriert, ohne es theoretisch einordnen zu können, was der Lacanianismus und seine sozialtheoretischen Spielarten bei Laclau, Žižek oder Stavrakakis als das Reale bezeichnen und unterscheiden von der Realität. Der Begriff des Realen verweist auf jenen unsymbolisierbaren Rest, der dem Symbolischen, also der sozial konstruierten Wirklichkeit, entgeht und jeden Konstruktionsversuch in letzter Instanz scheitern lässt. (Wollte man nun im epistemologischen Stil nachfragen, woher man denn überhaupt etwas von diesem Realen wissen könne, dann lautet die Antwort, man könne eben nichts von ihm wissen, man könne aber auf die Existenz einer solch außersymbolischen Instanz rückschließen aufgrund der 28Verzerrungen und Störungen, die sich immer wieder innerhalb des Symbolischen erfahren lassen.)
Nicht in den wohlgeformten Gesellschaftsdefinitionen, so meine These, sondern gerade in der deformierten Gestalt eines Irritation, Ablehnung, Ekel oder gar Schrecken verbreitenden Dings tritt das »Realobjekt« Gesellschaft im Wissenschaftsdiskurs auf. Nicht qua Konstruktion eines nach Maßgabe wissenschaftlicher Bestimmungsregeln möglichen, das heißt erlaubten Objekts, sondern durch Anrufung eines unmöglichen, wenn nicht verbotenen Objekts verweisen die Abjektformeln, die unsere symptomatologische Lektüre bislang aufgetan hat, auf die Irritationserfahrung des Sozialen. Sie registrieren innerhalb des Diskurssystems der Wissenschaft die ärgerliche Tatsache der Gesellschaft, die sie nicht in wohlgeformter, sondern nur in deformierter Gestalt zu porträtieren wissen. Und die Deformation verweist wiederum zurück auf Kämpfe, die eine endgültige und objektive Fixierung des Sozialen verunmöglichen. Am Grund »der Gesellschaft« finden wir nichts anderes als diese Kämpfe. Allerdings ist vor einer allzu konkretistisch gefassten Vorstellung von sozialen Kämpfen zu warnen. Wir wären damit über den sozialwissenschaftlichen Objektivismus nicht hinaus und hätten nach wie vor die Möglichkeit eines nicht-umkämpften Gesellschaftsbegriffs offengelassen. Stattdessen schlage ich vor, die Differenz zu berücksichtigen zwischen den konkreten »ontischen« Kämpfen und einer »ontologischen« Dimension unumgänglicher Strittigkeit des Sozialen. Der zweite Teil dieser Untersuchung wird dieser Dimension nachspüren. Es ist aber bereits jetzt erforderlich, die Sinnfälligkeit dieser Unternehmung aufzuweisen. Um die notwendige oder ontologische Dimension der Strittigkeit zu belegen, werde ich daher einen kurzen Umweg machen und zunächst historisch fragen: Wie kommt es, dass sich deren Erfahrung ab einem bestimmten historischen Zeitpunkt offenbar verallgemeinert hat?
Die Antwort liegt in der Etablierung jenes Dispositivs der Ungewissheitsgewissheit, das gewöhnlich mit dem Begriff der Moderne bezeichnet wird. Denn ein fundamental strittiger Gesellschaftsbegriff wird überhaupt nur dort denkbar, wo kein sozialer Tatbestand von vornherein als gesichert, das heißt als unstrittig gelten kann. Die Moderne ist geradezu definiert durch eine enorme Ausdehnung der Zonen der Ungewissheit. Die Sozialwissenschaften erklären die wachsende Verunsicherungserfahrung unter anderem mit Verweis 29auf Industrialisierung, zunehmende Arbeitsteilung, funktionale Differenzierung, Ausbildung voll entwickelter Kommunikationsmedien und schließlich der Herausbildung einer Weltgesellschaft. Zugleich ist immer wieder bemerkt worden, dass die Soziologie als eigenständige Disziplin ihre historische Entstehung genau der Erfahrung jener Ungewissheit verdankt, die sie zu erklären versucht. In den meisten Fällen geschah dies reaktiv, das heißt die Soziologie versuchte auf die diagnostizierte Verunsicherung mit der Entwicklung neuer Gewissheitsformeln zu reagieren.[10] Bereits der Saint-Simonismus, der mit Saint-Simons Schüler Comte überhaupt den Begriff der Soziologie prägte, lässt sich als eine progressive Sozialtechnologie zur Kanalisierung von Ungewissheit verstehen. Er reagierte auf eine grundlegende – und zugleich grundstürzende – Verschiebung im »symbolischen Dispositiv« der Gesellschaft. Mit der Französischen Revolution war nämlich ein qualitativer und vor allem symbolischer Bruch eingetreten, auf den hin sich die neuen Sozialwissenschaften zu verhalten hatten. Sie mussten nun auf das in der Französischen Revolution symbolisch verdichtete »Verschwinden der Zeichen der Sicherheit«, um eine Formel des politischen Theoretikers Claude Lefort aufzugreifen, antworten (Lefort 1981, vgl. Kapitel 5 in Marchart 2010a). In der Revolution war auf offener politischer Bühne ein Verunsicherungsprozess ausagiert worden, der natürlich schon lange vorher begonnen hatte. Auch in der Soziologie wird der einschneidende Charakter dieses Ereignisses gelegentlich gewürdigt:
Die Revolution und ihre Folgen leiteten eine Krisenperiode ein, in der die Gesellschaftserfahrung des Menschen immer weiter in Frage gestellt, überdacht und unter ganz neuen Perspektiven gesehen wurde. In einem bestimmten, sehr realistischen Sinn ist die Französische Revolution immer noch im Gange. Philosophisch, politisch und ökonomisch war sie nur der Anfang einer Krise, in der wir stecken. Die Geschichte des gesellschaftlichen Denkens seit damals ist im wesentlichen auf sie zurückzuführen. In diesem Sinn steht sie am Anfang der Soziologie als Wissenschaft. (Berger/Berger 1993: 23)
30Auch Richard Rorty hat darauf hingewiesen, dass es (neben den Romantikern in der Kunst) vor allem das soziale und politische Ereignis der Französischen Revolution war, in dem sich Verunsicherungserfahrungen mit einem Schlag verdichteten. Mit der Französischen Revolution »faßte in der Vorstellungswelt Europas der Gedanke Fuß, daß die Wahrheit gemacht, nicht gefunden wird« (Rorty 1999: 21). Heute gibt es eine Tendenz, die epochale Erschütterung, die die Französische Revolution europaweit – und über Europa hinaus (Buck-Morss 2009) – ausgelöst hatte, zu relativieren. Aber mit ihr war durch menschliches Handeln allgemein sichtbar bewiesen worden, dass soziale Ordnung auf keinen unumstößlichen Fundamenten aufruht und Gesellschaft daher auch anders geordnet sein könnte. Der korrekte technische Begriff dafür ist nicht Ungewissheit, sondern Kontingenz. Kontingent ist, was auch nicht oder anders sein könnte.[11] In dieser Hinsicht ist die Erfahrung von Kontingenz das entscheidende Charakteristikum der Moderne, in der sich Kontingenz – wiewohl bereits zuvor in bestimmten Diskursen etwa der Kunst oder Theologie verfügbar – verallgemeinert hat. Aber, und das ist wesentlich, Kontingenz unterscheidet sich von bloßer Unsicherheit darin, dass sie ein Reflexionsprodukt ist (Makropoulos 1997: 147). Die Gesellschaft ist nicht einfach nur verunsichert, das war sie zu Kriegs- oder Krisenzeiten auch früher schon, sondern sie beginnt sich selbst als kontingent zu beschreiben. Damit ist gesagt, dass die Moderne ein verallgemeinertes Bewusstsein der Tatsache hervorbringt, dass die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse auch anders geordnet sein könnten, sofern sie in keinem soziotranszendenten Legitimationsgrund verankert sind. Kontingenz wird, wie Luhmann griffig formuliert, zum Midas-Gold der Moderne, denn »[d]er Blick auf Kontingenzen ist so eingeübt, daß er alle Suche nach Notwendigem, nach Geltungen a priori, nach unverletzlichen Werten begleitet und in der Kontingenz 31dieser Bemühung (die als Bemühung sichtbar wird) die Ergebnisse in Kontingentes transformiert« (Luhmann 2006: 94).
Das bedeutet, dass in der Moderne nur eines gewiss ist, nämlich die Ungewissheit. Genau genommen ist die spezifisch moderne Erfahrung daher nicht, dass die sozialen Verhältnisse kontingent sind – diese Erfahrung stand, wie gesagt, in gelegentlichen Krisensituationen und in spezifischen Diskursgenres auch vormodernen Gesellschaften zur Verfügung –, sondern dass sie notwendig kontingent sind. Nun werden sie nicht nur in einer bestimmten Hinsicht oder einem bestimmten Ausschnitt als kontingent erachtet, sondern in ihrer Gesamtheit und ihrem Wesen. Daher muss unser überkommener Kontingenzbegriff radikalisiert werden: Kontingenz nimmt unter den Reflexionsbedingungen der Moderne den Charakter des Notwendigen an.[12] Im Reich des Sozialen, so die moderne Erkenntnis, ist nichts möglich, was nicht auch anders möglich wäre. Die Moderne beschreibt sich als Epoche notwendiger Kontingenz.
1.4. Am Grund des Sozialen: Kontingenz und Konflikt
Der historische Umweg hat uns zu dem Argument geführt, das den grundlegenden oder »ontologischen« Strittigkeitscharakter des Sozialen erklären kann. Die Moderne reflektiert ihr eigenes Fundament als notwendig kontingent. Dass dieses »Fundament« nun auch notwendig konfliktuell ist, liegt auf der Hand, sobald wir die schlechte Gewohnheit abgelegt haben, Kontingenz mit Arbitrarität, also mit Zufall und Willkür zu verwechseln (vgl. Vogt 2011). Als arbiträr kann gelten, was aus beliebigen Gründen so ist, wie es ist. Ein sozialer Tatbestand ist jedoch in den seltensten Fällen zufällig zustande gekommen. Auch wenn man zugestehen mag, dass 32in der Geschichte immer auch zufällige Ereignisse eine gewisse Anstoßwirkung entfalten, wäre es absurd, zum Beispiel behaupten zu wollen, die gegenwärtige Verteilung gesellschaftlichen Reichtums sei rein zufällig zustande gekommen. Soziale Entwicklungen entfalten sich nicht zufällig, und soziale Verhältnisse sind nicht beliebig strukturierbar. Tatsächlich gibt es kaum jemanden, der eine solche Position sozialwissenschaftlich verteidigen würde, auch wenn sie gelegentlich jenen Autoren untergeschoben wird, die man als postmodern bezeichnet. Wenn es überhaupt eine Postmoderne solchen Zuschnitts geben sollte, dann handelt es sich bei ihr wohl eher um eine antifundamentalistische Spielart der Moderne, die Kontingenz mit Arbitrarität verwechselt. Als Paradigma eigenen Rechts hat sie das Kontingenzparadigma der Moderne nie abgelöst. Man könnte in Abwandlung eines Buchtitels Latours sagen: Wir sind nie postmodern gewesen!
Ein sozialer Tatbestand ist somit nicht kontingent, weil er arbiträre Gründe hätte, sondern weil er keine notwendigen Gründe hat. Damit ist zugleich gesagt, dass dieser Tatbestand sehr wohl Gründe hat. Die sozial-, wirtschafts- und finanzpolitischen Gründe, die zum Beispiel für eine bestimmte Einkommensverteilung verantwortlich sind, könnten verändert zu einer anderen Verteilungskurve führen. Wenn sie jedoch in einer gegebenen Situation nicht beliebig verändert werden können, dann aufgrund der Kräfteverhältnisse, die ihrer Veränderung Grenzen setzen. Grenzen, die ihrerseits durch soziale Kämpfe fixiert wurden, daher kontingent sind und durch weitere Kämpfe um Einkommensverteilung erneut verschoben werden können. An dieser recht simplen Überlegung sollte bereits erkennbar geworden sein, weshalb eine Gesellschaft, die ihre Gründe als prinzipiell kontingent erachtet, den Streit auf derselben fundamentalen Ebene verankert. Die Auflösung einer soziotranszendenten Legitimationsbasis bedingt, dass um die Legitimation eines jeden Grundes jeweils und immer aufs Neue gerungen werden muss. Wo sich ein Universum der Notwendigkeit in eines der Kontingenz verwandelt, dort entsteigen die Götter ihren Gräbern »und beginnen untereinander wieder ihren ewigen Kampf«, wie es bei Max Weber heißt (Weber 1980: 605). Kontingenz und Konflikt implizieren einander. Allerdings dürfen wir, wie bereits erwähnt, die ontologische Dimension der Konfliktualität nicht konkretistisch missverstehen. Es handelt sich bei ihr um eine Grundbestim33mung des Sozialen.[13] In diesem Sinne müssen Konflikte keineswegs die gesamte Struktur des Sozialen in Aufruhr versetzen. Konflikt im Sinne einer Grundbestimmung muss nicht einmal die Form offener Auseinandersetzung – etwa der erwähnten »fürchterlichen Straßenschlachten« – annehmen. Konflikte können durchaus zu halbwegs stabilen Strukturen gerinnen, wenn auch immer nur vorübergehend. Denn sie bleiben in diesen Strukturen – Ritualen, Institutionen, geregelten Funktionsabläufen, Kräfteverhältnissen, Subjektivierungsformen – aufgespeichert und können oft durch geringste Verschiebungen reaktualisiert werden.
Die Reflexionsbestimmungen des Sozialen, Konflikt und Kontingenz, sind somit gleichursprünglich. Das eine ruft das andere immer mit auf. Kontingenzerfahrung produziert Konflikte: Wo eine Gesellschaft eine Krise erfährt, dort bilden sich sofort Konflikte um ihre Neuzusammensetzung.[14] Was wir als Moderne bezeichnen, ist geradezu dadurch definiert, dass alles zum Gegenstand potenzieller Auseinandersetzung werden kann. Diese Erkenntnis ist direkte Folge der Selbstbeschreibung moderner Gesellschaften als notwendig kontingent. Und umgekehrt: Konflikte produzieren Kontingenzerfahrung. Wo immer um etwas gestritten wird, legt dieser Streit Zeugnis von der Kontingenz seines Gegenstands ab. Das, worum gestritten wird, könnte auch anders sein, sonst gäbe es keinen Streit. Die Kontingenz schreibt sich in die Streitsache selbst ein; und umgekehrt wird jeder soziale Tatbestand, sofern er als kontingent betrachtet wird, zur potenziellen Streitsache.
Mit dieser Überlegung sind wir zugleich einer Erklärung des merkwürdigen Charakters des Abjekts »Gesellschaft« nähergekommen. Denn was für andere gesellschaftliche Bereiche gilt, das gilt selbstverständlich auch für das Konfliktfeld der Sozialwissenschaften: »Kontroversen artikulieren Kontingenzen, sie verweisen auf konkurrierende Sichtweisen, auf funktionale Äquivalente bei 34der Wahl begrifflicher, theoretischer und methodischer Optionen« (Moebius/Kneer 2010: 7). Solche Kontroversen, gerade weil sie die Kontingenz soziologischer Positionen, Schulen und Paradigmen zutage treten lassen, tragen zur Kohäsion, wenn nicht zur eigentlichen Identität der Disziplin bei. Aber der Streit um den Begriff der Gesellschaft dürfte von grundlegenderer Natur sein als der Streit um andere sozialwissenschaftliche Grundbegriffe. Der Begriff war ja, wie wir sahen, in seiner »heroischen Phase« mit sozialen Bewegungen synonym gesetzt worden und verwandelte sich so vom Kampfbegriff zum Inbegriff für diesen Kampf selbst.[15] Zugleich nahm der Begriff der Gesellschaft immer mehr den Charakter eines Kontingenzbegriffs an, verwies er doch auf die Ärgerlichkeit der Primärerfahrung ontologischer Resistenz sozialer Verhältnisse. Das heißt mit anderen Worten, er verweist uns zurück auf deren ontologische Grundlosigkeit. Darin, so meine Vermutung, liegt die Ursache für die seltsamen Verformungen und Paradoxierungen, die der Gesellschaftsbegriff erfahren hat. Denn als sozialwissenschaftlicher Grundbegriff deutet Gesellschaft auf einen Ab-Grund: Als zentrale Kontingenz- und damit zugleich Konfliktformel von Soziologie kann sich dieser Grundbegriff nur auf ein Fundament beziehen, das unseren Feststellungsbemühungen notwendigerweise entgleitet. Im sozialwissenschaftlichen Gesellschaftsbegriff, gerade wo er in der Semantik des »sterbenden Wals« auftritt, schwingt etwas vom Entzug eines festen Grundes mit, von jener kontingent-konfliktorischen Natur des Sozialen also, die sich uns allzu oft als Ärgernis oder in Form von Irritation, Ekel oder gar Schrecken aufdrängt, also immer dann, wenn unsere Erwartung eines festen Grundes frustriert wird.
Ich habe mich bislang der Terminologie eines sozialwissenschaftlichen Paradigmas bedient, das erst in den letzten Jahren Aufmerksamkeit erregt hat und im Englischen als post-foundationalism bezeichnet wird, was sich, bei allen Unzulänglichkeiten des deutschen Begriffs, mit Postfundamentalismus übersetzen lässt. Darunter subsumiert man neuere Theorieansätze, die die Annahme 35zurückweisen, Wissen und Erkenntnis wären in einem universalen, objektiven Fundament – in Gott, der Vernunft, den ökonomischen Bewegungsgesetzen oder den menschlichen Genen – verankert. Obwohl anfänglich im Bereich der Epistemologie und Wissenschaftstheorie angesiedelt, wanderte das Paradigma alsbald in die Sozialwissenschaften weiter.[16] Die Idee eines stabilen Fundaments sozialer Verhältnisse und Entwicklungen, wie es etwa noch im marxistischen Determinismus im Gewand der »ökonomischen Basis« auftrat, wird von jenen Autoren, die auch im Zentrum der vorliegenden Untersuchung stehen, zurückgewiesen. Der Glaube an eine soziotranszendente und revisionsresistente Gründungsinstanz, der den epistemologischen und sozialwissenschaftlichen Fundamentalismus definiert, ist ihnen unwiderruflich verlorengegangen.[17]
Die »postmoderne« Folgerung könnte nun darin bestehen, die Idee jeglicher Gründung, auch partieller Gründungen, abzuweisen. Gesellschaft würde dann zu einem amorphen Patchwork, das keinerlei totalisierende Effekte kennt (ein Ansatz, der oft, wenn auch nicht ganz zu Recht, mit Lyotard assoziiert wird). Damit wären wir aber im Paradigma des anything goes, das letztlich nur von wenigen Autoren wie zum Beispiel Feyerabend (1975) vertreten wird. In der Soziologie dürfte Baudrillards These vom »Ende des Sozialen« (Baudrillard 2010), das sich im Strudel verallgemeinerter Simulation auflöst, einer solchen Position nahekommen. Baudrillard ersetzt 36damit aber nur die fundamentalistische Sozialphysik à la Durkheim mit einer absurdistischen Pataphysik à la Jarry (vgl. zu deren aktueller Variante Fassler 2009). Für die in dieser Studie diskutierten Autoren wie zum Beispiel Ernesto Laclau, Niklas Luhmann, Bruno Latour oder Michel Foucault, ja selbst für Jean-François Lyotard ist dies keine gangbare Alternative zum Fundamentalismus: Der sozialwissenschaftliche Fundamentalismus wird mit dem Verzicht auf jegliche Form sozialer Fundierung nicht etwa überschritten oder subvertiert. Er wird bloß auf den Kopf gestellt. Deshalb handelt es sich in solchen Fällen um einen bloßen Antifundamentalismus. Selbst bei Zurückweisung der Idee des einen Grundes darf die Dimension der Gründung nicht völlig aus den Augen verloren werden. Weder sollte man darauf hoffen, dass ein ultimativer Grund des Sozialen gefunden werden könne, noch sollte man unterstellen, dass das Soziale völlig unfundiert wäre. Vielmehr ist es, mit einem Wort Judith Butlers, gebaut auf »contingent foundations«, auf gleichermaßen kontingenten wie umkämpften Gründen (Butler 1992). Mit Ernesto Laclau wiederum kann man sagen, es gehe um politische Gründungsversuche im Plural, die zwar in letzter Instanz scheitern werden, aber dennoch zu partiellen Totalisierungseffekten des Sozialen, das heißt zu Gesellschaftseffekten führen. Folglich bedeutet die Abwesenheit eines letzten Grundes des Sozialen nicht allein, dass Gesellschaft sich nie zu einer mit sich selbst identischen Totalität schließen kann. Die Abwesenheit eines letzten Grundes impliziert genauso, dass partielle, kontingente Gründungen erforderlich werden. Sofern keine Sozialordnung vollständig arbiträr sein kann, wird sie immer paradoxe Objekte partieller Totalität hervorbringen: Gesellschaftseffekte, das heißt Bruchstücke eines Ganzen, das es nicht geben kann, ohne die andererseits aber keine noch so vorübergehende Stabilisierung des Sozialen möglich wäre.[18]
371.5. Heideggers Ab-Grund, oder was die ontologische Differenz in der Sozialtheorie zu suchen hat
Der bedeutendste philosophische Vorläufer des gegenwärtigen Postfundamentalismus ist Martin Heidegger. Die Terminologie, derer sich viele Postfundamentalisten bedienen, ist maßgeblich von Heidegger geprägt. Ebenso die elementare Denkfigur der »ontisch-ontologischen Differenz«, die diese Terminologie ordnet und das wesentliche Strukturmerkmal eines jeden postfundamentalistischen Ansatzes benennt. Es mag überraschen, dass ein oft als obskurantistisch beschimpfter Denker wie Heidegger, noch dazu politisch übel beleumundet, zum Gewährsmann der Gesellschaftstheorie werden soll. Die Rezeption Heideggers in den Sozialwissenschaften, ja selbst in der Sozialphänomenologie, fiel demgemäß immer verhalten aus (Schmid 2003: 481). Innerhalb des objektivistischen Mainstreams der Wissenschaften ist mit Heidegger nicht viel zu gewinnen. Für die postfundamentalistischen Theoretiker aber, die ich im Folgenden diskutieren werde, stellt Heidegger eine bedeutende Bezugsperson dar – vielleicht neben Nietzsche die bedeutendste. Gerade die französischen Postfundamentalisten wie Althusser, Foucault oder Latour – wie auch deren philosophische Mittelsleute Derrida, Deleuze und Lacan – sind durch die Erfahrung Heidegger gegangen. Dessen enorme Bedeutung kann leicht übersehen werden, wurde Heidegger doch, wie Jacques Derrida bemerkte, »ein Vierteljahrhundert lang von denen, die viel später in Frankreich privat oder öffentlich anerkennen mußten, daß er in ihrem Denken eine wichtige Rolle gespielt hatte (Althusser, Foucault, Deleuze zum Beispiel), nie in irgendeinem Buch genannt« (Derrida 1994: 111).[19] Zu Recht wurde von einem französischen »Heideggerianismus der Linken« (Janicaud 2001) gesprochen. Was machte die Anziehungskraft des Heideggerschen Denkens aus?
Heidegger hatte als Erster die postfundamentalistische Kondition philosophisch ausgelotet. Und das heißt: nicht nur den Abgrund der modernen sozialen Welt, wie er sich in Anomie- und Krisenerfahrungen auftut, sondern das unabstellbare Spiel zwischen Grund und Abgrund: »Der Grund gründet als Ab-grund« (Heideg38ger 1994: 29).[20] Damit war er der Erste, der erkannt hatte, dass der metaphysische Fundamentalismus, der die Geschichte des abendländischen Denkens immer schon bestimmt hatte, nicht überwunden wird, indem man in den Antifundamentalismus flüchtet. Man muss sich den Mühen der Ebene aussetzen und Metaphysik durcharbeiten, wie Freud gesagt hätte, der ein ganz ähnliches Projekt mit der menschlichen Psyche verfolgte. In ihrer Eigenschaft als »Onto-Theo-Logik« hatte die Metaphysik das Sein des Seienden als festen Grund vorgestellt. Grund war dort nur ein anderer Name für das erste, höchste oder letzte Seiende. Das hieß lange Zeit Gott, der wiederum neuzeitlich von Vernunft, Subjekt oder Geschichte abgelöst wurde. Unser Glaube an die determinierende, fundierende Funktion dieser Instanzen ist geschwunden. Aber Postfundamentalisten, allen voran Heidegger, geht es eben nicht um den hoffnungslosen Versuch, die Dimension des Grundes zu verleugnen. Der Grund bleibt als eine Dimension des Sozialen anwesend – aber anwesend als Dimension, die sich entzieht, weil sie ihrerseits dem Spiel der ontisch-ontologischen Differenz unterliegt: der Differenz also zwischen Sein (als Grund) und Seiendem (als Gegründetem), die ineinander übergehen und doch nicht identisch sind. Für Heidegger ist die Sache des Denkens genau diese Differenz zwischen Sein und Seiendem »als Differenz« (Heidegger 1957: 37).
Seinsdenken wird zu Differenzdenken. Kein Wunder also, dass Heidegger für die französischen Theoretiker der Differenz von solcher Bedeutung war. Doch es sei nochmals betont: Im Differenzdenken Heideggers geht die Dimension des Seins beziehungsweise Grundes nicht verloren, es kommt nur zur Schwächung ihres ontologischen Status. Das haben wiederum die italienischen Linksheideggerianer auf den Begriff des »Schwachen Denkens« gebracht, der in dem einflussreichen, von Gianni Vattimo gemeinsam mit Pier Aldo Rovatti herausgegebenen Sammelband Il pensiero debole vorgestellt wurde (Rovatti/Vattimo 1983; vgl. Vattimo 2000 für dessen eigenen Beitrag zu dem Band). Das »Sein« des schwachen Denkens »ist das Gegenteil der metaphysischen Auffassung des Seins als Stabilität, Stärke, energeia; es ist ein schwaches, untergehendes Sein, das sich im Entschwinden entfaltet« (Vattimo 1990: 130). Diese 39Schwächung der ontologischen Grundlagen versteht sich einerseits als eine philosophische Unternehmung, die Fundierungsdiskurse durch hermeneutische Interpretation ersetzt, und andererseits als ein politisches Projekt, das eine liberale und tolerante Demokratie befördern soll.[21] Seinen historischen Hintergrund hatte dieses Projekt in Auseinandersetzungen innerhalb des italienischen Marxismus. In den späten 1960er und den 1970er Jahren griff man insbesondere auf Heidegger zurück, um sich der marxistischen Doxa des ökonomischen Determinismus wie auch der dialektischen Fixierung auf Versöhnung und Totalität zu entwinden.[22] Darin besteht eine gewisse Nachbarschaft zu den vor allem in Zagreb beheimateten Mitgliedern der jugoslawischen Praxis-Gruppe, die auf ihrer Suche nach unorthodoxen Lesarten des Marxismus schon früher auf Heidegger gestoßen waren. Insbesondere Gajo Petrović hat Heideggers Seinsdenken auf Themen wie Selbstverwaltung und Revolution übertragen. So fragt Petrović etwa in einem Kommentar zu Marx’ Feuerbachthesen, ob das Denken des Seins nicht Denken der Revolution sein müsse, denn: »Ist nicht die Revolution das ›Wesen‹ selbst des Seins, das Sein in seinem An-Wesen? Und wenn die Revolution das Sein selbst ist, ist nicht die Philosophie als der Gedanke des Seins eben dadurch (nicht nur nebenbei oder dazu) der Gedanke der Revolution?« (Petrović 1971: 16)
Diese und ähnliche Verschränkungen von Marx und Heidegger waren theoriegeschichtlich einflussreicher, als heute allgemein angenommen. Die Geschichte des Linksheideggerianismus – von 40Marcuse über Derrida bis Agamben – wäre eine eigene Studie wert. Mir geht es hier um etwas anderes. Die Beispiele illustrieren, dass es schon früh zu einer fruchtbaren, den Marxismus von innen her entgründenden Aufnahme Heideggers in die Sozialtheorie kam. Und diese Entwicklung ist noch keineswegs abgeschlossen. So hat sich jüngst etwa Vattimo wieder dem Marxismus angenähert. Unter dem Titel From Heidegger to Marx (Vattimo/Zabala 2011) verteidigt er nun einen schwachen und hermeneutischen Kommunismus, der allerdings nichts mit den ehemaligen realsozialistischen Regimen zu tun haben möchte. Mit dem Begriff ist vielmehr eine Alternative zum neoliberalen Kapitalismus gemeint, die sich der Sache der Schwachen – der Minoritäten, der Ausgebeuteten etc. – verschreibt, womit das schwache Denken zum Denken der Schwachen werden soll. Und ist nicht der Postmarxismus, wie er von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe entwickelt wurde und in der »Essex School« der politischen Diskursanalyse und Hegemonietheorie fortgeführt wird, nicht ebenso ein heideggerianisierter, von der Last ökonomischer Letztbegründungen befreiter Marxismus?
Man darf sich also von den wiederholten Begegnungen mit Heidegger, zu denen es im Laufe unserer Untersuchung kommen wird, nicht irritieren lassen. Gesellschaftstheorie wäre postfundamentalistisch ohne Heidegger nicht zu entwickeln.[23]