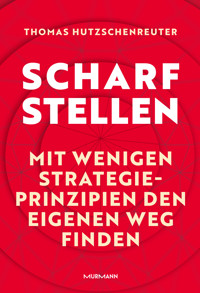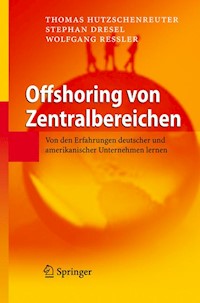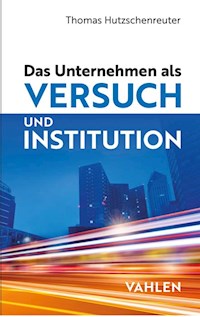
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vahlen
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Was ist ein Unternehmen? Die Antwort auf diese Frage bestimmt darüber, wie Unternehmer und Manager ihre Unternehmen führen. Und sie bestimmt über die Ausrichtung der Betriebswirtschaftslehre, denn mit dieser Antwort steht und fällt das Verständnis der Wissenschaft, deren Kerngegenstand Unternehmen sind. Man meint, die Antwort sei klar. Doch dem ist nicht so.
Die Beantwortung der Frage, was ein Unternehmen ist, startet mit dem Problem des unternehmerischen Praktikers. Er muss sichere Ausgaben tätigen, um unsichere Einnahmen zu generieren. Sein Problem ist die individuelle Unsicherheit, unter der er handelt.
Die individuelle Unsicherheit des unternehmerischen Entscheiders macht das Wesen des Unternehmens zum Versuch. Um den Versuch Unternehmen zu gestalten, bedient er sich institutioneller Gestaltungselemente, die das Unternehmen als Institution erscheinen lassen.
Alles Zukünftige ist unsicher.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Inhalt:
Was ist ein Unternehmen? Die Antwort auf diese Frage bestimmt darüber, wie Unternehmer und Manager ihre Unternehmen führen. Und sie bestimmt über die Ausrichtung der Betriebswirtschaftslehre, denn mit dieser Antwort steht und fällt das Verständnis der Wissenschaft, deren Kerngegenstand Unternehmen sind. Man meint, die Antwort sei klar. Doch dem ist nicht so.
Die Beantwortung der Frage, was ein Unternehmen ist, startet mit dem Problem des unternehmerischen Praktikers. Er muss sichere Ausgaben tätigen, um unsichere Einnahmen zu generieren. Sein Problem ist die individuelle Unsicherheit, unter der er handelt.
Die individuelle Unsicherheit des unternehmerischen Entscheiders macht das Wesen des Unternehmens zum Versuch. Um den Versuch Unternehmen zu gestalten, bedient er sich institutioneller Gestaltungselemente, die das Unternehmen als Institution erscheinen lassen.
Zum Autor:
Universitätsprofessor Dr. Thomas Hutzschenreuter, geboren 1971 in Borna/Sachsen, ist Inhaber des Lehrstuhls für Strategisches und Internationales Management an der Technischen Universität München. Seine Forschung, für die er internationale und nationale Preise erhalten hat, beschäftigt sich mit der Entwicklung von Unternehmen, dem Eigentum und der Governance von Unternehmen sowie der Gestaltung unternehmerischer Entscheidungsprozesse. In der Lehre, für die er ebenfalls mehrfach ausgezeichnet wurde, begeistert Thomas Hutzschenreuter Studierende und Führungskräfte von der Lebendigkeit des Managements. Für die Unternehmenspraxis ist er ein geschätzter Ansprechpartner in Strategiefragen sowie ein lehrreicher und unterhaltsamer Keynotespeaker. Die Kombination aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen lässt Thomas Hutzschenreuter sehr gern in Essays, zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, einfließen. Er ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und lebt in Bayern.
Unternehmer und Manager gestalten Zukunft. Ihr Handeln ist stets auf die Zukunft ausgerichtet. Das Verständnis, was ein Unternehmen ist, hängt davon ab, ob man annimmt, die Zukunft sei wissbar, oder ob man annimmt, dass die Zukunft nicht gewusst werden kann. Ist die Zukunft wissbar, lässt sich praktisches Unternehmenshandeln optimieren, die Möglichkeit von richtigen Entscheidungen existiert und Analytik und deduktive Logik dominieren. Optimalität im praktischen Unternehmenshandeln ist hingegen ausgeschlossen, wenn die Zukunft nicht wissbar ist. Zudem ist richtig oder falsch kein eindeutiges Kriterium. Neben Analytik und deduktive Logik treten individuelle, interpersonell nicht zwingend überprüfbare Imaginationen sowie Vertrauen und Überzeugungskraft jenseits „beweisbarer“ Gründe.
Alles Zukünftige ist unsicher. Es ist möglich, über Zukünftiges Prognosen, Vorhersagen, Imaginationen, Planungen etc. anzustellen, aber eben nicht möglich, Wissen zu besitzen. Wenn alles Zukünftige unsicher ist, dann ist ein Unternehmen kein Gegenstand von Optimierung, sondern sein Wesen ist der Versuch. Dies ändert sich auch nicht mit fortschreitendem Bestehen eines Unternehmens. Das Unternehmen ist somit nicht nur ein Versuch zu Beginn seines Bestehens, sondern es ist ein fortwährender Versuch.
Das Unternehmen als Versuch und Institution
Ein Essay zum Kerngegenstand der Betriebswirtschaftslehre
von
Univ.-Prof. Dr. Thomas Hutzschenreuter
5Für zwei Personen,
denen ich sehr verbunden bin,
Omi Omi und Thomas, der Ungläubige,
sowie
für meine Wissenschaft, die Betriebswirtschaftslehre.
7Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Denkschulen zur Theorie des Unternehmens im Überblick
Neoklassische Unternehmenstheorie
Transaktionskostentheorie
Ältere Ressourcentheorie
Neuere Ressourcentheorien
Kernargumentation der bisher skizzierten Unternehmenstheorien
Entrepreneurship-Theorien
Teil I Wesen des Unternehmens als Versuch
Kapitel 1 Unternehmerisches Entscheiden
Unternehmensgründung, Unternehmer und Unternehmerintention
Wertschöpfungsprozess, Kapital und Kapitalzyklus
Wissen, Nichtwissen, Irrtum und Wissensillusion
Individuelle Unsicherheit
Imaginatives Urteilen, Vertrauen und die Überzeugung anderer
Kapitel 2 Das Unternehmen als fortwährender Versuch
Kapital, Investitionen und Verwertung unter individueller Unsicherheit
Fortwährender Versuch
Unternehmerische Freiheit und Freiheitsaufgabe zur Teilnahme an Unternehmen
Absprachen und Ankündigungen
Intention, Teilnahme anderer und Geheimhaltung
Kapitalgewinn, Glück und Pech
Kapitel 3 Überleben eines Unternehmens
Überleben als Fortsetzung des Versuches
Wert, Preis und Kosten
Profitabilität aus Effizienz und Innovation als gewöhnliche Geschäftstätigkeit
Profitabilität aus unverhofften Gelegenheiten als außerordentliche Geschäftstätigkeit
Fit, Vorteil und Transformation
Kapitel 4 Entscheidungs- und Wertschöpfungsprozesse
Individuelle Unsicherheit und Planung
Individuelle Unsicherheit, Lernen und Flexibilität
Gleichzeitigkeit mehrerer Versuche
8Teil II Erscheinung des Unternehmens als Institution
Kapitel 5 Beteiligte am Unternehmen
Direkt und indirekt Beteiligte und deren Interessen
Direkt Beteiligte
Indirekt Beteiligte
Interessen
Berücksichtigung von Interessen in den Zielen des Unternehmens
Kapitel 6 Kapitalkonstruktion
Eigentum und Haftung
Entkoppelungen für den Umgang mit individueller Unsicherheit
Kapitalkonstruktion, Unternehmensziele und Einfluss
Kapitalkonstruktion, Information und Geheimhaltung
Kapitalkonstruktion und die Aneignung des Kapitalgewinns
Kapitalformen, Versuchsbedingungen und Wachstum
Kapitel 7 Führungskonstruktion
Rollen bei der Führung von Unternehmen
Führung durch Eigentümer und Nicht-Eigentümer
Einfluss der Gläubiger auf die Führung
Zusammensetzung des Führungsteams
Teil III Implikationen in zehn Thesen
Thesen zum Unternehmen als Theorieobjekt
Thesen zum Management von Unternehmen
Thesen zur Betriebswirtschafslehre als Wissenschaft
Quellen und Anmerkungen
9Vorwort
Die schlechte Nachricht zuerst. Wir können nicht vorhersagen, ob ein Unternehmen mit Sicherheit erfolgreich sein wird. Wir können Ihnen nicht sagen, wie Sie überdurchschnittlichen Erfolg mit Sicherheit erzielen werden. Wenn es dennoch genau das ist, was Sie von diesem Buch erhoffen oder gar erwarten, sollten Sie es jetzt weglegen und Ihre Zeit anders nutzen. Wobei, vielleicht noch einen kurzen Moment. Was würden Sie zu folgender fiktiver Anekdote sagen? Stellen Sie sich einen Studierenden im ersten Semester an einer Hochschule der Künste vor. Er spaziert am ersten Vorlesungstag in den Hörsaal, setzt sich in die Mitte der Bankreihe und hebt kurz nach dem Beginn der Vorlesung den Arm, um eine Frage zu stellen. Der Rektor, der an diesem Tag die Begrüßung vornimmt, unterbricht und fordert den Studierenden auf, zu sprechen. Der Studierende fragt: „Können Sie mir bitte sagen, wie ich ein Bild male, das auf einer zukünftigen Auktion mit Sicherheit einen Preis jenseits von 1 Mio € erzielen wird?“ Der Rektor antwortet: „Nein.“ Niemand im Hörsaal wundert sich über den Rektor, aber alle über den Fragesteller. Intuitiv weiß jeder, dass kein Mensch zu sagen vermag, wie man ein Bild malt, das auf einer zukünftigen Auktion einen solchen Preis mit Sicherheit erzielen wird. Trotzdem strömen jedes Jahr viele Studierende an die Hochschulen der Künste.
Dies ist kein Buch über die Künste, die an derartigen Hochschulen gelehrt werden. Sondern es ist ein Buch über Unternehmen. Jedoch verhält es sich mit Unternehmen ähnlich wie mit dem zuvor angesprochenen Bild. Kein Mensch kann sagen, wie ein Unternehmen zu gestalten ist, das mit Sicherheit überdurchschnittlich erfolgreich sein wird. Die Wissenschaft, die eine solche Frage zum Gegenstand hätte und der ich angehöre, heißt Betriebswirtschaftslehre. Unsere Wissenschaft kann nicht sagen, wie ein Unternehmen gestaltet werden sollte, das mit Sicherheit überdurchschnittlich erfolgreich sein wird. Dazu sind wir nicht in der Lage und werden es nie sein. Warum dies so ist, steht in diesem Buch. Damit ist zunächst einmal gesagt und dann später erklärt und begründet, was unsere Wissenschaft nicht kann. Aus meiner Sicht ist es für eine Wissenschaft wichtig, zu sagen, was sie kann, und auch, was sie nicht kann. Dies bildet realistische Erwartungen. Der Müller, der dem König sagte, seine Tochter könne Stroh zu Gold spinnen, hat dies nicht beachtet und (je nach Version des Märchens vom Rumpelstilzchen tatsächlich oder nur beinahe) damit eine Katastrophe ausgelöst. Ich bin deshalb gut beraten, reinen Wein einzuschenken und zu bekennen, was unsere Wissenschaft nicht kann, weil sie es nicht können kann. Damit der schlechten Nachrichten genug. 10Warum und für wen habe ich dieses Buch geschrieben und was kann es Ihnen sagen?
Dieses Buch entspringt einem tiefen inneren Bedürfnis, die Frage, was ein Unternehmen ist, zu beantworten. Die ersten Anstöße hierfür liegen lange zurück. Mit den Arbeiten von Ronald H. Coase bin ich bereits im Studium durch Professor Krahnen in Berührung gekommen. Von Professor Hahn habe ich über Konrad Mellerowicz und seine Auseinandersetzungen in der deutschsprachigen Betriebswirtschaftslehre gehört. Bei Professor Seth durfte ich die angelsächsischen Klassiker der Theorie des Unternehmens lesen und ProfessorHungenberg hat mich mit der Unternehmenspraxis vertraut gemacht und mir ansonsten jede Freiheit gelassen. Der Samen war gesät.
Im Exekutive-Hörsaal, in dem ich viel Zeit verbringe, sagte mir eines Tages ein Teilnehmer, dass das, was ich da mache, alles sehr gut ankomme, solange ich nicht auf theoretische Konzepte zurückgreife, denn diese sind zwar stringent und elegant, allerdings setzt ihre Anwendung ein Wissen voraus, das in der Praxis nicht vorliegt. Ein väterlicher Freund, der Unternehmer ist, gab mir nach der Veröffentlichung meines Lehrbuches zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre den Hinweis, dass das Buch exzellent sei, jedoch für die Preisbildung in der Praxis – ich zeige die Preisbildung dort anhand eines Nachfrage-Angebots-Modells – die Informationen zur Nachfragekurve nicht vorliegen, weswegen die Preisbildung in der Praxis anders funktioniert. Ich machte an mir selbst die Beobachtung, dass ich im Kontakt mit der Unternehmenspraxis Erfolg damit habe, wenn ich weitgehend aus einem anderen Reservoir als meinen eigenen wissenschaftlichen Arbeiten schöpfe. Dies ist ein Stachel in meinem Fleisch als Akademiker.
Die Betriebswirtschaftslehre befindet sich in einer Krise. Dies drückt sich exemplarisch darin aus, dass offen über eine Verbannung der Betriebswirtschaftslehre aus den Universitäten hin zu den Fachhochschulen nachgedacht wird, sowie darin, dass die Unternehmenspraxis mit wenigen Ausnahmen die universitäre Betriebswirtschaftslehre nicht als ersten Ansprechpartner für aktuelle und neue Probleme ansieht. Es ist eher anders herum, die Akademiker hängen an den Lippen der Praktiker. Was in der Betriebswirtschaftslehre Realität ist, wäre in der Medizin undenkbar. Die Krise ist eine Bedrohung, zugleich aber auch eine Chance für unser Fach.
Für den Umgang mit der Krise der Betriebswirtschaftslehre gibt es unterschiedliche Ansätze. AxelGloger machte der Betriebswirtschaftslehre schwere Vorwürfe, nicht das Richtige oder zu wenig für die Unternehmenspraxis und die Gesellschaft zu leisten. Eine mögliche Reaktion darauf, die auch erfolgt ist, ist, die (gegebenenfalls verborgenen) Leistungen der Betriebswirtschaftslehre hervorzuheben und aufzuzeigen, welche Bedeutung die Betriebswirtschaftslehre tatsächlich für die Gesellschaft hat. BurkhardSchwenker, Sönke Albers, Wolfgang Ballwieser, Tobias Raffel und BarbaraWeißen11berger haben hier im selben Verlag ein viel beachtetes Buch vorgelegt, das man diesem Ast der Krisenbekämpfung zurechnen kann. Aus meiner Sicht ist es völlig richtig, die Leistungen der Betriebswirtschaftslehre zu betonen. Gleichwohl könnte es aber auch sein, dass die Krisensymptome nicht nur von außen (unberechtigt) hereingetragen werden, sondern zudem auch hausgemacht sind. Mit anderen Worten, es könnte doch sein, dass die Krise nicht nur auf mangelnde Öffentlichkeitsarbeit für die Betriebswirtschaftslehre zurückgeht, sondern ihre Ursachen auch in der Substanz der Betriebswirtschaftslehre liegen, wie es beispielsweise in den Vorwürfen von FranzSchencking zum Ausdruck kommt.1
Die (große) Schwester der Betriebswirtschaftslehre, die Volkswirtschaftslehre, sieht sich einer ähnlichen Situation gegenüber. Dort hat der Soziologe JensBeckert mit seinem Buch „Imaginierte Zukunft“ einen bemerkenswerten inhaltlichen Beitrag zur Krisenbekämpfung geleistet.2 Er nimmt eine Erklärung des Kapitalismus aus fundamentaler Unsicherheit und fiktionalen Erwartungen heraus vor und zeigt, wie sich aggregiertes Akteurverhalten zu gesamtgesellschaftlichen Phänomenen formt. Ich gehe einen ähnlichen Weg und suche die komplementäre Krisenbekämpfung auch in einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Kerngegenstand meiner Wissenschaft. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Betriebswirtschaftslehre ihre Krise erst dann überwindet, wenn sie auf einem (noch) tragfähig(er)en Fundament steht. Mit diesem Buch versuche ich, einen Beitrag zu einem solchen Fundament zu leisten.
Als Kerngegenstand der Betriebswirtschaftslehre sehe ich Unternehmen als einzelwirtschaftliche Akteure und deren individuelles Verhalten an. Ich erkläre in diesem Buch das Unternehmen als Versuch und Institution und konzentriere mich somit fast ausschließlich auf die Frage, was ein Unternehmen ist. Ich beschäftige mich ausführlich weder mit dem Management von Unternehmen noch mit der Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft, sondern leite hierfür mit einer teilweise loseren Verbindung zu den Hauptinhalten nur wenige Implikationen im abschließenden Teil des Buches ab.
Für wen ist dieses Buch geschrieben? Der erste Teil einer ehrlichen Antwort auf diese Frage ist: für mich selbst. Mit diesem Buch will ich im ersten Schritt vor allem mir selbst klar werden, was ein Unternehmen ist. Der zweite Teil der Antwort lautet: Das Buch ist für jeden geschrieben, der an der gestellten Frage, was ein Unternehmen ist, interessiert ist. Da das Buch fast keinerlei praktische Empfehlungen enthält, darf befürchtet werden, dass Praktiker an diesem Buch nicht interessiert sein werden. Diese Befürchtung teile ich nicht. Jeder, der mit Unternehmen zu tun hat – und insbesondere der akademisch geprägte Praktiker –, dürfte ein Interesse an der Klärung der genau gleichen Frage haben, wie sie meine Frage hier ist. Und natürlich ist dieses Buch für alle Studierenden der sowie die Kollegen in der Betriebswirtschaftslehre geschrieben, da sie sich mit dem 12Unternehmen als Kerngegenstand gegebenenfalls nicht praktisch, aber in jedem Fall akademisch und professionell beschäftigen. Es gibt somit nicht die Zielgruppe für dieses Buch. Es ist für alle da.
Da ich, wie ich in der folgenden Einleitung ausführe, auf vielfältige Grundlagen zurückgreife, könnte die Gefahr bestehen, dass das Buch nichts Neues enthält. Dem ist nicht so. Im Gegenteil, meine ausdrückliche Warnung ist, dass dieses Buch Ihr Weltbild, was ein Unternehmen ist, erschüttern könnte. Es würde Ihnen dann so gehen, wie es einem Praktiker ging, dem ich dieses Buch vorab gezeigt habe und der mir nach einer Weile zurückmeldete, dass ihm aufgefallen sei, dass er sein Unternehmen nunmehr mit anderen Augen sieht. Also Vorsicht und Augen auf! Das Buch ist kein Thriller, bisweilen eher „starker Tobak“. Wenn Sie immer noch erwarten, dass das Buch erklärt, was man tun muss, um erfolgreich als unternehmerischer Entscheider oder Manager zu sein, dann legen sie es bitte sofort weg. Dazu sagt dieses Buch nichts und erklärt stattdessen, warum dies auch sonst keiner sagen könnte. Ein anderer Praktiker, der das Buch vorab gelesen hat, machte mich auf ein interessantes Paradoxon in diesem Zusammenhang aufmerksam. Die Schlussfolgerung, dass unternehmerische Entscheider den „richtigen“ Weg nicht wissen können, macht das Buch unter Umständen wenig attraktiv. Es könnte sein, dass sich diese Erkenntnis nämlich deshalb wenig eignet, dem Publikum mitzuteilen, wenn das Publikum jemanden möchte, der die Zukunft kennt. Ob dies so sein wird, oder nicht, wird man sehen. Es könnte aber auch zu Demut gegenüber der Aufgabe und Arbeit unternehmerischer Entscheider und Manager führen. Es könnte dazu führen, dass man versteht, warum es beispielsweise neben aller Analytik im Management wichtig sein kann, dass Manager als sympathisch und authentisch oder mit welchen persönlichen Eigenschaften auch immer wahrgenommen werden. Also, wenn Ihnen die mögliche Erschütterung des eigenen Weltbildes als unsichere Belohnung für die sicheren Mühen des Lesens und damit den Verzicht auf alternative Wohlgenüsse genügt, dann weiterlesen, ansonsten nicht.
Wenn man weiterliest, kann man sich dieses Buch wie folgt einteilen. Unbedingt lesen sollte man die Einleitung. Sie komprimiert die wesentlichen Aussagen und Bausteine. Wer an der skizzenhaften Aufarbeitung der Theorie des Unternehmens interessiert ist, sollte den vorgestellten Abschnitt zu den Denkschulen der Theorie des Unternehmens lesen. Er lernt hieraus die Grundzüge der Argumentation dieser Theorien kennen und erfährt auch, warum ich anders als Coase Unternehmen nicht als Substitut zu Märkten sehe, sondern argumentiere, dass sich Unternehmen und Märkte gegenseitig bedingen. Zentral für dieses Buch sind die ersten beiden Kapitel des ersten Hauptteils. Alle weiteren Kapitel bauen meinen Ansatz aus und vertiefen. Wer direkt zu den Implikationen springen möchte, kann dies gern tun und gegebenenfalls danach einzelne Aspekte der vorherigen Kapitel vertiefen.
13Dieses Buch ist im Laufe der letzten vier Jahre entstanden. Ich habe versucht, den teils schwierigen Stoff so gut les- und verstehbar wie möglich zu schreiben. Auch deshalb ist das Buch als Essay verfasst, es beschränkt sich weitgehend auf die Angabe grundlegender Literatur und verzichtet auf eine „Fußnotenschlacht“, wie sie ansonsten wissenschaftlichen Texten bisweilen zu eigen ist. Gelegentliche Wiederholungen sind bewusst eingewoben, um einen Wiedererkennungseffekt von Kernargumenten zu erreichen.
Ich habe dieses Buch mit Bleistift handschriftlich vorgeschrieben und meine langjährige Sekretärin, Maria Vuillemin, hat es übertragen. Hierfür sowie für ihr sonstiges einzigartiges Engagement möchte ich ihr meinen allerherzlichsten Dank aussprechen. Kurz vor Ende der Arbeit an diesem Buch habe ich es einer Reihe von Kollegen, Doktoranden und Praktikern zur Kommentierung gegeben. Es war für mich unfassbar, mit welchem Enthusiasmus und mit welch großem Einsatz mir geholfen wurde, das Buch zu verbessern. Für jedes dieser Geschenke möchte ich mich bei den folgenden Personen von Herzen bedanken: Sönke Albers, Oliver Alexy, Klaus Brockhoff, Martin Glaum, Fabian Günther, Eun-Seok Han, Herbert Illgner, Sebastian Jans, Peter Kesting, Ingo Kleindienst, Jan Pieter Krahnen, Bernd Öhring, Andreas Ott, Michael Schmitt, Burkhard Schwenker, Eva Terberger, Arnis Vilks, Jürgen Weber, Barbara Weißenberger und Torsten Wulf. Weiterhin möchte ich mich ganz herzlich bei Thomas Ammon vom Verlag Vahlen für die sehr fruchtbare Diskussion der Idee zu diesem Buch sowie die gesamte Betreuung im Lektorat während der Entstehung des Buches bedanken. Ganz besonders danke ich meiner Frau für ihren verständnisvollen Umgang mit meinen Vorhaben.
Dieses Buch liegt mir ganz besonders am Herzen. Deshalb freue ich mich über jegliche Reaktionen. Diskutieren Sie mit mir, wenn Sie eine Gegenrede zu meinen Argumenten haben, teilen Sie mir etwaige Fehler mit, die Sie finden, und benachrichtigen Sie mich auch, falls Sie das Buch oder etwas in ihm richtig gut finden. Ich freue mich auf Ihr Feedback!
München, im September 2021
Thomas Hutzschenreuter
15Einleitung
Die Frage, die ich in diesem Buch beantworten will, lautet: Was ist ein Unternehmen? Die Antwort, die ich geben werde, lautet: Das Unternehmen ist sowohl Versuch als auch Institution. Das Wesen des Unternehmens ist der Versuch, die Erscheinung des Unternehmens die Institution. Bei der Begründung dieser Sätze greife ich auf Grundlagen und Gedanken zurück, die Ökonomen und Betriebswirte vor mir geschaffen haben. Ich nutze dieses Ausgangsmaterial, um hieraus eine neue Synthese zu präsentieren. Gegebenenfalls füge ich selbst tatsächlich nur einen einzigen Satz zur Theorie des Unternehmens hinzu, der da heißt: Das Unternehmen ist ein Versuch. Ich fundiere meinen Ansatz auf Ideen und Arbeiten von ArthurSchopenhauer und KarlPopper, wenn es um erkenntnistheoretische Grundlagen geht; Frank H.Knight, George L. S.Shackle und Friedrich Augustvon Hayek, wenn es um Unsicherheit, Imagination und verteiltes Wissen geht; Karl Marx, Eugen vonBöhm-Bawerk und Joseph A.Schumpeter, wenn es um die Rolle des Unternehmens in einer kapitalistischen Wettbewerbsordnung geht; sowie Ronald H.Coase, ErichGutenberg und Konrad Mellerowicz, wenn es darum geht, unterschiedliche Herangehensweisen an das Unternehmen als Theorieobjekt gegeneinander abzugrenzen.3
Im Folgenden will ich in dieser Einleitung kurz die wesentlichen Elemente meiner Argumentation zusammenfassen. Das Buch entwickelt diese Argumente ausführlicher, geht auf Diskussionen hinter diesen Argumenten ein und zeigt Verbindungen und Implikationen. Wer hieran interessiert ist, kann nach der Einleitung weiterlesen. Wem die Zusammenfassung genügt, dem dient sie wie ein Rohbau – man erkennt das Haus, sieht aber noch keine Details. Wer hingegen nach dem Lesen der Einleitung nicht überzeugt ist, der sollte das restliche Buch sehr genau lesen – entweder um hierin die Angriffspunkte zur Gegenrede zu finden, oder aber um die Gründe zu finden, warum mein Ansatz überzeugt.
Ronald H. Coase hat mit seinem 1937 erschienenen Artikel4 der Frage, was ein Unternehmen ist, ein eigenes Feld geschaffen. Coase versteht Unternehmen als Substitute zu Märkten. Wie ich zeigen werde, stehen Unternehmen und Märkte aber in keiner substitutiven, sondern in einer Beziehung wechselseitiger Abhängigkeit. Unternehmen setzen Märkte voraus, Märkte brauchen Unternehmen. Ursächlich hierfür ist, dass Unternehmen sich auf Märkten Ressourcen verschaffen, über deren Verwendung sie sich die Freiheit nehmen (müssen), nach der Markttransaktion zu entscheiden. Und Unternehmen verwerten Produkte und Dienstleistungen 16auf Märkten, um eingesetztes Kapital wiederzuerlangen. Märkte würden nicht existieren, wenn Unternehmen nicht versuchen würden, einen höheren als den eingesetzten Kapitalbetrag mit der Verwertung der Produkte und Dienstleistungen zu erzielen.
Hinter dem Verhältnis von Unternehmen und Märkten steht fundamental die Frage, was ein unternehmerischer Entscheider wissen kann, wenn er Kapital für die Erlangung von Kontrolle über Ressourcen einsetzt, um die Produkte und Dienstleistungen, die diese Ressourcen schaffen, später in Kapital zu verwerten. Die substitutive Perspektive geht davon aus, dass der unternehmerische Entscheider die Charakteristika von zu vergleichenden Alternativen marktlicher oder unternehmensinterner Transkationen kennen und somit im Sinne einer Optimalität vergleichen kann. Die Perspektive der wechselseitigen Abhängigkeit geht hingegen davon aus, dass der unternehmerische Entscheider die Charakteristika der Alternativen nicht kennen kann, da die Charakteristika (zum Teil) erst in der Zukunft bestimmt werden und er nicht in der Lage ist, die Zukunft zu kennen. Die Trennlinie im Verständnis von Unternehmen geht somit auf die Frage zurück, ob die Zukunft wissbar ist.
Aus dieser Trennlinie resultieren signifikante Unterschiede. Ist die Zukunft wissbar, lässt sich praktisches Unternehmenshandeln optimieren, die Möglichkeit von richtigen Entscheidungen existiert und Analytik und deduktive Logik dominieren. Optimalität im praktischen Unternehmenshandeln ist hingegen ausgeschlossen, wenn die Zukunft nicht wissbar ist. Zudem ist richtig oder falsch kein eindeutiges Kriterium. Neben Analytik und deduktive Logik treten individuelle, interpersonell nicht zwingend überprüfbare Imaginationen sowie Vertrauen und Überzeugungskraft jenseits „beweisbarer“ Gründe. Kurzum, die Trennlinie bewirkt eine völlig andere Sicht darauf, was ein Unternehmen ist. Der Ausgangspunkt, dass die Zukunft wissbar ist, führt dazu, das Unternehmen unter der Annahme des Vorliegens von „as if“-Wissen zu behandeln, während der Ausgangspunkt, dass die Zukunft nicht wissbar ist, dazu führt, das Unternehmen als Gegenstand praktischen unternehmerischen Handelns zu verstehen. Diesem Ansatz folge ich in diesem Buch. Die Theorieobjekte, die aus beiden entgegengesetzten Ausgangspunkten resultieren, sind zu völlig unterschiedlichen Aussagen in der Lage. Der „as if“-Ansatz erlaubt durch die Beschreibung von „as if“-Problemen die Ableitung von eindeutigen „as if“-Lösungen, wobei ihm die Voraussetzungen zur Lösung des praktischen unternehmerischen Problems fehlen. Der von mir vertretene Ansatz erlaubt eine Beschreibung des praktischen unternehmerischen Problems, ohne dieses Problem für den Praktiker lösen zu können, da es ohne die Kenntnis der konkreten praktischen Umstände in Raum und Zeit nicht lösbar ist. Damit haben beide Ansätze unterschiedliche Stoßrichtungen und einen jeweils unterschiedlichen potenziellen Nutzen.
17Die zwei tragenden Elemente meines Ansatzes sind die Zeit5 und der Kapitalzyklus6. Die Zeit bildet die Grundlage für das Konzept der Unsicherheit. Unsicherheit resultiert in meinem Ansatz aus nicht-wissbarem Nichtwissen. Etwas Zukünftiges kann nicht gewusst werden.7 Nur etwas, das war oder ist und sich damit nicht mehr ändern kann, kann gewusst werden. Unternehmerische Entscheidungen finden somit unter Unsicherheit statt – ich spreche später von individueller Unsicherheit.8 Mein Ansatz fußt darauf, dass ich mit der Trennlinie zwischen der Vergangenheit und Gegenwart9 auf der einen Seite und der Zukunft auf der anderen Seite sehr strikt umgehe. Alles Zukünftige ist unsicher. Es ist möglich, über Zukünftiges Prognosen, Vorhersagen, Imaginationen, Planungen etc. anzustellen, aber eben nicht möglich, Wissen zu besitzen. Auch Wahrscheinlichkeiten können nicht gewusst werden.10 Ursächlich für die Unmöglichkeit von Wissen über die Zukunft ist das Nichtwissen über (einen Teil der) Gründe, deren Konsequenzen die Zukunft ist. Mit anderen Worten: Wenn man alle Gründe (Ursachen) kennen würde, wäre Wissen über die Zukunft möglich. Dann gäbe es keine Unsicherheit. Ein typischer Einwand gegen mein Vorgehen ist, dass es Phänomene gibt, zum Beispiel dass jeden Morgen die Sonne aufgeht, für die meine Einteilung irrelevant ist. Ich stimme zu, dass es solche Phänomene gibt – unabhängig davon sind auch diese Phänomene tatsächlich unsicher und für das Beispiel des Sonnenaufgangs gilt, dass es sehr relevant wäre, würde er einmal ausbleiben –, aber für unser Phänomen hier ist die Einteilung nicht irrelevant. Im Gegenteil, sie identifiziert den entscheidenden Baustein zum Verständnis von Unternehmen. Und sie erlaubt eine klare Abgrenzung von Wissen auf der einen Seite und allen Vorgehensweisen (Prognosen, Vorhersagen, Imaginationen, Planungen etc.), die sich auf den Umgang mit nicht-wissbarem Nichtwissen – sprich Unsicherheit – beschäftigen, auf der anderen Seite.
Wenn alles Zukünftige unsicher ist, dann ist auch die Höhe des zukünftigen Kapitalgewinns unsicher. Kapitalgewinn oder -verlust entsteht am Ende des Kapitalzyklus. In diesem wird Kapital eingesetzt, um Ressourcen zu kaufen, diese gehen in die Wertschöpfung von Produkten und Dienstleistungen ein, die versucht werden, gegenüber Kunden wiederum zu Kapital zu verwerten. Am Beginn und am Ende dieses Zyklus steht Kapital, wobei der Kapitaleinsatz im Zeitpunkt des Beginns sicher ist, der Kapitalbetrag am zukünftigen Ende dieses Zyklus hingegen unsicher. Ursächlich für die Unsicherheit am Ende des Zyklus ist, dass der Zyklus Zeit in Anspruch nimmt11 und im Zeitpunkt des Beginns des Zyklus sein Ende etwas Zukünftiges ist. Wenn Kapitalgewinn im hier verwendeten Sinn individuell unsicher ist, dann kann der Kapitalgewinn nicht optimiert werden, da hierfür Wissen notwendig wäre. Das Unternehmen, dessen Kernprozess kaufen, um zu verkaufen, ist, ist damit kein Gegenstand von Optimierung, sondern sein Wesen ist der Versuch. Dies ändert sich auch nicht mit fortschreitendem Bestehen eines Unternehmens. Das Unternehmen ist 18somit nicht nur ein Versuch zu Beginn seines Bestehens, sondern es ist ein fortwährender Versuch.
Das Wesen des Unternehmens als Versuch führt dazu, dass es keinen Messias als unternehmerischen Entscheider geben kann, der aus der Kenntnis der Zukunft die für das Unternehmen mit Sicherheit richtigen Entscheidungen trifft.12 Das Publikum, das davon ausgeht, dies könne es doch geben, unterliegt einem Irrtum. Das Empfinden, die Zukunft doch zu kennen und deshalb zu wissen, was richtig für das Unternehmen ist, trügt, wie auch die vielen Beispiele zeigen, in denen erfolgreiche Unternehmen, die meinten, ihren Markt zu kennen, lernen mussten, dass dem doch nicht so ist, und in Misserfolgen untergegangen sind. In derartigen Fällen wird häufig das Satz gesagt: „Wir haben das nicht für denkbar gehalten“, womit gesagt werden soll, dass man eine mögliche Entwicklung nicht gedacht hat. Es kommt somit im Hinblick auf die Zukunft darauf an, Möglichkeiten zu denken, statt Zukünftiges zu wissen, was nicht möglich ist.
Zu meinen, die Zukunft zu kennen, heißt, einer Wissensillusion zu unterliegen. Es heißt, sich in einer sehr kleinen, wohl strukturierten Welt zu bewegen, während die Welt tatsächlich sehr viel größer ist und Dinge bereithält, die in der kleinen, wohl strukturierten Welt nicht für möglich gehalten werden. In einer solchen sehr viel größeren, nicht vollständig erkennbaren Welt gibt es ganz andere Probleme, als das der Optimierung zu lösen. Hier geht es darum, in den Lauf der Welt selbst einzugreifen, statt (nur) den „richtigen“ Platz zu finden.
Für das bessere Verständnis beim weiteren Lesen des Buches will ich drei Aspekte in dieser Einleitung ansprechen, die in der Diskussion immer wieder auftauchen. Diese sind: Sind die Konsequenzen des Unternehmenshandelns, wie zum Beispiel der Kapitalgewinn, indeterminiert und deshalb nicht sicher vorhersehbar? Ist das Unternehmen, weil es unsicher ist, eine Wette? Und: Ist die Unsicherheit begrenzt, weil es Dinge gibt, auf die sich ein unternehmerischer Entscheider verlassen kann?
Unbestimmtheit und Unvorhersehbarkeit. Alles, was geschieht, geschieht notwendig, da es Gründe gibt, die Ursachen ihrer Konsequenzen sind.13 Gemäß diesem Schopenhauer‘schen Prinzip sind auch die Konsequenzen des Unternehmenshandelns und damit auch der Kapitalgewinn nicht indeterminiert. Davon zu unterscheiden ist, ob die Konsequenzen sicher, im Sinne von Wissen, vorhersagbar sind. Sie können zwar prognostiziert, imaginiert und in diesem Sinne vorhergesagt werden, aber es ist nicht möglich, sie sicher vorherzusagen; die Vorhersage ist unsicher. Sie sind somit zwar durch Gründe determiniert, jedoch können diese Gründe nicht vollständig gewusst werden und damit ist eine sichere Vorhersage nicht möglich.
Unternehmen als Wette. Man kann ein Unternehmen als Wette ansehen, die unternehmerischen Entscheider wären dann die Spieler, das Kapital der 19Wetteinsatz. Tut man dies, ist es ganz wichtig, zu beachten, welche Art Wette ein Unternehmen dann ist. Anders als beim Roulette oder Lotto kann der unternehmerische Entscheider die Chancen im Vorhinein nicht deduktiv ableiten, jedoch kann er Einfluss auf den Ausgang der Wette nehmen, nachdem die Wette abgeschlossen und der Wetteinsatz geleistet ist. Es ist sogar eines der Kerncharakteristika des Unternehmens, dass der unternehmerische Entscheider die Freiheit des Bestimmens über die konkrete Verwendung der Ressourcen hat, nachdem diese Ressourcen kontrahiert worden sind. Deshalb ist ein Unternehmen, wenn man es als Wette bezeichnen möchte, keine Wette wie Roulette oder Lotto, sondern eine Wette mit der Möglichkeit des aktiven Eingreifens nach Vereinbarung der Wette.
Begrenzte oder unbegrenzte Unsicherheit. Es wird zuweilen argumentiert, dass die individuelle Unsicherheit, der Unternehmenshandeln ausgesetzt ist, begrenzt sei,14 da sich der unternehmerische Entscheider auf bestimmte Dinge verlassen kann. Als Beispiele werden formale und informelle institutionelle Regelungen genannt, die in einer Gesellschaft anzutreffen sind. Ich stimme der Auffassung zu, dass man sich mit guten Gründen auf das Eintreffen bestimmter Ereignisse, die aus solchen oder ähnlichen Beispielen resultieren, verlässt. Gleichwohl halte ich fest, dass all jene zukünftigen Dinge, die von Menschen gemacht werden, auch anders als in der Vergangenheit und damit anders als erwartet sein können. Für mich sind die angeführten Elemente keine Begrenzungen von Unsicherheit und damit Sicherheitsspender, sondern sie sind Vereinbarungen, Absprachen, Ankündigungen etc. und können eintreten, sicher ist dies jedoch nicht. In der Unternehmenspraxis kann für diese Aspekte von Unsicherheit der Unterschied zwischen Wissen und Unsicherheit aus Gründen der Relevanz verwischen. Aus analytischem Standpunkt jedoch ist die Trennlinie und Unterscheidung wichtig. Erlaubt man die Begrenzung von Unsicherheit und damit Wissen über die Zukunft, gibt es keine Klarheit mehr darüber, was Unsicherheit versus Wissen ist. Und dies ist von überragender Bedeutung, es wird unklar, was Lernen (Handeln zur Erweiterung von Wissen) ist und was Praktiken im Umgang mit Unsicherheit wie zum Beispiel Prognosen, Imaginationen, Vorhersagen, Planungen etc. sind. Aus diesem Grund ist es wichtig, wenn es um die wissenschaftliche Diskussion von Unsicherheit geht, im ersten Schritt die analytische Klarheit zu schaffen, und im zweiten Schritt, wenn es um die Lösung von praktischen Problemen geht, in Bezug auf die konkreten Umstände über die Relevanz von Quellen von Unsicherheit zu befinden. Dies ist eine individuelle Angelegenheit des unternehmerischen Entscheiders und gerade hierin liegen bereits Möglichkeiten für Unterschiede zwischen unternehmerischen Entscheidern, nämlich genau dann, wenn ein unternehmerischer Entscheider an die Verlässlichkeit vermeintlich Sicherheit spendender Institutionen glaubt und ein anderer nicht und genau darauf eine unternehmerische Handlung aufbaut. Ich gehe somit davon aus, dass Unsicherheit als nicht-wissbares 20Nichtwissen über die Zukunft unbegrenzt ist, nicht reduziert werden kann und unabhängig davon ist, wie weit die betreffende Zukunft entfernt ist. Dies ist auch der grundlegende Unterschied zum Ansatz von Dieter Schneider, der in Unternehmen Institutionen zur Verringerung von Einkommensunsicherheiten sieht15 und damit davon ausgeht, dass Unsicherheit reduziert werden könnte. Allerdings gehe ich zudem davon aus, dass sich die Möglichkeiten, dass sich die Zukunft von der Vergangenheit unterscheidet, mit zunehmendem zeitlichen Abstand in die Zukunft erhöhen. Mit anderen Worten: Jegliche Zukunft ist unsicher, je weiter weg eine Zukunft jedoch liegt, um so mehr Möglichkeiten der Veränderung gegenüber der Gegenwart und Vergangenheit.
Wie unschwer zu erkennen ist, hat das auf der Zeit basierende Konzept der Unsicherheit eine überragende Bedeutung für meinen Ansatz. Um diesen Ansatz zu entwickeln, gehe ich wie folgt vor. Im Anschluss an diese Einleitung stelle ich die Denkschulen zur Theorie des Unternehmens vor. Dieser Abschnitt dient dazu, den Unterschied aufzuzeigen zwischen der Perspektive auf Unternehmen als Theorieobjekt unter den Annahmen von „as if“-Wissen – repräsentiert durch etablierte Unternehmenstheorien – und der Perspektive praktischen unternehmerischen Handelns als Theorieobjekt unter den Bedingungen individueller Unsicherheit – repräsentiert durch Entrepreneurship-Theorien. Mein Ansatz entwickelt dann mit den ersten beiden Kapiteln eine Perspektive vom Unternehmen als Theorieobjekt praktischen Handelns unter den Bedingungen individueller Unsicherheit und mündet in der Erläuterung des Satzes vom Unternehmen als fortwährendem Versuch. Hierfür entfalte ich den Kapitalzyklus unter individueller Unsicherheit, das unternehmerische Entscheiden als imaginatives Urteilen und Kommunizieren, das unternehmerische Handeln als Vertrauen und Commitment sowie den Zusammenhang zwischen unternehmerischem Handeln und Kapitalgewinn. Mit dem dritten Kapitel des ersten Teils, der sich dem Wesen des Unternehmens widmet, zeige ich, wovon das Überleben von Unternehmen abhängt, um dann im vierten Kapitel zu diskutieren, wie der Versuch Unternehmen in den Entscheidungs- und Wertschöpfungsprozessen ausgestaltet wird. Im zweiten Hauptteil des Buches gehe ich dann auf die Erscheinung des Unternehmens als Institution ein, wobei ich mich darauf beschränke, drei Bereiche institutioneller Gestaltung skizzenhaft durch die Brille des Unternehmens als Versuch zu diskutieren. Ich beschränke mich auf die Diskussion von privatwirtschaftlichen Unternehmen, die (zumindest potenziell) im Wettbewerb stehen. Meine Überlegungen können mit entsprechenden Anpassungen auch auf andere Arten von Unternehmen und Organisationen, wie öffentliche Unternehmen, Stiftungen, Genossenschaften etc., übertragen werden.
Im abschließenden dritten Teil widme ich mich einigen Implikationen, die mein Ansatz für drei Bereiche hat. Erstens leite ich Implikationen zum Unternehmen als Theorieobjekt ab. Hierbei greife ich auch den dritten 21Methodenstreit der deutschen Betriebswirtschaftslehre zwischen dem Gutenberg-Lager und dem Mellerowicz-Lager auf und versuche zu zeigen, dass beide Lager aneinander vorbei auf unterschiedlichen Ebenen argumentieren, nicht konkurrierend, sondern komplementär zueinander sind. Zweitens leite ich Implikationen für das Management von Unternehmen ab. Die Managementperspektive – wie können und sollen Unternehmen geführt werden? – ist nicht mein Gegenstand, aber aus der Perspektive des Unternehmens als Theorieobjekt lassen sich Implikationen formulieren, die Ausgangspunkte für die Entwicklung der Managementperspektive zum Unternehmen als Versuch und Institution sein können. Und drittens werde ich einige Implikationen aus meinem Ansatz für die Frage ableiten, wie die Wissenschaft von Unternehmen, die Betriebswirtschaftslehre, als Erforschung der und Lehre von Unternehmen aussehen kann. Diese Implikationen könnten Ausgangspunkte für die Ausarbeitung einer Logik der betriebswirtschaftlichen Forschung und Lehre sein.
23Denkschulen zur Theorie des Unternehmens im Überblick
Was ist ein Unternehmen? Dies ist die Kernfrage der Theorie des Unternehmens. Die Antwort auf diese Frage bestimmt, was man in Unternehmen sieht und wie man sich mit Unternehmen (als einem wissenschaftlichen Gegenstand) beschäftigt. Man könnte so weit gehen, zu sagen, dass die Antwort auf die Frage, was ein Unternehmen ist, alles Weitere in der (wissenschaftlichen) Auseinandersetzung mit Unternehmen bestimmt. Die Antwort auf diese Frage ist eine Art Brille, durch die man sieht. Je nachdem, ob man eine Brille und welche Brille man aufhat, sieht man anders und man sieht etwas anderes. Die Brille richtet den Blick auf bestimmte Eigenschaften und wendet ihn dabei von anderen Eigenschaften ab. Die Brille setzt etwas Bestimmtes ins Hellfeld und lässt anderes im Dunkeln. Für die Frage, was ich an und in einem Gegenstand sehe, wie ich ihn sehe und was ich nicht sehe, ist also entscheidend, welche Brille ich trage.
Ronald H. Coase hat mit seinem 1937 erschienenen Artikel „The nature of the firm“16 die Diskussion zur Theorie des Unternehmens auf den Punkt gebracht. Er fragt in klarer Sprache und stringenter Argumentation danach, was ein Unternehmen ist und warum Unternehmen existieren. Der damals vorherrschenden Diskussion lag die Idee zugrunde, dass Märkte als Quasi-Gegenstück zu Unternehmen primär existieren und die Existenz von Unternehmen derivativ von Märkten abzugrenzen sei. Coase schuf hierfür die Brille der Transaktionskosten und damit eine Sicht, die bis heute den Blick auf Unternehmen prägt. Coases Artikel hat der Diskussion um das Verständnis des Unternehmens ein eigenes Feld geschaffen. Coase benennt für die Theorie des Unternehmens vier Erklärungsbereiche: Was ist ein Unternehmen? Warum existieren Unternehmen? Was bestimmt die Grenzen des Unternehmens? Und was bestimmt die interne Organisation von Unternehmen? Ich konzentriere mich auf die ersten beiden Fragen. Aus meiner Sicht sind die beiden letzten Fragen aus Derivaten der Antworten auf die ersten beiden Fragen zu beantworten. Die von Coase auf den Punkt gebrachte Diskussion um die Natur von Unternehmen ist bislang noch nicht zu einem Ende gekommen. Stattdessen stehen sich im Sinne von Thomas S. Kuhn17 mittlerweile mit den etablierten Unternehmenstheorien und den Entrepreneurship-Theorien zwei größere Lager – man könnte sie als die Brillengestelle verstehen – gegenüber, deren Frontlinie in diesem Essay den Ausgangspunkt bilden soll. Innerhalb des jeweiligen 24Lagers gibt es zwar durchaus unterschiedliche Auffassungen, die aus Sicht der jeweiligen Protagonisten sogar die Zugehörigkeit zu verschiedenen Paradigmen begründen würden. Jedoch sind diese Unterschiede eher marginaler Natur im Vergleich zu der großen Abbruchkante zwischen den beiden Lagern. Die Trennlinie zwischen den beiden Lagern, auf die ich wenig später detaillierter zurückkomme, verläuft entlang der Frage, von welchem Wissen über die Zukunft ausgegangen wird. Etablierte Unternehmenstheorien setzen solches Wissen in unterschiedlichen Formen voraus, während Entrepreneurship-Theorien in unterschiedlicher Weise von der Existenz solchen Wissens abstrahieren.