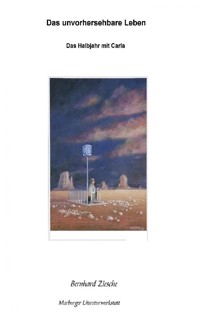
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Dieses "hypothetische Tagebuch" aus dem alltäglichen Leben eines Unscheinbaren erzählt vom Unvorhersehbaren im Leben, also von dem, was immer und überall ganz unauffällig geschieht, wenn wir glauben, die Verhältnisse im Griff zu haben. Es geht um Liebe und Leid, um Angst und Wagnis, um Leidenschaft und Freundschaft, um Verdacht und Verrat - es geht um das, was Gewicht hat im Leben und doch stets zum Ungleichgewicht neigt, weil das blinde Mädchen Fortuna den Titanen Zufall zum Wägemeister bestellt hat. Vieles und viele spielen dabei eine Rolle, deren Text sie nicht selbst geschrieben haben: - Ein Biochemiker, der in seine Heimatstadt Berlin zurückkommt und dabei vom Unvorhersehbaren überrascht wird. - Ein seltsames Institut, als Hochsicherheitstrakt gestaltet. - Ein Doktor Mephisto genannter Kollege, "dilettierender Soziostrukturmechaniker" laut eigener Aussage. - Ein amüsanter "Salon der verqueren Inkonsequenz" mit einer faszinierenden Gastgeberin. - Eine Einladung zu Tee ... und mehr. - Eine leidenschaftliche Liebesaffäre zwischen zwei Verhexten. - Ein Dreiecksverhältnis mit problematischem Pakt. - Ein Schriftsteller, der sich in doppelter Anonymität versteckt. - Geheimnisvolle Geschäftsführer und noch geheimere Leute vom "Dienst". - Peter & Paul in ihrem Restaurant. - Familiengeburtstage und großväterliche Betrachtungen. - Ein tränenreicher und liebevoller Abschied ... und noch manches andere in 48 Kapiteln. Vor allem ist es aber die uralte Geschichte, die in jedem Leben neu erzählt wird, die einzige Geschichte, die nie endet: Wie zwei sich suchen und finden, wie zwei lieben und leiden, wie zwei einander festhalten wollen und sich trennen müssen. Wie keiner klüger wird, als die Klugheit der Art ihm erlaubt, wie das Spiel von vorn beginnt und wieder hinterrücks endet. Die Geschichte, über die alles bekannt und gesagt ist, und die doch immer unvorhersehbar ist für den, der sie erfährt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das unvorhersehbare Leben
Das Halbjahr mit Carla
Erstes Tagebuch des Marc Dreihausner
Marburger Literaturwerkstatt 2018
Erste Buchauflage 2018 © Bernhard D. Ziesche, Marburg 2018 ISBN 9781717010780
Erste E-Book-Auflage 2023 © Bernhard D. Ziesche, Marburg 2023 - Marburger Literaturwerkstatt -
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagbild mit freundlicher Genehmigung von
© Gerhard Glück, Kassel.
Inhalt
Vorbemerkungen zur E-Book-Auflage 2023
Vorwort des Herausgebers Vorbemerkungen des Lektorats Editorische Notizen
Biographische Notizen
1 Nach Berlin!
2 Vorstellung im Institut
3 Erster Arbeitstag
4 Brief an Ottilie
5 Doc Mephisto
6 Jonas und Simona
7 Freund Hildebrand
8 Institutsbesprechung9 Kryoniker10 Geheimes Institut
11 Einladung zum Vortrag
12 Vortrag und Party
13 Gespräch mit Danilo
14 Warnung an Ottilie
15 Einladung zum Tee . . . und mehr
16 Spandauer Wohnung
17 Frühlingsanfang
18 Fachgespräch mit Danilo
19 Neni und Bikini
20 Geheimnis in Gedichten
21 Ein Tag- und Nachtgespräch
22 Carla erzählt
23 Gespräch mit Karl
24 Kolloquium in der Kulturbrauerei
25 Ein problematischer Pakt
26 Zweites Treffen mit Karl
27 Paargespräch
28 Nach Vaters Geburtstag
29 Carlas Geburtstag - ohne mich
30 Zweisamkeit in Vertrautheit
31 Maiennacht
32 Zeit der Kirschen
33 Angst und Zweifel
34 Bekennende Nymphen
35 Onkel Otto
36 Am Schlachtensee
37 Scriptefix
38 Leute vom Dienst
39 Peter und Paul
40 Grund der Liebe
41 Quatorze Juillet
42 Sicherungsarbeit
43 Väterliche Betrachtungen
44 Russisch Roulette
45 Zukunft der Liebe
46 Kündigung
47 Liebe unter Stress48 Abschied
Vorbemerkungen zur E-Book-Auflage 2023
Gegenüber der Druckversion von 2018 wurden außer den für ein E-Book erforderlichen Anpassungen im Layout einige redaktionelle Änderungen zur Verbesserung stilistisch holpriger Sätze, zur Berichtigung von zwei sachlichen Fehlern und zur Berücksichtigung der Änderungen in der Orthografie vorgenommen.
Die Fußnoten der Print-Ausgabe von 2018 werden mit der dortigen Nummerierung direkt hinter die zugehörige Textstelle kursiv in eckigen Klammern angefügt, z.B. [1 Sie hat ihren Mädchennamen nach der Heirat beibehalten.] Das stört zwar den Textfluss, ermöglicht aber dem Leser sofortige Kenntnisnahme, ohne dass er in einem Verzeichnis am Ende des Buches, auf das verzichtet wurde, nachschlagen und dann zur Textstelle zurückspringen muss.
Vorwort des Herausgebers
Mein Freund Marc Dreihausner übergab mir vor einem Jahr einen Packen Blätter mit den Worten: „Mach damit, was du willst. Ich bin fertig mit der Geschichte. Die Vergangenheit ist geschlossen, die Zukunft steht offen, ich verschwinde nun im Heute. Wen interessiert schon eine Sex-and-Crime-Story aus dem alltäglichen Leben eines Unscheinbaren. Kein Happy End, sondern ein Open End - zum Gähnen realistisch! Kein Mord, keine Vergewaltigung, kein Millionenbetrug, keine Mafia - wie unspektakulär! Keine Grafen, Gurus, Chefärzte, Oberforst- meister, keine Topmodels, Hollywoodidole, Millionärstöchter - nur bürgerliche Mittelschicht mit ihren aufgeblasenen Problemchen, wie langweilig! Das lese ich nicht mehr, und das liest sonst auch niemand.
Aber wenn du einen Verleger mit deinem herben Charme und deinem famosen Rotwein so besoffen quatschen kannst, dass er das drucken will, meinetwegen, ich habe nichts zu verbergen und nichts dagegen. Es wird so viel Schund auf den Büchermarkt geworfen, da kommt es auf ein Werk zweifelhaften Inhalts mehr oder weniger auch nicht an.“
Ohne es zu wissen und zu wollen, übergab uns Marc damit ein Teilstück seiner „hypothetischen Autobiographie“, wie Gregor von Rezzori es einmal nannte. Die Angaben in den Tagebuchaufzeichnungen, Briefen und Berichten genügen der Wahrheit und Vollständigkeit aus der Sicht der Beteiligten; doch auch der wahrhaftigste Bericht bleibt weitgehend imaginär, selbst wenn er mit der Genauigkeit eines Kanzleischreibers erstellt würde. Es ist der Versuch, Licht und Sinn in eine gleichwohl nur erfundene Vergangenheit zu bringen, in der der Zufall das einzig wirklich Authentische ist. Das größere Kopfzerbrechen bereitete nicht, was in die Sammlung aufzunehmen, sondern was auszulassen war. Auch dabei entschieden wir uns für eine Mischung aus Notwendigkeit und Zufall. Wir waren überrascht, welche angenehmen Wirkungen sich nach einiger Übung aus diesem Spiel sowohl für die Farbigkeit und Vielfalt des Textes als auch für unsere Freude daran ergaben.
Der Text enthält keine Botschaft; vielleicht ist gerade dies seine besondere Botschaft. Er erzählt nur von dem, was so oder ähnlich immer und überall geschieht. Ihm eine besondere Bedeutung zu unterlegen, verfehlt ihn. So wie der Sinn des Lebens das Leben ist, so ist der Sinn der Erzählung das Erzählen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger - also eine ganze Menge.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zwar nicht beabsichtigt, doch unvermeidlich, weil sich in jeder der schreibenden oder beschriebenen Personen jeweils mehrere dutzend bis hundert verschiedene Persönlichkeiten zu Recht wiederzuerkennen glauben werden; solche Ähnlichkeiten und Entsprechungen sind somit nicht zufällig, sondern zwangsläufig. Jeder erkenne also ungeniert das wieder, was er darin von sich zu erkennen vermag - er kommt der eigenen Wirklichkeit sicher ein Stück näher.
Wir haben uns bemüht, eine eher leserfreundliche als textkritische Ausgabe zu erstellen. Es kam nicht darauf an, die originale, leider oft sehr nachlässige Schreibweise der Syntax, Orthografie und Interpunktion oder die stilistischen und grammatikalischen Besonderheiten, besser: Skurrilitäten, zu bewahren, sondern eine behutsam modernisierte, von störendem oder seltsamem Beiwerk befreite Erzählform zu schaffen. Bei dieser Arbeit hat sich Frau Ursina Berburg-Faber durch ihr sicheres Sprachgefühl und die Sorgfalt von Textvergleich und Textinterpretation, die sie in ungezählten Stunden der Lektüre und Diskussion bewies, ganz besondere Verdienste erworben; dafür danke ich ihr herzlich.
Ebenso sei dem Verlag gedankt für die verständnisvolle Unterstützung und die Bereitschaft zur Herausgabe der wirren und anspruchslosen Texte, die mich persönlich zwar stark betreffen, von denen ich aber nicht annehmen darf, dass sie bei Unbeteiligten besondere Aufmerksamkeit erwecken.
Manches, das ich mit meinem Freund Marc in Briefen und Gesprächen durch die Befangenheit der Nähe und durch die Beteiligung an den Ereignissen nicht behandeln konnte, sehe ich nun rückblickend deutlicher oder erkenne es zum ersten Mal. Gern würde ich ihm selbst sagen, was ich hier zum Leser über ihn schreibe. Ich hoffe, dass er es demnächst lesen, ergänzen und erklären wird.
Es ist eine Erzählung vom Schwanken und Brechen, vom Aufrichten und Widerstehen, vom Fügen und Zerreißen, eine Erzählung vom Ungleichgewicht, wenn das blinde Mädchen Fortuna den Titanen Zufall zum Wägemeister bestellt. Eine Erzählung vom Einbruch des Zufalls ist aber immer eine über Schicksal, Fügung, Verhängnis, über Glück und Leid, also über das Bedeutsame, Gewichtige im Leben. Wenn alle Verhältnisse im Gleichgewicht sind, hat keines ein wirkliches Gewicht.
Und dann ist es natürlich die uralte Geschichte, die in jedem Leben neu erzählt wird, die einzige Geschichte, die nie endet: Wie zwei sich suchen und finden, wie zwei lieben und leiden, wie zwei einander festhalten wollen und sich trennen müssen. Wie keiner klüger wird, als die Klugheit der Art ihm erlaubt, wie das Spiel von vorn beginnt und wieder hinterrücks endet.
Das Verhalten von Marc war keine Auflehnung, nicht einmal eine unbewusste, sondern es war ganz einfach das Leben, das vorüberging und ihn mitnahm. Er spürte manchen Mangel und wollte etwas gewinnen, das dem abhülfe; aber es sollte sich wie nebenbei ereignen, durchaus mit einer gewissen Anstrengung, doch ohne Wagnis. Aber das größte Wagnis gehen bekanntlich jene ein, die nie das kleinste Risiko auf sich nehmen; sie erreicht der Zufall unvorbereitet in seiner ganzen Härte.
Leid erweckt den Geist, Unglück ist der Weg zur Empfindsamkeit, in der Angst nimmt das Herz an Adel zu.
Während Marc lange Zeit unterfordert war und sich nur träge veränderte, machte er unvermutet einen stressinduzierten Entwicklungswirbel durch, wobei er durch die ihm schon immer eigene Neugier, durch die Bedrohung durch Macht, Gewalt und Tod, vor allem aber durch die Herausforderungen der Liebe vorher unentdeckte Fähigkeiten entfaltet, ihn selbst überraschende Strategien zur Bewältigung der Herausforderungen findet sowie ungeahnte Wachheit und Kreativität an sich entdeckt. Bei aller Anspannung und Anstrengung wird es eine Zeit höchster Intensität und tiefen Glücks; nie war das Leben reicher, pulsierender, vielfältiger, gefährlicher.
An Dr. Dreihausners Persönlichkeit schätze ich, dass Rationalität und Emotionaltät gleichermaßen gut entwickelt sind, so dass sie - imAllgemeinen - das Verhalten und Urteilen in einem ausgewogenen Verhältnis bestimmen. Er neigt aber dennoch - im Besonderen - gelegentlich zu krassen Fehlurteilen, wie alle Menschen, wenn die Schwerkraft starker Gefühle das Feld des Denkens verzerrt. So ist das Konvolut von Texten keine „Sex and Crime Story“, sondern eine triviale Liebesgeschichte, wie sie immer und überall abläuft. Doch, um mit Heinrich Heine zu sprechen,
Es ist eine alte Geschichte,Doch bleibt sie immer neu;Und wem sie just passieret,Dem bricht das Herz entzwei.
Mein Freund Marc hat diese für uns alte Geschichte, die für ihn aber das außerordentliche Erlebnis wurde, schreibend verarbeitet und so, wie er glaubt, bewältigt. Für ihn ist das wertvoll, für uns außenstehende Leser in vielem eher befremdlich. Es ist seine Erzählung mit seiner Sicht der Dinge, nicht unsere. Er schildert keine „wahren Begebenheiten“, auch wenn sie sich tatsächlich zugetragen haben, sondern Perspektiven und Interpretationen seiner Eindrücke und Erinnerungen, so zeitnah sie auch niedergeschrieben wurden. Auch wenn wir mit einer Reihe von Aussagen nicht einverstanden sind, steht es uns nicht zu, falsche oder übertriebene Ansichten durch unsere eigenen, womöglich ebenso unzutreffenden zu ersetzen, nur weil diese uns besser gefallen.
Da es sich um ein persönliches Tagebuch handelt, spiegelt es die Auswahl von Themen und Thesen, von Ansichten und Einsichten des Schreibers wider. Als Biochemiker und Neurowissenschaftler schreibt Marc oft über Fragen und Themen, die sich aus seinem fachlichen und persönlichen Interesse sowie aus Gesprächen mit Leuten gleicher oder ähnlicher Ausrichtung ergeben. Wir haben überlegt, solche Abschnitte zu streichen oder zu kürzen, uns aber dann doch entschlossen, die manchmal weitschweifigen Ausführungen bis auf wenige Ausnahmen mit allzu abwegigem Inhalt beizubehalten, um dieAuthentizität des Textes nicht noch mehr durch unnötige Eingriffe zu verfälschen. Uns leitete dabei auch die Hoffnung, dass der Leser manches Wissenswerte erfahre, das ihn zu eigenem Nachdenken und Nachforschen anrege. Solch ein Werk wächst und verändert sich beim Schreiben und Redigieren wie ein Lebewesen. Es wird ständig einiges aufgenommen, anderes wird ausgeschieden; erst wenn es gedruckt vorliegt, ist der Lebensprozess abgeschlossen, es erstarrt zur Sache. Ob weitere Tagebücher für Zeiträume davor oder danach erhältlich sein werden, ist ungewiss. Mein persönliches Interesse daran muss nicht das des Lesers sein.
Und wie immer im Leben: Keine voreiligen Schlüsse! Seien Sie unvoreingenommen und lassen Sie sich überraschen. Ich bin nicht Hildebrand, der im Text genannte Jugendfreund. Auch Marc und Carla sind nicht die, die sie scheinen. Finden Sie es heraus.
Dieses Werk ist niemandem gewidmet oder verpflichtet außer jenen, die Gefallen daran finden.
Abschließend noch die notwendigen Warnhinweise:
Sie lesen auf eigene Verantwortung! Verlag und Herausgeber haften nicht für Schäden durch Wutausbrüche, Schwermutattacken, nostalgische Herzkrämpfe oder sonstige schädliche Emotionen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Buchhändler oder Nervenarzt. Bei anhaltenden oder heftigen Symptomen unterbrechen Sie die Lektüre; wenn auch das nicht hilft, übergeben Sie den Text der Altpapierverwertung.
Dies ist kein Kinderbuch, sondern ein Buch für Erwachsene. Es ist freigegeben ab 16 Jahren durch die Freiwillige Selbstkontrolle des Buchhandels (FSB).
Wir bitten die Leserschaft um Nachsicht mit den unvermeidbaren „Geburtsfehlern“, die jede komplexe Datenstruktur aufweist, sei es das menschliche Genom, ein größeres Computerprogramm oder ein längerer Text wie der vorliegende. Für Hinweise auf Fehler und Unge- reimtheiten sind wir dankbar. Bitte senden Sie Einspruch oder Zuspruch, Aufmunterung oder Schmähung, Anmerkungen oder Ergänzungen …oder was Sie sonst noch zu sagen haben an
Marburg, im Mai 2018/Juli 2023 Bernhard D. Ziesche
Vorbemerkungen des Lektorats
Die uns zur Veröffentlichung überlassenen Aufzeichnungen, von denen wir hier eine erste Folge vorstellen, bilden kein zusammenhängendes Manuskript, sondern wurden uns als eine sachlich und zeitlich nur lose geordnete, oft lückenhafte Sammlung von teils absichtsvoll, teils zufällig gestaltetem Schriftmaterial übergeben. Wenn wir uns dennoch zur Herausgabe entschlossen haben, zeigt das, dass wir darin manches Wertvolle und allgemein Bedenkenswerte zu finden glaubten. Die Leserschaft, die wir dem Werk trotz seiner offensichtlichen Mängel gerade wegen seiner versteckten Vorzüge wünschen, wird im Laufe der Zeit entscheiden, ob unsere Beurteilung gerechtfertigt oder ein Fehlurteil war.
Herrn Prof. Dr. Bernhard Ziesche konnten wir als Herausgeber gewinnen, der als langjähriger Gesprächs- und Briefpartner des Autors bestens geeignet ist, die unterschiedlichen Texte zu redigieren, zu kommentieren, mit Beiträgen aus dem eigenen Erleben, der eigenen Erinne- rung und Briefsammlung zu ergänzen und andererseits viel Nebensächliches und den Fluss der Erzählung Störendes ohne schmerzliche Schnittstellen auszuscheiden. Wir hoffen, dass es uns gemeinsam gelang, einen zusammenhängenden Text zu erstellen, der gut lesbar und allgemein verständlich ist.
Für die Bereitschaft, diese streckenweise äußerst mühsame Arbeit zu übernehmen, und für die besondere Güte und Sorgfalt, mit der die Aufgabe gelöst wurde, danken wir in besonderer Verbundenheit Herrn Dr. Ziesche.
Die sorgfältige Arbeit und große Erfahrung von Dr. Ziesche verpflichtete uns eher zu einem ebenso sorgfältigen wie aufwändigen Lektorat, als dass sie uns davon entband. Wir haben unklare, schwierige oder offensichtlich fehlerhafte Stellen oft kritisch diskutiert, unabhängig recherchiert und viele Hinweise zu Korrekturen gegeben. Wir wollten damit bewusst und gern dazu beitragen, dass das häufig gefällte Urteil, es werde heutzutage nicht mehr lektoriert, sich als Vorurteil erweist. Wenn dennoch Ungenauigkeiten und Fehler bestehen bleiben, so liegt das zum einen an der Fülle des durchzuarbeitenden Materials, besonders der umfangreichen Tagebücher und Korrespondenz, die eine durchgehende Überprüfung unmöglich macht, zum anderen an der manchmal schlechten Lesbarkeit und an der gelegentlichen Flüchtigkeit von Form und Ausdruck der Quellen, und nicht zuletzt daran, dass wir uns nicht anmaßten, die Irrtümer und Täuschungen des Autors, die zu seinem Leben gehören und somit sein Menschenrecht sind, wiederum in eigene Vor- und Fehlurteile umzufälschen. Wir hoffen, dass der Leser sowohl die Mühe und Sorgfalt als auch die Freude und den Gewinn wiederfindet, die wir - und augenscheinlich auch der Autor - beim Erarbeiten dieses Textes hatten. Wir wünschen ihm die gleiche innere Bewegung wie uns aus wechselnder Zustimmung und Ablehnung, aus Kopfschütteln und Nicken, aus Anteilnahme und Unverständnis, aus Spannung und - ja, auch dies - gelegentlichem Desinteresse.
Ch. D.
Editorische Notizen
Herausgeber und Lektorat haben alle Eingriffe in den Text miteinander abgestimmt und auf das Notwendigste beschränkt, um die Gestalt der Originale möglichst unberührt zu erhalten. So wurden zwar offensichtliche unspezifische Schreibfehler und Irrtümer stillschweigend be- richtigt, aber stilistische und orthographische Eigenheiten sowie sachliche Fehler und irrige Meinungen in den Texten werden nur in den seltenen Fällen kommentierend geändert, wo dies zum angemessenen Verständnis für den Leser unerlässlich scheint. Wiederholungen konnten dann nicht gestrichen werden, wenn ohne sie das Verständnis des laufenden Textes gelitten hätte. Ansonsten werden Eigenheiten der Orthografie oder Interpunktion und gram- matikalische Irregularitäten ebenso beibehalten wie die Besonderheiten bei Wortwahl und Satzbau.
Es hat Herausgeber wie Lektorat einige Mühe gemacht, korrekte Erläuterungen zu erstellen, denn der Autor verwendet - besonders in den Gesprächen - eine Fülle von erkennbaren und verdeckten Zitaten, die er nur selten mit Angabe der Quelle kenntlich macht. Wenn die Quelle hinreichend verlässlich ermittelt werden konnte, wurde sie als Fußnote angegeben; sonst sind Anspielungen, Redewendungen und übernommene oder abgewandelte Textstellen aus oft nicht näher bekannten Quellen als in freier Rede übliche Verwendung anzusehen. Wir sind sicher, dass nicht alle Bezüge aufgedeckt werden konnten, so dass wir die Leser ermuntern, selbst zu entdecken, was uns entgangen ist.
Es konnten nicht alle Textstellen zweifelsfrei entziffert, nicht alle Bezüge aufgeklärt und nicht alle Hintergründe erhellt werden. Da es sich um keine im literaturwissenschaftlichen Sinn textkritische Ausgabe handelt, wurden um der ungestörten Lesbarkeit willen die meisten zweifelhaften oder undeutlichen Stellen nicht mit Alternativen kenntlich gemacht oder kritisch kommentiert. Nur dort, wo der Leser ohne solchen Hinweis sich schwer zurechtfindet, wurde mit [ ? ] oder einer kurzen Erläuterung auf problematische, widersprüchliche oder unklare Textstellen verwiesen.
Anmerkungen und Kommentare des Herausgebers werden innerhalb der authentischen
Texte [kursiv] in eckige Klammern gesetzt. Sie werden sparsam nur da verwendet, wo sie zu Verständnis und Klarstellung erforderlich scheinen. Vom Herausgeber vorgenommene Auslassungen und Streichungen im Text werden durch [ …] angezeigt. Längere Kommentare des Herausgebers, wie umfangreichere Erläuterungen, Zusammenfassungen von gekürzten oder ausgesparten Dokumenten, Ergänzungen von fehlenden Textstellen oder Richtigstellungen durch eigene Nachforschungen werden in eigenen Absätzen kursiv zwischen Asterices *, nicht in eckige Klammern gesetzt.
Da der Autor in seinen Notizen und besonders den Tagebuchaufzeichnungen zur Kommentierung und Ergänzung von Zitaten wie üblich meist eckige Klammern verwendet, wurden bei der Übertragung seines - gelegentlich auch handschriftlichen Textes - diese in geschweifte { } Klammern umgewandelt, um Zweideutigkeiten zu vermeiden. Unterstreichungen im Manuskript werden wie üblich im Druck kursiv gesetzt und stellen dann keine Hervorhebung durch den Herausgeber dar, sofern sie nicht von dem Vermerk [Hervorhg. d. Hrsg.] gefolgt werden.
Abkürzungen werden im Allgemeinen nicht aufgelöst, lediglich Eigennamen werden, soweit möglich und nötig, in eckigen Klammern ergänzt. Signifikante Selbstkorrekturen der Schreiber werden im fortlaufenden Text in eckigen Klammern mit [gestr.: Textstreichung], [eingef.: Texteinfügung], [soll heißen: Textkorrektur], [neu über gestr.: überschriebener Text] angegeben. Randbemerkungen oder quer verlaufende Überschreibungen geben wir am Ende des zugehörigen Absatzes oder Schriftstücks durch [Am Rand/quer: Randtext bzw. quergestellter Text] wieder.
Biographische Notizen
Karla, ihre Familie und Freunde
Karla Virginia Freyenstein [1 Sie hat ihren Mädchennamen nach der Heirat beibehalten.], geboren am 24. April 1973 in Berlin-Zehlendorf. Nennt sich selbst oder wird genannt: Carla, Carol, Karline, Caroline, Carletta, Carlita, Virginie, Gina.
Besuchte als Schülerin das Arndt-Gymnasium Dahlem (AGD), benannt nach dem Schriftsteller Ernst Moritz Arndt (1769 – 1860), 1908 als Landschulheim, vor allem für den preußischen Adel, gegründet; heute eine Schule besonderer pädagogischer Prägung in humanistischer und reformpädagogischer Tradition mit starker musischer, aber auch naturwissenschaftlich-mathematischer Ausrichtung sowie Englisch als erster Fremdsprache.
Nach dem Abitur begann sie 1993 das Studium der Romanistik und Philosophie an der Freien Universität Berlin, brach es zwei Jahre später ab, um zu heiraten. Nach Scheidung der kurzen Ehe nimmt sie das Studium mit fast 24 Jahren wieder auf, diesmal für das Lehramt mit der Fächerkombination Deutsch, Französisch und Biologie, beendet es aber nach drei Semestern vor der Geburt des Sohnes Gernot Peter.
Laut Eigenaussage bezeichnet sie ihre Laufbahn mit „ehemals Gattin, Hausfrau und Mutter, nun freischaffende Moralphilosophin von Beruf, Geliebte aus Berufung.“
Dr. Karl Freyenstein, Karlas Vater, geboren am 2. Mai 1945 [2 Am Tag der Kapitulation Berlins.] in Berlin-Pankow, bis zur Pensionierung 2010 Oberstudiendirektor am privaten Gymnasium Königin-Luise-Stiftung (1811 für Mädchen gegründet) in Dahlem, Podbielskiallee 78. Charlotte Freyenstein, geb. Blücher, Karlas Mutter, geboren am 12. Mai 1949 [3 Am Tag, als die Berliner Blockade endete.], bis zur Heirat 1971 Grundschullehrerin, dann Hausfrau und Mutter bis 1985, als Karla 12 Jahre alt wurde, dann bis 2012, bis zur Pensionierung mit 63 Jahren, Lehrerin für Musik und Kunsterziehung an der Fichtenberg-Oberschule in Steglitz, Rothenburgstraße.
Karlas Eltern wohnen in Steglitz, Schmidt-Ott-Straße, nahe beim Wasserturm am Fichtenberg.
Karl-Gunther Schwaigner, Karlas Ehemann. Wegen seiner Körpergröße von 192 cm von Freunden „Karl der Große“ genannt, oder auch der „Heilige Dulder von Dahlem“. Geboren am 2. März 1968 in Berlin-Neukölln.
Abgebrochener Lehramtskandidat, mal Gelegenheitsarbeiter, mal Schriftstelleraspirant mit dem Künstlernamen „Carlos Anonymos“, jetzt als Selbstbezichtigung „arbeitsloser, aber vielbeschäftigter“ Verwaltungs-angestellter im mittleren Dienst im Robert-Koch-Institut, Abt. 2: Epidemiologie & Gesundheitsmonitoring, FG21 Epidemiologisches Datenzentrum / Forschungsdatenzentrum, am Hauptsitz, Standort Nordufer.
Karls Vater Theodor stirbt 2008 mit 72 Jahren an Krebs, die Mutter Gerlinde geht 2009 mit 70 Jahren in die Augustinum Seniorenresidenz Kleinmachnow bei Berlin. Karl und Karla, sie in zweiter Ehe, heiraten 1998, sie mit 25, er mit 30 Jahren. Ihr Sohn Gernot Peter Schwaigner, geboren am 10. Oktober 1999 in Berlin-Moabit, 17 Jahre alt in 2016, besucht - wie einst seine Mutter - das Arndt-Gymnasium Dahlem in der Königin-Luise-Straße.
Ihre Tochter Sophia Maria Freyenstein, geboren am 8. Mai 2001 in Berlin-Moabit, 15 Jahre alt im Jahr 2016, besucht ebenfalls das Arndt-Gymnasium Dahlem.
Umzug 2009 in das Elternhaus von Karl in Dahlem in der Thielallee. In der Nähe der Triestpark, an der Habelschwerdter Allee Ecke Landoltweg das Institut für Philosophie der Freien Universität Berlin, in dessen Bibliothek Karla gerne liest und schreibt.
Der Erzähler, seine Familie und Freunde
Dr. Marc Louis Dreihausner, der Erzähler, Brief- und Tagebuchschreiber, geboren am 25. Februar 1972 in Paris, ab 1976 in Berlin-Charlottenburg. Kindheit bis zum vierten Lebensjahr in Paris, ab fünftem Lebensjahr in Berlin, 1990 Abitur und Baccalauréat am Französischen Gymnasium – Lycée Français – Berlin, Studium der Biologie und Informatik an der Freien Universität Berlin bis zum 28. Lebensjahr (Promotion 2000), davon 1994 zwei Semester in Paris. Lernt 1996 Ottilie kennen, heiratet sie am 14. August 1998. Geburt des Sohnes Jonas am 10. Mai 2000, der Tochter Simona am 17. September 2002.
Marc arbeitet ab 2010 am ESI [4 Ernst Strüngmann Institute (ESI) for Neuroscience (in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft)] in Frankfurt am Main, ab 2013 als Partner bei der ABCDE Ltd. in Marburg. Scheidung Ende November 2015.
Ottilie Dreihausner, geborene Schuster, geboren am 11. November 1975 in Berlin-Wilmersdorf, seine geschiedene, frühere Ehefrau, März 2013 erst Trennung, dann im November 2015 Scheidung. Bleibt mit den Kindern in Berlin-Schöneberg in der Ehewohnung in der Rosenheimer Straße.
Dr. Karoline Schuster, ihre unverheiratete Schwester. Geboren am 30. März 1971.
Ludwig Dreihausner, der Vater von Marc, geboren am 20. April 1937 in Berlin-Zehlendorf. Von ihm Meine französischen Jahre bzw. Berlin-Paris 1964.
Ingrid Dreihausner, geborene Sawitzky, Mutter von Marc, geboren am 10. Juni 1940 in Jerichow, jetzt Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt.
Wohnen seit 1986 in der Goethestraße in Charlottenburg.
Paul-Otto Sawitzky alias „Onkel Otto“, Bruder der Mutter, das „schwarze Schaf“ der Familie, aber der geliebte Onkel von Marc.
Bernadette Ingrid Schneider, geb. Dreihausner, Schwester von Marc, geboren am 2. Januar 1974 in Paris, ab 1976 in Berlin, seit 1995 verheiratet mit Oliver Schneider.
Die Personen im Institut
Prof. Dr. Ernst Rechtweiss, Inhaber des Lehrstuhls und Leiter der Arbeitsgruppe für Soziobiologie der Insekten (ISI) am Institut für Biologie der Humboldt-Universität zu Berlin, Philippstraße 13, Haus 04 (PH 13-H04), U6 oder Tram 1,6,13,50 Oranienburger Tor, S Friedrichstraße; zugleich Geschäftsführer (und Mitgesellschafter) der Forschungsgesellschaft für Experimentelle Soziobiologie mbH & Co. KG (FES) auf dem Campus Berlin-Buch. Angelika Uhrsprung, Diplom-Biologin, seine Assistentin und Geliebte.
Dr. Danilo Flüsterer, genannt Doktor Mephisto oder kurz DocM, für Marc genannt Till, geboren am 6. Juni 1960 in Berlin-Lichtenberg.Wohnt seit jeher in Prenzlauer Berg, Altbau in der Oderberger Straße, zwischen Kastanienallee und Choriner Straße / Schönhauser Allee.
Leute im Umfeld
Hildebrand, ein Freund des Erzählers Marc seit der Schulzeit, wohnt mit seiner Frau Hiltrud in der Hildebrandstraße in Berlin-Tempelhof.
Scriptefix, Pseudonym für den mit Karl befreundeten Schriftsteller Werner Walther, der unter dem Namen Rolf Wolff veröffentlicht.
1 Nach Berlin!
“Wem sonst als Dir …” [5 In Anlehnung an die Widmung Hölderlins in dem Exemplar seines Hyperion, das er seiner Diotima zueignete.]
“Schicksal ist das Unvorhersehbare. Alles Leben ist Schicksal.” (Rolf Wolff)
Montag, den 29. Februar 2016,am zusätzlich geschenkten Tag dieses Jahres.
Hinter mir liegt Marburg, vor mir liegt Berlin. Ich fahre mit den Erinnerungen durch und in meine Vergangenheit. Flache Landschaft vorm tiefen Horizont, Wiesen mit Gräben, weite Felder ziehen vorbei, von früher vertraute Ortsnamen und einzelne Bäume huschen vorüber, neu sind Gruppen von riesigen Windrädern wie Ausrufungszeichen, dann wieder lange Zeit Wälder aus Kiefern und Birken, alles auf Sand gebaut und gewachsen.
Noch fünfundsiebzig Minuten bis Berlin.
Hinter mir liegt ein halbes Leben - und vor mir die andere Hälfte?
Mitte des Lebens - ich blicke zurück und sehe, dass alles unvorhersehbar war, nichts war bestimmbar, nichts durch mich verfügbar.
Ich schaue voraus und sehe - nichts. Auch künftig wird also nichts vorhersehbar sein. Die Entwicklung der Welt folgt Gesetzen und ist doch unberechenbar. Das menschliche Verhalten folgt Impulsen und ist unvorhersagbar. Ich denke, mein Leben zu gestalten, und schlingere doch auf meiner Bahn hin und her wie ein mikroskopisch kleines Rußteilchen unter der Brownschen Bewegung. Spürbare Verschiebungen in meinem Leben werden dadurch be- wirkt, dass Gefühlsimpulse in ungeordneter Gemütsbewegung ständig aus allen Richtungen in großer Zahl ein Wollen anstoßen, das mich zufällig mal in die eine, mal in die andere Richtung treibt.
Ist das Grund zur Sorge? Nein, ich verspüre keine Angst vor dem Unvorhersehbaren, nur Neugier auf das, was kommen mag. Leben kommt mit dem zurecht, was schon immer war, ist und bleibt. Nur mit dem Vorhersehbaren, mit dem Tod, kann ich mich nicht einrichten. Hinter mir liegen auch drei Jahre Trennung und eine Scheidung vor drei Monaten, vor mir liegt bis zum Horizont Erwartung. Mit zweihundertfünfzig Kilometern in der Stunde fahre ich in die Zukunft. Doch was weiß ich von der Zukunft? Die einzige Zukunft, an der es keinen Zweifel gibt, ist der Tod; den suche ich aber gerade nicht, ich suche das Leben. Ich fahre in die Stadt meiner Jugend-, Studien- und Ehejahre, kehre aber nicht in eine gefühlte Vergangenheit zurück, sondern erwarte nur Gegenwart im Denken und Empfinden. Gern habe ich den Auftrag für die wissenschaftliche Mitarbeit angenommen, weil ich mein privates Scheitern durch einen beruflichen Erfolg zu überwinden oder wenigstens zu mildern hoffe. Hinter der verheißungsvollen Aussicht schaut immer der Schmerz über Verlust und Versagen durch, unter der zarten, grünen Schicht frischer Hoffnung nagt der Zweifel an den Wurzeln meiner Zuversicht. Die eingeübten Verhaltensweisen und die gewachsenen Verfestigungen begleiten mich im Gepäck, so weit ich auch fahren oder fliehen würde. Was kann ich davon zu welchem Preis überwinden? Was soll geändert werden, was muss bleiben? Was ist unabänderlicher Kern, was abwerfbare Schale?
Achtung, Illusionsgefahr!
Denn war es nur die wissenschaftliche Herausforderung, die für Berlin entschied? Ich hätte auch nach Paris gehen können, die Stadt meiner ersten vier Lebensjahre und eines Studienjahres. Oder einem Ruf meiner amerikanischen Teamkollegen folgen, wenn ich wirklich unbelastet von emotionaler Vergangenheit neu beginnen wollte. Mein Fachgebiet in der Proteinforschung ist hoch aktuell, ich kann überall hingehen, wohin ich möchte. Wissenschaftliche Herausforderung habe ich auch in Marburg reichlich. Durch meinen Weggang, wenngleich zeitlich begrenzt, gefährde oder verzögere ich die Aussicht der Berufung auf eine Professur, die durch meinen im letzten Jahr erweiterten Lehrauftrag befördert wurde. Was in mir hat sich bloß für Berlin entschieden? Alles erhoffen, sagt das Gefühl; nichts erwarten, sagt der Verstand. Wer wird recht haben?
Berlin ist heikel, dort leben Ottilie - und die Kinder. Jonas und Simona möchte ich schon wiedersehen, sie sollen mich als Vater nicht ganz aus den Augen verlieren. Und Ottilie? Eine Begegnung, ja oder nein? Ich wünsche es, ich fürchte es. Ich beginne einen Brief an sie. Ansage: „In wenigen Minuten erreichen wir Berlin Hauptbahnhof.“ Also Schluss der Debatte. Die S-Bahn bringt mich in acht Minuten zum Savignyplatz, meine Füße tragen mich in zehn Minuten zum Hotel. Das Apartmenthotel am Ende der Goethestraße, kurz vor dem Steinplatz, ist sehr angenehm. Neu, gepflegt, hell, ruhig. Großer Raum, kleine Küchenzeile, freundliches Bad von acht Quadratmeter, drei Quadratmeter Schreibtischplatte, außer W-LAN auch Kabelanschluss für schnelles Internet. Fenster zum Hof, Südseite, voll verglast. Wird im Sommer wohl zu warm, aber jetzt im Frühjahr vorteilhaft. Ich brauche helles Licht, Ausblick ins Freie, Grüne, Blaue. Ich denke, hier werde ich vorerst gut arbeiten und leben können. Es bleibt noch Zeit für erste Erkundungen. Ich trete hinaus und spüre, dass ich mich auf vertrautem Gebiet bewege. Berlin ist mir nicht so vertraut wie früher, aber es ist mir nicht fremd geworden.
2 Vorstellung im Institut
Dienstag, den 1. März 2016.
Bertrand hat mir geschrieben, mein Antrittsbesuch sei am 1. März um 10 Uhr bei Prof. Dr. Ernst Rechtweiss, Inhaber des Lehrstuhls und Leiter der Arbeitsgruppe für Soziobiologie der Insekten (ISI) am Institut für Biologie der Humboldt-Universität zu Berlin, Philippstraße 13, Haus 04. Es bleibt Zeit für das reichhaltige Frühstücksbuffet und etwas Lektüre der gewohnten Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bevor ich mich um 9:20 Uhr zum S-Bahnhof Savignyplatz begebe, in zehn Minuten am Bahnhof Friedrichstraße bin, in die U 6 umsteige und eine Station bis Oranienburger Tor fahre. In Berlin sind die Wege oft weit, die Verbindungen aber meist schnell. Nach kurzem Fußweg finde ich das Haus PH 13-H04 und im 1. Stock das ISI.
Freundlich begrüßt mich Professor Rechtweiss: „Seien Sie willkommen in unserem Institut, Kollege Dreihausner. Ich freue mich, dass Sie unser Team verstärken werden. Sie finden herausfordernde Aufgaben vor, und ich bin zuversichtlich, dass Sie sie mit Einsatz und Ideenreichtum bewältigen werden.“
„Gern werde ich’s versuchen und mich bemühen, Sie nicht zu enttäuschen. Wie und wo fangen wir an?“
„Wie Sie aus der Vereinbarung zwischen Ihrem Unternehmen und uns wissen, werden Sie ab heute für ein halbes Jahr, mit der Option einer Verlängerung in gegenseitigem Einvernehmen, an unserem Institut arbeiten, um uns in speziellen Techniken der Proteomik zu unterstützen, in denen Ihre ABCDE Limited führend ist. Sie wurden uns von Ihren Partnern als Spezialist empfohlen, und Sie haben dankenswerter Weise zugesagt. Formal sind Sie dem Arbeitskreis und Lehrstuhl für Soziobiologie der Insekten der Humboldt Universität als Gastforscher zugeordnet, Ihr Arbeitsplatz wird aber an der uns verbundenen Forschungsgesellschaft für Experimentelle Soziobiologie, kurz FES, auf dem Campus Berlin-Buch sein. Das ist aus rechtlichen, haushaltstechnischen und räumlichen Gründen erforderlich, weil wir Personal- und Sachmittel für eine nicht-universitäre Forschungsgesellschaft nicht aus Haus- haltsmitteln der Hochschule bezahlen können.“
„Das überrascht mich. Warum ist dann der Vertrag nicht direkt zwischen der FES und der ABCDE geschlossen worden, sondern nur in Abschnitt 7. geregelt, dass die Abwicklung der Vereinbarung durch die FES erfolgt, ansonsten aber das ISI Vertragspartner ist?“ „Die gefundene Lösung war ein Vorschlag der ,Rechtsgelehrten‘, damit die Ergebnisse als universitäre Forschungsleistungen zugunsten der Humboldt Universität veröffentlicht werden können.“
„Die Ergebnisse bleiben aber privatwirtschaftlich Eigentum der FES und sie entscheidet, was wann wo und wie verwertet wird, nehme ich an.“
„Ja, so ist es. Sie bleiben hiermit in dem Ihnen von der ABCDE Ltd. vertrauten gesellschaftsrechtlichen Rahmen.“
„Aber unsere Gesellschaft und ich als ihr Partner erwerben keine Rechte an den von mir erarbeiteten Forschungsergebnissen?“
„Ja, natürlich nicht. Sie erbringen eine Dienstleistung, die Ihnen und Ihrem Unternehmen vergütet wird und deren Anteil an unserem Gesamtergebnis sich nicht getrennt bewerten lässt. Beachten Sie bitte auch, dass Sie die gewonnenen Kenntnisse streng vertraulich behandeln müssen und weder für sich selbst noch in Ihrem Unternehmen in irgendeiner Weise verwenden dürfen.“
„Kann ich einige Informationen zu meinem überraschend nach Buch verlagerten Arbeitsplatz bekommen?“
„Meine Sekretärin wird Ihnen die vorbereitete Mappe mit allen notwendigen Angaben geben. Heute schauen Sie sich am besten in Berlin ein wenig um, fahren dann morgen nach Buch und melden sich bei meiner Assistentin vor Ort, Frau Uhrsprung. Sie wird Ihnen bei allem behilflich sein.“
Ich bin’s zufrieden und bummele durch Berlins neue Mitte, über die Friedrichstraße zum Gendarmenmarkt, durch die Jägerstraße, vorbei am Haus, in dem vor zweihundert Jahren der Literarische Salon der Rahel Varnhagen von Ense blühte, zur verschandelten Friedrichwerderschen Kirche von Schinkel, deren grandiosen, nun nicht mehr zugänglichen Innenraum ich so schätze. Das Imitat des Stadtschlosses von Schlüter wächst aus dem Boden, um zum Humboldtforum zu mutieren - ich sehe mir die Pläne im Pavillon an. In der Alten Nationalgalerie Wiedersehen mit den Lieblingsbildern der Jugendjahre - ich beschließe, möglichst jede Woche einen Saal zu besuchen und die Bilder mir wieder vertraut zu machen. Schauen wir mal, was daraus wird; habe schon hundert Beschlüsse gefasst, von denen neunundneunzig ersatzlos verfallen sind und nur einer am Leben blieb.
Kleiner Imbiss im Lokal Zum Schwarzen Ferkel, - „Frische Berliner Traditionsküche“ als Werbung -, in der Dorotheenstrasse, Ecke Kupfergraben, gegenüber vom Neuen Museum und Pergamonmuseum. Durch den Monbijoupark zum Hackeschen Markt, kreuz und quer durch die Hackeschen Höfe und von dort ins ursprüngliche Scheunenviertel, auf Spurensuche mit dem unveröffentlichen Buch Literarische Spaziergänge durch Berlin meines Freundes Joachim R. Klicker, der die im Selbstverlag durch Freunde erfolgte Herausgabe seines Werkes leider nicht mehr erleben konnte. Auf einer Bank im Schendelpark studiere ich in SECHSTER SPAZIERGANG: Von der Volksbühne durch das Scheunenviertel zum Garnisonfriedhof, was ich beim kommenden Streifzug erkunden will.
Ich schlendere schließlich durch die Sophien-, Krausnick- und Auguststraße, schaue in die eine oder andere Galerie. Beim zweckfreien Bummeln durch die Erinnerungen denke ich an Franz Hessels Spazieren in Berlin und nicke zustimmend, als ich seine Worte auf mich beziehe: „Langsam durch belebte Straßen zu gehen, ist ein besonderes Vergnügen. Man wird überspült von der Eile der anderen, es ist ein Bad in der Brandung. - Ich möchte beim ersten Blick verweilen, möchte den ersten Blick auf die Stadt, in der ich leben werde, gewinnen oder wiederfinden. - So beschloss ich heute, aus Reih und Glied der hastenden Schar zu treten, Zeit zu haben und als eine Art falscher Fremder müßiggängerisch herumzustreifen.“ Guter Vorsatz!
Nach fast vier Stunden Streifzug werden die Beine müde vom harten Pflaster, die Kehle durstig von Staub und trockener Luft. Ich kehre in die Tadshikische Teestube im Kunsthof in der Oranienburger Straße neben der Synagoge ein, setze mich auf ein Sitzkissen an einem flachen Tisch zwischen handgeschnitzten Säulen aus Sandelholz und bestelle einen russischen Tee aus dem Samowar.
3 Erster Arbeitstag
Mittwoch, den 2. März 2016.
Mein erster Arbeitstag. Was mich wohl erwartet? Ein wenig Herzklopfen, ein wenig Anspan- nung, mehr Zuversicht und viel Neugier begleiten mich auf der Fahrt nach Buch. Vom S-Bahnhof Savignyplatz zum Bahnhof Friedrichstraße, umsteigen in S 2 nach Bernau, zehn Stationen bis Buch. Statt den Bus 353 zum Campus zu nehmen, gehe ich zwanzig Minuten zu Fuß, um erste Eindrücke vom Ort zu gewinnen, vorbei an spätbarocker Schlosskirche und Schlosspark, an der Wiltbergstraße ein „klassizistisch“ inspiriertes russisches Ehrenmal, auf einem steinernen Kubus mit flankierenden Doppelsäulchen eine Pyramide mit (Sowjet-)Stern. Wird noch zu erkunden sein.
Mein Ziel ist der BiotechPark im Campus Berlin-Buch, - Motto: Der Gesundheit verpflichtet-, dort - ich schaue auf dem Briefbogen nach - die Forschungsgesellschaft für Experimentelle Soziobiologie mbH & Co. KG (FES), Robert-Rössle-Straße 10, Haus 82, Geschäftsführer Prof. Dr. Ernst Rechtweiss. Hinterm Torhaus rechts das zweite Gebäude, erster Aufgang, Erdgeschoss. Neben einer massiven Tür aus gebürstetem Chrom-Nickel-Stahl eine Sprechanlage mit Klingel und Kamera, darüber ein Schild: F.E.S. Ich drücke die Klingel, höre aber keinen Ton. Nach etwa fünf Sekunden eine automatische Ansage durch eine weibliche Computerstimme: „Bitte warten.“ Alle fünf Sekunden wiederholt sich die Ansage: „Bitte warten.“ Nach einer halben Minute dann eine menschliche weibliche Stimme: „Wie ist ihr Name und zu wem möchten sie?“ Ich nenne meinen Namen Dr. Marc Dreihausner und den von Frau Uhrsprung, im Auftrag von Dr. Rechtweiss. „Einen Moment bitte.“ Bald darauf surren Motoren, Metall reibt gegen Metall, es öffnet sich eine schwere Panzertür mit drei Paar Sperrstiften. Ich trete in einen fensterlosen Raum mit kahlen weißen Wänden und einer Stahltür gegenüber der stählernen Eingangstür. Zwei Videokameras bilden den Raum auf zwei Monitoren lückenlos ab. Außer zwei Sesseln aus Kunstleder gibt es kein Mobiliar.
Ich setze mich und warte. Nach fünf Minuten tritt eine Frau im weißen Kittel herein, etwa Mitte dreißig, rothaarig, unscheinbar. Sie bittet mich, meine Tasche und alle Gegenstände, die ich bei mir führe, in Plastikschalen zu legen und durch die nun folgende Sicherheitsschleuse zu gehen. Danach muss ich meinen Pass auf einen Scanner legen, mit beiden Augen in eine Kamera zur Iriserkennung schauen und schließlich beide Hände auf eine Glasplatte mit wan- derndem Lichtstrahl drücken. Dann führt sie mich zur siebenten Tür links am Ende eines Ganges, mit Türschild: Sekretariat Geschäftsleitung - Eintritt nur nach Aufforderung! Sie klopft, öffnet auf ein „Ja“ mit Keycard und Schlüssel und sagt: „Herr Dreihausner ist da. Er ist sauber.“
„Soll reinkommen“, sagt eine Frauenstimme.
Ich sitze der Diplom-Biologin Angelika Uhrsprung gegenüber, Sekretärin und Assistentin von Professor Rechtweiss vor Ort, und warte auf ihre Instruktionen. Denn dass sie hier das Sagen hat, war mir sogleich klar.
„Sie sind formal der Arbeitsgruppe von Frau Dr. Behrendt, Zimmer 17, zugeteilt. Ihr Arbeitsplatz ist in Raum 19. Sie sind dort allein tätig und berichten nur Herrn Professor Rechtweiss direkt. Kontakte zu anderen Arbeitsgruppen und deren Mitgliedern sind nicht erwünscht, das lenkt nur von den gestellten Aufgaben ab. Wenn sie etwas benötigen, wenden Sie sich an mich, ich werde das Nötige veranlassen.“
„Mit wem kann ich die nötigen fachlichen Diskussionen führen? Mit Frau Behrendt?“ „Nein, sie betreut ein ganz anderes Arbeitsgebiet. Da fragen Sie am besten Professor Rechtweiss.“ Pause, dann: „Ach ja, meiden Sie Dr. Flüsterer, der hat ein negatives Karma.“ „Wie soll ich das verstehen?“
„Wie ich es sage.“
„Mir scheint eher, dass hier im Institut das schlechte, zerstörende Karma Upaghataka wirksam ist.“
„Vorsicht! Sie sind hier als Auftragnehmer, nicht als Mitarbeiter. Sie haben weder das Recht, die inneren Angelegenheiten zu beurteilen noch sich in irgendeiner Weise einzumischen. Beachten Sie bitte alle vertraglichen Regelungen genau, insbesondere sind die Sicherheitsvor- schriften strikt einzuhalten. Bei Verstoß endet Ihr Vertrag mit sofortiger Wirkung.“ Damit reicht sie mir eine Mappe mit der Aufschrift „Herrn Dr. Dreihausner persönlich“ und bemerkt:
„Darin ist alles, was Sie beachten müssen. Die Mappe enthält auch den persönlichen Schlüssel und Ihre zugehörige Keycard. Wir arbeiten hier mit mehrfacher Authentifizierung. Vor den beiden Stahltüren jeweils zuerst die Keycard vor den Sensor halten, dann lassen sich mit dem Sicherheitsschlüssel die Türen zum Vorraum und zur Sicherheitsschleuse öffnen. Dort identifizieren Sie sich anhand Ihrer biometrischen Daten und laden die Keycard mit Ihrem persönlichen Code, der nach Verlassen des Hauses gelöscht und beim Betreten wieder per Zufallsgenerator neu generiert wird. So erhalten Sie, und nur Sie, Zugang zu den für Sie freigegebenen Bereichen. Auch zum Öffnen aller Türen innerhalb des Gebäudes sind immer Keycard und Schlüssel gemeinsam erforderlich.“
„Auch für die Toiletten und die Teeküche?“ -
„Ja, auch da. Und bevor Sie jetzt Ihren Arbeitsraum aufsuchen, gehen Sie bitte zuerst in die Sicherheits-schleuse und laden Ihre Keycard mit Ihrem Code.“
„Danke, mache ich.“
„Noch etwas. Jegliche Kommunikation nach und von außen ist nur über unseren gesicherten Server möglich, auch das Drucken von Dokumenten. Jegliche elektronische Geräte, wie Mobiltelefone, Tablets, Notebooks, Diktiergeräte und ähnliches, sind ebenso wie Fotoapparate im Schließfach zu deponieren, das Ihrer Raumnummer zugeordnet ist und das Sie mit Keycard und Schlüssel öffnen und schließen. Ein eingeschaltetes elektronisches Gerät jenseits der Sicherheitsschleuse löst Alarm aus.“
Ich authentifiziere mich, gehe in Raum 19, besehe alle Geräte und Einrichtungen, die vereinbarungsgemäß installiert wurden, und gehe grußlos. Mir reichen die zwei Stunden im Hoch- sicherheitstrakt für heute, ich brauche frische Luft und Freiheit. Zurück nehme ich den Fuß- weg entlang der Panke und durchs Fließ, nach fünfzehn Minuten bin ich im großen, stillen Schlosspark, mit altem Baumbestand, vom Bächlein Panke durchzogen. Eine Stunde Erho- lung und Ruhe auf verschlungenen Wegen.
4 Brief an Ottilie
Donnerstag, den 3. März 2016.
Acht Stunden im Hochsicherheitsgefängnis sind genug. Ich sah niemanden, sprach niemanden, hörte niemanden. Was bin ich dort, Gefangener oder Aufseher? Der Vorteil ist, dass keine Ablenkung, keine Störung den Aufbau der Versuchsapparaturen und deren Testläufe verzögert. Ich kam so gut voran, dass ich morgen die ersten Produktreihen untersuchen kann.
Aufs Zimmer hole ich mir Salate, krosse Brötchen, Schinken, Käse und eine Flasche Côtes du Rhône vom Feinkostgeschäft gleich an der Ecke, setze mich ans Fenster, esse und trinke mit Genuss, zufrieden mit meinem Los. Ich denke an die Freunde in Berlin, die ich wiederse- hen werde, auch die Eltern und die Kinder - und Ottilie. Mir fällt der unvollendete Brief an sie ein, den ich im Zug nach Berlin begonnen habe und den ich nun mit wenigen Sätzen rasch abschließen will.
Begonnen am 29. Februar im Zug auf dem Weg nach Berlin,
Liebe Ottilie,…
Liebe & Ottilie? Liebe ja, Ottilie nein!
Diese Verknüpfung gab’s einmal, aber sie ist zerrissen.
Also neuer Anfang? Ja beim Brief, nein zur Verbindung!
Hallo Ottilie.
Zeitlich liegen drei Jahre Trennung und drei Monate Scheidung zwischen uns, räumlich trennen uns bald vierhundert Kilometer. Innerlich trennte uns vieles, was wir uns nie eingestehen wollten, weil schon die Fragen danach, mehr aber die Antworten darauf das fragile Gebäude unserer Beziehung zum Einsturz gebracht hätten. Ungefragt und unbeantwortet ließen wir alles liegen, die Beziehung stürzte dennoch krachend ein. Wir räumten die größten Trümmerstücke beiseite und begannen jeder für sich mit dem Neubau. Aber im zugeschütteten Dunkel des Kellers unserer Beziehung liegen noch viele Relikte, die ans Licht der Erkenntnis kommen sollten.
„Was willst du noch?“, wirst Du sagen, „es ist doch alles entschieden, alles vorbei.“ Ja, entschieden ist alles, aber nichts ist geklärt.
„Und wozu soll das gut sein? Lass mir meine Ruhe, es schmerzt ohnehin genug!“ Eltern und Kinder versäumen meist den Zeitpunkt, über ihre nicht immer einfache Beziehung und die damit verbundenen Gefühle zu sprechen. Erst wenn alles vorbei ist, die Eltern nicht mehr leben, heißt es bedauernd: Hätte ich doch meine Mutter besser verstanden, ich verstände mich besser; und hätte ich mit meinem Vater inneren Frieden geschlossen statt eines äußeren Waffenstillstands, fände ich in mir mehr Frieden. Doch vorbei, zu spät! Was versäumen wir, wenn wir verdrängen, was uns geschieden hat, was gewinnen wir, wenn wir uns den Fragen nach dem Unverständnis und Unvermögen in unserer Ehe offen stellen? Für uns ist es noch nicht zu spät, wir können noch - jeder für sich - gewinnen. Lass es uns doch versuchen!
Warum sind wir gescheitert? Nicht weil wir besonders unfähig zur Gestaltung der gemeinsam gelebten Zeit, davon immerhin fünfzehn Jahre praktizierte Ehe, gewesen wären, nein, wir waren darin noch ganz gut für zwanzig Jahre, eine lange Zeit. Andere scheitern in dieser Zeit dreimal oder siebenmal; und manche von jenen, die fünfzig Jahre oder mehr ausharren, bleiben lebenslänglich im Kerker einer qualvollen Abhängigkeit, aus Angst und Mutlosigkeit. Nein, wir hatten Geschick im Verdrängen und Anpassen, wir waren auch recht erfolgreich im sogenannten Beziehungsmanagement, aber das reicht nicht, um die immer weiter auseinanderklaffenden Unterschiede der Neigungen, Sehnsüchte und Träume zuzukitten. Wir kannten uns nie, verkannten uns aber immer mehr. Unser Fühlen teilten wir nicht, unsere Gedanken verstanden wir nicht. Zwar zerbrach der Kern unserer Beziehung nicht, weil es nie einen gegeben hatte, aber die Schale wurde immer brüchiger, bis sie auseinanderfiel und jeder sehen konnte, wie morsch und hohl sie gewesen war. Das war für viele ein Schreck, der sie betraf, weil es in ihren Ehen ähnlich aussah.
Es gehört zum Ritual solcher rückblickenden Abrech-nungen, sich außer den während der gemeinsamen Lebenszeit getätigten Schuldzuweisungen nun endlich die Fehler, Versäumnisse und Unzulänglichkeiten um die Ohren zu schlagen, die man - „um des lieben Friedens willen“ - vorher nicht auszusprechen wagte, nach dem Motto: Was ich dir schon immer mal sagen wollte …
Wir wollen Differenzen benennen, nicht Fehler oder Schuld; denn es geht um Verständnis und Verständigung, dazu brauchen wir klaren Verstand mehr als verletztes Gefühl. Unterbrochen, als der Zug in den Hauptbahnhof einfuhr,
und nun am 3. März im Hotel fortgesetzt, ohne zu wissen,in welche dunklen Ecken oder lichte Höhen die Gefühle meine Gedanken treiben werden.
Wenn sich eine Lücke aufgetan, ein Irrweg gezeigt hat, muss man oft erst zurückgehen, um voranzukommen. So beginnt mein Aufbruch in mein Leben ohne Dich mit dem Rückblick, die Gestaltung von Zukunft mit spontanem Erinnern an Vergangenes.
Um es offen zu sagen: Ich bereue nichts. Ich fühle mich frei und offen für Neues, wie schon lange nicht mehr. Ich will nicht zurück, ich will nur vorwärts. Und noch deutlicher: Mich graust, wenn ich erinnere, was ich mir zugemutet habe, um Dir einen Gefallen zu tun. Wie ich meine Gefühle verleugnet habe, um nicht als unfreundlich oder desinteressiert zu erscheinen. Und was half es? Nichts, Du hast mich eine „asoziale Ratte“ genannt, weil ich nur gelegent- lich und dann widerstrebend und mürrisch zu Deinen häufigen Geselligkeiten aller Art mitkam - ich bin halt kein nachtaktives Rudeltier wie die Ratten. Aber du hast unrecht, Ratten sind nicht asozial, es sind füreinander sehr fürsorgliche Tiere mit hoch entwickeltem Sozialverhalten. Sie helfen selbstlos auch unbekannten Artgenossen, wenn ihnen in der Vergangenheit selbst einmal geholfen wurde - eine Pfote wäscht die andere. Ein solches Kooperationsver- halten war lange nur von Affen und Menschen bekannt, wobei ich aber bei Menschen sehe, dass solche Haltung auf der Roten Liste des vom Aussterben bedrohten Verhaltens steht - außer vielleicht das Merkmal, dass eine Hand die andere wäscht.
Wie meist kam es auch bei uns zum Bruch wegen einer Nebensache, weil man an die Haupt- sache nicht zu rühren wagt, denn man weiß oder ahnt, wie brüchig die ist. Bei uns war es sogar ein Irrtum, der ausreichte, um das morsch und unwohnlich gewordene Haus unserer Beziehung, das wir nie mit wirklicher Zuneigung, echtem Vertrauen und gegenseitiger Achtung hatten möblieren können, einstürzen zu lassen. Ein Wiederaufbau auf diesem Haufen von Trümmern war nicht möglich, es blieb uns nur, den gröbsten Schutt wegzuräumen und jeder für sich an anderer Stelle neu zu bauen. Ich lebe noch im Provisorium, mir fehlt die Innenarchitektin, um mein Leben nach meinem Vorentwurf in einem Neubau wohnlich einzu- richten.
Dein Gefühl behauptete eine - von Dir vermutete oder unbewusst sogar erhoffte? - Untreue meinerseits. Das war falsch und richtig zugleich. Eheliche Untreue mit einer anderen Frau: nein! Innere Untreue: ja, denn ich liebte Dich trotz aller Anstrengung des Verstandes nicht mehr mit dem Herzen. Ich fragte mich, ob ich das je wirklich getan habe. Aber ich liebte das Weibliche und sehnte mich nach Zärtlichkeit, Vertrautheit, Unbekümmertheit und - ja, auch nach körperlicher Hingabe.
Aber wenn nur das Gefühl wie bei Dir das Urteil fällt, hat es immer recht. Dagegen kommt man nicht an, ein Gefühl lässt sich nicht widerlegen. Ein sich allein aufs Gefühl stützendes Urteil ist weder wahr noch falsch - es ist halt ein Gefühl. Für Dich hatte Dein Gefühl recht, für mich meines - Gefühle haben immer oder nie recht, sie verzichten auf Argumente, Logik, Widerspruchsfreiheit, Objektivität. Also zog jeder die Konsequenzen aus seinem Gefühl - und es war gut so.
Es gab viele Anlässe und Gründe, warum ich mich in unserer Beziehung fremd und unbehaust fühlte. Ich will jetzt nicht aufrechnen, aber einiges, was mich besonders störte, will ich wenigstens niederschreiben, wenn ich es auch nie aussprechen durfte.
Am unwohlsten fühlte ich mich bei den Familienfeiern und sonstigen „geselligen Anlässen“, wohl deshalb, weil ich als Kind und Jugendlicher unter den ritualisierten Treffen der Gehässigkeiten und Heuchelei gelitten habe. In der Runde der Verwandten und Bekannten war immer nur die Rede von all dem, was nicht der Rede wert ist, von den allgemeinen bürgerlichen Erregungen. Schwatzende Zungen, lüsterne Ohren, immer bereit, in wechselseitigem Geben und Nehmen Gerüchte auszusprechen und aufzunehmen. Aber von was sollte man denn sonst sprechen? Doch nicht etwa vom Wesentlichen - oh Schreck, nein, das könnte ja Konsequenzen haben! Man plauderte kreuz und quer von defizitärer Gesundheit und expansiven Gebrechen, von als Geheimtipp offen gehandelten Namen der Heilpraktiker und Wundermittel, von auftrumpfenden und doch im Erlebnisgehalt jämmerlichen Urlaubsreisen, von Schul-problemen der Kinder und den Fehlurteilen der Lehrer, von Feindschaften mit den Nachbarn oder Kollegen und all dem Üblichen. Wer an der Reihe war, sprach hastig, andere redeten dazwischen, wer schweigen musste, gähnte, niemand war an der Rede des anderen interessiert, jeder wollte sich langatmig produzieren, damit er sich selbst weniger langweile, die anderen dafür um so mehr. Es waren also schöne Geburtstags- und Familienfeiern, wie man anerkennend bestätigte; denn nichts beunruhigte den leichten Schlaf der Ängste, die mit der dünnen Decke der Verdrängung zugedeckt und mit der Schlafdroge der Verleugnung besänftigt worden waren, aber jederzeit erwachen konnten, wenn helles Licht in die dämmrige Bewusstseinskammer fiel.
Dicke Bäuche, feiste Gesichter, träge Gedanken, von den dumpfen Gefühlen ganz zu schweigen - hier schwafelte nur die Arroganz der Ohnmacht, der durchdringende Ton der Dummheit, manchmal und bestenfalls das melancholische Schimpfen entmachteter, trotziger Kinder, ein desorganisiertes Geschnatter als organisiertes Gebrechen.





























