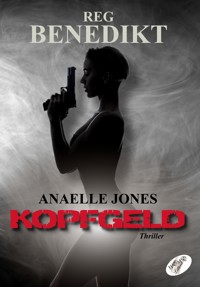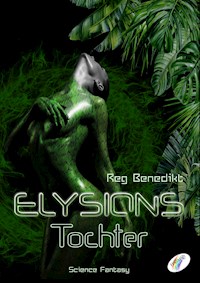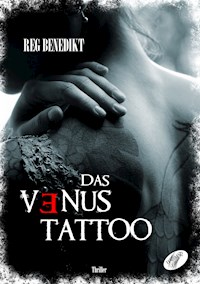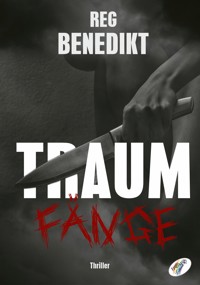
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Homo Littera
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was, wenn du niemandem und nichts mehr trauen kannst? Nicht einmal dir selbst ...
Sasha Barnetts dritter Fall!
Als Sasha einen anonymen Auftrag erhält, eine junge Frau zu finden, ahnt sie nicht, in welche Abgründe sie bald blicken wird. Eine erste Spur führt sie in eine Bar zu einem Mann, der sich vor ihren Augen erschießt - mit ihrer Waffe. Was wie ein rätselhafter Selbstmord erscheint, entwickelt sich zu einem perfiden Spiel mit der Realität. Schon bald gerät sie in ein verworrenes Netz aus Täuschungen, Wahnsinn und verhängnisvollen Verbindungen zwischen einem Psychiater, einem machthungrigen Unternehmer und mysteriösen Männern in Schwarz. Je tiefer sie gräbt, desto brüchiger wird ihre Wahrnehmung, und innerhalb kürzester Zeit kann Sasha niemandem mehr trauen - am wenigsten sich selbst.
Ein packender Thriller über Kontrollverlust, paranoide Vorstellungen und das Zerreißen der eigenen Realität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Traumfänge
Traumfänge
Impressum
Über die Autorin
Traumfänge
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Programm
Die Träne der Aphrodite
Das Venus-Tattoo
Anaelle Jones: Kopfgeld
Reg Benedikt
Thriller
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet.
Hinweis zur automatisierten Analyse gemäß geltendem Urheberrecht (z. B. § 44b UrhG DE, § 42g UrhG AT): Die automatisierte Auswertung dieses Werkes – insbesondere zur Erkennung von Mustern, Trends oder Korrelationen („Text and Data Mining“) – ist untersagt, soweit gesetzlich möglich. Eine Nutzung zu Analysezwecken außerhalb gesetzlicher Ausnahmen bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Rechteinhaber.
Verlag HOMO Littera
1. Auflage
Deutsche Erstausgabe 09/2025
Copyright © Reg Benedikt, Traumfänge
Copyright © HOMO Littera
Am Rinnergrund 14/5, 8101 Gratkorn
Umschlaggestaltung: Autorenservice Gorischek, Rofl Schek
unter Verwendung der Motive von Adobe Stock © Guitafotostudio
Adobe Stock © olegkruglyak3
Satz: HOMO Littera, Gratkorn
ISBN Print: 978-3-99144-060-4
ISBN EPUB: 978-3-99144-061-1
ISBN PRC/Mobi: 978-3-99144-062-8
www.HOMOLittera.com
Über die Autorin
Reg Benedikt, geboren 1973, ist eine deutsche Schriftstellerin und lebt in Berlin. Das Schreiben begleitet sie schon sehr lange und ist inzwischen ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Lebens.
Neben spannenden Abenteuern verbirgt sich in ihren Büchern auch jedes Mal eine Liebesgeschichte, die man nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennt, denn sie ist sorgfältig verpackt in düstere Intrigen und mystische Geheimnisse – und es gibt immer ein bisschen Drama. Mit Humor und Leidenschaft lässt sie ihre Protagonistinnen am Ende siegen – vermutlich …
Veröffentlichungen bei HOMO Littera:
Sasha Barnett-Reihe:
Die Träne der Aphrodite, Thriller, 2020
Das Venus-Tattoo, Thriller, 2020
Die Magische Grenze-Reihe:
Jägerin der Schatten, Fantasy, 2019
Wächterin der Dunkelheit, Fantasy, 2021
Anaelle Jones-Reihe:
Kopfgeld, Thriller, 2024
Elysions Tochter, Science Fantasy, 2022
Sich verlieben in: Friedenszeit, Miteinanda für die Ukraine, Benefizanthologie, 2022
Hinweis zu sensiblen Themen
Dieses Buch enthält Inhalte, die psychisch belastend wirken können, darunter Themen wie Suizid, Waffengewalt, Drogenmissbrauch, Gewaltanwendungen, psychiatrische Erkrankungen, Kontrolle durch Institutionen, Machtmissbrauch, Identitätskrise und Realitätsverlust. Ebenso enthält das Buch erotische Szenen und sexuelle Handlungen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Schilderungen bei manchen Leser:innen emotionale oder psychische Reaktionen auslösen können. Wenn Sie auf entsprechende Themen empfindlich reagieren, raten wir vom Lesen dieses Buches ab.
Autorin und Verlag übernehmen keine Verantwortung für etwaige psychische Belastungen, die durch die Lektüre entstehen könnten. Die Lektüre erfolgt auf eigene Verantwortung.
1. Kapitel
Die Faust schoss durch den herabströmenden Regen auf mich zu. Die Absicht dahinter war, mir die Nase zu brechen oder gerne auch den einen oder anderen Zahn auszuschlagen. Es schien meinen Angreifer nicht zu kümmern, dass er sich dabei wahrscheinlich selbst die Handknochen verletzen würde. Letzteres wäre mir herzlich egal, die ersten beiden Ansätze allerdings fand ich wenig erstrebenswert.
Ich wich ihm aus. Mein Fuß rutschte auf dem glitschigen Dach ab, und ich stolperte nach hinten. Der Boden knirschte unheilvoll unter meinem Schritt, und mir wurde klar, dass ich mich nicht mehr auf dem löchrigen Flachdach befand, sondern auf den alten Oberlichtern des baufälligen Lagerhauses. Es war fraglich, ob das Fenster der Belastung standhalten würde.
Ich wollte mich zur Seite werfen, aber ein weiterer Faustschlag traf mich in die Rippen und ließ mich aufstöhnen. Ich packte den Arm meines Angreifers, als das Glas splitternd unter mir nachgab.
Ich hörte mich schreien – glaube ich. Jedenfalls wollte ich schreien. Mein Magen verkrampfte sich, dann schlug ich bereits auf. Es war nicht so schmerzhaft, wie ich befürchtet hatte, aber bevor ich realisierte, wo ich war, kippte der Boden unter mir, und es ging weiter abwärts. Kisten stürzten um mich herum ein, und ich fiel mit ihnen den restlichen Weg nach unten und landete so hart auf dem Beton, dass mir fast die Luft wegblieb. Das kam eher dem nahe, was man nach einem Fall aus mehreren Metern erwartete.
Stöhnend wälzte ich mich herum und schob mit dem Bein eine der Kisten beiseite, die halb auf mir lag. Eine Flut von getrocknetem Grünzeug ergoss sich auf mich, und es roch intensiv nach Tee. Grünem Tee, würde ich meinen. Aber ich war da keine Expertin.
Mir tat jeder Knochen weh, jedoch blieb mir kaum Zeit darüber nachzudenken, ob ich noch in einem Stück war. Ich konnte mich bewegen, das musste reichen.
War er mit mir abgestürzt?
Ein Krachen und Bersten war die Antwort, als er sich unerbittlich zwischen den verstreuten Resten von Verpackungsmaterial auf die Beine kämpfte. Er fuhr zu mir herum, und ich kam nur so weit hoch, dass ich mich hinter eine Palette mit Säcken werfen konnte, als ein Schuss die Luft zerriss. Die Kugel schlug viel zu nah über mir ein, und noch mehr Tee rieselte auf mich herunter.
»Ihr bekommt mich nicht!«, rief er und schoss wieder auf den bedauernswerten Tee. So etwas hatte er am Anfang unserer überaus anstrengenden Verfolgungsjagd schon einmal gebrüllt. Inzwischen musste er erkannt haben, dass ich alleine war, aber offenbar interessierte es ihn nicht.
Seine Schritte erklangen, als er weglief. Ich rappelte mich auf und sprintete ihm hinterher, immer darauf bedacht, jederzeit Deckung zu suchen, aber er schien sich für die Flucht entschieden zu haben. Ohne merklich langsamer zu werden, stieß er die Brandschutztür des Lagers auf und rannte hinaus in den Regen. Ich blieb an ihm dran und holte auf. Er humpelte. Der Sturz war ihm nicht besser bekommen als mir. Eher schlechter.
Plötzlich stoppte er und wirbelte herum, den Arm mit der Pistole ausgestreckt, um auf mich zu schießen, aber ich war schon zu nah. Mit dem Schwung meiner Bewegung schlug ich seinen Arm beiseite. Der Schuss ging dennoch los, und ich glaubte, die Hitze an meiner Wange zu spüren. Mit der anderen Hand traf ich ihn von unten am Kiefer. Sein Kopf flog nach hinten. Gezielt boxte ich ihm in den Magen, und er klappte vornüber. Ich rammte ihm das Knie ins Gesicht und landete weitere Schläge gegen seine Nieren. Erst als er zusammenbrach, hörte ich auf.
Ich rang nach Atem. Mit dem Fuß kickte ich die Waffe aus seiner Reichweite und kniete mich neben ihn, um ihn an seiner Jacke herumzudrehen, bis er auf dem Rücken lag. Blut floss aus seiner Nase und seiner aufgeplatzten Oberlippe. Sein Blick war unstet und zuckte immer wieder an mir vorbei, als würde er etwas suchen.
Ich hätte mir mehr Aufmerksamkeit von ihm gewünscht, aber es schien tatsächlich so, als wäre ich nicht sein größtes Problem.
»Wer bist du, verdammt noch mal?«, fuhr ich ihn an und begann seine Taschen zu durchsuchen, weil ich nicht mit seiner kooperativen Mitarbeit rechnete. Ich fand sein Portemonnaie und öffnete es. Es gab zu wenig Licht, und die durchnässte wolkenschwere Nacht war so dunkel, dass ich mich anstrengen musste, um die winzige Schrift seines Ausweises zu erkennen.
»Sie werden mich holen«, wisperte er kaum hörbar.
Das wieder!
Ich ignorierte sein Gestammel und blinzelte mir ungehalten den Regen aus den Augen. Mühsam entzifferte ich, dass der zerbeulte Mensch, der vor mir auf dem regennassen Asphalt lag, irgendein Thomas war. Das würde ich später noch präzisieren, an einem Ort, wo es heller war – und trockener. »Für wen arbeitest du?«
Ich erwartete keine Antwort, aber tatsächlich schenkte er mir ein Gemurmeltes: »Kenne ich nicht …«
»Du hast in der Bar Fragen gestellt. Warum?«
Seine Augen zuckten zu mir, und es war das erste Mal, dass er mich direkt ansah. »Eine Falle. Es … ist eine Falle …«
Nahm er Drogen? Vielleicht irgendetwas, was ihm nicht gut bekam. Er war kaum ansprechbar. Allerdings hatte er sehr präzise geschossen. Ziemlich fit war er ebenfalls, wie mir mein Körper schmerzhaft mitteilte.
»Sie werden mich holen … Es ist zu spät …«
»Jaja. Klar. Wir werden jetzt zur Polizei gehen, und da kannst du denen alles erzählen. Oder du arbeitest mit mir und beantwortest meine Fragen. Dann sehe ich eventuell darüber hinweg, dass du mich erschießen wolltest. Überleg es dir. Das Angebot ist zeitlich begrenzt.«
Er stemmte sich hoch, bis er halb saß. Mit dem Ärmel seiner Jacke wischte er sich über die Nase, um das Blut aufzuhalten, das sich unaufhörlich weiter mit dem Regen auf seinem Gesicht mischte. Danach tastete er nach seinem Portemonnaie. Ich überließ es ihm. Mir war alles recht, wenn er nur mit seinem verrückten Gefasel aufhörte. Mit zitternden Fingern zog er ein Foto heraus und reichte es mir.
Verwundert nahm ich es ihm ab. Ein Mädchen war darauf abgebildet, nein, eher eine junge Frau.
»Sie ist jetzt dein Problem«, krächzte er, lachte kurz auf und verstummte sofort wieder, als er an mir vorbeischaute. Ich war versucht, mich umzudrehen, wusste aber, dass dort nichts war. Seine Augen weiteten sich entsetzt, und ich war ihm nah genug, um zu erkennen, wie er nacheinander etwas ansah. Etwas – oder jemand – war hier!
Schließlich blickte ich doch über die Schulter zurück, bereit, beiseitezuspringen, aber es war nichts da, außer der leeren Straße eines verlassenen heruntergekommenen Stadtteils. Nicht mal Nutten standen herum. Selbst bei dem Lärm, den wir veranstaltet hatten, fühlte sich niemand gemüßigt, herauszukommen. Wenn die Leute in dieser Gegend Schüsse hörten, blieben sie im Haus und verriegelten die Türen, um am nächsten Morgen in den Nachrichten zu verfolgen, welche Kriminellen sich gegenseitig umgebracht hatten.
Verdammt, was war los mit diesem Typen? Wütend drehte ich mich wieder zu ihm, als ich einen kurzen Ruck an meinem Gürtel spürte, genau dort, wo ich meine Pistole in einem Holster trug. Mein Herzschlag setzte aus, und mein Magen verkrampfte sich vor Panik.
Er zitterte erbärmlich, als er mit meiner eigenen Waffe auf mich zielte. Er merkte es selbst und griff auch mit der anderen Hand zu. Es wurde kaum besser. Ich erstarrte und bemühte mich, nicht auf die Pistole zu achten, sondern seinen Blick einzufangen. Vielleicht konnte ich erraten, was er als Nächstes tun würde. Immerhin hatte er bisher nicht abgedrückt, obwohl schon drei endlose Sekunden vergangen waren.
»Ich kann dir helfen«, redete ich ihm zu und hörte, wie flach meine Stimme klang. Mir fehlte einfach die Luft.
»Niemand kann mir helfen. Beeil dich, dann holt sie dich nicht. Du musst nur schnell sein …«
»Wen meinst du?« Ich fand es wichtig, zu reden. Wenn er etwas zu sagen hatte, wollte er vielleicht, dass ich zuhörte, und das konnte ich kaum, wenn er mir eine Kugel in den Kopf jagte. Gern stellte ich mich als Gesprächspartner zur Verfügung, egal, wie durchgeknallt er war, sofern es mich am Leben hielt.
»Es geht um … Jade«, stieß er hervor. »Du wirst es bald verstehen.«
»Okay«, stimmte ich beschwichtigend zu und streckte langsam die Hand nach der Pistole aus. »Aber warum erzählst du mir nicht in Ruhe davon?«
Er rückte die Waffe Zentimeter aus meiner Reichweite fort, und ich wagte es nicht, einfach danach zu greifen.
»Dafür ist es zu spät.« Wieder schaute er an mir vorbei und stöhnte unterdrückt bei dem, was er dort sah. Sein Mund verzerrte sich vor Angst, und er schluchzte auf. »Großer Gott …«
Er sprang so unerwartet auf, dass ich vor Schreck nach hinten fiel und hastig ein Stück von ihm fortrutschte. Wild zielte er über mich hinweg in die menschenleere Nacht – von rechts nach links, als könnte er sich nicht entscheiden, wen oder was er zuerst erschießen sollte. Dann lachte er hysterisch, während ihm Tränen über die Wangen liefen. Er öffnete den Mund, schob den Lauf der Pistole hinein und als der Schuss die Dunkelheit zerriss, wandte ich entsetzt den Blick ab.
2. Kapitel
»Er hat sich also selbst erschossen?«
Ich hockte auf einem unbequemen Plastikstuhl auf dem Polizeirevier und rang darum, nicht die Geduld zu verlieren. Ich war in eine knallrote Decke gewickelt, die wenig dazu beitrug, mich zu wärmen. Meine Sachen waren bis zur Unterwäsche durchweicht. Ein Tee wäre nett gewesen – aus irgendeinem Grund hatte ich Appetit auf Tee –, aber so viel Fürsorge wollte man mir nicht angedeihen lassen, ehe man sich nicht sicher war, ob ich eine psychotische Mörderin war oder nicht.
Die Polizistin, die meine Aussage notierte, hatte Schwierigkeiten mit meiner Glaubwürdigkeit. Das musste sie gar nicht laut äußern – ihr skeptischer Gesichtsausdruck schrie mir entgegen, dass sie mich für ein fragwürdiges Subjekt hielt, das es sich zur Aufgabe gemacht hatte, ihr diese Nachtschicht mit Papierkram und einer haarsträubenden Geschichte schwer zu machen. Sie hätte auch Kaffee schlürfend ein Schwätzchen mit ihrer blonden Kollegin halten können, die neben ihr saß und mich nicht weniger misstrauisch beäugte. Eisenketten und ein Verlies wären in ihren Augen für mich angemessen.
Um uns herum herrschte reger Betrieb, der es schwierig machte, sich zu konzentrieren. Jeder Polizeifilm-Regisseur wäre auf die Kulisse neidisch gewesen. Ein junger Mann in Handschellen heulte einen Tisch weiter Rotzblasen und versicherte in einer ewigen Litanei, dass alles ein Irrtum sei. Zwei Nutten in je einem kurzen Jäckchen, das nur knapp bis über die Brust reichte, sowie einem anliegenden Stretchkleid, das kaum den Hintern bedeckte, und Overknees aus schwarzem Lack diskutierten lautstark mit einem Beamten über die Gesetzeslage, die es ihnen als freie Bürgerinnen erlaubte, derartig aufgetakelt am Straßenrand zu flanieren. Eine der Damen hatte eine überaus männliche Stimme.
Ständig kam und ging irgendjemand, und das Klingeln der Telefone raubte mir den letzten Nerv. Bestimmt eine nicht unübliche Nacht auf dem Revier.
Als i-Tüpfelchen auf meinen harmonischen Abend bekam ich Cagney und Lacey aus dieser Fernsehserie der 80iger zugeteilt.
Ich seufzte lautlos. »Ja, er hat sich selbst erschossen. Denken Sie wirklich, ich würde ihm meine Waffe in den Mund stecken und abdrücken? Wissen Sie, was das für eine Schweinerei ist?«
Die brünette Beamtin verzog angewidert das Gesicht. Das Namensschild an ihrer steif gebügelten Uniform offenbarte einen Nachnamen osteuropäischen Ursprungs, der so viele Z, C und S in unaussprechlicher Reihenfolge aufwies, dass ich für mich beschloss, bei Lacey zu bleiben. Allzu intensiv wollte ich unsere Bekanntschaft ohnehin nicht werden lassen.
»Allerdings. Wir haben ihn schließlich gesehen.« Sie überflog das Geschriebene auf ihrem Bildschirm. »Also … Frau Barnett, Sasha.«
Ich verdrehte die Augen, weil sie so hübsch das Formular ablas, nickte aber artig.
»Sie haben eine Privatdetektei und sind dem Toten – Thomas Hall – in einer Bar begegnet. Und weiter?«
»Er schien nach jemandem zu suchen.«
»Nach diesem Mädchen?« Sie tippte auf das Foto, das Thomas mir gegeben hatte. Es lag etwas derangiert und aufgeweicht neben ihrer Tastatur. »Und Sie dachten sich, Sie gehen mal hin und bedrohen ihn?« Sie hob missbilligend die Brauen.
»Nein, natürlich nicht. Ich wollte ihn lediglich fragen, wer sein Auftraggeber ist.«
»Warum hat Sie das interessiert?«
Ich lehnte mich zurück und drapierte meine Polyesterdecke enger um mich. »Ich interessiere mich für vieles«, wich ich ungeschickt aus.
Cagney und Lacey warfen sich einen Blick zu, und mich beschlich die Befürchtung, dass ich so einfach nicht wegkam. Ich musste ihnen etwas anbieten, sonst landete ich auf direktem Weg in einer anheimelnden Zelle mit Chromtoilette, die ich mir heute Nacht vermutlich noch mit wenigstens zwei Nutten teilen durfte.
Ich kramte ein Foto aus meiner Jackentasche und legte es ebenfalls auf den Tisch. Es war ein völlig identisches Bild von der jungen Frau, das Thomas bei sich gehabt hatte. »Offenbar suchten wir dieselbe Person.«
Die Beamtinnen starrten die Bilder an, und es war ziemlich eindeutig, dass sie kein Wort verstanden. Da ging es ihnen wie mir.
»Wer ist ihr Auftraggeber?«, bohrte Lacey nach, die das Verhör führte. So nannten sie es natürlich nicht. Ich glaube, sie hatten nur angekündigt, sie wollten den Tathergang aufnehmen, aber es fühlte sich an wie ein verdammtes Verhör.
»Dazu kann ich Ihnen nichts sagen.« Ich lächelte nachsichtig. »Meine Detektei verspricht Diskretion.«
»… wenn Sie schon nicht mit Professionalität glänzen können«, ergänzte sie meinen Satz höhnisch.
Wütend biss ich die Zähne zusammen, um nicht ausfallend zu werden, was Lacey ein herablassendes Lächeln auf die Lippen zauberte.
»Und?«
»Was?«
»Wer war sein Auftraggeber? Hat er es Ihnen verraten? Oder war er auch so … verschwiegen?«
Ich ignorierte ihren Sarkasmus. »So weit sind wir nicht gekommen. Er entdeckte mich.«
»Und?«
»Rannte weg.«
»Und?«, hakte sie noch einmal deutlich genervt nach, weil ich mich störrisch anstellte, aber ich hatte keine Lust, ihr meine Arbeit auseinanderzupflücken.
»Ich blieb an ihm dran. Meiner Erfahrung nach hat jemand, der scheinbar grundlos wegläuft, immer etwas zu verbergen. Das dürfte sich mit Ihren Einschätzungen decken. Es wurde interessant, als er das erste Mal auf mich schoss. So was kann ich nicht leiden.«
»Und statt die Polizei zu rufen, die dafür zuständig ist«, betonte sie missbilligend, »wollten Sie … Was? Selbstjustiz? Haben Sie ihn deshalb erschossen?«
Teufel auch, war diese Person uneinsichtig! Ich rang mir ein blasses Lächeln ab. »Nein, wie ich bereits sagte, habe ich ihn nicht erschossen. Das hat er selbst erledigt.«
»Mit Ihrer Waffe. Die registriert ist?«
»Wie Sie sicher schon rausgefunden haben«, entgegnete ich gezwungen freundlich. »Ich musste mich verteidigen. Notwehr, nennt man das, soweit ich weiß.«
»Notwehr? Das fällt Ihnen aber reichlich spät ein.«
Darauf reagierte ich nicht. »Untersuchen Sie ihn auf Drogen. Er schien mir nicht ganz bei sich zu sein.«
»Wie wir unsere Arbeit erledigen, überlassen Sie mal uns«, zickte sie mich an.
Na bitte schön, alles, was die Dame wünscht.
Das Telefon klingelte, und die blonde Kollegin nahm ab. Sie lauschte eine Weile, sagte dreimal ja und einmal okay und legte auf. Ihr Blick fand mich, und ich fragte mich, was jetzt wieder auf mich zukam.
»Die Datenbank gibt nichts her. Die Frau auf dem Foto wird nicht vermisst und ist auch nicht das unbekannte Opfer eines Gewaltverbrechens.«
Okay, das war überraschend. Der Auftrag war erst wenige Tage alt. Bisher hatte ich mich noch nicht entschieden, tiefer einzusteigen, oder versucht, rauszufinden, ob das Mädchen offiziell vermisst wurde. Die Datenbanken der Polizei standen mir nicht uneingeschränkt zur Verfügung – mit legalen Mitteln gar nicht. Insofern war Cagneys Information spannend, brachte mich aber nicht weiter. Sobald ich nicht mehr unter Beobachtung stand, musste ich erst mal überlegen, wie es weiterging.
»Das heißt, Sie spionieren einer unbescholtenen Bürgerin nach. Gibt es dafür nicht einen Straftatbestand?«, erkundigte sich Lacey bei ihrer Kollegin mit einem unschuldigen Augenaufschlag.
»Stalking, wenn ich mich nicht irre«, schlug diese vor.
Ach, die beiden waren ja so witzig. »Dafür müsste ich die Frau ja erst mal finden«, beschwerte ich mich mürrisch.
»Das führt uns wieder zurück zur ursprünglichen Frage: Wer ist Ihr Auftraggeber?« Lacey schien am Ende ihrer Geduld angekommen zu sein. Ein kurzer Weg.
Aber es war ja eigentlich auch egal. »Niemand.«
Sie seufzte. »Was?«
»Er – oder sie – blieb anonym. Ein Umschlag, eine Menge Geld, ein Foto und eine Adresse – die von der Bar –, und ein Zettel mit dem Auftrag, die Frau zu finden.«
»Das sollen wir Ihnen glauben?«
Ich lächelte erschöpft. »Das müssen Sie nicht. Aber genau so sieht es aus.«
Eine Weile musterten sie mich, und ich hielt ihnen ruhig stand. Ich hatte nichts mehr zu sagen.
»Nun gut«, gab Lacey schließlich nach und wollte offenbar fertig werden, was mir sehr recht war. »Sie haben die Lizenz als Privatdetektiv zu arbeiten, ihre Waffe ist registriert. Ihre Aussage haben wir ebenfalls …«
»Also kann ich gehen?«, sagte ich, als sie nicht weitersprach.
Sie machte ein Gesicht, als ob sie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt durchlitt, nickte aber knapp. »Ja. Es kann sein, dass wir noch ein paar Fragen haben werden. Sollte irgendeine Ungereimtheit auftauchen …«
Außer, dass sich ein Mann einfach so selbst erschießt, weil er derartig in Panik gerät, dass das für ihn der einzige Ausweg ist?
»… dann melden wir uns bei Ihnen.«
»Was ist mit meiner Waffe?«
»Ein Mann ist gestorben! Was glauben Sie? Sie wird als Beweismittel und Tatwaffe benötigt. Das dauert …« Sie lächelte milde. »… Monate.«
Verdammt! Ich zwang mich, mir nicht anmerken zu lassen, dass sie mir eins ausgewischt hatte.
Aber sie war auch noch nicht fertig. »Ihr Privatdetektive glaubt, das Gesetz so biegen zu können, wie ihr es gebrauchen könnt. Das haben wir hier immer wieder. So funktioniert das jedoch nicht. Das werden Sie bald merken, Frau Barnett.«
»Ja, vielen Dank für die wundervollen Worte«, entgegnete ich mit meinem süßesten falschen Lächeln, zu dem ich imstande war. Ich nahm eines der beiden Fotos wieder an mich, nickte den Damen zu und erhob mich. Lieblos knautschte ich die Decke auf dem Stuhl zusammen und verließ das Revier.
***
Ich erreichte gegen vier Uhr früh mit dem Taxi das Haus, in dem meine Wohnung lag. Nachdem ich die Eingangstür aufgeschlossen hatte, betätigte ich den Lichtschalter im Treppenhaus, aber alles blieb dunkel. Ich drehte mich noch einmal um, und ehe die Tür zufallen konnte, sah ich, dass auch die Straßenbeleuchtung ausgefallen war. Es war das zweite Mal in diesem Monat, dass es in dem Viertel einen Stromausfall gab. Ich hatte es fast nicht bemerkt, weil ich so müde war, und eigentlich war es mir egal. Ich wollte nur ins Bett. Irgendwer würde sich darum kümmern, davon war ich überzeugt.
Ich tastete mich die Treppe hinauf, öffnete die Wohnungstür und verriegelte sie hinter mir. Es war erstaunlich, wie finster eine Nacht bei völliger Abwesenheit von künstlichem Licht sein konnte. In einer Großstadt ein seltenes Ereignis. Ich konnte auch nicht behaupten, dass ich es genoss. Kurz dachte ich über eine Taschenlampe oder Kerzen nach, aber beides würde ich im Dunkeln nicht finden, falls ich überhaupt Kerzen besaß. Das fiel in die romantische Kategorie, und daher war es gut möglich, dass mein Haushalt nicht damit aufwarten konnte. Ich hätte noch meine Handylampe, aber für die paar Meter zum Bett würde es auch so gehen.
Ich schälte mich aus der nassen Jacke und ließ sie achtlos zu Boden fallen. Die Schuhe folgten. Dann entledigte ich mich der durchweichten Socken, als ich spürte, wie jemand hinter mich trat. Prickelnd schoss Adrenalin durch mich hindurch, und ich fuhr blitzschnell herum. Im selben Moment warf sich ein Körper gegen mich und drängte mich zurück. Ich stolperte und kämpfte um mein Gleichgewicht, als ich mit dem Rücken unsanft an die Wand stieß.
Ich stöhnte unterdrückt, weil sich einige schmerzende Stellen meldeten, die heute schon einmal grob mit Beton in Berührung gekommen waren. Gleich darauf pressten sich Lippen auf meinen Mund, Hände glitten unter mein Shirt und streiften es mir geschickt über den Kopf. Der BH war eine Sekunde später dran. Mein Herzschlag beschleunigte sich ungefragt, als die Hände meine Brüste fanden und sich besitzergreifend darum legten. Ein weiterer Kuss nahm mich gefangen.
Wenig später bissen Zähne in meine Unterlippe. Ich gab nach, als die dazugehörige Zunge sich einen Weg in meinen Mund suchte und wir uns in der feuchten Wärme spielerisch trafen. Die Hände tasteten hinab zu meiner Taille und begannen geschickt, meinen Gürtel und die Jeans zu öffnen. Die Lippen lösten sich von den meinen, wanderten an meinem Hals entlang und suchten meine Brüste – und während der Stoff der Hose nebst Unterwäsche an meinen Beinen hinunterfiel, glitt die brennende Spur aus Küssen tiefer, über meinen Bauch, meinen Unterleib und endete etwas unerwartet zwischen meinen Schenkeln, wo mir heißer Atem zusammen mit einer geschickten Zunge die Fassung raubten.
Ich rang hörbar nach Luft, meine Knie wurden weich, und ich sank erneut gegen die vermaledeite Wand. Ein leises Lachen erklang, eindeutig amüsiert von meiner Reaktion. Ich wurde wieder freigegeben und bekam Gelegenheit, aus der Jeans zu klettern.
Stoff raschelte neben mir, als Kleidung fiel. Hungrige Finger fanden mich, waren überall und zogen mich an einen Körper, der sich beweglich und aufregend gegen meinen drängte.
Unsere Küsse verloren den Rest Zärtlichkeit, als die Erregung uns überrollte und unser Atem schwer wurde. Wieder glitt eine Hand an mir hinab und fand meine erregte Mitte. Die Finger fühlten sich regelrecht kühl an gegen das, was mich von innen heraus verbrannte, und ich hatte erhebliche Schwierigkeiten, mich auf den Beinen zu halten. Mit schnellen und sehr geschickten Bewegungen trieb sie mich zum Höhepunkt. Ein langer Kuss erstickte mein Stöhnen.
Ich brauchte etwas, um wieder zu mir zu kommen, währenddessen liebkosten weiche Lippen meine Wange und fanden mein Ohr.
»Der Strom ist ausgefallen«, wisperte Jo, und ihre Stimme vibrierte vor unterdrücktem Lachen.
Ich musste grinsen. »Ach, was du nicht sagst.«
»Du riechst gut.« Ich lächelte – aber da setzte sie hinzu: »Aromatisch.«
Ach so, das … »Grüner Tee.«
Sie zögerte, fragte aber nicht weiter. Stattdessen strich sie über meine Rippen, meine Taille und um mich herum. Ihre Finger spreizten sich auf meinen Pobacken, und mit festem Griff zog sie mein Becken gegen ihres.
»Und wo warst du so lange?«, murmelte sie abwesend an meinem Hals.
Oh, wenn ich ihr das erzählte, würde das nicht zur Stimmung beitragen. Es konnte gut sein, dass ein Psychopath, der versucht hatte, mich zu erschießen, zwar nicht geschafft hatte mich zu töten, aber dieses Ereignis allein genügen würde, die, ähm … romantische Atmosphäre zwischen uns zu ermorden. Es würde Vorwürfe geben und Streit, das war so sicher, wie mein Tiefkühlschrank eben ohne Strom auftaute.
Jo rückte ein Stück von mir fort. Im Dunkeln waren ihre Gesichtszüge nur zu erahnen, aber ich konnte regelrecht spüren, wie sie mein Schweigen interpretierte.
»Sollte ich nicht fragen?«
Denk nach!
»Dein Waffenholster ist leer.«
Wer war hier eigentlich die Detektivin?
»Ohne deine Waffe gehst du nicht mal ins Bett.«
Eine unbestreitbare Tatsache. Meine Glock lag immer neben mir – seit es Jo in meinem Leben gab allerdings in der Schublade des Nachttisches und nicht sichtbar oben drauf.
Ich war zu Kompromissen bereit, dachte ich selbstironisch.
Genau genommen gab es nur einen Weg, wie ich Jo davon abbringen konnte, mir weiter Löcher in den Bauch zu fragen. Ich neigte mich zu ihr und fand sie zu einem Kuss. Meine Zunge liebkoste ihre Lippen, und sie kam mir entgegen. Na also.
»Ich weiß genau, was du vorhast …«, raunte sie kaum verständlich.
Himmel, das war doch nicht zu glauben. Ich drehte mich mit ihr herum, bis sie die Wand im Rücken hatte, und schob energisch meinen Oberschenkel zwischen ihre Beine. Mit meinem gesamten Gewicht lehnte ich mich gegen sie und drängte meine Zunge in ihren Mund, in der Hoffnung, sie endlich abzulenken. Meine Hände fanden ihre Taille und hielten sie nah bei mir fest – fordernd. Ich hörte ihr leises Stöhnen und spürte ihre Erregung an meinem Bein. Mit den Fingernägeln krallte ich mich in ihre Haut, und sie rang nach Luft.
»Okay …«, keuchte sie angestrengt. »Du hast gewonnen. Aber lass uns im Bett weitermachen. Diese Wand ist verdammt unbequem und kalt.«
***
Etwas lauerte außerhalb meines Blickfeldes.
Ich wusste, dass es da war, aber egal, wie sehr ich mich anstrengte, ich konnte es nicht genau erkennen. Die Welt um mich versank in grauem Nebel. Ich meinte, Gesichter auszumachen, aber sie blieben undeutlich und verschwanden sofort wieder, sobald ich mich auf sie konzentrierte. Es gab keinen Horizont, kein Oben und kein Unten. Das allein war unheimlich genug und drehte mir fast den Magen um. Ich hätte mich gern irgendwo festgehalten, aber leider war nichts da. Nicht mal ein Boden, obwohl ich mir einbildete, auf etwas zu stehen. Mir wurde schwindlig.
Ich verlor den Halt, driftete gemächlich an die Oberfläche und merkte, dass ich nur träumte. Der Nebel löste sich auf, und ich konnte nicht behaupten, darüber traurig zu sein. Ich fühlte mich zerschlagen. Blinzelnd öffnete ich die Augen. Es war taghell. Dem Stand der Sonne nach zu urteilen, die den Regen offenbar über Nacht vertrieben hatte und deren Strahlen heiter durch die Schlafzimmerfenster fiel, später Vormittag.
Ich streckte mich, zuckte aber zusammen, als sich einige Muskeln schmerzhaft zu Wort meldeten, und quälte mich dann kraftlos zum Bettrand, wo ich erst mal sitzen blieb. Ich entdeckte etliche blaue Flecke auf meinem Körper, ohne genauer hinzusehen.
»Jetzt?«
Ich hob den Kopf. Jo stand im Türrahmen zum Schlafzimmer, vollständig gekleidet in einen schwarzen Hosenanzug und eine weiße Bluse. Mit verschränkten Armen betrachtete sie mich aufmerksam. Ich konnte mir sicher sein, dass sie jede meiner Blessuren zur Kenntnis genommen hatte, als ich geschlafen hatte.
Ja, jetzt. Irgendwann musste ich ihr erzählen, was passiert war.
Ich stand auf und suchte mir frische Sachen aus dem Kleiderschrank heraus. »Ich habe dir von diesem seltsamen Auftrag erzählt?«
»Anonym. Per Briefumschlag. Ein Foto. Ich hatte dir davon abgeraten«, fasste sie es treffend zusammen.
Das hatte sie – und ich hatte wie immer nicht auf sie gehört. Irgendwann würde mich meine Neugierde noch umbringen. »Nun … Ich fuhr zu der Adresse. Was nicht heißt, dass ich den Auftrag annehme. Ich wollte mir das nur mal ansehen.«
»Sicher.«
»Es war eine Bar. Ein Mann war dort, der ebenfalls nach der Frau fragte. Er lief weg.« Jo seufzte resigniert, und ich zuckte mit den Schultern. »Natürlich verfolgte ich ihn«, beantwortete ich ihren stummen Vorwurf. »Es ist mein Job, Geheimnisse zu enträtseln. Schon vergessen? Ich will dich nicht mit Details langweilen«, kürzte ich sicherheitshalber ab. »Ich erwischte ihn, und er erschoss sich.«
Jo stutzte. »Was?«
»Ich erwischte ihn, und er erschoss sich.«
»Ich bin nicht taub, Sash.« Sie runzelte ungeduldig die Stirn, und es bildete sich eine steile Falte zwischen ihren dunklen geraden Brauen. Ein schlechtes Zeichen. »Aber wieso hat er sich erschossen?«
Bisher hatte ich noch keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken. »Er schien mir nicht bei sich zu sein. Hat ziemlich verwirrtes Zeug gefaselt. Unglücklicherweise hat er für diesen, hm … letzten Schritt meine Waffe verwendet.«
Jo nickte ruhig, und ihr Gesichtsausdruck wirkte ausdruckslos.
Ich biss mir auf die Unterlippe und verfluchte meine Dämlichkeit. Angespannt hielt ich die Luft an. War es zu spät, sich rauszureden?
»Er hatte deine Waffe?«, hakte sie undurchdringlich nach.
Ja, eindeutig zu spät. Schutzsuchend umarmte ich den Kleiderhaufen. »Das war seltsam. Er gab mir ein völlig identisches Foto von der Frau und quatschte mich mit echt irren Sachen voll, und plötzlich hatte er meine Waffe und …« Ich zuckte wieder mit den Schultern, wich Jos durchdringendem Blick aber nicht aus. »Es geht mir gut.«
»Anderenfalls wärst du tot«, bemerkte sie relativ kühl, wie ich fand. Zumindest sickerte mir ein unangenehmer Schauer über den Rücken.
Einen endlosen Moment starrten wir uns an, dann ließ sie ihre Schultern kraftlos sinken. Sie stieß sich vom Türrahmen ab, kam zu mir und löste meine hilflose Umarmung von der Kleidung, die sie achtlos aufs Bett warf. Gleich darauf nahm sie meine Hände, legte sie um sich und schmiegte sich an mich. Ihre Wange an meiner hielt sie mich still fest.
Etwas überfordert, umarmte ich sie und wartete. Sie roch leicht nach Blumen – und eben nach Jo, eine unvergleichliche Mischung, die mir ein Gefühl von Geborgenheit vermittelte; es war vertraut und sicher.
Es tat mir leid, dass ich ihr Sorgen bereitete. Schon wieder. Es war ein leidiges Thema zwischen uns.
Die Umarmung dauerte lange, und ich hätte gerne gewusst, was in Jo vorging.
Schließlich entfernte sie sich und umschloss mein Gesicht mit beiden Händen. Sie sah mich an, und in ihren Augen fand ich Kummer und Hilflosigkeit. Mit den Fingern strich sie mir durch mein vom Schlaf vermutlich chaotisch zerzaustes kurzes Haar und lächelte schwach. »Ich muss ins Museum. Treffen wir uns heute Abend?«
»Natürlich.«
Sie nickte, streifte flüchtig meinen Mund für einen Kuss und verließ gleich darauf die Wohnung.
Ich zog mich an und ging in die Küche. Der Strom war wieder da, und Jo hatte bereits Kaffee gekocht. Eine unbescheiden große Tasse stand neben der Maschine. Beste Detektivin der Welt lautete der Becheraufdruck, der durch das Abbild einer Lupe scheinbar vergrößert wurde. Ein Geschenk von Charlee zum siebenunddreißigsten Geburtstag. Ich wusste immer noch nicht, ob sie sich lustig gemacht hatte oder nicht. Ich selbst hätte mir eine derartig arrogante Verfehlung nicht gekauft, zumal es nicht stimmte, wie die letzte Nacht bewiesen hatte.
So war es wohl witzig … irgendwie. Hauptsächlich aber passte eine Menge Kaffee in die Tasse. Ich goss mir großzügig ein, nebst Milch, und schlürfte einen Schluck. Er war viel zu heiß, aber das war mir egal. Das Koffein hatte die nicht unwesentliche Aufgabe, mich lebendig zu machen, da ich zu wenig Schlaf bekommen hatte.
Eine übertrieben bunte Postkarte lag auf dem Tresen meiner amerikanischen Küche. Fröhliche Menschen auf einem Markt grinsten mir entgegen. Es war sicher die hässlichste Karte, die es gab, und ich konnte nicht mal erraten, wo das Bild aufgenommen worden war. Ich drehte sie um und musste grinsen. Es waren Urlaubsgrüße von Georg. Er war ein freier Mitarbeiter meiner Detektei – sozusagen. Wenn ich Hilfe brauchte, war er zur Stelle – gegen die entsprechende Bezahlung. Ein Mann, mit wenig Gefühlsregungen und so gut wie keinen Worten. Die paar, die er verwendete, verbrauchte er nie unnütz.
Ähnlich umfangreich fiel jetzt auch die Karte aus: Herzliche Grüße an alle. Hier ist es schön. Lass dich nicht erschießen!
Wo war hier? Sollte ich das wissen? Sein Tipp, mich nicht erschießen zu lassen, war jedenfalls großartig. Aber was tat ich dagegen, wenn sich andere vor meinen Augen erschossen?
Ich lehnte die Karte gegen die Kaffeemaschine und schlenderte mit der Tasse in der Hand zur Wohnungstür. Meine regennasse Jacke war ordentlich auf einem Bügel aufgehängt, damit sie wenigstens die Chance bekam, zu trocknen. Ich hatte ein angemessen schlechtes Gewissen, andererseits hätte ich mich darum eventuell gestern noch gekümmert, wenn ich nicht so … abgelenkt gewesen wäre.
Ich schmunzelte und durchsuchte mit der freien Hand die Taschen, bis ich das Foto fand und es herausnahm. Es war meines, das ich bekommen hatte. Das identische, das Thomas gehabt hatte, lag bei der Polizei – bestimmt in derselben Pappschachtel wie meine Waffe.
Ich trank noch einen Schluck und studierte das Bild – eine junge Frau von vielleicht neunzehn Jahren. Sie hatte rotbraunes halblanges Haar und schaute mit einem kaum sichtbaren Lächeln in die Kamera. Der Blick ihrer grünen Augen war offen und freundlich.
Thomas Hall war ebenfalls auf der Suche nach ihr gewesen, zumindest hatte es in dieser Bar den Anschein gehabt. War es derselbe Auftrag? Andererseits war er offenkundig verrückt gewesen – jedenfalls hatte er sich ausgesprochen irrational verhalten, so sehr, dass es in seinem Selbstmord geendet hatte. Wenn das nicht durchgeknallt war, wusste ich es auch nicht. Also, wie viel konnte man darauf geben, was ein mutmaßlicher Psychopath faselte, wenn er behauptete, sie wäre jetzt mein Problem?
3. Kapitel
Das Restaurant, in dem ich mich Punkt zwölf Uhr an einen Tisch setzte, kam gänzlich ohne Sterne jeglicher Art aus. Das Essen war mittelmäßig, dafür aber günstig. Ich bestellte mir eine Gemüsesuppe. Es war meine erste Mahlzeit des Tages, da wollte ich meinen Magen nicht gleich mit einem undefinierbaren Gemisch aus Beilagen überfordern.
Ich löffelte mich bis zum Grund des Tellers durch und beobachtete die Leute. Die meisten kamen aus dem benachbarten Institut, um hier ihre Mittagspause zu verbringen. In Gruppen oder einzeln tröpfelten sie herein, und die Kellner nahmen ihren Job immerhin so ernst, dass sie hin- und hereilten wie fleißige Bienen.
Mein Telefon vibrierte in meiner Jackentasche, und ich ging ran.
»Bist du da?«, fragte Charlee. Es war meine Büronummer, von der sie anrief. Als einzige Mitarbeiterin meiner Detektei war sie die gute Seele, wenn auch bisweilen überaus resolut. Wahrscheinlich brauchte ich das – und sie hielt den Laden am Laufen, das konnte ich nicht leugnen.
»Sicher. Aber er ist nicht da.«
»Er kommt. Ich kenne ihn von früher, und er ist immer pünktlich.«
Nun, heute scheinbar nicht. »Es ist nach zwölf.«
»Er kommt«, versprach Charlee überzeugt. »Wie ist dein Plan?«
»Hab keinen«, gestand ich und kaute auf einem Stück Brot herum.
»Willst du einfach hingehen und fragen?« Sie klang beinahe fassungslos.
Was war daran so verkehrt? »Dachte ich – ja. Vielleicht lass ich meinen Charme spielen.«
Kurz lachte Charlee auf, aber weil ich nichts sagte, verstummte sie und meinte: »Das war dein Ernst?«
»Warum nicht?« Das klang ein wenig angesäuert.
»Okay … Sasha. Du hast wirklich viele Qualitäten«, begann sie zu erläutern, und allein ihr Tonfall ließ mich die Augen verdrehen. Sie sah es ja nicht. »Du kannst wundervoll küssen …«
Ich verschluckte mich fast an meinem Brot und würgte es schnell hinunter.
»… und du bist teuflisch gut …
»Charlee!«, zischte ich.
»… mit deiner Waffe.« Ich hörte ihr Grinsen.
Okay. Na gut, auch wenn das reine Übungssache war, dennoch richtete ich mich stolz auf.
»Du kannst einstecken, das muss man dir lassen. Viel zu viel.«
Ich sackte wieder zusammen. Ja, aber das war tatsächlich keine lobenswerte Eigenschaft. Es wäre besser, ich würde mehr austeilen.
»Aber, Sasha?«
»Ja?«, seufzte ich ergeben.
»Charme ist nicht deine Stärke. Du wirst ihm Angst machen, wenn du versuchst, zu flirten.«
Ich knirschte mit den Zähnen. Hielt sie mich für einen Waldschrat, der Menschen nur von Bildern kannte? Vielleicht war ich kein Megastar im Augenaufschlag, aber einen verstaubten Gerichtsmediziner würde ich wohl noch rumkriegen, zumal seine übliche Kundschaft relativ reglos und kalt auf Tischen lag. Dagegen war jedes lebende Wesen eine Bereicherung.
Bevor Charlee weitere Attribute über mich aufzahlen konnte, die ich nicht hören wollte, hatte mein Warten ein Ende. In einer Gruppe von sechs anderen Männern und Frauen betrat er das Restaurant. »Da ist er.«
Charlee lachte leise und überaus selbstzufrieden. »Zwölf Uhr fünfzehn. Auf die Minute. Sei einfach nett«, ermahnte sie mich und legte auf.
Ich steckte das Telefon weg, wischte mir den Mund mit der Serviette ab und probierte, mich mental in einen anderen Modus zu versetzen. Einen, der mir überhaupt nicht lag. Lieber hätte ich mich in einen aussichtslosen Zweikampf mit einem Zwei-Meter-Riesen begeben, als … das!
Nichtsdestotrotz öffnete ich an meinem Hemd einen weiteren Knopf und zog meinen Ausschnitt zurecht, sodass er mehr versprach als ein blaues Auge – falls jemand ein solches riskieren würde. Meine bescheidene Oberweite war eher sportlich als lasziv, aber es musste genügen. Ich erhob mich und trat auf die Gruppe zu. Die meisten von ihnen, auch die beiden Frauen, trugen Anzüge, die alle ähnlich aussahen und sich nur minimal im Schnitt und in den Farbnuancen von Schwarz zu Dunkelblau unterschieden.
»Dr. Rothen?«, fragte ich den Mann in mittleren Jahren, dessen Haar sich in einem gleichmäßigen Halbkranz bereits über gut ein Drittel des Schädels zurückgezogen hatte, dafür aber voll und lockig im Nacken endete. Immerhin hatte er nicht mit der Haarpracht vom Hinterkopf die Defizite im vorderen Bereich getarnt. Er hob sich nicht unbedingt vorteilhaft aus der Gruppe hervor, weil er einen bräunlichen Tweedblazer mit Lederflicken auf den Ellenbogen trug. Das Ding musste aus den Siebzigern sein.
Er blickte mich über seine Brille hinweg an. »Ja?«
Ich zauberte ein Lächeln auf mein Gesicht und strich mir mit der Hand die eine oder andere blonde Haarsträhne aus der Stirn hinter das Ohr, wo sie natürlich nicht blieben, weil sie dafür zu kurz waren. Stattdessen fielen sie wieder zurück und warteten auf einen weiteren Einsatz der Flirtkunst. »Ich bin Studentin … der Medizin, und man sagte mir, Sie könnten mir vielleicht bei einem Problem helfen.«
Er musterte mich mit hochgezogenen Brauen. »Welche Fachrichtung?«
»Psychologie.«
»Das ist nicht mein Gebiet.«
Unsicher senkte ich den Kopf, um ihn von unten herauf anzusehen. »Oh, d-das tut mir leid. Dann hat man mich falsch informiert. Es ist mir sehr unangenehm, dass ich Sie belästigt habe.«
»Hm … schon gut.« Er wollte sich abwenden, um zu seinen Kollegen aufzuschließen, die sich inzwischen einen Tisch gesucht hatten.
»Dabei versicherte man mir, Sie wären einer der erfahrensten Pathologen, und man würde Sie bei den wirklich schwierigen Fällen als Zweitmeinung heranziehen.«
Er zögerte und drehte sich wieder zu mir. »Wer behauptet das?«
»Nun, alle in meiner Studiengruppe.« Ich lächelte scheu.
Skeptisch schüttelte er den Kopf. »Ich glaube, Sie verwechseln mich.«
»Verwechseln?« Ich lachte glockenhell auf. »Sie sind doch Dr. Herbert Rothen, oder nicht?«
»Ja – schon …«
»Sehen Sie«, bemerkte ich respektvoll. Ich trat auf ihn zu und streckte ihm die Hand entgegen. In einem Reflex ergriff er sie. Warm schloss ich meine Finger darum und hielt sie mit sanftem Druck fest, den er nur schlaff hinnahm. Unangenehm. »Es ist mir eine Ehre, Sie kennenlernen zu dürfen.« Ich suchte seinen Blick. Seine Augen waren ein verwaschener Mix aus Schlammfarben, und er sah mich verwirrt an.
Ich gab seine Hand frei. »Einen schönen Tag, Dr. Rothen.« Erneut strich ich mir eine Haarsträhne aus der Stirn, lächelte ihm zu und wandte mich ab. Gemächlich begab ich mich zum Ausgang und ließ ihm Zeit. Viel Zeit. Herrje, wenn ich noch langsamer wurde, fiel ich um. Er war wirklich nicht der Schnellste.
Ich hatte die Tür fast erreicht und befürchtete, Charlee hatte recht und meine Flirtqualitäten reichten nicht mal aus, einen introvertierten Gerichtsmediziner hinter dem Obduktionstisch hervorzulocken. Er lebte allein mit zwei Katzen, und ich hatte angenommen, dass mein Charme dafür reichen sollte. Scheinbar hatte ich mich geirrt. Verdammt!
»Warten Sie!«, rief er mir hinterher, als ich eben die Tür aufstoßen wollte.
Na endlich! Ich zauberte ein verwundertes Lächeln auf meine Lippen und drehte mich um.
Mit einem etwas hölzernen Gang kam er zu mir und rückte auf dem Weg seine Krawatte zurecht. »Ich würde mir ihr Problem gerne anhören. Vielleicht kann ich Ihnen ja trotzdem helfen.« Er bedeutete mir, vorauszugehen, und ich suchte uns einen freien Tisch in einer entfernten Ecke. Ich würde sie lauschig nennen, wenn daneben nicht der Durchgang zu den Toiletten gewesen wäre.
Nachdem er uns zwei Kaffee bestellt hatte, schaute er mich erwartungsvoll über seine Brille hinweg an.
Kurz überlegte ich, aber ich hatte nicht den Ansatz einer Idee, wie ich ihn mit säuselnder Stimme nach einem Mann fragen konnte, der sich selbst das Hirn weggeblasen hatte. Ich gab es auf.
»Es handelt sich um einen Selbstmord, den Sie auf dem, ähm … Tisch haben müssten«, begann ich ohne Umschweife, und meine Stimme vermittelte nicht mehr den Eindruck, ein spätpubertierendes Groupie zu sein.
»Ich verstehe nicht. Ich dachte, Sie haben eine Fachfrage?«
»Oh ja. Der Mann, hat sich in der vergangenen Nacht erschossen. Mich würde interessieren, ob er irgendwelche Drogen im Blut hatte. Sein Verhalten war überaus seltsam.«
»Wer sind Sie?«
»Können Drogen derartige Wahnvorstellungen auslösen?«
»Das Gespräch ist beendet!«, bestimmte Dr. Rothen resolut und wollte sich erheben, aber ich packte seinen Arm, und die Kraft meines Griffs genügte, dass er sich wieder setzte. Er wirkte ein wenig erschrocken und von der Situation überfordert. Das war gut, denn solange sein Verstand den Ereignissen hinterherhinkte, kam er auf keine komischen Ideen – wie laut um Hilfe zu rufen, zum Beispiel.
Möglich, dass ich ein wenig über das Ziel hinausschoss, als ich unauffällig meine Waffe aus dem Holster hinter dem Rücken zog. Die Glock war auf dem Polizeirevier und würde noch unbestimmte Zeit in einem Pappkarton außer Gefecht sein. Aber als ehemalige Personenschützerin sowie praktizierende und ermittelnde Privatdetektivin wäre es dumm, wenn ich nur eine Waffe besitzen würde. Mein Ersatz war eine Sig Sauer P6. Ich legte mir die mattschwarze Pistole auf den Oberschenkel. Der Lauf zielte auf Dr. Rothen, dessen Augen sich weiteten.
»Ein paar einfache Fragen. Danach bin ich verschwunden.«
»Ich darf darüber nicht reden«, beharrte er störrischer als erwartet.
»Ich weiß, darum versuche ich Sie ja auch zu überzeugen.«
Er sah noch einmal auf die Waffe, dann hinauf in mein Gesicht. »Das gelingt Ihnen.«
Ich zögerte überrascht.
»Charlee hat schon angekündigt, dass Sie mir ein paar Fragen stellen wollen. Sie sind doch Sasha Barnett, oder nicht?«
Ich kapierte nichts mehr. Konsterniert starrte ich ihn an, und er neigte sich ein wenig zu mir vor. »Von mir aus können Sie die Waffe wieder wegstecken, aber das überlasse ich Ihnen. Wenn Sie sich damit wohler fühlen und meinen, die Situation besser zu kontrollieren, ist das in Ordnung für mich.«
Es war in Ordnung für ihn? Ich … Das … »Was?«
Er trank einen Schluck Kaffee. »Charlee rief mich vorhin an und sagte mir, eine große Blondine – die nicht dem Bild entspräche, das ich im Kopf hätte – würde heute, ähm … auf mich zukommen«, fand er eine Beschreibung, die ihm gefiel, »um mir ein paar Fragen zu stellen. Sie empfahl mir auch, ich solle es Ihnen nicht zu leicht machen. Sie würden sonst misstrauisch werden.«
Das hatte Charlee ihm gesagt? Auf ihr Geheiß hin hatte er sich so lange geziert, dass ich an mir gezweifelt hatte. Aber eigentlich war er ja gar nicht auf meine Flirtqualitäten reingefallen, sondern Charlee hatte ihn instruiert. Ich schob das beiseite, würde jedoch später garantiert noch mal darauf zurückkommen.
»Ich dachte, Sie unterliegen einer Schweigepflicht«, hielt ich skeptisch dagegen.
»Natürlich. Aber …« Er seufzte wehmütig. »Es ist Charlee. Seine Jugendliebe vergisst man wohl nie.«
Du lieber Himmel, das waren mir eindeutig zu viele Informationen. Ich wollte mir nicht mal vorstellen, wie die süße Charlee mit ihren japanischen Wurzeln, ihren warmen Mandelaugen und der adretten zierlichen Figur … mit diesem hölzernen Leichendoktor – Schluss!
Ich räusperte mich unbehaglich. »Dann …« Ja was? Ich war ein wenig aus dem Konzept gebracht. Charlee würde ich bei Gelegenheit was erzählen. Sie hatte mich reingelegt, auf besonders perfide Art und Weise. Ach ja! »Also, hatte er Drogen genommen?«
»Nein. Alles sauber«, erklärte Dr. Rothen bereitwillig und schaute mich erwartungsvoll an, was ich als Nächstes wissen wollte.
Ich fühlte mich unter Druck gesetzt, was eher ungewöhnlich war, wenn man die Absicht bedachte, weshalb ich hier war. »Er redete verrücktes Zeug, und ich denke, er hat Sachen gesehen, die nicht da waren. Gibt es dafür eine Erklärung?«
Er schüttelte den Kopf. »Soweit ich bisher erkennen kann, nicht. Von seinem Gehirn war allerdings auch nicht mehr viel übrig.« Er senkte den Blick zu meiner Pistole, und erst da wurde mir bewusst, dass ich immer noch auf ihn zielte. Missmutig steckte ich die Waffe ins Holster zurück, und er fuhr fort: »Die Kugel hat maximalen Schaden angerichtet. Sie drang durch seinen Rachen ein und nahm Zahn- und Knochensplitter mit, zerstörte große Teile des Zentralhirns, und der Austritt erfolgte durch den Perietalknochen.«
Ja, ich hatte ein flüchtiges Bild vor Augen, weil ich nicht schnell genug weggesehen hatte. Ich schluckte mühsam. »Haben Sie eine Idee, warum er das getan hat?«
»Sie waren dabei. Haben Sie eine?« Ich schüttelte den Kopf, und er lehnte sich zurück. »Ich auch nicht. Wir haben nur Ihre Zeugenaussage, dass er sich selbst erschossen hat. Mit Ihrer Waffe.« Er hob die Brauen, und die Falten auf seiner Stirn reichten weit zu seiner Halbglatze hinauf.
»Also war er gesund – nun, bis auf diese Kugel-Hirn-Geschichte?«
»Ja. Nicht mal Alkohol war in seinem Blut.«
Resigniert sank ich auf meinem Stuhl zusammen. Ich hatte mir das nicht eingebildet. Die Nacht war chaotisch gewesen, die Verfolgung mühselig – vorsichtig ausgedrückt. Der Sturz vom Dach hatte auch bei mir Spuren hinterlassen, aber dennoch hatte ich mir die Angst von Thomas Hall nicht eingebildet – Todesangst gemischt mit einem Hauch Wahnsinn.
»Wollen Sie noch etwas wissen?«, fragte Dr. Rothen.
Ich schüttelte den Kopf. »Danke für Ihre Zeit.« Ich konnte immerhin versuchen, höflich zu sein.
»Grüßen Sie Charlee bitte ganz herzlich von mir«, bat er, kehrte zu seinen Kollegen zurück und ließ mich genauso schlau wie vorher sitzen.
4. Kapitel
Natürlich hätte ich den Selbstmord eines Psychopathen auf sich beruhen lassen können – selbst wenn er nach demselben Mädchen gesucht hatte, von wem auch immer der Auftrag kam.
Das war das Problem, nicht wahr? Alles war anonym. Der Umschlag hatte vor drei Tagen im Briefkasten meiner Detektei gelegen. Unbeschriftet, also persönlich eingeworfen. Die Menge Bargeld war nicht zu verachten und es zumindest wert gewesen, den einen oder anderen Gedanken zu verschwenden und sogar einen Abstecher zu der Adresse zu unternehmen, die in der kurzen Anweisung genannt gewesen war.
Dass dieser Ausflug ausartete und ich mich wegen eines Selbstmörders auf dem Polizeirevier erklären musste, hatte niemand ahnen können.
Verdammt, es war das Foto einer Unbekannten, die nicht offiziell vermisst wurde. Vielleicht existierte das Mädchen gar nicht, oder sie lebte glücklich und zufrieden bei ihrer Familie und malte Herzchen für ihren Schwarm in ein Poesiealbum. Allerdings wäre ich eine schlechte Detektivin, wenn ich nicht wenigstens probieren würde, die Fehler in der Story aufzuklären. Schon im eigenen Interesse, denn ich wollte Cagney und Lacey vom Polizeirevier nicht unnötig an mir drankleben haben.
Warum also sollte jemand so viel Geld für nichts verplempern, und warum sollte dieser jemand auch noch doppelt bezahlen – falls Thomas denselben Auftrag erhalten hatte? Vielleicht hatte er das Mädchen aus anderen Gründen gesucht.
Aber mit einem identischen Foto?
Als sich der Tag dem Ende entgegenneigte, fuhr ich zu der Bar, wo ich Thomas Hall zum ersten Mal begegnet war. Es war noch nicht viel los, aber der eine oder andere Gast betrat bereits das diffus beleuchtete Innere. Ich hatte gestern keine Zeit gehabt, mich ausführlich umzusehen, dafür war ich zu schnell wieder draußen gewesen, um Thomas hinterherzuhetzen, als ich mitbekommen hatte, dass er das Personal befragte. Keine große Sache, bis es zu einer Verfolgungsjagd wurde.
Ich trat zur Theke und bestellte mir ein Bier. Der Barmann war klein und rundlich mit einem Vollbart, der direkt in sein lockiges Haar überging und von seinem Hals abwärts die Brust hinunterwucherte, drahtige Kringel bildete und unter seinem Hemd verschwand.
Als er mir die Bierflasche hinstellte, zeigte ich ihm das Bild von Thomas auf meinem Handy. Es war das Passbild von seinem Ausweis. Darauf sah er noch wohlbehalten aus. Ein Typ, wie er an jeder Ecke zu finden war. »Kennen Sie den?«
Der Barmann beachtete das Foto nicht. »Bist du ’n Bulle?«
»Nee, Privatdetektiv. Was ist jetzt?«
»Kenn’ ich nich’.«
Verdammt noch eins, Charlee würde wieder unleidlich werden, wenn ich unser Budget so verschleuderte, trotzdem zog ich einen zerknautschten Schein aus der Jackentasche und legte ihn auf die Theke. Es war weit mehr, als das Bier gekostet hatte. »Und jetzt?«
Er grinste – glaube ich. Es war hinter dem Bart nicht gut zu erkennen. Er nahm den Geldschein und steckte ihn weg. »Das funktioniert nur in Filmen.«
Ärger schoss in mir hoch, aber ich zwang mich, ruhig zu bleiben. Ich zeigte ihm das Foto von dem Mädchen. »Was ist mit ihr?«
Flüchtig streifte sein Blick das Bild. Jemand setzte sich neben mich auf einen der Barhocker, und der Barmann schaute kurz zu der Person, ehe er zu mir sagte: »Glaub’ nich’.«
Noch mal machte ich nicht den Fehler, ihm Geld zu geben, aber er beendete meine Fragerunde ohnehin, indem er sich abwandte.
Das war ja nicht besonders erfolgreich gelaufen.
Viel mehr Ideen hatte ich aber nicht mehr.
»Glaub ihm nicht. Er lügt«, bemerkte eine weibliche Stimme, die sich anhörte wie von einem Rockstar nach einem Drei-Stunden-Konzert und einem Fass Whisky – dunkel und rauchig.
Ich musterte die dazugehörige Frau neben mir. Sie lehnte mit beiden Ellenbogen auf der auf Hochglanz polierten Theke und betrachtete mich von der Seite. Ihr rötlich braunes Haar war halblang durchgestuft und hing ihr unordentlich ins Gesicht und in die Stirn. Sicher war es so gewollt. Am prägnantesten war ihre Nase, sehr gerade und eindeutig keine niedliche Stupsnase, aber sie passte hervorragend zu ihren scharf geschnittenen Zügen. Sie trug eine anliegende Jeans, die ihre wohlgeformten Beine betonte, und eine Motorradjacke aus Leder mit diversen Reißverschlüssen, Riemen und Schnallen. Insgesamt eine beeindruckende Erscheinung. Ihr Blick, der noch immer auf mir lag, hatte etwas Durchdringendes.
»Warum sollte er?«, fragte ich.
Sie lächelte schief, ein wenig abfällig vielleicht. »Weil ich ihm gesagt habe, dass er lügen soll.«
Kurz wanderten ihre Augen an mir hinunter und wieder hinauf, und als sie erneut bei meinem Gesicht ankam, vertiefte sich ihr Lächeln und ihre Zähne blitzten. »Kann ich dich auf einen Drink einladen?«
War das eine Anmache? Wenn ja, dann war es eine der seltsamsten, die ich je erlebt hatte. Ich deutete auf mein Bier, das ich noch nicht angerührt hatte.
Davon ließ sie sich nicht bremsen und winkte dem haarigen Barmann. Er brachte uns, ohne dass sie irgendetwas bestellen musste, Gläser, füllte Eiswürfel hinein und goss aus einer Flasche zwei Finger breit ein – Scotch, wenn ich das richtig erkannte. Nicht ganz mein Geschmack.
Die Frau nahm ihr Glas und hielt es mir hin, und da ich wissen wollte, wie die Geschichte weiterging, stieß ich mit ihr an. Ich nippte an dem Alkohol, der sich durch meine Kehle brannte und in meinem Magen aufflammte. Bah!
Sie lachte amüsiert, als ich das Gesicht verzog. »Ich bin Riley.«
»Sasha.« Ich stellte mein Glas beiseite und verkniff es mir, mit Bier nachzuspülen. Ich schätzte, dass das Zeug teuer war, und bevor ich nicht wusste, was vorging, wollte ich meine … Gönnerin nicht vor den Kopf stoßen. Ob sie oft hier war, brauchte ich nicht zu fragen, wenn der Barmann ihre Vorlieben kannte. »Warum sollte er lügen?«, wiederholte ich.
»Weil die Wahrheit einen ungesunden Beigeschmack hat.«
Was für eine seltsame Äußerung. »Also kennt er Thomas Hall?«
Sie legte ein wenig den Kopf schief und betrachtete mich neugierig. »Warum interessiert dich das?«
Ich zögerte, aber wenn ich die Wahrheit rausbekommen wollte, egal, wie ungesund sie war, dann war ich auch bereit, weiterzugehen. Ein paar Krümel an Informationen halfen da manchmal. »Er hat sich erschossen. Ich will wissen, warum.«
Riley schien darüber nicht sonderlich erschrocken zu sein. Sie trank einen Schluck und starrte nachdenklich auf die Eiswürfel in ihrem Glas.
»Das wundert dich nicht?«
Sie schüttelte kaum merklich den Kopf. »Nicht sehr.«
Besonders nahe hatten sie sich demnach nicht gestanden. Ich legte das Bild der jungen Frau neben ihr Glas. »Und was ist mit ihr?«
Kurz streifte sie das Foto mit den Augen und schob es mir dann zurück. »Was willst du?«
Antworten von ihr zu bekommen, versprach mühsam zu werden, aber ich war gewillt, mich zu gedulden. »Thomas hat mir vor seinem Tod dieses Bild gegeben. Er meinte, sie wäre jetzt mein Problem.«
Ein rascher Blick von der Seite traf mich, ehe die lautlos schmelzenden Eiswürfel wieder Rileys volle Konzentration verlangten.
Mit buddhistischer Gelassenheit drehte ich mein Glas auf der Theke. Die Eiswürfel waren unspektakulär, und ich hoffte, bald wieder ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Vielleicht konnte ich dann irgendwas in ihrem Gesicht lesen.
»Halt dich von ihr fern«, raunte sie so leise, dass ich nicht sicher war, ob ich mich verhört hatte.
»Was?«
Sie wandte sich mir zu und wiederholte entschieden: »Du sollst dich von ihr fernhalten.«
Also hatte ich doch richtig verstanden. »Du kennst sie?«
»Sie geht dich nichts an.« Riley glitt vom Barhocker und drehte sich zum Ausgang.
Eine Sekunde schaute ich verblüfft ihrer hochgewachsenen Gestalt nach, die mit ausgreifenden und selbstbewussten Schritten dabei war, zu verschwinden.
»Hey …«
Irritiert sah ich neben mich und begegnete dem Bar-Wookiee. Er blinzelte kurzsichtig, bis mir klar wurde, dass er mir zuzwinkerte. Du lieber Himmel! Aber es gesellte sich noch ein hektisches Fuchteln mit der Hand dazu, und ich kapierte, dass ich näher kommen sollte. Gehorsam beugte ich mich zu ihm.
»Der Mann, den du suchst …«, wisperte er aufgeregt. »Er hat nach der Kleinen gefragt, so wie du.«
Ich war verwundert über seine Kooperationsbereitschaft. Hatte diese Riley so viel Einfluss auf ihn? Es schien so. »Was wollte er von ihr?«
»Sie finden.«
»Also wird sie vermisst?«
»Keine Ahnung. Aber wenn ihr alle nach ihr sucht – dann ja. Riley auch. Du solltest ihren Rat befolgen und dich raushalten. Sie ist … unnachgiebig. Wenn sie etwas will, bekommt sie es, und ich glaube, dafür geht sie über Leichen.« Fahrig schaute er zur Tür, aber Riley war längst verschwunden. »Der Typ, den du suchst, war nicht der einzige. Da waren noch andere – und keiner von denen ist wieder aufgetaucht.«
»Und alle haben nach dem Mädchen gefragt?«
Er nickte angespannt, und seine Augen unter den buschigen Brauen huschten wieselflink herum, als rechnete er damit, der Teufel persönlich würde gleich erscheinen – oder Riley.
»Warum hier in der Bar?«
Er zuckte mit den Schultern. »Sie hat hier gearbeitet, gekellnert. Für ihr Studium an der Uni oder so. Wer weiß? Is’ schon ’n paar Monate her.«
So lange? »Wie ist ihr Name?«
»Daran erinnere ich mich nicht mehr.«
»Ein Vorname? Irgendwas«, hakte ich nach. Wie konnte ein Mensch so vergesslich sein?
»Nein. Wir haben dauernd Aushilfskräfte. Ich merk’ mir die Namen nicht. Tut mir leid.«
»Mir auch«, murmelte ich resigniert und stand auf, um zu gehen.
»Aber sie hatte einen Spitznamen«, rief er mir nach. »Wir haben sie immer Jade genannt.« Er deutete unbestimmt in sein Gesicht. »Wegen der Augen.«
***
Es war schon spät, als ich meine Wohnung erreichte und aufschloss. Es roch nach Essen. Jo goss sich gerade Wein ein, als ich hineinkam, und holte ein weiteres Glas, um mir ebenfalls eins einzuschenken. Sie trug noch die Hose ihres Anzugs, hatte die Jacke aber ausgezogen und die Ärmel der Bluse hochgekrempelt. Sie war barfuß, und von ihrer ordentlichen Hochsteckfrisur von heute Morgen war nichts mehr übrig. Stattdessen hatte sie ihre langen dunklen Haare nur locker im Nacken zusammengefasst.
»Essen ist die Minute fertig geworden«, verkündete sie.