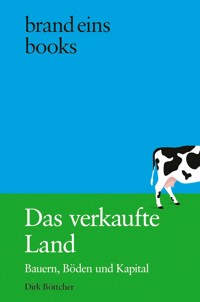
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wir verlieren den Boden unter unseren Füßen. Das Fundament unserer Existenz und unserer Wirtschaft wird versiegelt, überdüngt, überschwemmt oder vertrocknet. Die großen Krisen unserer Zeit – Wohnungsnot, Aufruhr der Landwirte, Migration, Krieg und Klimawandel – sind immer auch Bodenkrisen. Die römischen Bürgerkriege und die mittelalterlichen Bauernkriege begannen wegen Ländereien, das erste Ergebnis der französischen Revolution – eine Landreform. Auch heute rollen wieder die Trecker gegen Machthaber im Staat. Doch ist Boden neben Wasser auch unsere wichtigste Ressource, unser Boden besitzt die höchste Biodiversität aller Lebensräume auf der Erde. Und doch zerstören wir diese wichtige Ressource schneller, als wir sie verstehen können. Dieses Buch kommt also genau zur rechten Zeit und stellt die richtigen Fragen: Wem gehört dieses größte Ökosystem? Wie wollen wir es zukünftig nutzen? Wie finden wir einen klugen Umgang mit dieser vielfältigen Ressource? Und wie kann ein besseres Verständnis des Bodens die Zukunft Deutschland prägen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Dirk Böttcher
Das verkaufte Land
Bauern, Böden und Kapital
Über dieses Buch
Wir verlieren den Boden unter unseren Füßen. Das Fundament unserer Existenz und unserer Wirtschaft wird versiegelt, überdüngt, überschwemmt oder vertrocknet. Die großen Krisen unserer Zeit – Wohnungsnot, Aufruhr der Landwirte, Migration, Krieg und Klimawandel – sind immer auch Bodenkrisen.
Die römischen Bürgerkriege und die mittelalterlichen Bauernkriege begannen wegen Ländereien, das erste Ergebnis der Französischen Revolution eine Landreform. Auch heute rollen wieder die Trecker gegen Machthaber im Staat.
Doch ist Boden neben Wasser auch unsere wichtigste Ressource, unser Boden besitzt die höchste Biodiversität aller Lebensräume auf der Erde. Und doch zerstören wir diese wichtige Ressource schneller, als wir sie verstehen können.
Dieses Buch kommt also genau zur rechten Zeit und stellt die richtigen Fragen: Wem gehört dieses größte Ökosystem? Wie wollen wir es zukünftig nutzen? Wie finden wir einen klugen Umgang mit dieser vielfältigen Ressource? Und wie kann ein besseres Verständnis des Bodens die Zukunft Deutschland prägen?
Vita
Dirk Böttcher arbeitet seit mehr als 30 Jahren als freier Journalist. Er schreibt vor allem für das Wirtschaftsmagazin brand eins und ist Mitgründer der ag text und ag next GmbH, medialer Netzwerke, in denen Kreative verschiedenste journalistische und mediale Formate konzipieren und umsetzen. Auf den Boden wurde er in Kanada aufmerksam, wo er mehr als zehn Jahre gelebt hat. Eine spontane Kaffeepause mit dem Quebecer Bodenforscher Prof. Gilles Lemieux war der Beginn einer bis heute währenden Leidenschaft für dieses Thema. Dirk Böttcher lebt und arbeitet heute in Rostock und Parchim.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2024
Copyright © 2024 by brand eins Verlag Verwaltungs GmbH, Hamburg
Lektorat Gabriele Fischer, Holger Volland
Faktencheck Victoria Strathon
Projektmanagement Hendrik Hellige
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Covergestaltung Mike Meiré/Meiré und Meiré
ISBN 978-3-644-02208-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«Die Probleme unserer Welt sind allesamt Bodenprobleme. Nur im Boden lassen sie sich daher auch lösen.»
PROFESSOR MARKUS ANTONIETTI, Leiter des Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam
Einleitung
Anfang und Ende von allem – warum der Boden unser Schicksal und das faszinierendste Ökosystem dieses Planeten ist. Das wir leider nie besuchen können, aber trotzdem endlich besser kennenlernen sollten.
Arbeit, Boden, Kapital – von den drei Produktionsfaktoren der Volkswirtschaftslehre ist der Boden ein Sonderling. Eine Ressource, die sich nicht vermehren lässt und immer knapper wird. Der Boden ist Auslöser und gleichzeitig Lösung vieler Krisen in der heutigen Zeit. Wie also sollten wir mit ihm verfahren, um das Klima zu schützen, unsere Ernährung zu sichern und die Ungleichheit in der Gesellschaft zu mindern?
Der Boden ist ein Machtfaktor. Mit seinem Besitz lassen sich Werte schaffen, ohne dass man dafür etwas tun müsste. Er ist Gestaltungsraum. Und Konfliktherd: Die Krisen unserer Zeit? Sind Bodenkrisen.
Im Hebräischen steht Adam für Mensch und Adama für Ackerboden, Homo und Humu teilen noch immer den gleichen Wortstamm. Sämtliche Sprachen der menschlichen Kultur sind durch den Umgang mit dem Boden geprägt. Und doch beginnt zehn Zentimeter unter unseren Füßen ein unbekanntes Universum, von dem wir weniger wissen als von der Rückseite des Mondes oder den Tiefen der Meere. Nur eine Handvoll Humus beherbergt mehr Lebewesen, als dieser Planet jemals Menschen zählte. Es wimmelt von sonderbaren Wesen – winzige, zwar mehräugige, aber dennoch blinde Springschwänze etwa, die sich mit einem eingebauten Katapult durch die Unterwelt schießen.
Es sind diese bizarren Wesen, die den Lauf der Dinge mehr beeinflussen, als wir es glauben mögen. Das Leben auf der Erde wird in der Unterwelt entschieden. Unsere Nahrung, die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken – alles Bodenwerk. Hier befindet sich auch der größte Genpool dieses Planeten – wer Wirkstoffe für die Medikamente der Zukunft sucht, der sollte heute im Boden zu suchen beginnen.
«Du bist Erde und Du sollst zu Erde werden», so steht es in der Bibel. Nur wird uns diese Ressource knapp. Dass Bauern ihre Traktoren laut hupend durch die Straßen Berlins lenken, in Paris SUVs mehr Parkgebühr zahlen müssen und sich die Menschen über autofreie Zonen streiten – das alles sind nur verschiedene Lesarten ein und desselben Problems: dass uns der Boden fehlt. Er kommt uns abhanden, jeden Tag – dabei haben wir ihn noch nicht einmal im Ansatz verstanden.
Wir sollten uns mehr und besser mit ihm beschäftigen. Mit seiner ökologischen, aber auch mit seiner ökonomischen Seite. Der Boden ist die limitierte Auflage unseres Planeten. Es wird höchste Zeit, seinen wahren Wert endlich zu erkennen und besser für ihn zu sorgen.
1.Bodenständig – über die Bedeutung des Bodens für Ökonomie und Gesellschaft
Die Bilder von den Traktor-Korsos in Berlin und den vielen anderen Städten hat niemand vergessen. Aber was war da los? Die Traktoren waren plötzlich da und irgendwann wieder weg. Aber worum ging es bei diesem Aufbegehren? Tatsächlich nur um teuren Diesel?
Spulen wir zurück: Die Traktoren fahren von Berlin zurück aufs Feld – und dort suchen wir das Problem. Und finden gleich eine ganze Menge davon, nicht nur in der Landschaft.
Auf den Äckern dieser Republik lässt sich beobachten, wie sich Jahr um Jahr die gewachsene Struktur verändert und der Gestaltungsraum schwindet. So bearbeiten derzeit sechs von zehn Bauern einen Acker, der ihnen gar nicht gehört. In den neuen Bundesländern liegt dieser Wert noch höher, Tendenz: überall steigend.
Um den Boden ist in der Landwirtschaft ein beinharter Wettbewerb entstanden. Landwirte konkurrieren mit Kommunen, die Flächen für Wohnungsbau und Infrastrukturprojekte suchen. Mit großen Energiekonzernen, die auf Ackerland Wind- und Solarfarmen bauen wollen. Und mit kapitalstarken Investoren, die Ackerland als Anlagemodell entdeckt haben oder in riesige Agrar-Holdings investieren, die auf großen Flächen hochindustrielle Landwirtschaft betreiben. Die Folge: Allein in den vergangenen zehn Jahren stiegen die Pachtpreise für Ackerland um mehr als 60 Prozent. Dagegen ist das Auslaufen der Diesel-Subventionen kaum mehr als eine ärgerliche Lappalie.
Von den 262800 landwirtschaftlichen Betrieben, die im Rahmen der Landwirtschaftszählung von Destatis im Jahr 2020 ermittelt wurden, waren 10200 Betriebe als juristische Person oder Personengesellschaft eingetragen. Das entspricht zwar nur vier Prozent aller Betriebe – allerdings entfällt auf diese mittlerweile jeder fünfte landwirtschaftlich genutzte Quadratmeter. In den neuen Bundesländern kontrollieren Unternehmensgruppen sogar mehr als die Hälfte der Ackerflächen.
Aber was ist das Problem? Für eine Antwort lohnt ein Blick nach Mecklenburg-Vorpommern (M-V) – das Bundesland mit einem der größten landwirtschaftlich genutzten Flächenanteile in Deutschland. Um diese Flächen ringen seit einigen Jahren Investoren aus dem In- und Ausland. Die Folge: Der Kaufpreis für Ackerflächen hat sich seit 1995 mehr als verneunfacht. Ein Großteil der Flächen wird von der Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft (BVVG) verkauft. Das Gesetz, noch von der DDR-Volkskammer beschlossen, will es so, dass immer an den Höchstbietenden verkauft wird. Auf diese Weise hat der Bund in den neuen Bundesländern seit dem Jahr 2000 mehr als sieben Milliarden Euro eingenommen, das größte Bodengeschäft in Deutschland seit der Nachkriegsgeschichte. Für Flächen in M-V flossen mehr als 1,6 Milliarden Euro in die Kasse des Bundes. Kleine Randnotiz für interessierte Wirtschaftshistoriker: Die DDR hatte in der Bilanz ihrer Volkswirtschaft den Grund und Boden noch mit 0,00 DDR-Mark bewertet. Getreu der Lehre von Karl Marx, dass nur die geleistete Arbeit einer Sache einen Wert verleiht.
Davon sind wir bekanntlich wieder abgerückt. In M-V kostet der Hektar Ackerfläche mittlerweile mehr als 20000 Euro, bei sehr hoher Bodenqualität werden Preise bis zu 40000 Euro geboten. Die BVVG hat nach eigenen Angaben im Nordosten bis heute mehr als 246000 Hektar verkauft, immer zu Höchstpreisen.
Für Landwirtschaftsminister Till Backhaus ist das «ein Jammer». Denn die öffentliche Hand könne ein Stück Land eben immer nur einmal verkaufen, «und dann ist es weg und sollte doch eigentlich der Allgemeinheit dienen», so Backhaus. Inzwischen verkauft man in M-V schon lange keine eigenen Flächen aus dem Eigentum des Landes mehr, sondern verpachtet nur noch. Wir sehen später noch, dass das auch für andere Probleme eine Lösung sein könnte.
Zurück zu den hohen Bodenpreisen – die kann schon lange kein kleinbäuerlicher Landwirt mehr aufbringen. Das Großkapital schon. Vor allem seit der Finanzkrise 2008 sind echte Werte wieder gefragt – und was kann echter sein als Acker? Die Familien Viessmann oder Rethmann (Remondis) investierten seither in Hunderte Hektar Feld und Wald. Dafür werden zahlreiche Agrar- und Immobiliengesellschaften sowie Holdings gegründet, von denen dann Investoren über sogenannte Share Deals Anteile erwerben. Angenehmer Nebeneffekt: Die Grunderwerbsteuer fällt bei diesem Konstrukt auch noch weg, da der Käufer das Land nicht direkt, sondern über das gekaufte Unternehmen erwirbt.
Die hohen Boden- und Pachtpreise machen die kleinbäuerliche Landwirtschaft unerschwinglich, immer mehr Betriebe müssen aufgeben und werden von den Großen aufgekauft, die mittlerweile viele Tausend Hektar Land bewirtschaften. Vor allem für Neuverpachtungen steigen die Preise, auch bei kleinen Flächen von weniger als fünf Hektar. Dort werden mittlerweile Pachten von knapp unter 1000 Euro aufgerufen, ein Zuwachs von fast 140 Prozent im Vergleich zu 2010. Unter diesen Bedingungen lässt sich Landwirtschaft nicht mehr profitabel betreiben.
Man geht davon aus, dass man aus mittelguten Böden in 20 bis 25 Jahren circa 7000 bis 8000 Euro Gewinn pro Hektar erwirtschaften kann. Das wäre dann auch eine Richtgröße für einen betriebswirtschaftlich vernünftigen Preis, die derzeit aufgerufenen Summen bilden allerdings das Dreifache und mehr ab. Wie aber kommt es zu diesem Aufschlag? Durch die hohe Nachfrage – allerdings nicht durch die Landwirte, von denen immer mehr ihre Betriebe aufgeben. Die Äcker sind das Ziel des Kapitals, das überall Zuflucht sucht. Die absoluten Preise sind dabei zweitrangig, die landwirtschaftlichen Böden versprechen langfristig werthaltige Investitionen. Es ist der sichere Hafen zum Aussitzen von Krisen.
Und die Politik? Befeuert diesen Trend, zum Beispiel über die EU-Subventionen für die Landwirtschaft. Denn diese werden nicht an die Landwirte ausgezahlt, die die Äcker bewirtschaften, sondern an die Eigentümer der Flächen. Eine Recherche von FragDenStaat und Arena for Journalism in Europe zeigt anhand der gezahlten Subventionen, wer in Deutschland die neuen Großgrundbesitzer sind. So erhielt die Unternehmensgruppe von Aldi-Nord über ihre Eigentümerstiftung seit 2019 mehr als 2,7 Millionen Euro, die Lindhorst-Gruppe 12,5 Millionen Euro, die Steinhoff-Familienholding mehr als 11 Millionen Euro und die Familienstiftung des Bauunternehmers Zech seit 2018 sogar mehr als 21 Millionen Euro. Auch die Konzerne RWE und BASF strichen Millionensummen ein. In Polen und Österreich ist der größte Empfänger der EU-Subventionen die katholische Kirche. Insgesamt kassiert das oberste Prozent der Eigentümer mehr als ein Drittel aller EU-Subventionen in der Landwirtschaft.
Als Folge müssen die kleinbäuerlichen Landwirte weichen, der ökologische Landbau wird in den industriellen Großbetrieben immer schwieriger umzusetzen sein. Die Ausflucht in Biogas-Anlagen hilft zwar einigen Landwirten, die teure Pacht bezahlen zu können. Allerdings wirkt auch hier die staatliche Regulierung anders, als sie wohl gemeint war. Die hohen EEG-Umlagen machen es möglich, auch Anlagen mit einem geringen Wirkungsgrad immer noch profitabel zu betreiben. In der Folge wird auf großen Flächen Mais in Monokultur angebaut, eine Pflanze, die extrem viel Wasser benötigt, die Böden verdichtet, durch den Dünger die Nitratkonzentration im Grundwasser steigen lässt und über die Flüsse Phosphor und Stickstoff in die Ostsee spült.
Warum der Boden seit Jahrtausenden Ursache von Aufruhr ist
Im Jahr 133 v. Chr. ließ der Volkstribun Tiberius Sempronius Gracchus Boden an einfache Arbeiter Roms verteilen, um, so hieß es, das Kleinbauerntum wieder zu aktivieren und die vielen in die Städte gezogenen Bauern wieder zur Rückkehr auf das Land zu bewegen. Rom besaß damals das sogenannte ager publicus, also Land im öffentlichen Besitz, das regelmäßig an Privatpersonen verteilt wurde, gleichzeitig kamen durch Eroberungen immer wieder neue Flächen dazu.
Doch Tiberius hatte mit dieser Landreform weniger das Wohl der Kleinbauern im Sinn, so die heutige Sicht von Historikern, sondern das Wehe seiner Rivalen. Die Verteilung des Großgrundbesitzes traf einige mächtige Senatoren, die sich einen Großteil des öffentlichen Landes unter den Nagel gerissen hatten, und die sich am Ende dann auch an Tiberius rächten. Seine Ermordung wurde ausgerechnet auf einem ager publicus vollzogen, und für Historiker beginnt mit diesem Ereignis der Niedergang des Römischen Reiches. Denn am Ende war der gesamte ager publicus verteilt, also quasi privatisiert – und Begehrlichkeiten nach Land führten zu immer mehr Streitigkeiten. Den römischen Eliten gelang es nicht mehr, diese wachsenden Rivalitäten friedlich beizulegen, die Folge waren Gesetzesbrüche und Gewalt – die Römischen Bürgerkriege begannen und bedeuteten den Anfang vom Ende des Römischen Reich.
Auch schon lange vorher, 2000 vor Christus, gab es in Athen Ärger um den Boden. Der gehörte damals Familien und Clans, durfte aber nicht verkauft werden





























