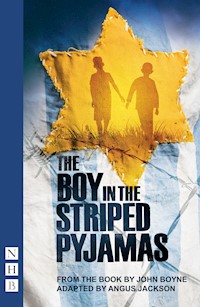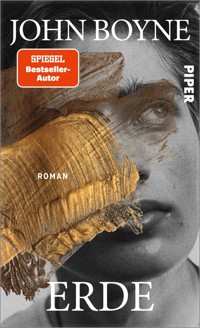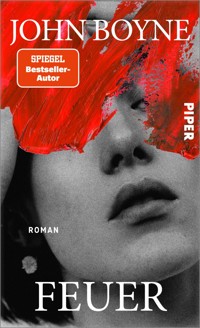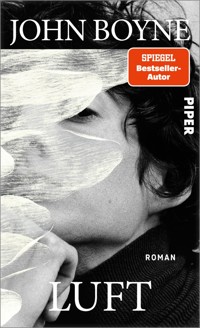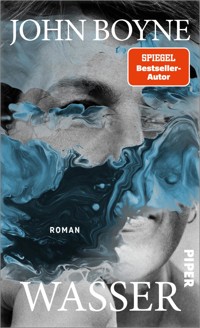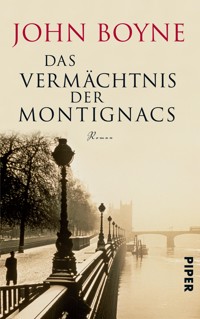
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
London, 1936. Owen Montignac, der attraktive, charismatische Spross aus gutem Haus, erwartet bang die Testamentsverlesung seines unlängst verstorbenen Onkels. Doch Owen wird nicht berücksichtigt. Die Alleinerbin ist seine schöne Cousine Stella, zu der er eine etwas fragwürdige Zuneigung empfindet. Zudem plagen ihn hohe Spielschulden – und so ersinnt Owen einen teuflischen Plan …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Con
Übersetzung aus dem Englischen von Gabriele Weber-Jarić
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-95916-2
© 2006 John Boyne
Titel der englischen Originalausgabe:
»Next of Kin«, Penguin, London 2006
Deutschsprachige Ausgabe:
© 2013 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München
Umschlagmotiv: Special Photographers Arvchive/The Bridgeman Art Library
Datenkonvertierung E-Book: Kösel Media GmbH, Krugzell
KAPITEL 1
1
Vor vielen Jahren, als Leutnant in der Armee und direkt außerhalb von Paris stationiert, traf Charles Richards auf einen Rekruten, einen Jungen von etwa achtzehn Jahren, der allein auf seiner Pritsche im Schlafsaal saß, den Kopf gesenkt, und lautlos weinte. Nach kurzer Befragung stellte sich heraus, dass er seine Familie und sein Zuhause vermisste, der Armee ohnehin nie hatte beitreten wollen, sondern von seinem Vater, einem Veteranen, dazu gezwungen worden war. Die Vorstellung eines weiteren Appells am frühen Morgen, gefolgt von einem Zwanzig-Meilen-Marsch über unwegsames Gelände und dabei immerzu feindlichen Angriffen ausweichen zu müssen, hatte ihn zu einem emotionalen Wrack gemacht.
»Steh auf«, sagte Richards, winkte den Jungen mit einem Fingerzeig hoch und streifte seine schweren Lederhandschuhe ab. Der Junge stand auf. »Wie heißt du?«, fragte Richards.
»William Lacey, Sir.« Der Junge wischte sich über die Augen und war außerstande, dem Offizier ins Gesicht zu sehen. »Bill.«
Richards umschloss die Finger eines Handschuhs mit festem Griff und schlug dem Jungen mit dem Leder zweimal ins Gesicht, ein Mal auf die linke und ein Mal auf die rechte Wange, und ließ, wie nach einer jähen Explosion, auf der sonst blassen Haut rot erblühte Flecke zurück. »Soldaten«, erklärte er dem konsternierten Rekruten, »weinen nicht. Nie.«
Folglich überkam ihn ein Gefühl leichter Verwunderung, als er 1936 an einem schönen Junimorgen in der achten Reihe einer Privatkapelle der Westminster Abbey saß und feststellte, dass hinter seinen Augen Tränen darauf drängten, hervorzuschießen, während Owen Montignac zum Schluss seiner Lobrede über seinen jüngst verstorbenen Onkel Peter kam, einen Mann, den Richards nie sonderlich gemocht, den er, genau genommen, für kaum mehr als einen Halunken und Scharlatan gehalten hatte. Richards hatte in seinem Leben an etlichen Beerdigungen teilgenommen, doch jetzt im fortgeschrittenen Alter bedrückte ihn die Erkenntnis, dass die Abstände zwischen ihnen kürzer und kürzer wurden. Aber nie hatte er einen Sohn erlebt, der seinen Gefühlen für den verblichenen Vater Ausdruck verlieh, geschweige denn einen Neffen, der seinen Schmerz über einen verstorbenen Onkel so redegewandt und bewegend vortrug, wie Owen Montignac es gerade getan hatte.
»Verdammt nobel«, murmelte er kaum hörbar, als Montignac in die erste Bankreihe zurückkehrte und Richards aus der Distanz noch dessen außergewöhnlich weißen Haarschopf sah. Um seinen Tränen Einhalt zu gebieten, drückte er verstohlen mit den Zeigefingern auf seine Augenwinkel. »Verdammt noble Rede.«
Später stand er nur wenige Fuß von dem offenen Grab entfernt, diesem hungrigen Maul, dem die Sargträger sich gemessenen Schritts näherten, roch die frisch umgegrabene Erde und hielt in der Menge der versammelten Trauergäste nach Montignac Ausschau, denn mit einem Mal drängte es ihn, die Aufmerksamkeit des jüngeren Mannes zu erregen und ihm stumm Beistand zu leisten.
Erst als der Sarg hinuntergelassen wurde, erkannte er, dass der Gesuchte einer der Sargträger war. Der Anblick dieses gut aussehenden jungen Mannes, der den Leichnam seines Onkels in die feuchte Erde sinken ließ, überwältigte Richards nahezu, und er musste krampfhaft schlucken und husten, um Haltung zu bewahren. Er tastete nach rechts und umschloss die Hand seiner Frau. Überrascht spürte Katherine Richards diese seltene Berührung, die darüber hinaus mit einem sanften, betont liebevollen Händedruck einherging, was noch erstaunlicher war, sodass sie ihrerseits um Fassung rang, ehe sie sich umwandte, um ihren Mann anzulächeln.
Fünfzehn Fuß von ihnen entfernt stand Margaret Richmond, die ihre Gefühle gern zur Schau stellte. Sie bebte am ganzen Leib und drückte ein Taschentuch auf ihre Augen, um die Tränenflut aufzuhalten, denn gerade wurde der Mann, der achtundzwanzig Jahre lang ihr Arbeitgeber gewesen war, zur ewigen Ruhe gebettet. Peter Montignacs Tochter Stella stand an ihrer Seite, hoch aufgerichtet und gefasst, das blasse Gesicht frei von Tränenspuren. Dennoch wirkte sie mitgenommen, so sehr, dass man fürchten musste, die Kraft, die es sie kostete, nicht zu weinen, könnte sie an den Rand einer Ohnmacht führen.
Zu diesen beiden Frauen, seiner alten Kinderfrau und seiner Cousine, trat Owen Montignac, während der Geistliche den letzten Segen sprach; und es war Stellas Arm, den er nahm, als alles vorüber war und der Moment kam, wo die Trauernden sich verlegen und mit zögernden Schritten zu entfernen begannen, ohne recht zu wissen, ob sie zu ihren Wagen zurückkehren oder auf dem Friedhof warten sollten, bis die Familienangehörigen gegangen waren. Dabei lasen sie auf den Grabsteinen Namen und Daten und suchten nach denen, die auf tragische Weise in jungen Jahren oder auf rücksichtslose Weise im hohen Alter gestorben waren.
Der Regen, der sich, seit sie die Abtei betreten hatten, zurückgehalten hatte, machte sich wieder bemerkbar, plötzlich und so stürmisch, dass der Friedhof sich in wenigen Minuten leerte, mit Ausnahme zweier Totengräber, die, wie von Zauberhand gerufen, zwischen den Bäumen hervortraten, das Grab zuschaufelten, über die Fußballergebnisse des letzten Wochenendes sprachen und Selbstgedrehte rauchten.
Im Salon war die Luft von Zigarrenrauch geschwängert.
Etwa sechzig Personen waren nach dem Begräbnis nach Leyville geladen worden, dem Hauptwohnsitz der Familie Montignac, wo Owen, Stella und Andrew zusammen aufgewachsen waren. Inzwischen hatte jeder damit begonnen, sich zwischen den Versammelten im Erdgeschoss des formellen Ostflügels hindurchzuarbeiten, dem Bereich, der zur Gedenkfeier freigegeben worden war. Zwar war die Familie nicht so vulgär gewesen, über die Treppe eine Samtkordel zu spannen oder die Tür abzusperren, die zum geselligeren Westflügel führte, wo sich das Esszimmer und das Porzellan befanden und Peter Montignac Abend für Abend in seinem uralten Lehnsessel angestrengt versucht hatte, Radio zu hören, doch alle Besucher wussten, dass es nur wenige Räume gab, deren Betreten angemessen war.
Zudem besaßen die meisten von ihnen ein Zuhause wie dieses, hatten Eltern oder Ehepartner begraben und waren ohnehin in der Lage, den derzeit geltenden Anstandsregeln zu folgen.
Eine Gruppe von fünf Männern in dunklen Anzügen, drei von ihnen mit Schnurrbärten, die sich an Extravaganz überboten, stand unter dem Porträt eines toten Montignac, der vor zweihundertfünfzig Jahren gelebt hatte, derselbe, der begonnen hatte, rund um London Land aufzukaufen, was schließlich zu dem fast einzigartigen Reichtum seiner Familie geführt hatte. Die fünf Ehefrauen dieser Männer saßen wie durch Zufall auf der anderen Seite des Raums auf einem kleinen Sofa und zwei Sesseln nahe dem Porträt der Ehefrau jenes toten Montignac. Es war eine Ehefrau, über die man nur wenig wusste und für die man sich noch weniger interessierte. Immerhin definierte die Familie ihre Abstammung ausschließlich über ihre Männer, die Williams, Henrys und Edmunds, und befasste sich kaum mit der hilfreichen Schar von Müttern, die zu ihrer Fortpflanzung beigetragen hatten.
Dienstboten glitten durch den Raum. Man spürte, dass sie anwesend waren, aber als Menschen wurden sie ignoriert. Es waren junge Frauen, die den Damen Tee reichten, während ihre männlichen Kollegen den Herren Whisky einschenkten. Wein wurde ebenfalls angeboten.
»Ich sage nicht, dass es nicht bewegend war«, raunte ein Gast einem anderen zu, die beiden standen am Kamin. »Ich mache mir nur nichts aus diesem neumodischen Kram, das ist alles.«
»Ich würde es nicht für neumodischen Kram halten«, entgegnete der andere. »Dergleichen findet immerhin seit Tausenden von Jahren statt. Denk an Marcus Antonius, der auf den Stufen des Kapitol die Tugenden Cäsars gepriesen hat.«
»Ja, aber hatte er ihn da nicht kurz zuvor ermordet?«
»Nein, Marcus Antonius war keiner der Verschwörer. Als die Tat vollbracht war, kam er, um die Leiche von den Stufen des Senats zu holen. Du erinnerst dich, von Marcus Antonius betrauert, der zwar seine Hand bei Caesars Tod nicht im Spiel hatte, aber den Nutzen aus seinem Sterben empfangen wird. Angesichts der Umstände irgendwie passend, findest du nicht?«
Ein dritter Gast trat zu ihnen, eine Mrs Peters, die es genoss, Kontroversen auszulösen, indem sie sich zu Männergruppen gesellte und darauf bestand, an deren Unterhaltung teilzunehmen. (Ihr Ehemann war vor einigen Jahren gestorben, und ihr Bruder lebte in Indien, sodass es niemanden gab, der sie zügeln konnte, außerdem hatte sie Geld.) »Worüber tratscht Ihr Männer gerade?«, erkundigte sie sich und schnappte sich ein Glas Whisky von dem Tablett des jungen Dieners, der an ihr vorüberglitt.
»Alfie sagt, es ist eine Modeerscheinung«, antwortete der zweite Mann. »Ich bin anderer Meinung.«
»Was ist eine Modeerscheinung?«
»Dieses neue Gebaren. Bei Beerdigungen.«
»Was soll das heißen?«, fragte Mrs Peters. »Da komme ich nicht ganz mit.«
»Na, Elogen und so weiter«, erklärte der Mann. »Hübsche Reden. Kinder, die den Tod ihrer Eltern und was weiß ich noch alles beklagen.«
»Oder den ihrer Onkel«, sagte Mrs Peters. »Falls Sie sich auf Owens Rede beziehen.«
»Oder den ihrer Onkel«, bestätigte Alfie. »Dieses ganze emotionale Trara. Ich bin dagegen, weiter nichts.«
»Herrgott«, sagte Mrs Peters entnervt angesichts der Dummheit von Männern, die keine Probleme damit hatten, Kriege zu führen, aber zurückscheuten, wenn es darum ging, gegen ein paar Tränen anzukämpfen. »Es war eine Beerdigung. Wenn ein Junge nicht einmal bei dem Begräbnis seines Vaters ein paar Gefühle zeigen kann, wann dann?«
»Na schön, aber Peter war ja nicht Owens Vater, oder?«, betonte Alfie.
»Nein, aber so gut wie.«
»Absolut verständlich, wenn man mich fragt«, sagte der andere Mann.
»Ich kritisiere ihn ja auch nicht«, lenkte Alfie eilig ein, denn er wollte nicht als jemand gelten, der der Trauer eines wohlhabenden jungen Mannes gefühllos gegenüberstand, immerhin hatte dieser gerade eines der größten Besitztümer Englands geerbt und war somit nicht einer, von dem man sich distanzieren sollte. »Der Bursche hat mein ganzes Mitgefühl, gar keine Frage. Ich verstehe nur nicht, warum er sich vor aller Welt so zur Schau stellen musste, weiter nichts. So etwas behält man für sich, das ist immer am besten. Niemand möchte mit ansehen, wie jemand eine Parade nackter Gefühle aufführt.«
»Was für eine schreckliche Kindheit Sie gehabt haben müssen«, sagte Mrs Peters lächelnd.
»Da sehe ich keinen Zusammenhang«, erwiderte Alfie, überlegte, ob er beleidigt worden war, und richtete sich zu voller Höhe auf.
»Ist es nicht eine Schande, dass die Dienerschaft den Damen wie selbstverständlich Tee reicht und den Männern Whisky?«, fragte Mrs Peters, die von dem Gespräch jetzt schon gelangweilt war und nach einem etwas gewagteren Thema suchte. »In meinem Testament werde ich die strikte Anweisung hinterlassen, dass sich bei meinem Begräbnis jedermann amüsieren und peinliche Dinge tun muss, Männer wie Frauen. Wenn nicht, kehre ich zurück, um alle heimzusuchen. Bin gespannt, wie Ihnen das dann gefällt.«
2
Unter normalen Umständen dauerte der Weg vom Tavistock Square zum Old Bailey zu Fuß nie länger als eine Stunde, sodass Roderick Bentley, Anwalt und Richter Seiner Majestät des Königs, im Lauf seiner Karriere an den schönen Morgen den Rolls Royce lieber zu Hause gelassen hatte. Der Spaziergang bot ihm die Möglichkeit, über den Fall, mit dem er gerade beschäftigt war, nachzudenken und die Dinge in Ruhe zu erwägen, ohne von Staatsanwälten, Verteidigern, Gerichtsdienern oder Angeklagten gestört zu werden. Zudem sagte er sich, dass ihm die Bewegung guttue, denn ein Mann von zweiundfünfzig Jahren durfte seine Gesundheit nicht mehr aufs Spiel setzen. In genau diesem Alter war sein Vater einem Herzinfarkt erlegen, und deshalb hatte Roderick dem letzten Geburtstag mit fatalistischer Furcht entgegengesehen.
An diesem Tag war die Luft frisch, und ein wenig früher am Morgen hatte es geregnet, doch selbst wenn die Sonne die Bäume hätte glänzen lassen und der Himmel makellos blau gewesen wäre, hätte er Leonard gebeten, mit dem Wagen vorzufahren. Seit Donnerstagabend, als er die Verhandlung abgeschlossen hatte, campierten diese verfluchten Zeitungsleute vor der Tür, und Freitag, Samstag und Sonntag hatte er sich in seinem eigenen Haus wie ein Gefangener gefühlt.
An diesem Morgen war er früh aufgewacht, gegen halb fünf. Eine halbe Stunde oder so hatte er noch im Bett gelegen, versucht, den Schlaf wieder herbeizuzwingen und sich noch eine kleine Ruhepause zu gönnen, ehe die Mühen des Tages begannen. Doch als das Tageslicht durch die Vorhänge sickerte, wusste er, dass es zwecklos war. Jane, seine Ehefrau, schlief noch. Um sie nicht zu stören, schlüpfte er leise aus dem Bett und tappte in die Küche hinunter, um sich eine Kanne Tee zu machen. Die Post war noch nicht gebracht worden, dazu war es zu früh, aber die Sunday Times vom Vortag lag noch auf dem Tisch. Er griff danach, doch dann stellte er fest, dass Jane die Kreuzworträtsel schon gelöst hatte – die einfachen wie die verzwickten –, woraufhin er die Zeitung mit einem Seufzer zur Seite schob.
Wie immer hatte er die Zeitungen während des Wochenendes gemieden. Seit seinen Anfängen als Referendar in der Kanzlei des Anwalts und Richters Seiner Majestät, Sir Max Rice, ebenso wie in seiner Zeit als junger Anwalt, der in den Gerichten Londons und den umliegenden Bezirken Fällen nachjagte und im Gerichtssaal nur in der zweiten Reihe sitzen durfte, von wo aus er seinem gelehrten Vorgesetzten Ratschläge ins Ohr flüsterte, und auch danach als Anwalt, der durch seine Arbeit berühmt geworden war, hatte Roderick nie Zeitungsberichte über seine Fälle gelesen. Später, als er zum Richter des Hohen Gerichtshofs berufen worden war und einigen der berüchtigten Prozesse vorsaß, war diese Einstellung für ihn Ehrensache geworden.
Angesichts der außergewöhnlich großen Aufmerksamkeit, die sein gegenwärtiger Fall hervorgerufen hatte, wagte er es nicht, sich den Kreuzworträtseln der Titelseite zuzuwenden, denn die Schlagzeile konnte er sich vorstellen. Auch die Kolumnen überflog er nicht, seine Entscheidung durfte weder von der öffentlichen Meinung noch von den Ansichten eines Redakteurs beeinflusst werden, oder gar von den Leserbriefen, was noch schlimmer gewesen wäre. Deshalb warf er die Zeitung in den Abfalleimer und ging hinauf, um ein Bad zu nehmen.
Ungefähr eine Stunde später, kurz vor halb sieben, saß er in seinem Arbeitszimmer und las noch einmal die Urteilsbegründung, die er am Wochenende verfasst hatte und die die Ursache seiner Schlaflosigkeit am frühen Morgen gewesen war. Punkt elf Uhr würde er sie vor dem versammelten Gericht und den Vertretern der Presse verlesen. Er studierte den Text. Aus Angst, ihm könnte irgendwo ein Fehler unterlaufen sein, überprüfte er einige der zitierten Gesetze doppelt und dreifach, schließlich war er im Besitz einer eindrucksvollen Rechtsbibliothek. Dann lehnte er sich mit einem Seufzer zurück und sann über die Umstände nach, die ihn dazu zwangen, Entscheidungen dieser Art zu treffen.
Er kam zu dem Schluss, dass das Amt des Richters ein eigentümlicher Beruf war; denn zu ermessen, ob man jemandem die Freiheit gewähren oder verwehren sollte, beinhaltete eine merkwürdige Autorität, und einem Menschen zu gestatten, weiterzuleben, oder zu verkünden, dieses Leben solle beendet werden, bedeutete eine Macht, die demütig stimmte.
Er hörte, dass es sich im Haus zu regen begann, und nahm an, dass Sophie, das Hausmädchen, und Nell, die Köchin, kurz davor waren, ihre Arbeit aufzunehmen. Jane stand nie vor neun Uhr morgens auf, und da sie es vorzog, im Bett zu frühstücken, kam ihm der Gedanke, ihr das Frühstück heute einmal selbst zu bringen. An diesem schwierigen Wochenende war sie ganz besonders aufmerksam gewesen und hatte, um ihn von seinen Sorgen abzulenken, für Samstag und Sonntag eine kleine Auszeit in einem Hotel im Lake District angeregt. Da habe er eine friedliche Umgebung, um sein Urteil niederzuschreiben, hatte sie angeführt, doch er hatte das Angebot ausgeschlagen. Wie hätte das für die Presseleute ausgesehen, wenn er in der Gegend von Wordsworth Urlaub machte, während das Leben eines Menschen auf dem Spiel stand?
»Wen interessiert schon, was sie sagen?«, hatte Jane gefragt und festgestellt, wie viel grauer das Haar ihres Mannes in den letzten Monaten geworden war, seit Beginn dieser entsetzlichen Verhandlung. »Wen interessiert überhaupt, was sie über dich schreiben?«
»Mich interessiert es«, erwiderte Roderick mit bekümmertem Lächeln und einem Schulterzucken. »Wenn sie mich kritisieren, kritisieren sie die Rechtsprechung als Ganzes, und dafür möchte ich nicht verantwortlich sein. Wir könnten am nächsten Wochenende verreisen, wenn diese grässliche Sache hinter uns liegt. Abgesehen davon würden sie uns jetzt bis dorthin verfolgen, und wir hätten ohnehin keine schöne Zeit.«
Auf der Treppe wurden Schritte laut. Er hörte die Stimmen von Sophie und Nell, die von ihrer kleinen gemeinsamen Wohnung im Dachgeschoss zusammen nach unten gingen. Sie sprachen leise, in der Annahme, dass der Herr und die Herrin des Hauses noch schliefen, und, so absurd es auch war, wünschte er mit einem Mal, ihnen in die Küche folgen zu können, um an irgendeiner trivialen Unterhaltung der beiden teilzunehmen, was selbstverständlich nicht infrage kam. Sie würden denken, jetzt hätte er gänzlich den Verstand verloren, und wenn die Reporter das dann erführen, wäre der Rest der Geschichte gar nicht mehr auszudenken. Überall gab es Spione, und außer seiner Frau war niemandem mehr zu trauen, das hatte er in den letzten Monaten gelernt.
Auf jeder Seite seines Schreibtischs stand ein gerahmtes Foto. Mit liebevollem Blick schaute er von einem zum anderen. Auf dem einen war Jane abgebildet, es war vor zwei Jahren auf der Feier ihres vierzigsten Geburtstages aufgenommen worden. In den langen Jahren, seit er sie kannte, hatte sie sich kaum verändert; selbst auf diesem Foto hätte sie als zehn oder zwölf Jahre jüngere Frau durchgehen können. Jane war auffallend schön – und schwierig. So war sie schon, als sie sich kennenlernten, damals, als er noch Anwalt und Ende zwanzig gewesen war und sie eine Debütantin, zehn Jahre jünger als er, die Tochter eines alternden Kollegen, die auf der Suche nach einem potenziellen Ehemann und einem angenehmen Lebensstil war.
Auf dem anderen Foto war ihr Sohn Gareth zu sehen. Es stammte aus dem vergangenen Sommer, als er mit einem Freund aus Cambridge auf Segeltour gewesen war. Wenn Roderick sich nicht täuschte, war der Freund in der Ruderregatta Steuermann gewesen und seine Mannschaft hatte mit vier Längen gesiegt. Auf dem Foto grinste Gareth breit und hatte den Arm um die Schultern seines Freundes gelegt. Gareths Haar war zu lang für einen Jungen und seine Haltung zu sorglos für jemanden, der sich allmählich niederlassen und eine angemessene Stelle finden sollte. In den letzten Monaten war der Junge jedoch rücksichtsvoll gewesen, hatte gewusst, unter welchem Druck sein Vater stand. Wenn er da war, hatte er dann und wann eine aufmunternde Bemerkung gemacht, aber dieser Tage hielt er sich kaum noch bei ihnen auf. Wenn Roderick es recht bedachte, konnte inzwischen eine ganze Woche vergehen, ohne dass er seinen Sohn sah, der mit seinen Freunden die Nacht zum Tag machte, eine Gruppe, die offenbar vorhatte, in ihren Zwanzigern nichts anderes zu erreichen, als sich ihrem Hedonismus und dem fröhlichen Leben hinzugeben. Roderick wusste, dass der Junge ihm aus dem Weg ging, um das überfällige Gespräch zu vermeiden, das darauf hinauslaufen würde, Gareth solle sich eine Arbeit suchen. In dem Punkt war er als Vater in jüngster Zeit nachlässig gewesen. Aber auch das würde sich nach dem heutigen Tag ändern.
Es war alles so anders als zu der Zeit, als er in Gareths Alter gewesen war. Jura zu studieren, das war von jeher sein Wunsch, doch da er nicht aus einer wohlhabenden Familie stammte, war die Beendigung des Studiums ein Kampf gewesen. Sicher, nach den ersten Fällen hatte er sich rasch einen Namen als einer der hellsten Köpfe in der Kanzlei von Sir Max gemacht, aber in seinen Zwanzigern hatte er jeden Tag zum Aufbau seiner Reputation genutzt, war bei mehreren Verfahren erfolgreich gewesen und hatte Sir Max beeindruckt, der andeutete, eines fernen Tages könne Roderick die Kanzlei möglicherweise leiten, natürlich erst nach dem Tod von Sir Max und vorausgesetzt, er bliebe bei seinem Arbeitspensum und ließe in seinem Leben keine Ablenkungen zu. Und fraglos müsse er veröffentlichen. Das – oder untergehen.
Allerdings hatte es in Rodericks Leben ohnehin kaum Ablenkungen gegeben, bis er Jane kennenlernte, die ihm bewusst machte, dass das Leben nicht nur aus Arbeit bestand und dass all der Erfolg ohne Liebe bedeutungslos war.
Jetzt, viele Jahre später, leitete er die Kanzlei tatsächlich und war ein gefeierter, wohlhabender Mann, anscheinend so wohlhabend, dass sein Sohn annahm, er sei nicht verpflichtet, sich ein Leben oder eine Karriere aufzubauen, da das Konto seines Vaters ausreiche, ihn sein Leben lang zu unterhalten. Doch Roderick glaubte fest daran, dass ein dreiundzwanzigjähriger Mann eine Karriere brauchte und dass es keine Alternative war, wöchentlich in den Klatschspalten zu erscheinen.
Aber welches Recht hatte er, einem jungen Mann vorzuschreiben, wie er sein Leben führen sollte? Da saß er hier in seinem eleganten Haus, umgeben von Luxus und den Insignien seines Erfolgs, und grübelte darüber nach, wie sein Sohn die Zeit vergeudete, während ein anderer Dreiundzwanzigjähriger sicherlich wach in seiner Gefängniszelle lag und nervös, oder vielmehr ängstlich, an den kommenden Tag dachte; denn in wenigen Stunden würde Richter Roderick Bentley seinen Platz im Gerichtssaal einnehmen und ihm mitteilen, ob er den Rest seines natürlichen Lebens auf Kosten seiner Majestät im Zuchthaus verbringen oder in einen speziellen Trakt verlegt würde, bis zu dem Tag seiner Exekution, sprich, Tod durch Erhängen.
Hätte Roderick an dem Morgen gegen seine Grundregel verstoßen und TheTimes gelesen, wüsste er, dass dort beide Dreiundzwanzigjährige erwähnt worden waren, der eine auf der Titelseite, der andere auf indirekte Weise auf Seite sieben, wo es um Partys, Verlobungen und andere gesellschaftliche Ereignisse ging, die mit gequältem Humor und bemühten Wortspielen durchgehechelt wurden. Für seinen Blutdruck war es ein Glück, dass er weder das eine noch das andere sah.
Als Roderick den Teekessel in der Küche pfeifen hörte, ging er nach unten. Er brauchte eine Tasse Tee, eine sehr starke Tasse Tee.
3
»Das Problem ist, dass man irgendwann nicht mehr weiß, was man noch sagen soll. Es wirkt so unaufrichtig, immerzu die gleichen abgedroschenen Beileidsbekundungen von sich zu geben.« Das kam von Mrs Sharon Rice, einer Witwe, die drei Meilen östlich von Leyville mit ihrem Sohn lebte, einem erfolgreichen Bankier, dessen Ehefrau ihn unter skandalösen Umständen verlassen hatte.
»Tja, meine Liebe, die Alternative wäre, ihn einfach zu ignorieren und so zu tun, als feierten wir hier nur eine ihrer Partys«, entgegnete Mrs Marjorie Redmond, ließ ihren Blick über die versammelten Gäste in ihrer strengen, dunklen Kleidung wandern und fragte sich, welchen Sinn es hatte, bei einer Beerdigung Schwarz zu tragen. Letzten Endes wurden die Menschen dadurch nur noch deprimierter, als sie es ohnehin schon waren.
»Ich bezweifle stark, dass Owen Montignac hier in absehbarer Zeit Partys gibt. Vor Weihnachten rechne ich nicht damit, Leyville noch mal von innen zu sehen.«
»Junge Leute halten sich nie an alte Sitten«, sagte Mrs Rice mit dem empörten Schnauben einer Frau, die weiß, dass die wildesten Tage hinter ihr liegen. »Er wird sich ja nicht einmal an die Partys erinnern, die hier stattgefunden haben. Damals, meine ich.«
»Wissen wir denn überhaupt, ob Leyville jetzt tatsächlich ihm gehört?«, erkundigte sich Mrs Redmond, sah sich verstohlen um und senkte ihre Stimme. »Immerhin war er nur der Neffe. Von Rechts wegen wäre alles an Andrew gegangen, aber es ist ja auch denkbar, dass Stella jetzt die Nutznießerin ist.«
»Die Montignacs haben ihr Geld immer nur männlichen Erben vermacht«, erwiderte Mrs Rice. »Und Peter Montignac war äußerst traditionsbewusst. Stella wird ihren Anteil bekommen, da bin ich mir sicher, trotzdem dürfte Owen nach der Verlesung des Testaments ein sehr wohlhabender Mann sein.«
»Glauben Sie, dass er deshalb diese Lobrede gehalten hat?«
»Da hätte ich am liebsten Beifall geklatscht, meine Liebe. Wenn man mich fragt, gibt es viel zu viele Menschen, die ihre Gefühle unterdrücken. Und nach allem, was Peter für diesen Jungen getan hat, dass er ihn trotz der Dinge, die sein Vater sich geleistet hat, aufgenommen hat, ist es doch ganz natürlich, dass er seinen Gefühlen Ausdruck verleihen wollte. Offen gestanden bewundere ich ihn dafür.«
Die Männer am Billardtisch debattierten über ein ganz anderes Problem, während sie gegeneinander antraten und davon ausgingen, dass niemand sie stören würde. Einer von ihnen, ein junger Mann namens Alexander Keys, der mit Owen Montignac in Eton gewesen war, hatte den Gastgeber vor dem Spiel um Erlaubnis bitten wollen, denn ein Gefühl sagte ihm, andere könnten Billard an einem Trauertag verwerflich finden. Doch da Owen nirgends zu entdecken war, hatten sie einfach begonnen und sich auf kleine Einsätze geeinigt, nur so viel, um die Sache interessant zu halten.
»Die Tür da sollte geschlossen bleiben«, riet einer.
»Also sind wir einer Meinung?«, fragte Thomas Handel und zielte mit dem Queue auf eine Kugel. »Der Mann darf tun, was ihm beliebt?«
Alexander schnaubte. »Ich glaube nicht, dass wir einer Meinung sind. Sie finden, es geht nur ihn etwas an, aber ich tue das nicht. Schließlich gibt es noch so etwas wie Pflicht.«
»Freut mich zu hören«, sagte ein älterer Mann und stützte sich auf sein Queue. »Der Großteil von euch jungen Leuten glaubt doch gar nicht mehr daran. Ihr denkt, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt, und auf die Folgen wird gepfiffen. Aber die Pflicht ist genau das, worum sich alles dreht. In dem Punkt bin ich Ihrer Meinung, Sir.«
»Es wird ohnehin nichts dabei herauskommen«, sagte Thomas. »Sie werden sehen, dass ich recht behalte. Vor ein, zwei Jahren gab es schon mal eine Frau. Wie hieß sie noch gleich?«
»Früher haben wir an die Pflicht geglaubt«, sagte der Ältere und verlor sich in Gedanken und verschwommenen Erinnerungen.
»Diese Frau war eine Eintagsfliege. Doch wenn man seinerzeit nach den Klatschspalten ging, konnte man jeden Augenblick mit einer Verlobung rechnen.«
»Wenn man mich fragt«, warf der älteste Mann im Raum dröhnend ein, ein ehemaliger Innenminister, dessen Stimme mehr Gewicht als die der anderen Anwesenden hatte, sodass diese jetzt verstummten. Selbst der Spieler, der sich zum Anstoß bereit gemacht hatte, verharrte und wartete auf die kommende Perle der Weisheit. »Der ganze Kram ist doch nur ein Haufen Unfug, den sich Burschen wie Beaverbrook zum allgemeinen Ergötzen ausgedacht haben. Er soll einfach das tun, was seine Vorfahren schon seit ewigen Zeiten getan haben, nämlich heiraten und sich eine Geliebte nehmen, wie jeder andere ordentliche Mann auch. Eine ehrbare, handfeste Hure.«
»Als Schönheit kann man sie ja nicht gerade bezeichnen, oder, Sir?«, fragte Alexander, dessen Mundwinkel der Hauch eines Lächelns umspielte.
»Wie ich gehört habe«, entgegnete der Alte ernst, »soll Liebe blind machen.« Doch dann hob er eine Braue, zum Zeichen, dass er seinen Ausspruch für humorvoll hielt, einer, der ihn überleben und eines Tages bei seiner eigenen Beerdigung wiederholt werden könnte. »Falls das zutrifft, muss man wohl annehmen, dass der König eine Brille braucht.«
»Eine Eintagsfliege«, wiederholte einer der Jüngeren, schüttelte den Kopf und lachte. »Das gefällt mir.«
»Das wird auch jetzt wieder passieren, verlassen Sie sich darauf. Nächste Woche wird es das nächste Flittchen geben. Die Frau eines anderen, die Tochter eines anderen oder wieder eine Geschiedene.«
»Wo bleibt das verfluchte Mädchen mit dem verdammten Brandy?«, wollte der frühere Innenminister wissen, dessen Alkoholpegel gefährlich zu sinken begann.
»Hier bin ich«, sagte das verfluchte Mädchen, eine gerade mal Neunzehnjährige, die mit dem verdammten Tablett die ganze Zeit neben ihm gestanden hatte.
Sir Denis Tandy war allein in der Bibliothek und fuhr mit den Fingern anerkennend an den Rücken der in Leder gebundenen Bände des Gesamtwerks von Dickens entlang. Im Raum herrschte eine bemerkenswerte Ordnung. Die Regale an den Wänden waren aus Mahagoni, jedes mit einem Dutzend Reihen und einer Leiter versehen, die oben an einer Schiene hing, sodass der eifrige Leser auf der Suche nach Wissen und Unterhaltung über sich hinauswachsen konnte. Die Bücher waren sämtlich in Kategorien unterteilt, die Geschichte Londons an der Wand zur Linken beanspruchte für sich allein nahezu sechs Reihen. Inmitten des Raumes stand ein schwerer Lesetisch aus Eiche mit Lampen an den Seiten. In dem Fach darunter befanden sich gebundene Folianten, die Karten enthielten, einige mit Hinweisen auf die zahlreichen Grundstücke, mitunter ganze Straßenzüge, die sich im Besitz der Familie Montignac befanden. Ein so ungeheurer Wert, dass man das jährliche Einkommen daraus nur mit Mühe genauer beziffern konnte.
Sir Denis hatte Peter fast vierzig Jahre lang gekannt. Aus seiner Rolle als Anwalt war allmählich die eines engen Freundes geworden, in Peters mittleren Jahren dann die eines Vertrauten. In den letzten Jahren, als der alte Mann mutlos und verdrießlich geworden war, hatte Tandy wieder die Position eines Sachwalters und Angestellten eingenommen. Schuld daran war der Tod von Andrew, Peters einzigem Sohn. Selbst diejenigen, die den älteren Montignac nur flüchtig kannten, wussten, dass er diese Tragödie nie verwunden hatte. Es war ein Unfall mit der Schusswaffe gewesen, bei dem der Junge im Alter von achtzehn Jahren umgekommen war, doch keine der späteren Erklärungen hatten den Vater jemals zufriedenstellen können. Andrew sei ein erfahrener Schütze gewesen, betonte Peter jedes Mal, wenn das Thema aufkam. Er habe gewusst, wie man ein Gewehr reinigte. Ein verhängnisvoller Fehler seinerseits sei eine geradezu lächerliche Hypothese.
Es hatte Zeiten gegeben, in denen die Beziehung zwischen Anwalt und Mandant von Streitigkeiten geprägt worden war, trotzdem wusste Sir Denis, dass Peter ihm fehlen würde, dessen Unberechenbarkeit und Charme, die Wutanfälle und das Gift, das er bei seinen Feinden versprühen konnte. Peter Montignac war ein Mann der Extreme gewesen. Seinen Freunden gegenüber konnte er unverbrüchliche Treue zeigen, doch wenn jemand diese Freundschaft verriet, war er bereit, bittere Rache zu üben. Sir Denis hatte Peter gut genug gekannt, um jetzt zufrieden festzustellen, dass er es größtenteils geschafft hatte, dem Mann nicht in die Quere zu kommen.
Als er nach dem Begräbnis in Leyville ankam, hatte er die erste halbe Stunde mit der Suche nach Owen Montignac verbracht, um mit ihm die passende Zeit zur Verlesung des Testaments abzusprechen, doch Peters junger Neffe war nirgends zu entdecken. Trotzdem musste er mit den anderen zurückgekehrt sein, denn das unverkennbar weiße Haar war Sir Denis aufgefallen, als Owen vor dem Haus aus dem ersten Wagen stieg. Doch seitdem war er nicht mehr in Erscheinung getreten, was Sir Denis als taktlos empfand. Trauer war natürlich Trauer, doch die sollte privat bleiben und nicht zutage treten, wenn man das Haus voller Gäste hatte. Und was diese Lobrede betraf, diesen Ausbruch der Gefühle – Peter dürfte sich dabei im Grab umgedreht haben.
Die Verlesung des Testaments wollte Sir Denis so bald wie möglich hinter sich bringen. Zuvor würde er sich mit einigen steifen Brandys stärken, denn dass dieser Akt einen schönen Ausgang nehmen würde, konnte er sich nicht vorstellen. Er warf einen Blick auf seine Uhr. Falls Owen Montignac in der nächsten halben Stunde nicht auftauchte, würde er sich an Stella wenden. Auch sie hatte sich tagsüber im Hintergrund gehalten, doch mit ihrer Trauer ging sie weitaus würdevoller um als ihr Cousin, obwohl sie das leibliche Kind des Toten war.
Hier in Leyville hatten er und Peter vor vielen Jahren das ursprüngliche Testament entworfen. Damals gingen sämtliche Gelder und Zinseinnahmen an Peters inzwischen verstorbene Ehefrau Ann. Hier in diesem Haus war das Testament dann zugunsten seines Sohnes geändert worden, nur wenige Stunden nach Andrews Geburt. Hier war der Nachtrag entstanden, der die Zuwendungen für Stella und Owen festlegte, und schließlich war hier auch das Testament nach Andrews Tod erneut geändert worden.
Sir Denis sah der Testamentseröffnung mit gemischten Gefühlen entgegen. Er fragte sich, wie die Angehörigen angesichts der Nachricht reagieren würden. Aber womöglich wären sie nicht einmal überrascht, trotz des Traditionsbewusstseins der Familie, vielleicht rechneten sie sogar mit einem letzten spontanen Entschluss seitens des verstorbenen Patriarchen. Absehen ließen sich die Reaktionen nicht. Sir Denis konnte sie nicht einmal erahnen, denn die Montignacs waren eine eigenartige Familie, mit einer Neigung zu unvorhersehbarem und launenhaftem Verhalten.
4
Vorsichtig hielt Roderick Bentley das Tablett in den Händen, öffnete die Tür zum Schlafzimmer, trat hinein und achtete darauf, die sorgsam ausbalancierten Gegenstände nicht auf den Teppich fallen zu lassen. Jane war bereits wach, döste jedoch noch ein wenig. Als sie ihren Mann sah, setzte sie sich auf und lächelte ihn verschlafen an.
»Liebling«, sagte sie, »was für ein perfekter Diener du bist.«
Roderick lächelte und stand wie ein wohlerzogener Butler vor ihr. Sie richtete die Kissen in ihrem Rücken und setzte das Tablett behutsam auf ihrem Schoß ab.
»Frühstück, Madam«, verkündete er in dem affektierten Tonfall eines Butlers. Jane schmunzelte, hob die Glocke über dem Teller hoch und enthüllte eine Portion Rührei, Schinkenspeck und Würstchen.
»Rührei«, stellte sie stirnrunzelnd fest. »Darüber muss ich mit Nell reden. Rühreier haben etwas von den Zwanzigerjahren, findest du nicht? Aber aus irgendeinem unerklärlichen Grund weigert sie sich, die Eier zu pochieren.«
»Ich fürchte, was die Eiermode betrifft, bin ich nicht auf dem Laufenden.« Roderick ließ sich in dem Sessel am Fenster nieder. Seine Frau butterte eine Scheibe Toast.
»Du hättest eine zweite Tasse mitbringen sollen«, sagte sie und schenkte sich Tee ein. »Der Tee in der Kanne reicht für zwei.«
»Ich möchte nichts mehr«, entgegnete er mit einer abwehrenden Kopfbewegung. »Um fünf Uhr bin ich aufgestanden, und seitdem habe ich fortwährend dieses Zeug getrunken. Jetzt ist Schluss. Ich will mich im Gerichtssaal nicht ständig entschuldigen müssen.«
»Um fünf?« Jane wandte sich zu ihm um und sah ihn verwundert an. »Warum, um alles in der Welt –?«
»Ich konnte nicht schlafen. Wenn der Tag heute vorbei ist, geht es mir wieder besser.«
»Du siehst müde aus«, bemerkte Jane nach einer Pause. Über ihr Gesicht flog ein angemessener Ausdruck des Mitgefühls. »Armer Roderick. Es hat dich tatsächlich angegriffen, nicht wahr?«
Die gedämpften Laute eines Tumults waren von der Straße her zu hören. Roderick stand auf, schob die Vorhänge einen Spalt weit auseinander und spähte nach unten.
»Herrgott noch mal«, stieß er entnervt hervor.
»Was ist?«, fragte Jane. »Was ist da unten los?«
»Sieht aus wie zwei Reporter, die um den besten Platz auf dem Bürgersteig rangeln. Die anderen feuern sie an.« Roderick zog die Vorhänge wieder zu. »Wahrscheinlich schließen sie sogar Wetten ab, diese verdammten Parasiten. Vielleicht schlagen sie einander ja k. o.«
»Wenn das alles vorbei ist, werden unsere Nachbarn nicht gerade traurig sein«, sagte Jane. »Catherine Jones hat mich gestern angerufen und wollte wissen, wann du dein Urteil verkündest.«
»Und was hast du ihr gesagt?«
»Dass du zu Hause nie über deine Prozesse sprichst. Dass es so etwas wie richterliche Integrität gibt. Na ja, ganz so geschwollen habe ich es nicht ausgedrückt, aber ich glaube, sie hat es begriffen.«
»Braves Mädchen«, sagte Bentley mit beifälligem Nicken. »Du hast das Richtige getan.«
»Roderick?«
»Ja?«
»Du sprichst doch heute das Urteil, oder?«
Roderick ließ sich die Frage durch den Kopf gehen, nagte an seiner Oberlippe und atmete schwer. In einem Punkt hatte Jane recht, er sprach zu Hause nicht über seine Prozesse. Andererseits hatte er in seinen fünfzehn Jahren als Richter noch nie einer Verhandlung vorgesessen, die zu einem derartigen Aufsehen und öffentlichen Interesse geführt hatte, oder einen Fall gehabt, der dieses Maß an Schwierigkeiten und – für seine Familie – an Belästigungen seitens der Presse verursacht hatte. Und für seine Nachbarn. Er kam zu dem Schluss, dass er diesmal, aber nur dieses eine Mal, einen kleinen Regelverstoß wagen konnte, ohne seiner Integrität dadurch allzu sehr zu schaden.
»Ja«, gab er schließlich zu, »ja, heute Abend wird alles vorüber sein. Da kannst du dir ganz sicher sein.«
»Und wie wird es lauten?«, fragte Jane so beiläufig wie möglich. Dabei schaute sie nicht in seine Richtung und, um ihr mangelndes Interesse zu unterstreichen, gab sie ein wenig von dem anstößigen Rührei auf ihre Scheibe Toast. »Leben oder Tod?«
»Jane«, sagte Roderick mit leisem Lächeln angesichts der Methoden, die seine Frau anwandte, um ihn zu einer Antwort zu verleiten. Mit den Jahren hatte er sich an ihre Tricks gewöhnt und tappte ihr nur selten in die Falle. »Du weißt, dass ich dir das nicht verraten kann.«
»Liebe Güte«, sagte sie, als ginge es um eine triviale Angelegenheit, die ihr die Zeit kaum wert war, »in wenigen Stunden wirst du es ohnehin der ganzen Welt verkünden. Also kannst du es mir auch jetzt sagen, oder? Ich werde es niemandem vorzeitig weitererzählen, das verspreche ich dir.«
An der Tür wurde höflich geklopft. Jane runzelte die Stirn und rief, man solle eintreten. Sophie, das Mädchen für alles, kam herein und brachte die Morgenausgabe der Times, die gerade geliefert worden war.
»Danke, Sophie«, sagte Jane, »leg sie einfach da aufs Bett, ja? Und würdest du mir bitte das Bad einlassen. Ich stehe gleich auf.«
»Schon, Ma’am?«, fragte Sophie verblüfft, denn für gewöhnlich blieb ihre Herrin noch etwas länger im Bett, ehe sie sich erhob und der profanen Welt gegenübertrat.
»Ja. Heute Morgen werde ich den Richter zum Old Bailey begleiten, deshalb beeilen wir uns ein bisschen.«
»Jawohl, Ma’am.« Sophie stürzte aus dem Raum und lief hinauf zum Badezimmer.
»Du kommst mit zum Gericht?«, fragte Roderick, als sie wieder allein waren. »Du willst bei dem Urteilsspruch dabei sein?«
»Das habe ich gestern Abend beschlossen«, erwiderte Jane. »Du glaubst doch nicht, das ließe ich mir entgehen, oder? Ich werde dir ein wenig Beistand leisten. Damit du weißt, dass du in diesem kalten Gerichtssaal nicht allein bist. Außerdem wird jeder da sein.«
»Es wird aber nicht jeder eingelassen«, entgegnete Roderick gereizt. »Es gibt gar nicht genügend Platz für jeden.«
»Für die Ehefrau des Richters dürfte es ja wohl einen Platz geben.« Jane stellte ihr Tablett mit dem Rest des Frühstücks zur Seite. »Wie spät ist es überhaupt?«
»Zehn nach neun«, antwortete Roderick und wusste nicht, ob der Gedanke an seine Frau im Gerichtssaal ihm schmeicheln oder ihn nervös machen sollte. Sie zog die Aufmerksamkeit der Reporter auf sich und schien es zu genießen, wenn sie deren Fragen wie ein geübter Kricketspieler parierte.
»O je«, sagte sie, »ich muss mich beeilen. Wann brichst du auf? Gegen zehn?«
»Ja.«
»Aber nicht ohne mich«, betonte sie.
Roderick nickte und sah zu, wie seine Frau das Bett verließ, an den Kleiderschrank trat und ihren Morgenmantel hervorholte. Selbst jetzt, nach all den Jahren, konnte er den Blick nur schwer von ihr abwenden. Nicht nur deshalb, weil er damals, als sie sich kennenlernten, in puncto Frauen unerfahren gewesen war, oder weil sie ihm für mehr als zweieinhalb Jahrzehnte das sinnliche Leben geboten hatte, das er sich zuvor nie als Teil seines Daseins hätte erträumen können; sondern auch, weil sie die Art von Frau war, die mit den Jahren immer attraktiver wurde und ihm jedem Tag neues Glück bescherte. Bei dem Gedanken, an ihrer Seite zu sein, mit ihr zusammen das Gerichtsgebäude Old Bailey zu betreten, fühlte er sich wie ein junger Mann, der seine erste Liebe erlebt. Alles an ihr beflügelte ihn. Er liebte sie.
In jungen Jahren war Janes Haar ein hübsches Blond gewesen. Jetzt in ihren Vierzigern war der Glanz ein wenig verblasst, doch dadurch schien sie nur noch erfahrener, vielschichtiger, attraktiver. Vor Kurzem hatte sie ihr langes Haar auf Schulterlänge schneiden lassen, ein mutiger Entschluss, der Wunder gewirkt hatte. Dennoch gehörte Jane Bentley nicht zu den Frauen, die vorhatten, ihr Alter zu kaschieren. Er wusste, dass sie jetzt ebenso sinnlich wie in den Zwanzigern oder Dreißigern sein konnte, sogar noch mehr, wenn sie es wollte. Ihre aristokratische Haltung hatte sie über die Jahre perfektioniert, und dumme Menschen waren ihr zuwider.
»Was ist?«, fragte sie, drehte sich um und erkannte, dass ihr Mann sie anstarrte. »Was hast du?«
»Nichts«, erwiderte Roderick kopfschüttelnd. »Du bist eine schöne Frau, Jane. Ist dir das bewusst?«
Sie öffnete den Mund, wollte eine witzige Bemerkung machen, doch dann sah sie, dass es ihm ernst war.
Ein Gefühl der Zuneigung durchflutete sie, eine aufschießende Welle der Wertschätzung. Damals, vor all den Jahren, hatte sie gut gewählt, gar keine Frage. Was wäre, wenn sie einen netten, anständigen Mann, den sie nicht liebte, geheiratet hätte, oder – zunehmend elend – die ledige Tochter einer Familie geblieben wäre, deren Tage des Wohlstands längst vergangen waren? Nein, sie hatte keine großen Schwierigkeiten gehabt, ihre Entscheidung zu treffen. Und auf seine Bemerkung musste sie tatsächlich keine Antwort geben. Es war ein aufrichtiges Kompliment gewesen, und sie entschied, es als solches entgegenzunehmen.
Als sie am Bett vorbeikam, nahm sie die Times auf, warf einen Blick auf die Schlagzeile und hielt sie ihrem Mann hin, der die Augen schloss.
»Morgen wird der Fisch damit verpackt«, sagte er.
»Heute königliches Urteil«, las sie vor. »Von Bentley wird Nachsichterwartet.«
Roderick schüttelte den Kopf. »Bitte nicht.«
»Ein königliches Urteil – in der Tat«, bemerkte sie. »Der Junge und der König sind Cousins dritten Grades. Trotzdem ist er keiner der direkten Nachfolger. Unter solchen Voraussetzungen könnten wir uns wahrscheinlich alle königlich nennen.«
»So sind die Zeitungen.« Roderick war bei seinem Lieblingsthema angelangt. »Sie bauschen alles auf. Auf die Weise hat der Fall ihre Auflage in die Höhe getrieben. Ich sollte so was wie Prozente bekommen.«
»Trotzdem«, sagte Jane. »Oh, sieh mal, hier ist sogar ein ganz gutes Bild von ihm. Das ist ungewöhnlich. Eigentlich gar kein so übel aussehender Bursche, sofern man ihn im rechten Licht betrachtet. Obwohl mir die Kieferpartie der Hannoveraner noch nie gefallen hat. Mir scheint, keiner von ihnen hat ein Kinn.«
»Jane«, sagte Roderick, »der Mann wurde wegen des Mordes an einem Polizisten angeklagt, nicht aufgrund der ästhetischen Mängel seines Aussehens.«
»Es ist trotzdem traurig, oder?«, fragte sie. »Er ist erst so alt wie Gareth. Wenn dann der Rest des Lebens …« Sie taxierte ihren Mann, dessen Miene nichts verriet. »Es ist bedauerlich, ganz gleich, was mit ihm geschieht oder wie das Urteil ausfällt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie seine Mutter sich fühlen muss, wie ich mich fühlen würde, wäre unser Sohn in so einer Lage. Ich weiß, dass es ein furchtbares Klischee ist, aber in so einem Fall kann man gar nicht anders, als den Eltern die Schuld zu geben. Sie müssen ihm ein schlechtes Vorbild gewesen sein.«
»Unser Sohn würde nie in derartige Schwierigkeiten geraten«, betonte Roderick. »Trotzdem spielt es keine Rolle, wer der Angeklagte ist. Gesetz ist Gesetz. Ob man des Königs Cousin dritten Grades ist oder der jüngste und unehelichste Sohn eines Fischhändlers aus Cockfosters. Gesetz ist Gesetz«, wiederholte er.
Jane nickte und warf die Zeitung wieder aufs Bett. »Die lese ich im Auto«, erklärte sie. »Jetzt wird es Zeit für mein Bad. Man kann übrigens nicht der Unehelichste sein«, fügte sie hinzu, denn in puncto Grammatik nahm sie es gern genau. »Da gibt es keine Superlative. Man ist entweder ein Bastard oder nicht.«
Roderick quittierte den Einwand mit einem Schulterzucken, sah ihr nach, als sie den Raum verließ, blieb jedoch sitzen, bis er ihre Schritte auf der Treppe hinauf zum Bad im dritten Stock hörte. Erst da stand er auf, trat ans Bett und nahm – wider besseres Wissen – die Zeitung auf. Zwar wollte er den Artikel nicht lesen, denn über den Fall konnte kein Reporter ihm etwas berichten, das er nicht schon wusste, aber er wollte sich das Bild ansehen.
Seit fast sechs Monaten hatte dieser junge Mann ihm auf der Anklagebank gegenübergesessen, anfangs mit hochmütig abweisender Miene, gegen Ende mit einem Ausdruck des Entsetzens, doch dazwischen hatte sich auf seinem Gesicht die ganze Bandbreite der Gefühle abgespielt. Der Zeitungsfotograf hatte ihn erwischt, als er in den Polizeiwagen verfrachtet wurde. Da war er mit Handschellen an einen Polizisten mittleren Alters gekettet und wirkte bestürzt, als könne er nicht glauben, dass sich das ganze Drama tatsächlich dem Ende zuneigte und sich der Vorhang über etwas senken würde, das er bisher schlimmstenfalls für ein unangenehmes Zwischenspiel gehalten hatte. Und dass er zu guter Letzt des Mordes für schuldig befunden worden war und den Rest seines Lebens entweder im Zuchthaus verbringen oder getötet werden würde. Er wirkte jünger als dreiundzwanzig Jahre, beinah wie ein kleiner Junge, der bei etwas Verbotenem ertappt worden war. Im Grunde wirkte er panisch.
Roderick warf die Zeitung aufs Bett und ärgerte sich über seinen Unverstand, der ihn dazu gebracht hatte, sie überhaupt anzusehen.
»Für alle gilt dasselbe Gesetz«, murmelte er verbissen. »Bettler oder Könige. Gleiches Recht für alle.«
5
Margaret Richmond betrat die Küche, um nach den Dienstboten zu sehen. Seit den fast dreißig Jahren, die sie für die Montignacs arbeitete, hatte sich einiges geändert, doch heute gab es noch einmal einen jener seltenen Anlässe, bei denen das Personal vollständig war, auch wenn die meisten von ihnen nur für diesen Tag engagiert worden waren. Als Andrew, Stella und Owen noch Kinder waren, waren solche Leute in Leyville fest angestellt gewesen: ein Butler, zwei Lakaien, ein Gärtner, eine Köchin, ein Mädchen für oben, ein zweites für unten und ein drittes für den Rest. Und natürlich Margaret selbst, die sich um die Kinder kümmerte und die Dienstmädchen überwachte. Mit dem Butler hatte sie sich verstanden. Er hatte den Gärtner und die Lakaien beaufsichtigt, die wie die Jahreszeiten gekommen und gegangen waren.
Aber diese Zeiten waren vorüber. Nach dem Tod von Ann Montignac vor sechs Jahren hatte Peter die Hälfte von ihnen entlassen.
»Diese herumlungernden Leute brauchen wir nicht«, hatte er erklärt. »Ich komme allein zurecht, und Stella und Owen sind auch keine Kinder mehr. Sie können zur Abwechslung ruhig mal für sich selbst sorgen. Sie müssen für die beiden nicht mehr die Kinderfrau spielen.«
Inzwischen gab es nur noch eine Halbtagsköchin und ein Dienstmädchen, aber keinen Butler und keine Lakaien mehr. Zum Putzen und Staubwischen kamen täglich ein paar junge Mädchen aus der Umgebung. Margarets Rolle war unklar geworden. Sie lebte in der Hoffnung, dass Stella oder Owen heiraten und in Leyville bleiben würden. Und wenn sie dann Kinder hätten und eine Kinderfrau brauchten, würde die natürliche Wahl auf sie, Margaret, fallen. Schließlich war sie gerade erst sechzig Jahre alt geworden und hatte noch immer eine Menge zu bieten. Nur gab es nicht das geringste Anzeichen, dass es dazu kommen würde. Stella war seit über einem Jahr mit Raymond Davis liiert, und vor einigen Monaten hatten die beiden ihre Verlobung bekannt gegeben, aber Hinweise, dass daraus eine Ehe wurde, waren nicht zu erkennen. Margaret hatte den Verdacht, dass es sich um eine jener sich hinziehenden Verbindungen handelte, die junge Leute heutzutage schätzten, und es statt des Brautkranzes eines Tages eine Trennung geben würde. Und Owens Privatleben war ihr ein absolutes Rätsel. In der Zwischenzeit führte sie den Haushalt so gut sie konnte. Für die Trauerfeier hatte sie eine Gruppe junger Frauen und Männer aus dem Ort angeheuert. Owen und Stella schienen damit zufrieden gewesen zu sein.
In der Küche standen drei der Aushilfen in einer Ecke, schwatzten miteinander und rauchten. »Vielleicht schauen Sie noch einmal nach den Gästen«, sagte Margaret mit fester Stimme, »statt hier herumzustehen.« Die drei starrten sie verständnislos an, drückten ihre Zigaretten aus und kehrten zu den Trauergästen zurück. Margaret atmete auf. Ein Streit war das Letzte, was sie wollte. Nicht an einem Tag wie diesem. Aber Dienstmädchen musste man im Auge behalten, da gab es kein Vertun. Ein einziges Mal hatte sie es versäumt, und was waren daraus für Probleme entstanden.
Sie trat wieder hinaus auf den Gang und überlegte, ob sie sich zu der Gruppe im Salon gesellen sollte, wusste jedoch, dass sie sich unter den noblen Herrschaften fehl am Platz fühlen würde. Vollkommen reglos stand sie da und rang nervös die Hände.
An Peter Montignac wollte sie nicht denken, denn wenn sie das tat, müsste sie an Ann denken, die nicht nur ihre Arbeitgeberin, sondern auch ihre beste Freundin gewesen war. Und wenn sie an Ann dächte, würde sie an Andrew denken, den sie wie einen eigenen Sohn geliebt hatte. Hier gab es ein Übermaß an Tod, erkannte sie und wünschte, sie könnte die Bilder der Verstorbenen aus ihrem Kopf vertreiben. Sie herbeizurufen, würde zu Tränen führen, und vor dem Aufbruch der Gäste wollte sie nicht mehr weinen. Sie ging die Treppe hinauf, verharrte vor Owens Tür und beugte sich vor, um zu hören, ob er in seinem Zimmer war oder nicht. Vor einer kleinen Weile hatte sie ihn durch die Eingangstür kommen sehen, doch er war auf geradem Weg nach oben gelaufen, hatte zwei Stufen auf einmal genommen, und seitdem hatte ihn niemand mehr zu Gesicht bekommen. Sie klopfte sacht an die Tür.
»Owen«, sagte sie leise, »Owen, bist du da?«
Keine Antwort.
»Owen? Wie fühlst du dich?«
Von innen kam ein gedämpfter Laut, ein Hüsteln, gefolgt von einem verhaltenen »gut«, ein Wort, das wie ein Rauchfaden durchs Schlüsselloch schwebte.
»Magst du nicht herunterkommen?«, fragte Margaret. »Die Gäste …« Ihre Stimme verebbte. Sie wusste nicht, was mit den Gästen war. Sie tranken und aßen, auch die Männer, die sich vergessen hatten und während einer Trauerfeier Billard spielten. Jeder schien zufrieden. Aber wie auch nicht, die Leute liebten Beerdigungen.
»Danke, Margaret«, erklang es aus dem Zimmer.
Ein Dank, der gleichzeitig bedeutete, dass sie gehen konnte. Margaret nickte und machte kehrt. Auf der halben Treppe blieb sie stehen, ordnete ein Blumengesteck auf der Fensterbank und nutzte die Zeit, um zu entscheiden, was sie tun oder wohin sie gehen sollte. An diesem Tag war sie auf ihren Owen stolz gewesen, stolzer als in den letzten zehn Jahren, als ihre Liebe für ihn abrupt ins Gegenteil umgeschlagen war. Seine Worte in der Kirche hatten sie überrascht und bewegt. Hatte es jemals einen Jungen gegeben, der seinen Onkel dermaßen geliebt hatte? Diesen Jungen, den ich aufgezogen habe, ging es ihr durch den Sinn. Der mir ebenso wie ihnen gehört. DiesenJungen, den ich gerettet habe. Wieder verharrte sie reglos, den Blick in die ferne Vergangenheit gerichtet, auf die Kinder, die Bilder, die mit Fingerfarben gemalt worden waren, die Umarmungen, ihre Kleinen.
Eine Dame, bei deren Ehemann es sich um den früheren Innenminister im Billardzimmer handelte, kam aus dem Salon, streckte eine Hand im Samthandschuh aus und tippte Margaret mit der Fingerspitze auf den Arm, als dächte sie, Dienstboten könnten verseucht sein, sodass man sich ihnen besser mit Vorsicht näherte.
»Miss Richmond, oder?«, fragte sie.
»Ja, Ma’am.«
»Könnte es sein, dass eine frische Kanne Tee zu viel Mühe macht? Ich habe eines dieser jungen Mädchen darum gebeten. Sie hat durch mich hindurchgesehen, als wäre ich das Lästige in Person.«
»Kommt sofort, Ma’am«, entgegnete Margaret, die froh war, wieder eine Aufgabe zu haben, froh, gebraucht zu werden. »Für das Mädchen bitte ich um Entschuldigung. Ich erledige das sofort.«
In dem kleinen Zimmer rechts von der Küche saß Annie, die Köchin, und ruhte sich aus. Der Großteil der Speisen war am Vorabend vorbereitet und die frischen Sandwiches am Morgen hergerichtet worden, deshalb hatte sie im Moment kaum etwas zu tun, außer darauf zu warten, dass die Gäste aufbrachen und sie den Aushilfen erklären konnte, wo sauber gemacht werden musste. Obwohl Margaret Richmond sich wahrscheinlich auch darum kümmern würde. Annies Nichte Millie, ein Mädchen aus dem Ort, kam und brachte ihr eine Tasse Tee. Millie gehörte zu den Aushilfen, die nur für diesen Tag engagiert worden waren, hoffte jedoch, daraus würde etwas Festeres werden.
»Tut mir leid, mein Mädchen«, sagte Annie kopfschüttelnd. »Aber die Aussichten stehen schlecht. Offen gestanden glaube ich nicht, dass ich mich hier selbst noch für längere Zeit halte.«
»Aber du bist doch schon seit Jahren hier«, erwiderte Millie.
»Erst seit acht Jahren. Für eine alte Familie wie die Montignacs ist das nicht mehr als ein Tag. Ab sofort wohnen hier nur noch zwei von ihnen, und wozu sollten die eine Köchin brauchen? Dieser Owen hält sich kaum noch hier auf, sondern treibt sich ständig in London herum, weiß der Himmel, was er dort macht. Und Stella –« Annie verdrehte die Augen. Seit ihre Arme schwammig geworden waren und ihre Taille verschwunden war, missbilligte sie junge Frauen. »Stella benimmt sich nicht besser als unbedingt nötig. Wenn ich demnächst meine Papiere bekäme, würde es mich nicht wundern.«
Millie runzelte die Stirn. Demnach würde sie woanders nach einer Stelle suchen müssen, zu einer Zeit, in der es kaum nennenswerte Alternativen gab. »Wie war er überhaupt?«, erkundigte sie sich und ließ sich auf einem Stuhl neben ihrer Tante nieder.
»Wer?«
»Mr Montignac. Der heute begraben wurde.«
Annie zuckte mit den Schultern. »Eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe jedenfalls schon Schlimmere erlebt. Weder sehr freundlich noch bewusst unhöflich. Es hieß immer, früher sei er ganz anders gewesen, ehe sein Sohn starb. Sein einziger Sohn, muss man dazu sagen, denn dieser Owen ist ja nicht von ihm. Im Grunde kannte ich ihn nicht gut genug, um ihn richtig beschreiben zu können. Nur die Art, wie er gestorben ist, die war ein Schock.«
»Wieso?«
»Weil man nie den Eindruck hatte, dass er auf der Schwelle des Todes stand. Natürlich hatte er Probleme. Das Herz, der Magen – überhaupt jede erdenkliche Krankheit, wie es manchmal schien. Diesem Arzt da hat er jedenfalls reichlich zu tun gegeben. Allerdings hat er gegessen, als gäbe es demnächst nichts mehr, und das Fleisch musste immer so roh sein, dass man dachte, jeder halbwegs fähige Tierarzt könnte es wieder zum Leben erwecken. Und dann war wie aus heiterem Himmel Schluss.« Zur Betonung schnipste Annie mit den Fingern. »Tot.«
»So ein großes Haus für zwei Personen. Kommt mir wie eine Schande vor.« Für einen Moment fragte sich Millie, wie es wohl wäre, die Herrin eines solchen Hauses zu sein. Sie dachte an Owen Montignac, der ihr aufgefallen war, als er von dem Begräbnis zurückkehrte. Sie hatte ihn angestarrt, ihm wie gebannt nachgeschaut, als er die Treppe zu seinem Zimmer hinauflief. Ihr Herz hatte schneller geschlagen, denn er war außergewöhnlich schön, doch sein Gesicht hatte schmerzerfüllt gewirkt. Noch nie hatte sie einen jungen Mann mit derart weißem Haar oder solch bestechend blauen Augen gesehen.
»Sein Vater war wie er«, sagte Annie. »Hat eine Französin geheiratet. Ausgerechnet.«
»Er sieht sehr gut aus«, sagte Millie versonnen.
»Darauf würde ich nicht viel geben.«
»Nicht wie die meisten anderen hier in der Gegend.«
»Alles wird anders«, klagte Annie. »Heute wohnt kaum noch jemand in solchen Häusern. Die meisten können sich das nicht mehr leisten. Die Kosten sind zu hoch. Jetzt leben alle in London, in Stadthäusern und schicken Wohnungen. Die Landsitze bleiben das ganze Jahr geschlossen. Die meisten davon dienen nur noch Repräsentationszwecken.«
»Und Mr Montignac? Hat er das auch vor?«
»Woher soll ich das wissen.« Annie lachte und sog an ihrer Zigarette. »Denkst du, er weiht Leute wie mich in seine Pläne ein? In dem Punkt ist er wie sein Vater. Ich meine, wie sein Onkel. Das Personal interessiert ihn nicht, vielleicht mit Ausnahme von Margaret Richmond. Aber sie hat ihn ja praktisch aufgezogen, schon ab dem Tag, als er hier erschienen ist.«
In dem Augenblick kam die Besagte durch die Tür. Milly sprang auf. Annie, die sich weigerte, Mrs Richmonds Autorität anzuerkennen, rührte sich nicht vom Fleck.
»Annie, ich werde nach dem Tee gefragt«, sagte Margaret müde.
»Nach welchem Tee?«
»Nach dem fehlenden Tee.«
Annie blieb noch einen Moment sitzen. Dann stemmte sie sich hoch, mühsam, als hätte sie ein Gewicht zu tragen, für das sie kaum genügend Kraft besaß. Ohne Margaret anzusehen, ging sie an ihr vorbei in die Küche, wo sie den anderen kurze, scharfe Befehle erteilte.
»Und du? Mildred, oder?«, fragte Margaret.
»Millie, Ma’am.«
»Auch gut. Vielleicht siehst du einmal nach den Herren im Billardzimmer. Sie werden etwas brauchen, obwohl ich nicht finde, dass man an einem Tag wie diesem Spiele machen sollte.«
»Jawohl, Ma’am.« Millie war feuerrot angelaufen und rannte hinaus.
Verstimmt sah Margaret sich in dem leeren Raum um und ärgerte sich, weil alles ihr überlassen blieb. Es wäre um einiges leichter, wenn Stella und Owen sich ein wenig um die Gäste bemühen und sich für deren Erscheinen bedanken würden.
6
Leonard fuhr den Wagen zum Eingang des Hauses am Tavistock Square und drosselte das Tempo, um keinen der herumlungernden Reporter umzufahren, obwohl er genau das gern getan hätte. Einige von ihnen klopften ans Seitenfenster, riefen ihm durch die Glasscheibe Fragen zu, aber dabei handelte es sich um diejenigen mit der geringsten Erfahrung. Der Rest wusste, dass der Chauffeur ihnen nichts mitteilen würde, nicht einmal etwas Interessantes mitzuteilen hätte.
»Bist du so weit?«, fragte Roderick seine Frau. Jane begutachtete sich ein letztes Mal im Flurspiegel. Es war bereits Viertel nach zehn, und Roderick wollte unbedingt losfahren.
Jane nickte. »Ich bin soweit.«
»Und denk daran – kein Wort zu einem von denen da draußen«, mahnte Roderick und öffnete die Tür. An der Straße wurden sie von einem guten Dutzend Reporter empfangen, die Block und Bleistift zückten und sie mit Fragen bombardierten.
»Euer Ehren, werden Sie heute das Urteil verkünden?«
»Haben Sie mit dem Königshaus gesprochen?«
»Richter, wird es Leben oder Tod? Leben oder Tod? Wird er genau wie jeder andere behandelt?«
Zielstrebig und mit gesenktem Kopf steuerte Roderick den Wagen an. Leonard hatte die Tür des Fonds schon geöffnet und stand dort wie ein Wachsoldat. Jane tat, wie ihr geheißen, und sagte kein Wort, doch sie hielt den Kopf hoch und lächelte der Pressemeute zu. Fotografen waren nicht zugegen, was sie enttäuschte. Allerdings wusste sie, dass einige von ihnen am Old Bailey stehen würden. Und deshalb trug sie einen neuen Hut.
»Fahren Sie los, Leonard«, befahl Roderick, als sie sicher im Wagen saßen und die Türen geschlossen waren. »Wenn Sie wollen, können Sie auch losrasen.«
»Jawohl, Sir«, kam die Antwort vom Fahrersitz. Leonard legte den ersten Gang ein. Sie verließen den Platz und schlugen den Weg zum Justizpalast ein.
»Lange kann ich diese verdammten Zeitungsfritzen nicht mehr ertragen«, erklärte Roderick, doch während der Fahrt entspannte er sich ein wenig. »Was ist das nur für ein Beruf?«
»So etwas interessiert die Leute eben.« Jane zuckte mit den Schultern, als ginge es um die natürlichste Sache der Welt. »Daraus kannst du ihnen keinen Vorwurf machen. So sind die Menschen. Und es ist nun mal ihr Beruf.«
Bentley brummte irgendetwas und schaute aus dem Seitenfenster. Allmählich merkte man, dass der Sommer nahte. Die Bäume entlang der Southampton Row waren zum Leben erwacht. Hier und da sah man ein paar tapfere Seelen, die ihre Winterjacken gegen etwas Leichteres getauscht hatten. Für Juni war es ein ungewöhnlich warmer Morgen geworden.
»Roderick«, begann Jane wenig später, »hast du überhaupt einmal etwas von ihnen gehört?«
Diese eine Reporterfrage war ihr im Gedächtnis geblieben. Daran hatte sie in den vergangenen Monaten kein einziges Mal gedacht. Jetzt sann sie darüber nach.
»Von wem gehört?« Roderick wandte sich zu seiner Frau um.
»Dem Königshaus. Oder dem König. Hat er Kontakt zu dir aufgenommen?«
Roderick lachte auf. »Natürlich nicht. Du glaubst doch nicht im Ernst, der König würde aus persönlichem Interesse versuchen, ein Verfahren zu beeinflussen, oder?«
»Wenn, würde es mir nicht gefallen«, bekannte Jane. »Aber wundern würde es mich auch nicht. Er ist nicht ganz der Mann, der sein Vater war.«
»Darum geht es nicht«, entgegnete Roderick.
»Seit er den Thron bestiegen hat, sind wir nicht ein einziges Mal in den Buckingham-Palast eingeladen worden. Ist dir das auch aufgefallen?«
»In der Vergangenheit waren wir dort auch nicht gerade regelmäßige Gäste.«
»Das nicht«, räumte Jane ein, »aber wir wurden zum Gartenfest eingeladen. Das war 1932, weißt du noch? Als Königin Mary sich so reizend über meinen Hut geäußert hat.«
»Richtig«, sagte Roderick, der sich an das Fest erinnerte, jedoch nicht an das Kompliment und gewiss nicht an besagten Hut.
»Und als du zum Ritter geschlagen wurdest, fand eine Dinnerparty statt. Ramsay MacDonald war auch da.«
»Das sind zwei Mal«, sagte Roderick. »Zwei Einladungen in all den Jahren machen uns noch nicht zu Vertrauten der königlichen Familie.«
»Nein«, natürlich nicht«, erwiderte Jane, »aber ich fände es schön, auch zu anderen Anlässen eingeladen zu werden, du nicht? Der König gehört immerhin zu unserer Generation. Vielleicht würde ihm unsere Gesellschaft ja gefallen.«
»Vielleicht zu deiner Generation«, antwortete Roderick lachend. »Ich bin gut zehn Jahre älter als er.«
»Ach, die paar Jahre machen doch keinen Unterschied. Vielleicht sollten wir versuchen, zum nächsten Staatsdinner eingeladen zu werden. Aber wie stellt man so etwas an?«
»Keine Ahnung«, erwiderte Roderick, dem es zudem ziemlich einerlei war. Solche gesellschaftlichen Ereignisse interessierten ihn nicht.
»Wenigstens zu den Gartenpartys sollten wir regelmäßig eingeladen werden«, fuhr Jane fort. »Wenn wir uns mit ihm anfreunden, hätten wir die Möglichkeit, im nächsten Sommer zur Krönung eingeladen zu werden. Vielleicht sollte ich diese Simpson mal zum Nachmittagstee bitten. Hältst du das für machbar, oder sollen wir ihr die kalte Schulter zeigen, bis man uns eines Besseren belehrt?«
Der Wagen bremste abrupt. Die Bentleys rutschten nach vorn.
»Tut mir leid, Euer Ehren«, sagte Leonard und drehte sich kopfschüttelnd zu ihnen um. »Ein Zeitungsjunge«, ergänzte er. Ehe er aus dem Wagen springen und ihm nachsetzen konnte, war der Junge verschwunden, ein Kind noch, mit einem Arm voller Zeitungen und Pappschildern auf Brust und Rücken. Auf den Schildern hatte eine Schlagzeile gestanden. Bald Urteilspruch für königlichen Vetter.
»Man wird sie einfach nicht los«, stellte Roderick missmutig fest.