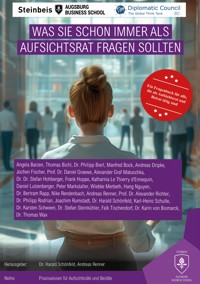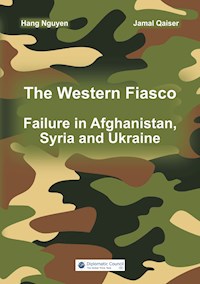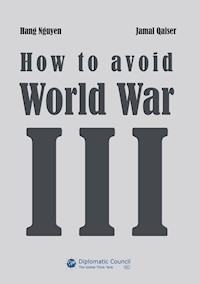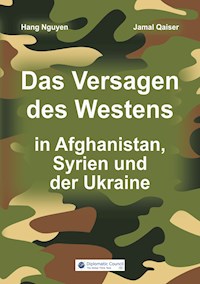
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sorgfältig recherchiert, spannend formuliert und mit viel Empathie für die Leidtragenden zeichnen die Autoren ein schonungsloses Bild der Auseinandersetzungen in Afghanistan, Syrien und der Ukraine auf - aber nicht nur! Weit darüber hinausgehend handelt dieses Buch von den globalen Mechanismen der Macht. Alle drei Länder stehen nämlich exemplarisch für das seelenlose Prinzip der Stellvertreterkriege. Hierbei werden die Machtspiele der Supermächte in Regionen verlagert, die als "Austragungsorte" für grausame Kriege herhalten müssen. Dabei beleuchten die Autoren die Ohnmacht der Vereinten Nationen ebenso wie die Hilflosigkeit der Europäischen Union Über Analyse und Anklage hinaus weisen Hang Nguyen und Jamal Qaiser konkrete Wege auf, wie Friedensprozesse gestartet und zum Erfolg geführt werden können. Nicht nur, aber eben auch in Afghanistan, Syrien und der Ukraine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Widmung
Dieses Buch ist den Kindern in Afghanistan, Syrien und der Ukraine gewidmet. Frei von eigener Schuld sind sie in ein von Gewalt und Krieg geprägtes Leben hineingeraten. Sie sind die Leidtragenden beim globalen Kampf um Macht und Einfluss, der von außen in ihre Heimat getragen wurde. Es ist zu hoffen, dass sie aus dieser Erfahrung heraus nicht selbst zu Kriegern werden, die das Leid in die nächste Generation weitertragen, sondern dass es ihn gelingt, der Not zu entkommen und ein friedliches und erfülltes Leben zu führen.
Inhalt
Vorwort
Stellvertreterkriege: Afghanistan, Syrien und die Ukraine
Das Recht der Völker auf Frieden
Das Scheitern des Völkerbundes
Die Anfänge der UNO
Grundlage für eine bessere Welt
Randnotiz: Deutschland ist ein Feindstaat
Der Krieg der UNO
Das Versagen in Afghanistan
Nine-Eleven: Das Drama beginnt
War on Terror
Bedingungslose Kapitulation
Afghanistan 2021 war wie Saigon 1975
USA als größter Waffenlieferant der Terroristen
Russland und China erklären sich zu Afghanistan
Neue Flüchtlingsströme nach Europa
Syrien – der kleine Weltkrieg
Vier Jahrzehnte Assad
Der Plan der UNO
Der neue Stellvertreterkrieg
Private Söldner auf dem Vormarsch
Das Dilemma der UNO
Die Ukraine – der neue Kalte Krieg
Kein Tag ohne Besorgnis
Annäherung an die EU scheitert
Die UNO schaltet die OSZE ein – vergebens
Krim gehörte zu Russland seit Katharina der Großen
Russland greift an
Die Idee einer europäischen Armee
Die NATO schlingert
Nine Eleven – der erste Bündnisfall
Europäische Armee vor gewaltigen Hürden
Die Welt rüstet auf
Friedenstruppen: Die Blauhelme
UNO-Einsätze zwischen Erfolg und Desaster
Blauhelme unter Beschuss
Zweifelhafter Ruf der Blauhelme
Blauhelme und Frauenhandel
Das Leid der Flüchtlinge
Ein dreijähriger Junge stirbt vor den Augen der Welt
Die erste Flüchtlingskrise 1992
Russische Föderation auf dem Weg nach Europa
Die zweite Flüchtlingskrise in Europa
Balkanroute der Schmuggler
Non-Papers zur Grenzschließung
Viele Wege führen nach Westen
Flüchtlingsdeal mit der Türkei
Syrischer Oberleutnant
Illegale Migration deutlich unterschätzt
Recht auf politisches Asyl hat keine Tradition
Genfer Flüchtlingskonvention
Grundrecht auf Asyl
Wege zum Frieden
Kleiner Weltkrieg, neuer Weltkrieg, Kalter Krieg 2.0
Glücklicher Ort und Nichtort Utopia
Über die Autoren
Hang Nguyen
Jamal Qaiser
Bücher im DC Verlag
Über das Diplomatic Council
Quellenangaben und Anmerkungen
Vorwort
Das vorliegende Buch dreht sich um die Auseinandersetzungen in Afghanistan, Syrien und der Ukraine – aber nicht nur! Es geht auch um die globalen Mechanismen der Macht, die Kriege verhindern – oder eben auch nicht. Alle drei Länder stehen nämlich exemplarisch für das seelenlose Prinzip der Stellvertreterkriege, bei denen die Machtspiele der Supermächte in Regionen verlagert werden, die mehr oder minder zufällig als „Austragungsort“ herhalten müssen. Der Vietnamkrieg und die Aufspaltung Koreas waren nach dem Zweiten Weltkrieg die markantesten „Stellvertreter-Tragödien“; Afghanistan, Syrien und die Ukraine sind die jüngsten.
Diese Entwicklung ist umso beklagenswerter, als die Staatengemeinschaft seit dem Zweiten Weltkrieg mit den Vereinten Nationen „eigentlich“ über eine globale Organisation verfügt, um Konflikte rund um den Globus friedlich zu lösen. Vielleicht nicht immer in Freundschaft, aber doch ohne militärische Auseinandersetzungen – und vor allem ohne das unendliche Leid eines Krieges für die Zivilbevölkerung. Dieses Buch dreht sich daher auch um die Macht oder besser gesagt die Ohnmacht der Vereinten Nationen bei internationalen Auseinandersetzungen, bei den entscheidenden Fragen von Krieg und Frieden. Es geht also auch um das Versagen der UNO – nicht nur des „Westens“.
Dabei ist ohnehin zu klären, wie weit der Begriff „der Westen“ in Zukunft noch zeitgemäß sein wird, wie dauerhaft die politische Freundschaft zwischen Europa, genau gesagt, der Europäischen Union, und den Vereinigten Staaten von Amerika halten wird. Erinnern wir uns: Es war das gemeinsame Militärbündnis, die NATO, die dafür gesorgt hat, dass Europa nach 9/11 in den US-amerikanischen Rachefeldzug gegen Afghanistan hineingezogen wurde. Und es war ein US-Präsident, der lautstark gefordert hat, Europa soll sich stärker an den Kosten der NATO beteiligen – so laut und solange, bis ein europäischer Regierungschef die Idee einer eigenständigen europäischen Armee in die öffentliche Diskussion eingebracht hat. Das könnte ein Ansatz sein, um Europa wenigstens ein Stück von den Stellvertreterkriegen der drei großen Supermächte abzukoppeln.
Auf alle diese Fragenkomplexe sind Antworten zu finden, wenn es um das Versagen des Westens in Afghanistan, Syrien und der Ukraine geht. Das vorliegende Buch erhebt den Anspruch, mit einer ganzen Reihe von Antworten hierzu einen wesentlichen Diskussionsbeitrag zu leisten
Hang Nguyen, Jamal Qaiser
Stellvertreterkriege: Afghanistan, Syrien und die Ukraine
In allen drei Ländern – Afghanistan, Syrien und der Ukraine – hat das Verderben Einzug gehalten, weil geopolitische Machtblöcke aufeinandergeprallt sind. Und in allen drei Ländern haben Stellvertreterkriege die Bevölkerung in die Katastrophe geführt. Daher gehört in einem Buch über das Versagen des Westens in Afghanistan, Syrien und der Ukraine an den Anfang das jahrzehntelange Versagen der internationalen Staatengemeinschaft weit über diese drei Länder hinaus bei allen Versuchen, Frieden in die Welt zu bringen.
Das Recht der Völker auf Frieden
Den Gedanken einer friedlichen Staatengemeinschaft gibt es schon lange. Der Begriff „Völkerrecht“ fand erstmals 1625 in dem Buch „Über das Recht des Krieges und des Friedens“ des niederländischen Rechtsgelehrten Hugo Grotius Erwähnung. Der Philosoph Immanuel Kant beschrieb 1795 in seinem Buch „Zum ewigen Frieden“ ausführlich die Idee einer „durchgängig friedlichen Gemeinschaft der Völker“. Die Aufklärung brachte im 19. Jahrhundert eine erste internationale Friedensbewegung hervor, die zu den Haager Friedenskonferenzen 1899 und 1907 führte.
Ziel war die Entwicklung von Grundsätzen für die friedliche Regelung internationaler Konflikte. Die Idee dahinter ist großartig: die Abschaffung des Krieges als Mittel der Auseinandersetzung zwischen Völkern und stattdessen die Etablierung eines Rechtsweges zur Lösung von Konflikten. Es ist damals nicht gelungen, es ist dem nach dem ersten Weltkrieg gegründeten Völkerbund nicht gelungen und mit heute rund 20 Kriegen jährlich lässt sich nur schwerlich argumentieren, dass die UNO erfolgreicher sei. Aber bei aller Kritik sollte man einen Moment innehalten, um die Großartigkeit des Gedankens „Rechtsweg statt Krieg“ zu würdigen, der allen diesen Bemühungen mehr oder minder zugrunde liegt.
Auf der ersten Haager Friedenskonferenz 1899 kamen 26 Staaten zusammen, auf der zweiten Konferenz 1907 immerhin 44 Länder, um eine internationale Rechtsordnung zu erarbeiten. Man einigte sich auf die Einrichtung eines Schiedsgerichtshof in Den Haag, konnte jedoch keine Verbindlichkeit der Gerichtsurteile der neu zu erschaffenden Institution festlegen. Schon damals trat die Kernfrage deutlich zutage, wieviel Souveränität die Staaten aufgeben wollen, um sich einer Art „supranationaler Weltordnung“ zu unterwerfen. Auch die Möglichkeiten zur Durchsetzung von Gerichtsurteilen wurde bereits erörtert, also die Frage nach einer internationalen Exekutive, wie sie heute die „Blauhelme“ der UNO darstellen.
Damals sollte die Festlegung der Verbindlichkeit auf einer für zunächst 1914, dann 1915, geplanten dritten Friedenskonferenz geschehen und wurde im Völkerbund als kollektive Sicherheit institutionalisiert.1 Der heute zur UNO gehörende Internationale Gerichtshof (IGH) als höchstes Organ der Rechtsprechung basiert ganz entscheidend auf den Ausarbeitungen der Haager Friedenskonferenzen.
Das Scheitern des Völkerbundes
Die Idee, eine weltweite Organisation zu schaffen, die als eine neutrale Plattform zur Verständigung der Staaten untereinander dient, wurde nach dem Ersten Weltkrieg wiederbelebt. Hierzu riefen die Siegermächte die Pariser Friedenskonferenz ein, auf dem der Versailler Vertrag unterzeichnet und die Gründung des Völkerbundes beschlossen wurde.
Es lässt sich schwer bestreiten, dass der Versailler Friedensvertrag zumindest argumentativ maßgeblich zum Aufstieg Hitlers und damit zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs beitrug. Schon damals waren einfache Argumentationslinien gefragt: Der Versailler Vertrag knechtet Deutschland ungebührlich, die Bevölkerung leidet darunter, das lassen wir uns nicht gefallen, sondern wehren uns – so lässt sich der damals in Deutschland populäre Tenor gegen den Vertrag von Versailles zusammenfassen.
Tatsächlich lassen sich Fakten dazu anführen: Deutschland musste Elsaß-Lothringen an Frankreich sowie Posen und Westpreußen an Polen abtreten, das Memelland kam unter französische Kontrolle, das Hultschiner Land ging an die neu gegründete Tschechoslowakei, das Saargebiet, Danzig und die deutschen Kolonien wurden dem Völkerbund unterstellt.
Diese umfassenden Maßnahmen reichten einerseits offenbar nicht, um Deutschland dauerhaft klein zu halten, gaben andererseits aber den Nationalsozialsten gewichtige Argumente an die Hand, um sich gegen den „aufdiktierten Frieden“ zu wehren. Der französische Marschall Ferdinand Foch analysierte den Versailler Vertrag trefflich: „Das ist kein Frieden. Das ist ein 20jähriger Waffenstillstand.“2
Es zeigte sich schon damals – wie später bei der Gründung der Vereinten Nationen –, dass die Formung eines Bündnisses der Staaten nach einem Weltkrieg, bei dem es Sieger und Besiegte gibt, einen grundlegenden Konstruktionsfehler aufweist: Die Sieger diktieren die Bedingungen. Dieses Problem setzte sich bei der Gründung der Vereinten Nationen als Nachfolgeorganisation des Völkerbundes fort. Stark vereinfacht skizziert besteht die UNO aus dem Sicherheitsrat als Spiegel der damaligen Machtverhältnisse, einer flexiblen, militärischen Eingreiftruppe unter der Führung des Sicherheitsrates, einer Gruppe von Unterorganisationen für praktisch alle Themengebiete der Menschheit, einem allumfassenden Netzwerk von Hilfsorganisationen und einer darum herum errichteten gigantischen Bürokratie.
Zurück zum Völkerbund: Als Ergebnis der Pariser Friedenskonferenz nach dem Ersten Weltkrieg und basierend auf einem „14-Punkte-Programm“ des US-amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson nahm der Völkerbund mit Sitz in Genf am 10. Januar 1920 seine Arbeit auf. Die Zielsetzung war damals schon ebenso hochtrabend wie später bei der UNO: dauerhafter Frieden durch ein System der kollektiven Sicherheit, internationale Abrüstung und die Beilegung eventueller Streitigkeiten zwischen den Staaten durch ein Schiedsgericht.
Im Gegensatz zur UNO sah die Satzung des Völkerbundes eine Verpflichtung aller Mitgliedstaaten vor, im Falle eines kriegerischen Angriffs eines Landes gegen einen Mitgliedsstaat „sofort und direkt“ militärische Hilfe zu leisten. Getreu dem Grundsatz „wehret den Anfängen“ sollte damit einer Verzögerung durch die Beratung in Gremien vorgebeugt werden. Im Ernstfall hielt sich allerdings kein Mitgliedsland an diese Vorgabe, sondern taktierte nach eigenem Gutdünken. Konsequenterweise wurde bei der späteren UNO-Gründung diese Verbindlichkeit abgesehen von Beschlüssen des UNO-Sicherheitsrates herausgenommen. Es hatte sich die Auffassung durchgesetzt, dass es besser ist, unverbindliche Erklärungen abzugeben als verbindliche, die aber nicht umgesetzt werden.
Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde das Scheitern des Völkerbundes besiegelt. Am 18. April 1946 beschlossen die 34 noch verbliebenen Mitgliedsstaaten, den Völkerbund mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Doch die Idee ging nicht unter: Noch während der Zweite Weltkrieg tobte, nahmen der US-amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt und der britische Premier Winston Churchill die Idee einer Weltorganisation zur Sicherung des Friedens wieder auf, die kurz nach dem Krieg in die Gründung der United Nations Organisation mündete.3
Roosevelt starb allerdings am 12. April 1945 nach einer langen schweren Krankheit und konnte die Gründung der UNO am 24. Oktober 1945 nicht mehr miterleben.
Die Anfänge der UNO
„Mr. chairman and delegates to the United Nations conference on international organisation: Oh what a great day this can be in history!” Mit diesen Worten eröffnete US-Präsident Harry S. Truman die Konferenz zur Gründung der Vereinten Nationen.4
Hierzu hatten sich am 24. April 1945 in San Francisco Diplomaten aus 50 Ländern zur Gründungskonferenz getroffen. Mit 850 Delegierten, Beratern und sonstigem Personal – insgesamt 3.500 Personen – galt sie als die bis dato größte internationale Konferenz ihrer Zeit. Es war mit zehn Vollversammlungen und knapp 400 Ausschusssitzungen und auf gut zwei Monate verteilt auch eine der längsten Konferenzen. Man kann also ohne weiteres sagen, dass die Wurzeln für die heutige Gigantomanie der Vereinten Nationen durchaus schon bei ihrer Gründung gelegt wurden.
Ebenso wegweisend war die bürokratische Vorgehensweise in San Francisco. Zunächst bildete die Konferenz einen Lenkungsausschuss, der aus den Delegationsleitern aller beteiligten Länder bestand. Dieser Ausschuss erhielt die Aufgabe, in allen politischen Fragen und allen grundsätzlichen Angelegenheiten zu entscheiden. Selbst bei nur einem Vertreter pro Land ergab sich freilich mit 50 Personen eine Ausschussgröße, die für Detailfragen zu unübersichtlich ist. Folglich wurde aus den Delegationsleitern ein 14-köpfiger Vorstand gewählt, der Empfehlungen an den Lenkungsausschuss vorbereiten sollte.
Danach wurde der Entwurf der Charta in vier Abschnitte aufgeteilt, die jeweils von einer Kommission geprüft wurden. Die erste Kommission befasste sich mit den allgemeinen Zielen der Organisation, ihren Grundsätzen, der Mitgliedschaft, dem Sekretariat und mit der Frage der Charta-Änderungen. Die zweite Kommission überprüfte alle Vollmachten und die Verantwortungen der Generalversammlung, während die dritte Kommission über den Sicherheitsrat beratschlagte. Die vierte Kommission erarbeitete einen Entwurf für die Satzung des Internationalen Gerichtshofs. Dabei blieb es aber nicht: die vier Kommissionen wurden nochmals in zwölf Fachausschüsse unterteilt.5
Wer heute behauptet, die UNO sei über all die Jahre hinweg immer komplexer geworden, hat Recht und irrt dennoch: Die UNO war schon in ihren Anfängen kompliziert. Vielleicht ist das ihrer Mammutaufgabe – der Sicherung des Weltfriedens – geschuldet, vielleicht ist das aber auch ein Grund dafür, dass sie genau diese Aufgabe nur unzureichend zu erfüllen vermag.
Schon damals zeichnete sich übrigens auch das Ringen um die richtigen Worte, die politisch korrekten Begriffe, ab. Sollte beispielsweise bei der Entlassung von Kolonien in die Freiheit die Übernahme einer Treuhandschaft durch die Vereinten Nationen dem betroffenen Staat „Unabhängigkeit“ (Independence) oder „Selbstverwaltung“ (Self-Government) bringen? Bereits damals galt: Wer das für unerheblich hielt, solange es den betroffenen Menschen die ersehnte Freiheit brachte, hatte die Rechnung ohne die Bürokraten gemacht. Das Ergebnis der Beratungen über diese spezifische Frage deutete wohl schon zur damaligen Zeit auf die Zukunft vieler UNO-Ergebnisse hin: Man einigte sich auf die Formulierung „Unabhängigkeit oder Selbstverwaltung“.
Die Kompetenzen des Internationalen Gerichtshofs verursachten eine umfangreiche Debatte. Die Konferenz beschloss, dass die Mitgliedstaaten nicht dazu verpflichtet würden, die Zuständigkeit des Gerichtshofs anzuerkennen, sondern dass sie ihre Zustimmung zur verbindlichen Rechtsprechung freiwillig geben. Diese Unverbindlichkeit, die den Vereinten Nationen später häufig den Ruf eines „Papiertigers“ einbrachte, wurde also schon mit der Gründung angelegt. Der Vorwurf, dass sie in aufwändigen Abstimmungsprozessen und Sitzungsmarathons vor allem viel Papier produziere, das jedoch wenig Wirkung zeige, holte die UNO im Laufe ihres Bestehens immer wieder ein. Dem ist entgegenzuhalten, dass es zumindest einen ersten Schritt darstellt, die „bessere Welt“ zu Papier zu bringen und dadurch Ziele zu setzen. Denn nur wer Ziele hat, kann sich auch auf den Weg machen, diese zu erfüllen – und möglicherweise und hoffentlich auch andere davon überzeugen, ebenfalls diesem Weg zu folgen.