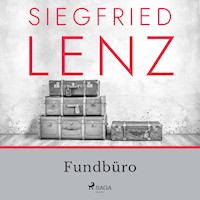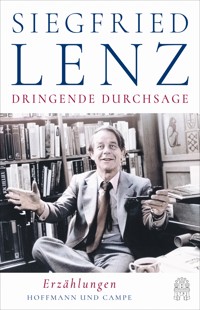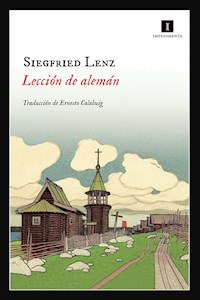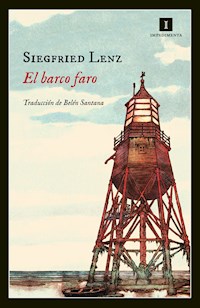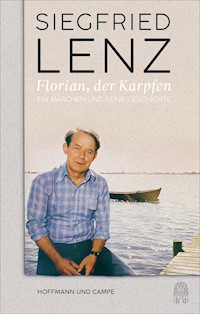9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für drei Pädagogen wird die Suche nach einem zeitgemäßen, verbindlichen Vorbild für die Jugend Ende der Sechzigerjahre zum Wagnis. Bald nach dem Erscheinen der Deutschstunde beginnt Siegfried Lenz mit der Niederschrift seines Romans Das Vorbild. Drei streitbare Fachleute für Schulpädagogik kommen 1968 in einer Hamburger Pension zusammen, um über ein neues und zukunftsweisendes Lesebuchkonzept zu beraten. Es geht um die Frage, ob es in der Bundesrepublik angesichts der Studenten- und Jugendrevolte noch Vorbilder geben könne, und wie in einem "Zeitalter der Diskontinuität" vor jeder "Begeisterung" im Politischen zu warnen wäre, die für Siegfried Lenz einer "ansteckenden Krankheit" gleichkommt: "Wer schreibt, ist bereits Pädagoge. […] Das Vorbild geht sowohl in die Politik wie in die privateste Sphäre – eine Fortsetzung der Deutschstunden-Thematik ist es nicht", erklärt er seinen Roman. Die drei Lesebuch-Fachleute scheitern mit ihrem ambitionierten Projekt sowohl thematisch als auch persönlich. Und auch der Autor präsentiert keine Antworten, sondern besticht mit denkscharfem Skeptizismus und stellt seine Leser vor einen Kosmos an Fragen und Fragwürdigkeiten. Siegfried Lenz kritisiert in seiner Zeit scharf die "Besessenheit, junge Menschen stumpfsinnig nach Vorbildern auszurichten", aber der Autor des Romans tut alles, um seinen Lesern noch heute eine eigene Orientierung zu ermöglichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Siegfried Lenz
Das Vorbild
Roman
Atlantik
1
Langsam, langsam; sie können doch nicht auf einmal da sein. Sie können doch nicht wie zufällig auf einem dunstigen, novemberlichen Bahnsteig ankommen oder sich unvorbereitet in dem trüben, von einem Leitergerüst gefangengesetzten Hotel vorfinden, als wären sie mit der Paketpost eingetroffen. Man kann ihnen doch nicht die Mühsal der Annäherung erlassen, sie einfach nur hineinstoßen in den mit Waffen überladenen Tagungsraum und sie dann vorzeigen bei zäh richtender Beschäftigung – in dieser Stadt, die selbst über jeden richtet, der sich in ihr aufhält. Und sie können doch auch nicht, einmal ins Schwerefeld von Hamburg geraten, in schroffer Umzäunung vorgeführt werden, so als gäbe es hier nur sie und ihre bemessene Aufgabe, denn wer hier ankommt mit Aufträgen, Plänen, Bereitschaften, wird unwillkürlich gemessen, wird ausgespielt und verglichen – also auch er, auch Valentin Pundt, dieser mächtige, steife Mann mit dem scheitellosen Haar, den eine Rolltreppe hochbaggert in die Halle des Hauptbahnhofs.
Es wird gleich zugegeben: dieser Mann, der im dünnen Licht der Halle zögert, der sich gleich zum falschen Ausgang wenden wird – in einer Hand einen Lederkoffer, in der anderen eine fleckige, schwere Aktentasche: Valentin Pundt, der in seiner Jugend Beckmann begegnet ist und prompt von ihm gemalt wurde – Norddeutscher Lehrer –, er ist einer der drei Sachverständigen, die im Auftrag eines Arbeitskreises der Kultusministerkonferenz an einem repräsentativen Lesebuch für Deutschland arbeiten; diesmal in Hamburg, in einem nassen November, der alles verschmiert.
Unschlüssig, von keinem bemerkt, die Gruppe müder stumpfgesichtiger Männer im Blick behaltend, die ihre Pappkartons spazierenführen wie quengelnde, widerstrebende Kinder, wendet er sich dem falschen Ausgang zu und erfährt schon auf dem kurzen Weg, welche Angebote diese Stadt bereithält, wie sie die Ereignisse mischt. Während sie also in förderlicher Zurückgezogenheit den dritten Abschnitt eines ganz neuen Lesebuchs für Deutschland beraten werden, feiert unter anderem der hiesige Hafen sein mehr als siebenhundertjähriges Jubiläum, und die Marine wirbt mit einem Tag der Offenen Tür. Da werden folglich Wimpel, da werden Flaggen knatternd von Leinen und Masten abstehen, man darf den Feuerleitstand betreten und eine Salve gegen die Altonaer Kühlhallen loslassen, ein Koch wird den Koch spielen und an jedermann bedrohliche Portionen Labskaus verteilen.
Nein, hier sind Sie falsch, dies ist der Ausgang Glockengießerwall, die Kirchenallee ist auf der anderen Seite, sagt ein Bahnpolizist; und deshalb geht Valentin Pundt zum zweiten Mal durch die trübe, zugige Halle und wundert sich über die Achtlosigkeit, mit der zwei Frauen den Boden der Halle fegen und den extra breiten Besen gegen die Schuhe von Stehenden stoßen. Scharf setzen sie die Besen auf, die Borsten zischen über die schmutzigen Fliesen, bringen den Staub in Aufruhr, der sich wolkig erhebt, bis unter das erblindete Glasdach hinaufsteigt, wo struppige Tauben eine dauernde Gefangenschaft verbringen. Valentin Pundt weiß, daß er am Ausgang Kirchenallee erwartet wird, neben einem Briefkasten, einem »unübersehbaren« Briefkasten, wie ihn Frau Dr. Süßfeldt beschrieben hat; das könnte für andere ein Grund sein, den Schritt zu wechseln, forscher, gespannter, ungeduldiger dem Treffpunkt zuzustreben, vielleicht sogar mit sich selbst eine Wette abzuschließen, daß oder daß nicht, doch dieser Mann, rauhhäutig, abweisend und offensichtlich bemüht, die Schwere seines Gepäcks nicht anzuerkennen, watet nur steif und ebenmäßig durch die Trübnis der Halle, in seinem langfallenden Lodenmantel, der eine beachtliche Feuchtigkeit aufzubewahren scheint, die Feuchtigkeit einer herbstlichen Fichtenschonung womöglich, und man kann schon die kurzgewachsenen Türken, die Griechen und Jugoslawen verstehen, die beim Anblick von Valentin Pundt ihre wärmenden Gespräche unterbrechen, sich anstoßen, bedeutungsvoll zunicken und ihm grinsend nachsehen, wie er dem Ausgang zustrebt, wobei es ihm gelingt, die Formation einer entgegenkommenden Schulklasse aufzuschlitzen. Wer ihm jetzt noch nachsieht, erkennt, daß er nur knapp hinaustritt, das verschlossene Gesicht nach links wendet, dort augenscheinlich – denn er blickt nicht nach rechts – den »unübersehbaren« Briefkasten entdeckt, allerdings auch nicht mehr als den Briefkasten, was ihn jedoch weder ratlos noch unsicher macht, sondern nur dazu veranlaßt, unter wildwachsenden Augenbrauen die nähere Umgebung durchzumustern, unerbittlich, bei langsamer Drehung in den Hüften. Nichts; er wird nicht erwartet, obwohl er am richtigen Ausgang steht. Der Zug hatte keine Verspätung. Am Datum ist nicht zu zweifeln. Der übergroße Briefkasten hat hier keine Konkurrenz; dennoch wird er nicht erwartet.
Valentin Pundt entschließt sich, zu telefonieren, geht schräg durch die Halle, erwägt, auf einen der Besen zu treten, die zischend gegen ihn vorstoßen, verweist jedoch nur die beiden formlosen Frauen durch einen Blick und schließt sich, ohne das Gepäck abzusetzen, der Reihe der Wartenden vor den Telefonzellen an.
Was macht sein Gepäck so schwer? Das schrumpelige Backobst, von dem er hin und wieder bei der Arbeit angeboten hat und auch diesmal wieder anbieten wird, kann es nicht sein; ebensowenig die geschnürten Katzenfelle, mit denen er sein Rheuma zähmt; es wird an den Flaschen mit selbstgebranntem Korn liegen, ohne die er nie verreist, ein hausgemachter Klarer, den er, lauschend im Bett sitzend, vor dem Frühstück kippt und aus dem er nach eigenen Worten »so eine Botschaft empfängt« – wenn Sie wissen, was ich meine. Und natürlich wird die Schwere seines Gepäcks nicht zuletzt auch durch all die Ordner und Notizen begründet, durch Zeitschriften und Bücher, die er unbarmherzig, wenn auch nicht wahllos, hineingezwängt hat in Fächer und Nebenfächer, sowie durch das zweiteilige Manuskript Die Erfindung des Alphabets, an dem er seit vierzehn Jahren arbeitet und das er sich in den Sitzungspausen vornehmen möchte, ohne Erfolg, selbstverständlich.
Doch jetzt können wir die Schlange der Wartenden verkürzen, Valentin Pundt eine Zelle zuweisen, allerdings kann er sie noch nicht betreten, da die Vorstellung hinter der Glastür kein Ende nehmen will, die volkstümliche Pantomime, die ein Bursche mit ölglänzendem Kraushaar und sehr breiten Koteletten anbietet: Pundt, immer dazu aufgelegt, einer Sache sofort einen Namen zu geben, nennt das alles »Mißglückte Versöhnung«, was da mit ziellosem Lächeln, mit flehender Hand und schräger Kopfhaltung beginnt, sich zusehends versteift und ungläubig verhärtet, ohne jedoch in banger Werbung nachzulassen, denn immer noch werden zaghafte Appelle an Einsicht oder Verständnis geäußert, was aber augenscheinlich auf der anderen Seite wirkungslos bleibt, so daß nun auf spitzmündiges Warnen ein Ausbruch von Fassungslosigkeit und Vorwurf folgt, unterstützt von einer Schuhspitze, die gegen die Zellenwand stößt, und von einer Hand, die fordernd mit einer Münze gegen die Flanke des Apparats tickt, auch das ohne Wirkung, wie sich herausstellt, worauf der telefonierende Pantomime zu atmen aufhört, den Kopf einzieht wie zu einem Rammstoß und mit einem Gesicht, das nichts zeigt als schlimme Undurchdringlichkeit, den Hörer auf die Gabel knallt und aus der Zelle stürzt und gleich zu laufen beginnt in Richtung auf ein beschlossenes Ziel.
Nun aber ist Valentin Pundt dran. Er wuchtet sein Gepäck in die Zelle, setzt den Koffer gegen die Wand, stellt die Tasche auf den Koffer und klemmt sie mit einem Knie fest, und in dieser Haltung sucht er nach dem Brief, da steht die Nummer drauf; wie warm der Hörer ist, wie feucht und beschlagen. – Hier spricht Pundt, Rektor Pundt aus Lüneburg, ich bin verabredet mit Frau Doktor Süßfeldt. – Haben wir nicht, sagt eine gehemmte Männerstimme und legt auf. Valentin Pundt wählt noch einmal, er hört dieselbe Männerstimme, er sagt: Bitte, Doktor Rita Süßfeldt. – Sie waren doch schon einmal da, sagt die Männerstimme, und Pundt darauf: Hier Pundt aus Lüneburg. Doktor Süßfeldt wollte mich von der Bahn abholen, es kann sein, daß wir uns verfehlt haben. – Sie ist zur Bahn gefahren, sagt die Männerstimme, vor einer Stunde schon, und wenn nix passiert, wenn sie keinen Rentner überfährt und keinen Polizisten, wird sie auch kommen und Sie abholen. Valentin Pundt will antworten, doch im Hintergrund hört er eine übelnehmende Frauenstimme: Laß das, Heino, du sollst nicht ans Telefon; mit wem sprichst du eigentlich? – Lüneburg, sagt Heino, jemand aus Lüneburg möchte Rita sprechen. – Ja? – Hier Süßfeldt, sagt die Frauenstimme, und Valentin Pundt wiederum: Pundt hier, Rektor Pundt aus Lüneburg. Frau Doktor Süßfeldt wollte mich von der Bahn abholen, offenbar haben wir uns verfehlt, wenn Sie ihr bitte ausrichten würden, daß ich direkt zur Tagungsstätte fahren werde, zum Hotel, ja. – Tun Sie das nicht, sagt die Frauenstimme, meine Schwester ist unterwegs zu Ihnen, sie ist bereits vor einer Stunde abgefahren, den Weg zum Bahnhof hat sie schon oft gemacht. – Danke, sagt Valentin Pundt und hängt ein, bugsiert sein Gepäck aus der Zelle, verläßt diesmal die Halle durch einen Nebenausgang und strebt auf den »unübersehbaren« Briefkasten zu.
Er stellt sich neben den Briefkasten und wartet, und im Prisma der Erwartung dehnt und vervielfacht sich alles, wächst sich aus zu bedrückender Größe: die ernsten Fassaden dieser hamburgischen Hotels rücken zusammen und bedrängen das Schauspielhaus; die Kaufhäuser versuchen, jedermann den Weg zu verstellen; die Prozession der Autos, die nur aus Lieferwagen von Chemischen Reinigungen und Büromöbelgeschäften zu bestehen scheint, erlaubt keinem das Überqueren der Straße. Ein Zeitungsverkäufer wirbt mit einem beispiellosen Bankrott. Das traditionelle Geschenk Norwegens, ein mit Stricken gefesselter Tannenbaum, wird auf einem Spezialwagen vorbeigefahren. Dort verdicken sich die Schnüre der Passanten vor einer Ampel. Mißmutig, mit klammen Fingern, laden sie hier Kabelrollen ab. Und über allem streitet sich das Licht mit diesem diesigen November.
Valentin Pundt wartet neben dem Briefkasten am Hauptbahnhof. Diesmal werden sie also, während Kollegen im Süden im gleichen Auftrag an einem Gegenmodell arbeiten, den dritten Abschnitt des neuen Lesebuchs für Deutschland fertigstellen: Lebensbilder – Vorbilder. Die beiden ersten Kapitel sind zusammengestellt, überprüft, beschlossen; zügig, fast ohne Widerstand, hat man sich auf Arbeit und Feste geeinigt; zäher, lustloser dagegen ist Heimat und Fremde entstanden, es hat da gereizte Nachfrage und spöttische Antwort gegeben, und wenn auch das, was erarbeitet wurde, als abgeschlossen gilt: bezweifelt wird es immer noch – nicht von ihm allerdings, nicht von Valentin Pundt. Er denkt an die mühselige, halbherzige Einigung am Schluß der letzten Sitzung. Wie anstrengend es ist, andere zu überzeugen, wie trostlos, selbst überzeugt zu werden. Damals war er gut vorbereitet. Wo sie nur bleibt?
Ein hochbeiniges, froschgrünes Auto kommt in leichtfertigem Slalom zwischen wartenden Taxis heran und hält vor ihm. Hinter verschmierten Scheiben winkt eine Hand, schnell, schnell, hier ist Halteverbot, die Hand pocht gegen die Scheibe, drängt Valentin Pundt zur Eile, der ist bereit, der hat sein Gepäck nicht einen Augenblick abgesetzt, umrundet schon das Auto und sieht, wie die Tür geöffnet wird, die Sitzlehne nickend und dienstbereit nach vorn kippt, das ist die Aufforderung, Koffer und Tasche – Vorsicht, da sind Flaschen drin – auf den Rücksitz zu bugsieren, da springt die Lehne auch schon zurück, er zwängt sich hinein und wirft die Tür zu, ohne zu merken, daß der langfallende Mantel eingeklemmt wird: Guten Morgen.
Rita Süßfeldt fährt an. Ihretwegen brauchte es weder Rückspiegel noch Seitenspiegel zu geben. Sie fährt an mit einem Seufzer der Genugtuung, wie immer, wenn sie einem Verkehrszeichen seine Entbehrlichkeit bewiesen hat, und der Mann auf dem Nebensitz wendet ihr das Gesicht zu und bedankt sich knapp. Rita Süßfeldt beobachtet den einzigen noch arbeitswilligen, wenn auch ermüdeten Scheibenwischer: seit zwanzig Minuten fahre sie um den Hauptbahnhof herum, immer in derselben Richtung, sie habe es sich abgewöhnt, hier nach einem Parkplatz zu suchen, schließlich müsse man ja einmal aufeinandertreffen, zwangsläufig, jedenfalls habe er gut daran getan, am Briefkasten zu warten, wie ausgemacht. Rita Süßfeldt fährt, wie gesagt, steuert das leichte Auto an der Tankstelle vorbei durch die Einbahnstraße, eine wippende Zigarette zwischen den geschminkten, aber nicht zu Ende geschminkten Lippen, das war voraussagbar, auch der zu helle Ton des Lippenstifts und die grauen Flecken auf Rock und Mantel waren voraussagbar, Ascheflecken, die sie achselzuckend verreibt, manchmal lächelt sie in gespielter Bekümmerung, wenn der fahle, gekrümmte Wurm von der Zigarette fällt und auf ihren Kleidern zerplatzt. Wie leicht sie es jedermann macht, wiedererkannt zu werden; immer noch, denkt Valentin Pundt – der sie freimütig abfragt mit seinen Blicken –, immer noch dieser Eindruck, als sei sie gerade irgendwo hastig aufgebrochen, mit einem Schreckensschrei und einem belegten Brötchen zur Garderobe gestürzt – immer noch, und in allem, dieser unausgeführte Entwurf ihrer selbst. Offen ist der Mantel, der durchsichtige Schal nur lose gebunden, das Stirnband, das dem kräftigen, rötlichen Haar Strenge auferlegen soll, sitzt schief; im Hotel wird Rektor Pundt außerdem entdecken, daß Rita Süßfeldt nur einen Ohrring trägt. Alles an ihr ist bedacht, geplant, eingeleitet, sie hat alles Nötige begonnen, doch ein unerwarteter Einfall, eine Ablenkung oder einfach überlegene Lustlosigkeit haben sie daran gehindert, das Begonnene auch zu beschließen.
Rauch steigt kräuselnd von der wippenden Zigarette auf, zieht über das glatte, sommersprossige Gesicht, über die gleichmäßig gewölbte Kinderstirn, sie muß die Augen schließen, sie wischt sich beim Fahren mit einer Hand über die tränenden Augen, gleich wird auch die andere Hand das Steuer loslassen, was Valentin Pundt jedoch nicht schert oder etwa besorgt macht, denn der geschätzte Schulmann, der gerade pensionierte Rektor ist nach eigenen Worten ein »erklärter Nichtfahrer«. Ob er sich wieder mit soviel schauderhafter Sorgfalt vorbereitet habe? – Er sei geziemend vorbereitet. – Ob er außer den verabredeten Texten auch noch neue Texte mitgebracht habe? – Er habe sich – die schwere Pädagogenhand zielt auf den Koffer – mit Texten ausreichend versehen. – Und Backobst? Werde er in kritischen Augenblicken wieder in der Lage sein, Backobst kreisen zu lassen? – Er werde dazu in der Lage sein.
Rita Süßfeldt lächelt und verschafft sich lächelnd Vorfahrt, manchmal unter Mithilfe heftiger und etwas zu groß geratener Dankesgesten, und die Hinweise anderer Autofahrer, daß da ein Mantel eingeklemmt, daß da ein beachtliches Stoffdreieck zur Tür heraus, daß da jedenfalls etwas Schlappes, Hängendes die Fahrbahn feudelt – all diese Hinweise mißversteht sie grundsätzlich und nimmt sie, wenn nicht als fröhlichen, so doch als bewundernden Gruß.
Sie will über die Kennedy-Brücke, das gelingt nicht, scheitert einfach daran, daß die Auffahrt anscheinend über Nacht verlegt wurde, doch man fährt bereits in gewünschter Richtung zur Lombardsbrücke hinab, an der Kunsthalle vorbei, die an diesem Morgen – der Schnee oder Regen, vermutlich aber den ortsüblichen Schneeregen bereithält – Trübsinn angelegt hat, und zwar den termingerechten Trübsinn, dem der Backstein jedesmal im November verfällt.
Ob er, Valentin Pundt, nicht die Ausstellung sehen möchte, die gerade eröffnet worden ist, eine sehenswerte Ausstellung: Kinderbildnisse europäischer Maler? Wenn er Zeit finde, werde er sich die Ausstellung ansehen. Überhaupt – sie läßt das Steuer los, um einen Batzen herabgefallener Asche in den dunkelblauen Wollrock zu reiben –, Hamburg habe eine Menge zu bieten, gerade in diesen Novembertagen, und man müsse sich schon gewaltsam Zeit nehmen, um das Wichtigste mitzubekommen. Zum Beispiel habe der Hafen Jubiläum. In Planten un Blomen finde zum Beispiel die traditionelle Skandinavische Lebensmittel-Ausstellung statt. Unterhaltsame Veranstaltungen biete auch die Werbewoche Freundschaft mit der Polizei. Und die Bach-Woche. Und der Internationale Puppenspieler-Kongreß. Die nötige Zeit, sich etwas davon herauszupicken, werde man schon finden: der Doktor Dunkhase sei ohnehin verreist und kehre erst in ein paar Tagen zurück.
Rita Süßfeldt biegt hinter der Lombardsbrücke rechts ab, es gelingt ohne Folgen, sie fährt an der Alster entlang, die nun unbevölkert ist, stumpf und schieferfarben; da formieren sich keine Segel zum Ballett, gläserne Versicherungsbauten, in denen einheimisches Unglück lautlos verwaltet wird, suchen erfolglos ihr zitterndes Spiegelbild, die hölzernen Landungsstege werden nicht mehr von hängeärschigen Schwänen besetzt und fauchend verteidigt. Jetzt, Ende November, gehört die Alster allein den wilden Enten, die in regungslosen Schnüren weit draußen auf dem Wasser treiben, rundlich, wie dunkle Glaskugeln eines verankerten Netzes. Vor der gängigen Grafik der Trauerweiden, auf dem sogenannten Wanderweg, weniger durch Nebel als durch Dunst um Genauigkeit gebracht, führen erstaunlich mangelhaft bekleidete junge Leute Hamburger Liebespaare vor: man hält sich in spielerischem Würgegriff, man wendet den einfachen und den Doppel-Nelson an, probiert das Ausheben, läßt den soliden Schwitzkasten gelten, und alle Augenblicke wächst man unter langen Mähnen mit den Köpfen zusammen. Valentin Pundt, der geschätzte Pädagoge, mustert die Frau auf dem Fahrersitz und denkt an eine Glaskugel, in der ein künstliches Schneegestöber das winzige Blockhaus und die Fichtenschonung verbirgt.
Die Ampel an der Alten Rabenstraße springt auf Rot um, Pundt liest den Namen der Straße, leise zuerst, dann fragt er: Alte Rabenstraße? Und da die Frau es bestätigt, streicht er sich über das scheitellose graue Haar und über die Stirn, so, als müßte er sich etwas zurückrufen oder herbeizwingen, was er zwar nicht vergessen, aber doch verschoben hat auf eine unbestimmte Zukunft: dies also ist die Alte Rabenstraße? – Ja. – Ich muß da mal vorbei, etwas abholen, was seit sechs Wochen wartet; es dauert nicht lange. Die Frau bemerkt den veränderten Ausdruck seines Gesichts, diese gesammelte Härte und plötzliche Zurückweisung, die doch eine Antwort sein müssen auf etwas, und deshalb fragt sie: Gleich? Wollen wir gleich? – Wenn es sich machen läßt, sagt Valentin Pundt. Da der linke Blinker seine Tätigkeit regelmäßig im Herbst, spätestens nach dem ersten Schneefall, einstellt, dreht Doktor Süßfeldt die Scheibe herunter, streckt den linken Arm hinaus und gibt dem Hintermann, leicht mit den Fingern schnippend, zu verstehen, daß sie, sobald die Ampel wieder Grün zeigt, nach links abbiegen werde, in die Alte Rabenstraße.
Es ist eine kurze, abschüssige Straße, langsam, können wir etwas langsamer fahren, da ist ein älteres Haus mit einem Vorgarten, nicht größer als ein Bettlaken, hier muß es sein: darf man hier halten? Rita Süßfeldt kann weder vor sich noch hinter sich ein Schild entdecken, sie hält, sie bietet ihre Hilfe an, doch Rektor Pundt schüttelt den Kopf: was dort aufbewahrt werde, könne er allein tragen, nur ein Karton und ein Koffer, alles stehe bereit seit Wochen, vielen Dank. Und er arbeitet sich heraus aus dem engen, aber warmen Auto, schiebt eine Schulter vor, dreht sich um dreißig Grad und senkt den Nacken, bringt sodann ein Bein und den Rücken heraus und, nach vorn abgestemmt, schließlich den ganzen Körper. Der Mantelsaum, der rechte Mantelsaum ist schwarz und verdickt, scheint sich etwas zusammengezogen zu haben, wodurch der Eindruck entsteht, als falle der Mantel ungleich lang – später, im Hotel, wird Valentin Pundt alles näher untersuchen. Jetzt durchquert der mächtige, barhäuptige Mann erst einmal den kümmerlichen Vorgarten, drückt einen Klingelknopf, stößt die Tür auf und tritt in das Haus, ohne zurückzusehen.
Rita Süßfeldt, freie Lektorin und Herausgeberin von Lesebüchern, ist überrascht, wie schnell Pundt zurückkehrt; jedenfalls hält er sich an seine Voraussage, kommt schon wieder mit Koffer und verschnürtem Karton, man wird kaum, vielleicht überhaupt nicht gesprochen haben, sein Gesicht ist immer noch gekennzeichnet von Härte und einer fast erbitterten Weigerung, und daß er ein besonderes Verhältnis zu den Gepäckstücken hat, beweist er durch die langfingrige Vorsicht, mit der er sie zum Auto trägt und auf dem Rücksitz verstaut. Hoffentlich keine neuen Texte, sagt Rita Süßfeldt, und Pundt, tonlos und geradeaus blickend: Ein Nachlaß. Der Nachlaß meines Sohnes.
Sie wenden, sie fahren wieder zur Alster hinab, und dann fragt die Frau, ob man nicht immer, wenn man von einem Nachlaß spreche, einen Tod voraussetzen müsse, und der Mann sagt: Ja. Und dann fragt die Frau, ob es auch in diesem Fall so sei, und der Mann sagt: es sei so. Und weiter fragt die Frau, ob es ein Unglücksfall gewesen sei, und der Mann sagt: es sei Selbstmord gewesen, in jenem Haus unter freundlichen Menschen, am Ende eines sorglosen und nie gefährdeten Studiums. Und wieder fragt die Frau – ihre Fragen fester und enger verklammernd –, ob das Unglück sich unmittelbar vor dem Examen ereignet habe, und der Mann sagt: nein; die Stunde des Selbstmords sei genau bestimmt worden, alles sei zwei Tage nach einem nicht nur mühelos, sondern auch mit Auszeichnung bestandenen Examen geschehen. Und bedachtsam fragt die Frau, welche Gründe zu solch einer Tat führen könnten, und der Mann sagt: er wisse einstweilen keine Gründe. Und leiser fragt die Frau, was Valentin Pundts Sohn studiert habe, und der Mann sagt: sein Sohn habe Geschichte und Pädagogik studiert.
Es läßt sich ohne weiteres annehmen, daß die Frau gern weiterfragen möchte und auch in der Lage wäre, das Geschehnis mit ihren Fragen weiter einzugrenzen, vielleicht so lange, bis zwar nicht alles, aber doch einiges durchsichtig geworden ist – doch dort ist das Hotel, man muß nach links abbiegen, obwohl ein durchgehender weißer Strich dagegen ist, man muß sich auf die schmale, von verwitterten Pfosten bemessene Einfahrt konzentrieren – die eisernen Gitterflügel sind geöffnet – und dann mit Schwung den steilen gewundenen Teerweg nehmen, der zur Hotel-Pension Klöver, Inhaberin Ida Klöver, hinaufführt und vor dem überdachten Eingang endet. Das Hotel, von einem Gerüst gefangengesetzt – es ist nicht zu entscheiden, ob die Arbeiten bereits beendet sind oder erst beginnen werden – bekennt auf den ersten Blick, daß es in seiner Jugend, jedenfalls vor dem Ersten Weltkrieg, nichts als Privat-Villa sein wollte, eine durch und durch hamburgische Villa, und das heißt: raumverdrängend, melancholisch und gediegen. Es liegt zurückgezogen, aber unübersehbar am bevorzugten Hang, ein sahnefarbener Kasten mit schmalen Fenstern und aufgesetzten Türmchen, in die Schießscharten eingelassen sind. Und es liegt so, daß die Alster, besonders im Sommer, als Bucht oder als Bay erscheint, sprühend vor Licht, eine Bay, die man weniger in träumerischer als in trockener Erwartung ins Auge faßt, weil da womöglich fleißige Schoner aufkommen könnten, um gesammelten Pfeffer, Kaffee und das einträgliche Sandelholz abzufahren. Hier hat sich Erinnerung ihren Alterssitz geschaffen.
Doch sie müssen ankommen. Sie müssen das Haus betreten, das Rita Süßfeldt als Tagungsstätte ausgesucht hat – zentral gelegen und überraschend still, hieß es in ihrem Brief –, vor allem müssen sie das Gepäck in die dämmrige, nußbaumgetäfelte Halle tragen.
Da steht Janpeter Heller. Der dritte Sachverständige steht erwartungsvoll vor dem nie benutzten Kamin, er ist schon einen Tag früher angekommen, hat Rita Süßfeldt schon begrüßt, jetzt stößt er sich mit dem Rücken von der Marmorplatte ab und geht mit verzogenem Gesicht und vorgegebener Trauer auf Valentin Pundt zu, ihre Hände fahren ineinander, bewegen sich jedoch nicht wie in üblicher Begrüßungsfreude, sondern verhalten sich ruhig, beinah andachtsvoll, gerade so, als ob man sich gegenseitig kondolieren wolle.
Was beabsichtigt Janpeter Heller? Was hofft er? Der junge Experte, der einen verwaschenen, aber immer noch weinroten Pullover trägt, der seinem zurückfliehenden Kinn einen Bart wachsen ließ, den er scharf nach vorn kämmt, hofft nicht weniger – und das sagt er gleich zur Begrüßung –, als daß es auf dieser Sitzung zu rascher Einigung kommt, ja, er möchte einen »Rekord an Einverständnis« aufstellen, und zwar nicht, weil der dritte Abschnitt des Lesebuchs es besonders zuläßt oder dafür geeignet ist, es sei vielmehr diese Stadt, es sei Hamburg mit seinen Angeboten, das eine zügige Arbeit nahelegt. Wir können uns nämlich nur bedauern, sagt er, wenn wir nicht Zeit herausschlagen für die Theater-Diskussion Was geschieht hinter unseren Bühnen? Wir begehen ein Versäumnis, sagt er, wenn wir nicht die Ausstellung Moderne Fotografie mitnehmen. Und Beat und Lyrik im Wartesaal. Und die Demonstration aufblasbarer Möbel. Und das Konzert mit den Monkees. Überhaupt alles, was er aus dem Terminkalender Wohin in unserer Stadt? für sich herausgefischt habe und worauf man zu Hause, in Diepholz, vergebens warte. Er glaubt sich verständlich gemacht zu haben. Er blickt seine Kollegen an. Nun gut, Lebensbilder – Vorbilder: wer fühlt sich nicht von ihnen sattsam umstellt, wem wurden sie nicht von Kindesbeinen an verordnet, jeder hatte doch so einen wechselvollen Umgang mit ihnen, nun braucht man sie doch nur aus dem hoch hängenden Rahmen zu schneiden, sozusagen. Keine Zustimmung, nur ein unscheinbares, ein abwesendes Nicken, seine Kollegen mustern noch die ungewohnte Halle, wollen oder können sich nicht festlegen, und als Valentin Pundt etwas sagt, reicht es nur zu der Feststellung: Sie haben einen Ohrring verloren. Rita Süßfeldt weiß es, sie winkt geringschätzig ab, mit aufschlußreicher Resignation: es werde ihr wohl nie gelingen, zwei Ohrringe zu gleicher Zeit einzusetzen, einer spiele immer Versteck; ja, sie weiß es. Janpeter Heller kann jetzt schon absehen, daß es schwierig sein wird, den Beginn der Sitzung vorzulegen oder, woran ihm gelegen ist, eine beschleunigte Behandlung des dritten Kapitels ausdrücklich abzumachen; deshalb weicht er in eine Hoffnung aus: Gut vorbereitet? Wenn wir alle gut vorbereitet sind, könnten wir die Sache bald im Kasten haben, das geforderte Pensum: Lebensbilder – Vorbilder; ich habe nämlich noch etwas Privates zu ordnen.
Nicht zu lange, sie dürfen einfach nicht zu lange unbemerkt in der dämmrigen Halle der Hotel-Pension Klöver stehenbleiben, denn wer hier eintritt, braucht sich, um entdeckt zu werden, weder rufend noch klingelnd verständlich zu machen; selbst schweigende Anwesenheit hat hier unmittelbar zur Folge, daß im ersten Stock eine Tür geht, daß ein mürrisches Selbstgespräch hörbar wird, dann eine schnaufende Annäherung, bei der man unwillkürlich das Gesicht hebt, und wer auch noch den Seufzer versteht, der ihn vom Treppenabsatz erreicht, macht sich sofort Vorwürfe, hier überhaupt eingetreten zu sein, zumindest bereitet er gleich eine Entschuldigung vor.
Ida Klöver, die Inhaberin, ist solche Entschuldigungen offenbar gewöhnt, sie wedelt schon auf der Treppe mit lascher, vielberingter Hand, ist gut, ist erledigt, und sie steigt angestrengt herab, bewegt von einem alten, vielleicht schon erschöpften, aber immer noch wirksamen Mechanismus, dem sie nichts entgegensetzen kann: eine Frau in schwarzem Kostüm, schwerfüßig, mit losem Wangenfleisch. Ihr Gesicht erzählt, was sie für sich selbst übrig hat, ihr freies, regsames Gesicht, das den Ausdruck von Überdruß nicht mehr loswerden kann.
Sie begrüßt ihre Gäste mit Handschlag, und auf dem kurzen Weg zur Empfangsloge gibt sie ungefragt Auskunft über ihre Schwierigkeiten: ohne Mann, in ihrem Alter, mit unzureichendem Personal, da verliere man seine Freude daran, ein Hotel zu leiten. Sie schiebt Pundt eine geöffnete Kladde hin, bittet ihn, sich einzutragen. Sie spricht auf seinen gebeugten Rücken hinab: Ja, wir hatten ein Hotel in Südwest-Afrika; achtundzwanzig Jahre waren wir dort, mein Mann und ich. Gleichgültig schließt sie die Kladde, legt sie aufs Fensterbrett und reicht Pundt einen Schlüssel mit den Worten: Lange wird’s nun nicht mehr gehn; lange nicht. Sie zögert, da war noch etwas – ja, es wurde angerufen, ein Anruf für Herrn Heller: Sie möchten Ihre Frau nicht besuchen, nicht heute abend. Dann bittet sie, ihr zu folgen, diese wenigen Stufen hinauf, hier, durch die Schiebetür: das ist unser Konferenz-Zimmer, wie Sie sehen, ein Raum mit Erinnerungen, hier ist man ungestört – falls Wünsche bestehen, kann man einfach läuten, und jetzt darf ich Sie wohl sich selbst überlassen.
Hier also, in diesem helltapezierten Raum – die Tapete zeigt fröhliche Szenen aus der Geschichte menschlichen Arbeitslebens, vornehmlich fröhliche Sackträger –, wird man tagen, unter verglasten, durchweg kränklich erscheinenden Fotografien, die alle etwas überbelichtet sind und den immer gleichen melancholischen Riesen vorstellen, der neben erlegter Beute kniet, steht, einmal auch mit aufgestütztem Oberkörper liegt. Kreuzweis Speere an den Wänden, Speere mit hölzernem und eisernem Schaft, mit Kupfer- oder Lederverzierung. Bogen, die einander gegenüber hängen und darauf warten, daß einer ihnen den Pfeil auflegt und sie auszieht. Pfeile in Köchern und zu losem Strauß zusammengebunden, Pfeile mit Knochen-, Eisen- und Steinspitzen. Verformte, aber handliche Äxte bieten ihren Dienst an; ein Blasrohr will ausprobiert werden.
Hier wird man tagen. Die Korbsessel stehen so da, als setzten sie knisternd ein Gespräch fort, das gerade in ihnen geführt worden ist. Der breite Palisandertisch empfiehlt sich als Ablage, desgleichen ein Teetisch auf Rädern. Hier also wird man sie ausbreiten und wenden, die Lebensbilder – Vorbilder, hier wird man sie prüfen, abschätzen, aussondern, bis im gemeinsam geschüttelten Sieb das Eine zurückgeblieben ist, das Erwünschte, zu dem jeder ja sagen kann. Ja, hier wird man sitzen und tagen.
Valentin Pundt setzt sich nicht, wie Rita Süßfeldt, probeweise in einen Sessel, er beobachtet mißtrauisch die hohen Fenster, hält eine Hand über das Fensterbrett und stellt sogleich fest, daß es hier zieht, begnügt sich indes nicht mit dieser Entdeckung, sondern weist gleich darauf den Heizungsrohren nach, daß sie ebenfalls Zugluft entlassen, und da sein Mißtrauen weder vor dem – allerdings sehr großen – Schlüsselloch haltmacht noch vor dem Blasrohr, erwägt er, womit er beide – Schlüsselloch und Blasrohr – verstopfen kann; Fenster und Heizungsrohre sollen wohl später drankommen. Nichts einzuwenden, sagt er, gegen den Raum habe ich nichts einzuwenden, vorausgesetzt, wir können die Zugluft abstellen.
Die hat Janpeter Heller noch nie gestört, wird ihn auch nicht stören. Der junge Experte prüft für sich die Schärfe der Waffen, indem er eine Fingerkuppe leicht auf Speerspitzen, Pfeilspitzen und auf die Spitzen zweischneidiger Jagdmesser drückt, gerade so weit, daß es zu einem kleinen Schmerz reicht; sie sind brauchbar, sagt er, falls wir uns nicht einigen können, diese Sachen sind sehr brauchbar. Er erwartet kein Lächeln auf seine zu naheliegende Bemerkung. Man scheint zuversichtlich zu sein, zumindest Doktor Süßfeldt, die noch einmal beiläufig den Raum vermißt mit langfallenden Schritten und dabei auf gewonnene Erfahrungen und Kenntnisse aus den ersten beiden Sitzungen hinweist. Hat man sich nicht beinahe spontan geeinigt bei dem Kapitel Arbeit und Feste? Und ist man sich nicht nähergekommen in nützlichen Auseinandersetzungen bei Heimat und Fremde? Wer will da von mangelnden Voraussetzungen sprechen? Außerdem habe sie schon herausgehört, daß diesmal jeder vorbereitet sei. Da kann man doch nur zusammentreten – unter dem matt glänzenden Gehörn eines Antilopenbocks – und nach kurzem gegenseitigen Abfragen die Stunde der ersten Sitzung festlegen, sagen wir: heute nachmittag, sagen wir: um drei. Jeder ist einverstanden und gibt sein Einverständnis zu erkennen auf eine ihm entsprechende Weise: nickend oder, wie Pundt, mit kurzem zustimmendem Brummen. Und jeder überschlägt dann für sich die verbliebene Zeit, teilt sie ein, bewirtschaftet sie im voraus: bis drei also; da kann ich noch, da muß ich, da könnte ich, jedenfalls sollten wir uns jetzt trennen, um dann zur vorgesehenen Zeit, gerüstet und gut aufgelegt, bewaffnet mit Kenntnissen, unnachgiebig, doch verzichtbereit, wo es sein muß, mit der uns anvertrauten Arbeit zu beginnen. Der Abschied findet in der Halle statt.
Hier könnte man wegblenden. Hier könnte man die drei ungleichen Sachverständigen aus dem Blickfeld beurlauben, sie in eine unerhebliche Zwischenzeit entlassen, die der Vorbereitung dient oder der Einstimmung, und mit ihren Worten könnte auch ich sagen: bis drei also; um drei sehen wir uns wieder, wenn die, sozusagen, entscheidende Arbeit beginnt. Doch wir bestehen darauf, ihnen nachzusehen. So bringen wir also Rita Süßfeldt dazu, sich kühn, doch folgenlos in den Verkehrsstrom auf dem Harvestehuder Weg einzufädeln; sie nimmt bei Gelb die Kreuzung Mittelweg, fährt geradeaus zum Klosterstern – nicht, weil sie dort hin müßte, sondern weil sie einfach vergißt, links abzubiegen –, fährt die Rothenbaumchaussee hinauf bis zur Oberstraße, biegt rechts ab in die Hochallee und noch einmal rechts in die Innocentiastraße – nur Einheimische werden den Umweg ermessen.
Es ist sicher, daß Janpeter Heller Pundt dabei hilft, das Gepäck aufs Zimmer zu bringen – Vorsicht, im großen Koffer sind Flaschen drin –, das Gepäck in der Mitte des Raums absetzt, einen prüfenden Blick durchs Fenster wirft und feststellt, daß Pundt fast der gleiche Ausschnitt der Alster angeboten wird wie ihm selbst; dann geht er rückwärts zur Tür, eilig, als fürchte er, der alte Mann könnte ihn in ein Gespräch ziehen: bis später.
Und Valentin Pundt? Der verschließt die Tür, ehe er den großen Koffer auf den Gepäckständer wuchtet, hängt den Lodenmantel über einen Bügel, melkt aus dem verdickten Mantelsaum schmutzige Wassertropfen heraus, die er mit einem Taschentuch aufnimmt, stutzt auf einmal und hebt gleichzeitig Reisetasche und Karton auf den Tisch.
Und Rita Süßfeldt stürzt mit einem angedeuteten Kuß an ihrer älteren Schwester Margarethe vorbei und wehrt jede Neuigkeit ab, indem sie die Hände kapitulationsbereit hebt: Jetzt nicht, Mareth, auch keine Heino-Geschichten, bitte halt ihn mir vom Leibe in den nächsten Stunden, denn ich muß arbeiten, ich muß mich noch vorbereiten; aber einen Tee könntet ihr mir bringen und zwei Scheiben Toast.
Und Janpeter Heller hebt ein Bein kreisend über die Stuhllehne und setzt sich und sackt zusammen vor den mehrfarbigen Ordnern mit Papieren, er bedeckt sein Gesicht mit den Händen und bietet jedem Beobachter das Beispiel eines zwar nicht aussichtslos, aber doch angestrengt nachdenkenden Mannes, bis er sich unerwartet aufsetzt, den Telefonhörer abhebt, wählt und, obwohl sich auf der Gegenseite niemand ausdrücklich gemeldet hat, mein Recht sagt, und dann: Ich hab doch wohl das Recht, das Kind wiederzusehen, wenn du schon nicht willst, also melde dich, ich hör doch deinen Atem, und außerdem warst du zu einem Treffen bereit – immer, wenn ich in dieser Stadt bin; also warum soll ich dich nicht besuchen?
Und der alte Pädagoge dröselt die verknoteten Schnüre auf, lüftet den Deckel des Kartons, beugt sich über den Inhalt, ohne etwas zu berühren oder herauszunehmen; vielmehr mustert er nur starr die kleinen Packen von Briefen und Fotografien, Schreibheften, die von Gummibändern zusammengehalten werden, sein Blick gleitet über den leeren Wechselrahmen, über das Bleistiftbündel und die Meerschaumpfeife mit dem zersplitterten Mundstück, und jetzt verschließt er den Karton, stellt ihn unter den Tisch, zögert und trägt ihn schließlich zum Schrank.
Und Doktor Süßfeldt fährt mit steifem Zeigefinger an dem Spalier der großen braunen Briefumschläge entlang, die wie Lohntüten auf einem Regal stehen, fischt sich einige Umschläge heraus und setzt sich an den bedrohlich zugewachsenen Schreibtisch, der ihr nur noch Beschäftigung im DIN-A4-Format zugesteht, steckt sich eine Zigarette an und liest, was sie selbst auf die braunen Umschläge geschrieben hat: III. Lebensbilder – Vorbilder.
Und nach dem dritten Versuch zu telefonieren – immer wurde abgenommen, nie hat sich eine Stimme gemeldet –, öffnet Heller den blaßgrünen Ordner, hebt einen handgeschriebenen Zettel ab, liest, ohne daß ihn die eigenen Worte erreichen: Fühle mit jedem, der Vorbilder nötig hat.
Und nach einem Schluck seines selbstgebrannten Korns zieht Pundt aus dem Hauptfach der Ledertasche die benötigten Manuskripte heraus und bleibt gleich bei dem Satz hängen, mit dem er selbst in seiner harten, steilen Schrift Bedenken gegen einen Vorschlag angemeldet hatte: Als Vorbild ungeeignet, da mehr- deutig.
Und Rita Süßfeldt nickt wie in abermaliger Bestätigung und bekennt sich zu der in privater Kurzschrift gemachten Notiz, daß von einem Vorbild zweierlei ausgehe: Verpflichtung und Herausforderung; diese Notiz wird unterstrichen werden.
Immer kürzer die Abstände, immer mehr geraten sie aneinander, nun, bei der Vorbereitung, sie sehen sich schon, sie hören bereits ihre Stimmen – Stimmen der Verteidigung, der Werbung, aber auch Stimmen des Zweifels und der Ablehnung –, jetzt schon, beim Sichten, beim Lesen und Wiederlesen, fühlt sich keiner von ihnen mehr allein, vielmehr umstellt und dauernd kontrolliert von den andern: sie wissen, daß alles schon begonnen hat.
2
Etwas näher zusammen, ruhig ein bißchen vorbeugen, die Papiere können so liegenbleiben: gleich zu Anfang wollen wir hier im Konferenzraum der Pension Klöver ein Erinnerungsfoto machen, mit Selbstauslöser, ja, ich habs gleich. Janpeter Heller blickt vom Sucher seines Fotoapparats auf, prüft und überprüft die von ihm arrangierte Gruppe, versetzt sich selbst neben Rita Süßfeldt und linst noch einmal, den Winkel erfragend und krausnasig, in den Sucher: der Gruppe fehlt etwas. Valentin Pundt fehlt etwas, der steif in hochgeschlossener Hausjacke dasitzt, starräugig und vorwurfsvoll, als wollte er das Objektiv einschüchtern; und Rita Süßfeldt fehlt etwas, da ihre sommersprossigen Hände sich anscheinend vervielfältigt haben und über dem breiten Palisandertisch ein Wurf- und Fangspiel mit dem letzten Ohrring vorführen. Was aber? Dies ist ja kein unmerklicher Augenblick, er besagt schon etwas, denkt Heller, und auf einmal tritt er an die sogenannte »Wand der Erinnerung«, sieht sich triumphierend um und pflückt da behutsam einige Waffen herunter, ein sehr dünnes Jagdmesser für Doktor Süßfeldt, eine Lanze für Valentin Pundt und für sich selbst einen Pfeil mit bleicher, vielfach gezackter Haifischzahn-Spitze: das ist schon besser, ein sichtbarer Ausdruck dafür, daß man nicht waffenlos zusammengekommen ist, doch wenn schon, dann möchte Rita Süßfeldt das Blasrohr. Heller zieht das Jagdmesser ein und reicht der Frau das Blasrohr.
So, und nun die persönliche Bewaffnung der Kamera vorzeigen, dieser Augenblick soll aufgehoben werden mit allem, was sichtbar ist, also auch mit den Papieren, Notizen, Büchern, und vielleicht, wenn die Aufnahme scharf genug gerät, wird sie für immer belegen, daß auf der ersten Sitzung ein Vorbild durchleuchtet oder vermessen wurde – es ist Hellers Vorschlag –, das in einer Geschichte von O.H. Peters entdeckt werden konnte. Das Manuskript liegt dreifach obenauf und heißt: Die Absage. Sie haben sie längst ausgetauscht und gelesen, sie haben die Geschichte längst abgeklopft, abgehorcht und mit Zettelchen gespickt, auf denen der diagnostische Befund festgehalten ist: kann man ihr Tauglichkeit bescheinigen? Volle Verwendungsmöglichkeit? Bedingte Verwendungsmöglichkeit? Lohnt überhaupt ihre Entdeckung?
Janpeter Heller kann sich jetzt ruhig mit seinem sprechenden, jedenfalls geständnisbereiten Erinnerungsfoto aufhalten – dies ist und bleibt sein Vorschlag, sein Beitrag, den er nach langen und enttäuschenden Streifzügen, auch nicht frei von Bedenken, hiermit anbieten möchte. Die Absage von O.H. Peters. Also:
Die Sprechstunde war vorbei. Nur noch ein Patient wartete draußen, er war angemeldet, seine Karteikarte lag bereits auf dem Tisch, doch bevor mein Vater ihn hereinrufen ließ, ging er wieder an den Medizinschrank und schenkte sich ein Glas ein. Und wie jedesmal, so wollte er auch diesmal mir ein Glas einschenken, doch ich lehnte ab. Es waren sehr kleine Gläser, er trank sie schnell aus und stand danach einen Augenblick stumm und mit offenem Mund da. Er wischte sich mit dem Handballen über die Lippen. Er zwinkerte mir zu. Er legte mir eine Hand auf die Schulter und stellte fest, wie gut mir der weiße Kittel paßte, den er mir geliehen hatte; sein Kittel. Nicht einmal dies brauchte sich zu ändern, sagte mein Vater: mit seiner Stellung als Vertrauensarzt könnte ich sogar seine Kittel übernehmen, wenn ich nur wollte. Ich sollte Schluß machen mit langer Fahrt, den Schiffsarzt an den Nagel hängen und übernehmen, was er sich geschaffen hatte in den Jahren: eine kleine, aber solide Privatpraxis und dies hier, die Stellung eines Vertrauensarztes bei einer Rentenbehörde. Fünf Jahre auf See sind genug, sagte er. An Bord gibt es keine Aufgaben für einen Mediziner, sagte er, zwischen Brest und Kapstadt wird einem Mediziner doch nur dies geboten: Blinddärme und abgequetschte Finger.
Ich verfolgte seine Bewegungen, sie waren genau und berechnet, es waren nicht die Bewegungen eines alten Mannes. Ich hörte auf seine Stimme, die immer noch so klang, wie mein Gedächtnis sie aufbewahrt hatte, mild und seimig, die Stimme eines Geistlichen. Und er hatte immer noch diesen abgleitenden Blick, als könnte er kein Gegenüber ertragen. Er war zuvorkommend. Er war scherzbereit. In den fünfziger Jahren hätte er in jedem deutschen Film den Hausarzt spielen können. Warum zögerst du, fragte er. Ist dir das nicht genug? Ich zuckte die Achseln. Ich sagte: Draußen wartet noch ein Patient – und mein Vater ging zur Tür und ließ ihn hereinrufen, während ich auf meinem Stuhl am Fenster sitzen blieb.
Mein Vater las die Karte des letzten Patienten. Er zerbiß dabei eine Pfefferminztablette. Er fächelte sich mit der Karte Luft zu. Dann trat der Patient ein, und mein Vater ging ihm entgegen und begrüßte ihn vertraulich, als wollte er ihm ein Bündnis anbieten, ein Bündnis gegen die Krankheit. Es war ein alter, mürrischer Patient, der an einem Stock ging. Er lehnte den Stock gegen den Schreibtisch und stülpte seine Mütze über den Knauf. Sein dünnes, aber langes Haar schob sich über den Jackenrand, als er sich setzte. Fordernd sah er meinen Vater an. Er hieß Boysen und arbeitete im Hafen. Wie fast jeden Patienten sprach mein Vater auch ihn im vertraulichen Plural an: Wo fehlt’s uns denn? Was können wir dagegen machen? Boysen zog den orthopädischen Schuh mit der hochgewölbten Kappe aus. Schweigend wickelte er Bandagen ab und einen grauen Verband. Mein Vater setzte einen Schemel hin, und Boysen hob seinen Fuß auf den Schemel. Der Fuß war blau angelaufen, über den Spann zogen sich gelbe Streifen, die Knöchel des deformierten und narbenbedeckten Fußes waren wundrot. Die Narben stammten von Geschossen. Boysen forderte meinen Vater mürrisch auf, sich »das einmal anzusehen«: die alte Verwundung und jetzt die Quetschungen an einer Luke. Er hatte Schmerzen. Er musterte meinen Vater aus schmalen, kalten Augen und verlangte zu wissen, warum man ihm immer mehr Prozente abstrich von seiner Erwerbsunfähigkeit. Nach dem Krieg waren es noch fünfundzwanzig Prozent, die sie ihm bei der Rente anrechneten, jetzt waren es nur noch fünfzehn. Und er sah den Tag voraus, an dem es noch weniger werden würden. Er forderte seine Prozente zurück, und mein Vater sollte ihm dabei helfen.
Mein Vater untersuchte den Fuß. Er strich behutsam den Spann hinab bis zu den Zehenstümpfen. Er bat Boysen, seinen Fuß fest aufzusetzen und einen Probeschritt zu machen; dabei wandte der Patient mir sein Gesicht zu und blickte mich feindselig und mißtrauisch an. Mein Vater sah sich die Röntgenaufnahmen an, die der Patient mitgebracht hatte, dann beklopfte er mit der Kuppe des Zeigefingers den Fuß und stellte durch massierende Bewegungen die Schmerzempfindlichkeit fest. Mit abgewandtem Blick sagte er voraus, daß die Schwellung bald zurückgehen werde, eine Entzündung ließe sich nicht nachweisen. Boysen sagte, daß ihm damit nicht geholfen sei, er verlangte eine gerechte Prozentzahl, was mit dem Fuß los sei, wisse er selber, das bekäme er zu spüren beim Gehen und Stehen. Ich konnte meinem Vater ansehen, daß die Untersuchung für ihn beendet war, der Befund feststand; trotzdem zögerte er, den Patienten zu entlassen. So machte er es immer. Indem er die Untersuchung in die Länge zog, zeigte er an, daß er alles berücksichtigen wollte, was zugunsten des Patienten sprechen könnte. Schließlich bat er mich, zu ihm zu kommen. Er forderte mich auf, Boysens Fuß zu untersuchen. Ich tat es und wollte zu meinem Stuhl zurückgehen, doch Boysen versperrte mir mit einer ausgestreckten Hand den Weg. Und Sie? fragte er, was schätzen Sie? Ist dieser Fuß nicht mehr wert als fünfzehn Prozent? Muß man da nicht etwas drauflegen? – Das sieht schlimm aus, sagte ich. Schlimm, wiederholte er geringschätzig, schlimm: dafür kann sich keiner was kaufen.
Mein Vater bat ihn, den Verband und die Bandagen wieder anzulegen. Er selbst setzte sich an den Schreibtisch und schrieb Buchstaben und Ziffern auf Boysens Karte. Also wieviel, fragte Boysen, wieviel hab ich zu erwarten? Ich weiß nicht, sagte mein Vater, das endgültige Resultat wird Ihnen brieflich zugestellt werden, brieflich, ja. – Mehr als diese schäbigen fünfzehn? fragte Boysen. Wir haben neue Richtlinien, sagte mein Vater, wir treffen alle Entscheidungen in Übereinstimmung mit unseren Richtlinien.
Schade, sagte Boysen, schade, daß man nie einen von denen zu Gesicht bekommt, die sich solche Richtlinien ausdenken. – Ich verstehe Ihre Erbitterung, sagte mein Vater. Ich wette, fuhr Boysen fort, daß keiner von denen auf eine Rente angewiesen ist. Richtlinien: dahinter geht man doch nur in Deckung. Ruhig gab mein Vater dem Patienten einen langstieligen Schuhanzieher. Er stützte ihn beim Anziehen. Er reichte ihm Stock und Mütze und begleitete ihn zur Tür. Wie lange wird’s dauern, fragte Boysen zum Abschied. Es hängt nicht allein von mir ab, sagte mein Vater.
Wir zogen die Kittel aus und hängten sie in den Schrank. Ich las die Karteikarte, versuchte die Eintragungen zu entschlüsseln, die mein Vater gemacht hatte. Das verstehst du nicht, sagte er, noch nicht. Und er sagte: wir müssen strenge Urteile fällen, mein Junge, es sind zu viele, die auf dieser Welle zu reiten versuchen. Er kann froh sein, wenn er seine fünfzehn Prozent behält. Du willst ihm nicht mehr geben, fragte ich. Mehr? sagte er. Hältst du mehr für angemessen? – Ja, sagte ich. Er nahm mir die Karteikarte aus der Hand und steckte sie in einen Kasten. Er legte mir eine Hand auf die Schulter. Sanft schob er mich zum Fenster. Unten auf der Straße stand Boysen und drohte mit dem Stock einem Radfahrer hinterher, bevor er durch den Regen tickend davonging. Du hast also noch nicht abgemustert, sagte mein Vater. Nein, sagte ich, wir sind ins Dock gegangen, und ich habe nur meinen Urlaub genommen. Aber du wirst abmustern, sagte er, jetzt wirst du es tun. – Warum? fragte ich. Jetzt wirst du hier gebraucht, sagte er.
Er war in Eile. Sie hatten ihn in ein Komitee gewählt, das einen Kongreß vorbereitete. Er mußte zur ersten Sitzung. Er wollte mich ein Stück im Auto mitnehmen, doch ich lehnte ab. Wir fuhren zusammen im ratternden Aufzug nach unten, und vor dem Eingang trennten wir uns. Ich ging durch den dünnen, sprühenden Regen in die Richtung, die auch Boysen eingeschlagen hatte. In den Anlagen saß ein Kerl auf einer Bank und schnitzte einen Namen in die Rücklehne: Paul war hier. Von hier aus konnte ich mein Schiff im Dock sehen. Die achteren Aufbauten ragten in hellem Grau über die rostfarbenen Dockwände empor. Eine kümmerliche Rauchfahne hing flach überm Schornstein. Ich fragte den Kerl nach der Karolinenstraße. Er wies mit dem Knauf des Messers zur Stadt hinauf, und ich folgte seinem Hinweis. Zweimal mußte ich noch fragen, dann fand ich die Karolinenstraße.
Ein leerer Kinderwagen stand im Flur, ein Fahrrad blockierte die Tür zum Keller. Obwohl es ein Neubau war, liefen Risse über die Flurdecke, und die gekalkten Wände waren gezeichnet von Schrammen und Kratzern. Vom Eisengeländer platzte die Ölfarbe ab. Ich las die Namen auf den Türschildern. Ein Junge, der lautlos erschienen war, beobachtete mich dabei, und er stieg mit mir hinauf, Stock für Stock, und hörte nicht auf, mich zu beobachten, bis ich den Namen fand und am altmodischen Klingelknopf drehte.
Seine Frau öffnete mir. Sie musterte mich weniger mißtrauisch als gereizt. Sie war schmal und flachbrüstig, unter ihren Augen lagen tiefe Schatten, ihre Lippen bewegten sich unaufhörlich. Ich fragte sie, ob ihr Mann zu sprechen sei, und sie sagte gereizt, daß er für niemanden zu sprechen sei, nicht einmal für sie selbst. Sie wollte die Tür schließen. Ich sagte: ich möchte Ihrem Mann einen Rat geben, weiter nichts, einen Rat, den er vielleicht gut gebrauchen kann. Sie ließ mich eintreten und schloß hinter mir ab. Sie ließ mich vorausgehen durch den trüben Korridor, an der Garderobe vorbei, an der nur Mützen hingen. Dort liegt er, sagte sie.
Boysen lag auf einem Sofa in der Küche. Neben dem Sofa stand eine gelbe Plastikschüssel, auf dem Herd zischte ein Wasserkessel; anscheinend bereitete er ein Fußbad vor. Er erkannte mich sofort. Er war nicht sehr überrascht, zumindest legte sich seine Überraschung schon nach kurzer Zeit. Seine Frau prüfte die Temperatur des Wassers im Kessel. Keiner von ihnen bot mir einen Platz an, keiner forderte mich auf, zu sagen, warum ich gekommen war. Hören Sie zu, sagte ich; ich war dabei, als Sie untersucht wurden. – Dann wissen Sie ja Bescheid, sagte er, und jetzt lassen Sie mich zufrieden, oder schulde ich Ihnen etwas? – Ich möchte Ihnen einen Rat geben, sagte ich, ich bin nur gekommen, um Ihnen einen Rat zu geben. – Mir? fragte er mißtrauisch und massierte seinen Fuß. Ich kenne Ihren Fall, sagte ich, und ich weiß, wieviel Ihnen daran liegt, Ihre fünfzehn Prozent zu behalten, wegen der Rente. Es ist nicht einmal sicher, ob es dabei bleibt, und deshalb bin ich zu Ihnen gekommen. – Behalten Sie Ihre Kenntnisse für sich, sagte er, und lassen Sie mich zufrieden: ich habe mir abgewöhnt, noch etwas zu erwarten. – Wir haben es uns abgewöhnt, sagte seine Frau, er und ich: mein Herzschaden wurde nicht anerkannt, und eines Tages wird auch sein Fuß nicht mal fünf Prozent wert sein. Wir haben es uns abgewöhnt, noch etwas zu erwarten.
Sie goß Wasser in die Schüssel. Ihre Hand rührte das Wasser. Vorwurfsvoll sah sie ihn an und stellte den Kessel auf den Herd zurück. Gehen Sie in die Bromberger Straße, sagte ich, Nummer zwölf, dort ist die Privat-Praxis. Melden Sie sich da als Privatpatient, ziehen Sie Ihr bestes Zeug an, lassen Sie sich noch einmal untersuchen von demselben Arzt. – Warum? fragte die Frau, warum soll er das tun? – Solche Ratschläge können Sie für sich behalten, sagte Boysen, und nun lassen Sie mich zufrieden. – Das Resultat wird günstiger ausfallen, sagte ich. Wenn Sie Wert darauf legen, daß Ihr Fuß etwas einbringt, dann tun Sie das, vielleicht können Sie Ihre Prozente sogar verbessern. Verschwinden Sie, sagte Boysen, ich hab Sie nicht gerufen. – Hören Sie nicht? sagte seine Frau. Wer sind Sie eigentlich? – Einer von diesen Prozenthändlern, sagte Boysen; er war bei meiner Untersuchung dabei. – Fang schon an, sagte die Frau gereizt und zeigte auf die Schüssel, fang an, sonst wird das Wasser wieder kalt.
Sie erwiderten nicht einmal meinen Gruß. Sie ließen mich gehen, und ich sperrte die Wohnungstür auf und ging hinaus. Ich fuhr zu meiner Pension am Dammtor. Es war für mich angerufen worden, ein Studienfreund hatte mich zum Essen eingeladen, und auch meine Reederei hatte anrufen lassen. Ich legte mich auf das Bett, sah auf das alte Marktbild aus Norddeutschland. Es war eine frühe Fotografie: Fischer verkauften Störfleisch von einem Leiterwagen. Nachdem ich einige Stunden geschlafen hatte, rief ich bei der Reederei an. Sie hatten eine Aufgabe für mich. Sie brauchten einen Arzt auf der Frisia, die eine Reise zu den Antillen machen sollte. Die Frisia war eine Neuerwerbung, und dies sollte ihre Jungfernfahrt nach dem Umbau sein. Ich sagte nicht zu, versprach aber, mir das Angebot zu überlegen. Und ich versprach ihnen, mich am nächsten Tag zu entscheiden.
Ich hatte noch nicht gefrühstückt, als mein Vater anrief. Er wunderte sich, daß ich meinen zweiten Urlaubstag fast ausschließlich in der Pension zugebracht hatte. Wieder versuchte er, mich zu überreden, doch nach Hause zu ziehen, ich lehnte ab. Solange Mutter im Sanatorium war, wollte ich nicht mit ihm in dem großen Haus wohnen. Er lud mich in seine Praxis ein. Er bestand darauf, mir die Neuerungen zu zeigen. Ich konnte es ihm nicht abschlagen, und nach dem Frühstück fuhr ich hinaus in die Bromberger Straße. Seine Privatpraxis lag in einem Villenparterre, es war ein Klinkerbau, den alte Rotbuchen umgaben. Als ich durch den Garten ging, winkte er mir aus dem Fenster; durch seine »geheime« Tür konnte ich gleich zu ihm. Er hatte uns Kaffee kochen lassen, und dazu bot er mir wieder ein öliges Getränk in sehr kleinen Gläsern an, die er im Schreibtisch verwahrte. Ich ließ es bei Kaffee, und ich ließ ihn sprechen: von seinem Alter, von dem, was er erreicht hatte, und von der Notwendigkeit, sein Werk zu übernehmen und fortzusetzen. Der Tisch ist hier bereitet, mein Junge, sagte er, du brauchst nur an ihm Platz zu nehmen, du allein. Wer sonst soll ihn erben?
Immer, wenn er einen Patienten empfing, ging ich in ein Nebenzimmer und beobachtete die Fische in einem Aquarium. Ich gab ihnen Trockenfutter. Ich säuberte das Aquarium von Algen und zog den Sauger über den Grund. Dann rief er mich wieder zu sich und fuhr fort, wo er aufgehört hatte: Draußen auf See gibt es keine Aufgaben für einen Mediziner; häng den Schiffsarzt an den Nagel; übernimm das, was ich erreicht habe. Er wiederholte sich unaufhörlich. Er gab’s nicht auf, mir die Vorteile auszubreiten. Die entscheidende Frage aber zögerte er immer noch hinaus. Wieder kam ein Patient, wieder ging ich ins Nebenzimmer. Wie unvermutet die Fische nach der Beute schnappten! Zuerst sah es so aus, als wollten sie vorbeischwimmen. Gleichgültig und gar nicht zielbewußt kamen sie näher. Plötzlich peitschten sie nach vorn, krümmten sich, stießen kraftvoll zu und schnappten sich ihren Teil. Ich beugte mich über das Aquarium. Ich stupste einen fast durchsichtigen Fisch mit dem Schlammabsauger, da ging die Tür zum Korridor. Als ich mich umwandte, wurde die Tür bereits wieder geschlossen, dann jedoch, in überraschendem Entschluß, noch einmal geöffnet.
Auf der Türschwelle stand Boysens Frau. Sie trug ein Kostüm und eine schwarze Lacktasche. Sie entschuldigte sich. Ich hab den Ausgang nicht finden können, sagte sie. Ich zeigte in die Richtung, wo der Ausgang lag, und ging unwillkürlich auf sie zu. Was machen Sie hier? fragte sie. Besuch, sagte ich, ich bin hier nur zu Besuch. Sie lächelte vorsichtig. Sie sah aus, als ob sie sich Hoffnungen machte auf etwas. Sind Sie schon drin gewesen? fragte ich und nickte zum Sprechzimmer hinüber. Jetzt haben wir es, sagte sie, was festzustellen war, ist festgestellt, jetzt muß ich nur noch zum Röntgen. Dies ist mein letzter Versuch. Sie zog die Tür zu und wandte sich zum Ausgang.
Mein Vater erwartete mich hinter seinem Schreibtisch. Er bot mir einen Platz an. Er erhob sich, als ich meinen Regenmantel aus dem Schrank nahm. Du willst gehen? fragte er. Sie haben einen Auftrag für mich, sagte ich; sie brauchen einen Arzt auf der Frisia, die eine Reise zu den Antillen macht. – Aber doch nicht heute, sagte er. In der kommenden Nacht, sagte ich, aber vorher muß ich noch in meine Pension.
Dies also, Die Absage, ist und bleibt Janpeter Hellers Vorschlag für den dritten Abschnitt des Lesebuchs, sein Beitrag, den er in einem Sammelband aufgestöbert hat und verteidigt gegen Pundts bedächtige Einwände, gegen Doktor Süßfeldts hartnäckige Nachfragen, während draußen der erwartete Schneeregen die Alster unkenntlich macht und hier im Konferenzraum zum zweitenmal Magda erscheint, das finstere Hausmädchen der Hotel-Pension Klöver, um eine Portion Tee mit Rum, einen Kaffee und einen Apfelsaft zu servieren. Die Waffen, die Heller sich für das Erinnerungsfoto ausgesucht hatte, hängen wieder an der Wand, bis auf den Pfeil mit der gezackten Haifischzahn-Spitze, den wiegt er in der Hand, den gebraucht er zu gedankenlosen Zielübungen, mitunter skandiert er mit ihm die eigene Rede. Brennt eigentlich Licht? Es brennt kein Licht. Magda hat es zwar eingeschaltet bei ihrem Eintritt, doch Heller hat es wieder ausgemacht, weil die Dämmerung, die Schummrigkeit, die dauerhafte Novembertrübnis ihnen nicht nur ausreichend, sondern auch förderlich erscheint bei ihrer Aufgabe.
Also dieser namenlose Schiffsarzt: von ihm möchte Rektor Pundt, die schweren Pädagogenhände ruhig auf dem Tisch zusammengelegt, noch etwas mehr erfahren, denn nach allem, was er aus der Geschichte von O.H. Peters herausgelesen habe, erkenne er noch nicht, was den Schiffsarzt als Vorbild geeignet erscheinen lasse. Man möchte ihm eine Zusammenfassung erlauben, ihn unterbrechen, falls es notwendig sei.
Da sei also ein junger Schiffsarzt, der das Angebot erhält, die Privatpraxis seines Vaters und gleichzeitig dessen Stellung als Vertrauensarzt einer Rentenbehörde zu übernehmen – ein warmes und sozusagen gut gepolstertes Nest. Bevor er sich entscheidet, entdeckt er, daß sein Vater Krankheit mit zweierlei Maß mißt, daß der Vertrauensarzt schematisch verweigert, was der Privatarzt freundlich zugesteht; und diese Entdeckung genügt dem Schiffsarzt, läßt ihn auf das Angebot verzichten. Er geht wieder auf ein Schiff. Absage also, Weigerung, Verzicht: aber reiche das schon aus, um vorbildhafter Haltung zu entsprechen? Er, Valentin Pundt, übersehe nicht, daß dieser Schiffsarzt auch handelt, etwa, indem er Boysen einen Tip dafür gibt, wie man sich durch List seine Gerechtigkeit zurückholen kann, aber all das reiche nicht hin, sei zu mager, lasse viel zu wünschen übrig. Zum Beispiel eine außergewöhnliche Lage. Ein unerhörtes Dilemma. Eine herausfordernde Wahl. Soll darin vielleicht die Lehre eines Vorbilds liegen, daß man sich entzieht? Einfach nur nein sagt und den Seesack schultert? Janpeter Heller möge es ihm nicht übelnehmen, aber soviel Plätze hat die Marine nun auch wieder nicht frei.
Rita Süßfeldt, nie locker entspannt, immer wenn auch in unscheinbarer Bewegung, nimmt eine neue Zigarette aus der geöffnet daliegenden Schachtel, zündet sie an dem Glutklumpen einer Kippe an, streicht ihren Rock glatt über den festen, fleischigen Schenkeln. Jetzt möchte sie etwas sagen. Welch eine Verpflichtung denn von diesem Vorbild ausgehe, möchte sie wissen, welch ein Beispiel es setze, wofür es stehe. Dieser Schiffsarzt entscheidet sich für den Abschied, für geordnete Flucht. Gut. Aber ist das genug? Sie bittet sich vorzustellen, was geschähe, wenn jeder nach einer verdrießlichen Erfahrung keinen anderen Ausweg wüßte, als seinen Hut zu nehmen. Davongehen: sei das nicht das typische Verlangen der Lauen, der Schmollenden, jedenfalls von Leuten, die sich den Luxus eines guten Gewissens durch Teilnahmslosigkeit bewahren möchten? Ihr, Doktor Süßfeldt, könne dieser Schiffsarzt nicht imponieren. Ja, wenn er geblieben wäre! Wenn er das Angebot seines Vaters angenommen hätte! Und wenn er dann, auf jedes Risiko hin, versucht hätte, die Verhältnisse zu ändern! Bleiben: darin liege das größere Wagnis, aber auch die größere Möglichkeit. Ein Vorbild, das eine Fahrkarte in der Tasche trägt? Undenkbar, jedenfalls für sie, Rita Süßfeldt, die jetzt bedauernd die Schultern hebt, Heller zulächelt und etwas leiser mit abschließendem Zweifel feststellt, daß man dem siebten bis neunten Schuljahr solch ein Vorbild ja wohl nicht auftischen könne.
Nun ist Heller dran – das heißt zuerst der Korbsessel, in dem er sich ruckhaft bewegt, was ein Knirschen und Knistern zur Folge hat, gerade so, als liefe ein kleines Feuer durch dünnes Unterholz –, und er setzt sich auf, mißmutig, doch gelassen, und tippt mit der Pfeilspitze auf seinen Beitrag: er sei nicht überrascht, mit dieser Mißdeutung habe er sogar gerechnet, denn sei es nicht immer so, daß, wenn drei sehr unterschiedliche Leute ein und dieselbe Geschichte lesen und wiedererzählen – daß dann bei der Wiedererzählung der Eindruck entstehe, es handle sich um drei verschiedene Geschichten? Das sei rechtmäßig, das sei ganz in Ordnung. Aber wundern müsse er sich doch darüber, wie der Kern unentdeckt bleiben konnte, das Zentrum, das – er möchte es mal so sagen: unscheinbare, aber herausfordernde Symbol. Die Absage heiße die Geschichte, nicht wahr? Sie könne mit dem gleichen Recht Die Kündigung heißen. Was dem jungen Schiffsarzt nämlich angeboten werde, das sei ja nicht weniger als ein sorgloses, paradiesisches Wohlleben, der Herr habe ihm alles bereitet, nur wegsehen müsse er, nicht weiterforschen und alle Fragen unterdrücken: dies sei der Preis. Mit einem Fuß stehe dieser Schiffsarzt bereits im väterlich bestellten Garten, doch dann werde er von einem Wissen unterwandert, das ihm keine Wahl lasse: er entscheide sich für Unsicherheit, für das Risiko, vor allem aber für Unabhängigkeit. Er kündige. Wie das nur habe unentdeckt bleiben können! Da bemerkt Valentin Pundt trocken, daß das ja auch an O.H. Peters liegen könne, und Rita Süßfeldt, die Möglichkeiten des achten Schuljahres im Auge, fragt sich, ob das Paradies auf jeden Fall eine belastende Adresse darstelle und ob ein Vorbild da unter allen Umständen ausziehen müsse.
Janpeter Heller wirft den Pfeil auf die Manuskripte, steht auf, umrundet langsam den Tisch, trinkt im Stehen einen Schluck Kaffee und setzt die Tasse hart ab. Sammelt er sich? Holt er aus? Jedenfalls bietet er den Anblick eines Mannes, der sich sammelt und vorbereitet, um etwas Fälliges loszuwerden, etwas längst Erwartetes. Er zieht den weinroten Pullover in die Länge, beweist der Wolle ihre Dehnbarkeit; dann geht er auf seinen Platz zurück und stellt fest, was vor allem Anfang hätte festgestellt werden müssen: die Anmaßung nämlich, die darin liegt, Vorbilder auszusuchen, sie im Lesebuch unterzubringen und jungen Menschen zu servieren – hier habt ihr euern Leonidas, euern Doktor Schweitzer, eifert ihm nach. Wenn Sie mich fragen: Vorbilder sind doch nur eine Art pädagogischer Lebertran, den jeder mit Widerwillen schluckt, zumindest mit geschlossenen Augen. Die erdrücken doch den jungen Menschen, machen ihn unsicher und reizbar und fordern ihn auf ungeziemende Weise heraus. Vorbilder im herkömmlichen Sinn, das sind doch prunkvolle Nutzlosigkeiten, Fanfarenstöße einer verfehlten Erziehung, bei denen man sich die Ohren zuhält. Alles, was sich von den Thermopylen bis nach Lambarene überlebensgroß empfiehlt, ist doch nur ein strahlendes Ärgernis, das nichts mit dem Alltag zu tun hat. Peinliche Überbautypen, um es mal so auszudrücken. Und wenn er, Heller, mal ganz bekenntnishaft werden dürfe: wer heute das Kapitel »Vorbilder« behandeln wolle, sollte nicht von exemplarischen Situationen, sondern vom Alltag ausgehen, von beispielhaftem Verhalten im Alltag. Nicht dröhnende Entscheidungen, sondern die unscheinbare, die zivile, die leise und dennoch nutzbringende Tat: die möchte er, wenn überhaupt, in einem Lesebuch ausgebreitet sehen, und deshalb habe er Die Absage vorgeschlagen. Nun hoffe er, daß man ihn verstanden habe.
Valentin Pundt hat ihn auf seine Weise verstanden, er antwortet zunächst mit einer bedächtigen Geste in Brusthöhe, einer schräg abwärts geführten Geste, die bekanntgibt, daß er etwas sogleich abgeschnitten oder weggewischt haben möchte, zum Beispiel den Eindruck, daß es hier um Persönliches gehe, oder daß womöglich ein verworfener Text einer persönlichen Niederlage gleichkomme. Wir sind hier, sagt Pundt, um zu erfragen, welche Vorbilder heute noch taugen, und um uns schließlich darauf zu einigen, was wir aus dem »gewonnenen Angebot« in das Lesebuch aufnehmen. Vielleicht gelingt es uns, ein Vorbild gemeinsam herzustellen, sagt Rita Süßfeldt. Jedenfalls, sagt Pundt, kann behauptet werden, daß die Jugend nach Vorbildern verlangt; unsere Aufgabe ist es, ihr die Vorbilder zu zeigen, die unserer Zeit entsprechen. – Und die unwillkürlich verpflichten und herausfordern, sagt Doktor Süßfeldt. Oder die auf Möglichkeiten einer Bewährung hinweisen, sagt Valentin Pundt. Wobei das Vorbild selbst durchaus problematisch, also menschlich sein soll, sagt Rita Süßfeldt. Ich denke an einen Maßstab für Augenblicke der Ungewißheit, sagt Pundt, an eine Hilfe bei Entscheidungen, und ich denke an den Zwang zum Vergleich: das Hervorragende sollte zum Vergleich einladen. Das Hervorragende ist asozial, sagt Heller, es belastet sich selbst; mit dem Hervorragenden kann sich niemand solidarisieren. Da möchte Rita Süßfeldt mit Recht wissen, was sich denn überhaupt noch als Vorbild verwenden läßt, und Pundt muß unwillkürlich zustimmen durch gleichmäßiges, lang andauerndes Nicken.