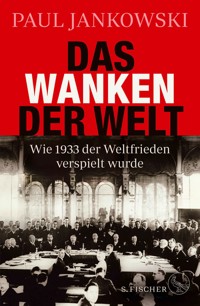
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Thriller der internationalen Diplomatie, der zwischen Februar 1932 und Oktober 1933 spielt – der Historiker Paul Jankowski erzählt die Geschichte vom Versagen der weltweiten Staatengemeinschaft, die Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges. Die Welt lief aus dem Ruder im Winter 1932/33. In Deutschland ergriff Hitler die Macht, Mussolini schielte nach Afrika, Japan griff China an und verließ den Völkerbund. In Frankreich gab es drei Regierungswechsel, die USA unter Roosevelt versuchten, die Weltwirtschaftskrise im Alleingang zu bewältigen. In einer fesselnden Erzählung schildert Paul Jankowski, wie die Welt durch nationalen Egoismus endgültig ins Wanken geriet. Jeder kämpfte gegen jeden, die große Genfer Abrüstungskonferenz scheiterte grandios, weltweit gelangten Autokraten und Diktatoren an die Macht. Ein spannendes Porträt der Weltpolitik in den 1930er Jahren – die Geschichte eines zerrissenen Jahrzehnts, das in den Zweiten Weltkrieg mündete. Mag es auch verwegen sein, Parallelen zu ziehen: Die Folgen des damaligen Scheiterns zeigen sich bis heute überall auf der Welt in unversöhnlichem Hass und wiederkehrender Gewalt. »Kenntnisreich und farbig geschrieben, ist diese Geschichte eine Warnung davor, der Aggression von Staaten nichts entgegenzusetzen.« Publisher's Weekly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 889
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Paul Jankowski
Das Wanken der Welt
Wie 1933 der Weltfrieden verspielt wurde
Über dieses Buch
Ein Thriller der internationalen Diplomatie, der zwischen Februar 1932 und Oktober 1933 spielt - der Historiker Paul Jankowski erzählt die Geschichte vom Versagen der weltweiten Staatengemeinschaft, die Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges.
Die Welt lief aus dem Ruder im Winter 1932/33. In Deutschland ergriff Hitler die Macht, Mussolini schielte nach Afrika, Japan griff China an und verließ den Völkerbund. In Frankreich gab es drei Regierungswechsel, die USA unter Roosevelt versuchten, die Weltwirtschaftskrise im Alleingang zu bewältigen.
In einer fesselnden Erzählung schildert Paul Jankowski, wie die Welt durch nationalen Egoismus endgültig ins Wanken geriet. Jeder kämpfte gegen jeden, die große Genfer Abrüstungskonferenz scheiterte grandios, weltweit gelangten Autokraten und Diktatoren an die Macht.
Ein spannendes Porträt der Weltpolitik in den 1930er Jahren – die Geschichte eines zerrissenen Jahrzehnts, das in den Zweiten Weltkrieg mündete. Mag es auch verwegen sein, Parallelen zu ziehen: Die Folgen des damaligen Scheiterns zeigen sich bis heute überall auf der Welt in unversöhnlichem Hass und wiederkehrender Gewalt.
»Kenntnisreich und farbig geschrieben, ist diese Geschichte eine Warnung davor, der Aggression von Staaten nichts entgegenzusetzen.« Publisher’s Weekly
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Paul Jankowski, Jahrgang 1950, ist Ray Ginger Professor für Geschichte an der Brandeis University in Boston, USA. Er wuchs auf in Genf, New York und Paris und studierte und promovierte am Balliol College in Oxford. 2015 erschien bei S. FISCHER seine große Gesellschaftsgeschichte der Schlacht von Verdun: »Verdun. Die Jahrhundertschlacht«, ausgezeichnet von der World War I Historical Association 2014 als bestes Buch zum Thema. »Das Wanken der Welt« war eines der 10 besten Geschichtsbücher 2020 in der »Financial Times«.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Deutsche Erstausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die englischsprachige Ausgabe erschien 2020 unter dem Titel »All Against All. The Long Winter of 1933 and the Origins of the Second World War« bei Profile Books Ltd., London, und HarperCollins Publishers, New York.
© 2020 Paul Jankowski
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114,
D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg
Coverabbildung: ullstein bild – IBERFOTO
(Das Cover-Foto entstand möglicherweise während der Genfer Abrüstungskonferenz, die am 2.2.1932 begann. Allerdings ist in der Mitte Aristide Briand zu sehen, der am 7.3.1932 nach längerer Krankheit verstarb. Es könnte daher auch ein Foto einer Völkerbund-Sitzung aus den späten 1920er-Jahren sein.)
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490232-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Zum Geleit
Genf und Schanghai
1 Heuschreckenjahre
2 Tokio und Rom
3 Berlin
4 Moskau
5 New York
6 Paris und London
7 Warschau und Budapest
8 Türen öffnen sich – einen Spaltbreit
9 Japan schließt eine Tür
10 Das Reich in den Augen des Auslands
11 Komplizen wider Willen
12 Washington schließt eine weitere Tür
Genf
Bildteil
Dank
Anmerkungen
Quellen und Literatur
Register
Zum Geleit
Mitunter werde ich gefragt, womit ich mich als Historiker gerade beschäftige. Mit dem Augenblick in den 1930ern, antworte ich dann, in dem die Weltmächte und einige der kleineren Staaten sowohl der »Weltordnung« – oder was davon noch übrig war – als auch einander den Rücken kehrten. »Hört sich ganz nach heute an«, meint mein Gegenüber dann oft.
Ich bin mir da nicht so sicher. Zwischen Herbst 1932 und Anfang Sommer 1933 kam Hitler an die Macht, Japan schickte Truppen über die Chinesische Mauer und trat aus dem Völkerbund aus, Mussolini schielte südwärts nach dem Horn von Afrika, Roosevelt, eben zum Präsidenten gewählt, sorgte mit seiner Isolationspolitik für eine Vertiefung der Kluft zwischen den USA und Europa, die Briten zogen sich in den Schutz ihres Empires zurück, und Frankreich sah, wie gleich drei Premiers erfolglos versuchten, seine beiden früheren Verbündeten in den magischen Kreis der Sieger von 1918 zurückzuholen. Stattdessen gerieten die drei ehemaligen Alliierten in einen erbitterten Streit um Kriegsschulden, Waffen, Währungen, Zölle und das Deutsche Reich. Nicht zum ersten Mal. Diesmal aber waren trotz jahrelanger gemeinsamer Vorarbeit unter der Ägide des Völkerbunds gleich zwei Weltkonferenzen gescheitert, die eine zur Abrüstungsfrage, die andere zur Sanierung der Weltwirtschaft. Mauern gingen hoch, wohin man auch blickte. In diesem langen Winter schlug die Nachkriegswelt endgültig in eine Vorkriegswelt um. Hört sich das wirklich nach heute an? Ich bin mir da, wie gesagt, nicht so sicher.
Der Glaube an eine Fragmentierung der Welt sitzt tief. Hinter ihm steht die Annahme, dass zentrifugale nationalistische Kräfte wiedererstarken und gegen die Schimäre globaler Integration konspirieren, die naiven Gemütern nach dem Ende des Kalten Krieges den Kopf verdrehte. Darüber hinaus beschwört die finstere Parabel der 1930er-Jahre den Aufstieg autoritärer Bewegungen und ihrer demagogischen Führer nebst einem Heer wirtschaftlich Unzufriedener, das sie mutmaßlich stützte. Beinahe, als besäßen sie Endgültigkeit, reihen die Gewissheiten sich aneinander. Nationalismus, Autoritarismus, soziale Ressentiments – dergestalt nimmt sich die dämonische Triade aus, die heute rund um den Globus zu beobachten ist, sich in aller Welt bemerkbar macht und die man im fernen Spiegel von W.H. Audens »elender, ehrloser Zeit« reflektiert wähnt.
Historische Analogien sind leicht zu entkräften. Die unsere basiert auf verworrenen Annahmen über die Welt von damals wie die von heute. So hat in einigen Ländern die wirtschaftliche Katastrophe der frühen 1930er-Jahre in der Tat dazu beigetragen, dass eigentlich unbedeutende faschistische Parteien sich zu Massenbewegungen aufblähten. In den Vereinigten Staaten und Frankreich jedoch brachte sie sozialdemokratische Regierungen der linken Mitte an die Macht. Und bis vor kurzem noch konnten im Geruch einer Blutsverwandtschaft mit denen der 1930er-Jahre stehende »Nationalpopulisten« oft gerade in den wohlhabendsten Ländern Erfolge verbuchen, während sie sich in anderen, in denen schleppendes wirtschaftliches Wachstum und hohe Arbeitslosigkeit herrschen, eher schwertun. Die meisten der autoritären Regierungen der 1930er-Jahre waren bei Ausbruch der Weltwirtschaftskrise bereits an der Macht und versuchten die ungebärdigen Faschisten – wenigstens eine Zeitlang – von den Regierungsgeschäften fernzuhalten. Mit zur lautesten ethnisch beziehungsweise rassisch motivierten Panikmache kam es in den demokratischsten Kulturen. Das Modell scheitert an seiner eigenen Reichweite. Es führt zum ewigen Streit zwischen dem Historiker, der den Wald vor Bäumen nicht sieht, und dem Politikwissenschaftler, der den Wald, aber keine Bäume zu sehen vermag.
Bedürften wir zur Erhellung unserer gegenwärtigen Dilemmata unbedingt einer historischen Analogie, so wäre die Welt um 1900 dazu wahrscheinlich besser geeignet als die der 1930er-Jahre. Anfang des 20. Jahrhunderts erbrachten die transnationalen Bewegungen von Menschen, Gütern und Kapital neben einer globalen Integration auch protektionistischen Eifer, die Heraufbeschwörung der »gelben Gefahr«, die Propagierung von White Australia und France d’abord, die Ausschließungsgesetze in den USA, pangermanische Phantasien in Berlin und Wien. Die Großmächte sorgten sich um ihre Stellung im kommenden Jahrhundert. Die neue Schule der Geopolitik erblickte das Licht der Welt. Der Nationalismus hatte der Globalisierung viel zu verdanken. Das gilt auch heute noch.[1]
Wie dem auch sei, niemand, der heute Zeitung liest, kann sich hier und da eines gewissen Schauers erwehren, schlägt er ein Blatt aus den 1930er-Jahren auf. Wie heute nutzten Demagogen bei ihrem Griff nach der Macht oder deren Erhalt nationale oder ethnische Animositäten; der Internationalismus gleich welcher Ausprägung – Weltkörperschaften, transnationale Zusammenschlüsse, Zivilgesellschaft, Weltrevolution, Freihandel, offene Grenzen, kollektive Sicherheit oder die klare Absage an jegliche Rivalität zwischen den Großmächten –, dieser Internationalismus wurde Opfer der schneidenden Rufe nach dem nationalen Primat. Zuweilen, wenn auch nicht immer, gingen derlei Rufe einher mit Angriffen gegen die Demokratie; zuweilen, wenn auch nicht immer, nützten sie den Demagogen. Unterschiedliche Staaten und Regime, von Moskau über Washington bis Tokio, folgten diesen Rufen auf unterschiedliche Weise. Autoritäre Persönlichkeiten, die sich gegen multilaterale Zwänge von außen ebenso sträuben wie gegen Verfassungen und abweichende Meinungen zu Hause, mögen eher geneigt sein, dem Ruf der 1930er-Jahre – »Jeder für sich!« – zu folgen, aber damals waren sie nicht die Einzigen.
Für einige Beobachter, insbesondere die sogenannten Realisten, sind die sechzig oder siebzig Jahre relativen Friedens und Wohlstands, die wir im Westen seit 1945 unter amerikanischer Ägide hatten, eine Anomalie, ein historischer Zufall, der sich kaum wiederholen wird.[2] Nichts an der politischen Landschaft der 1930er-Jahre vermöchte die Realisten unter den Theoretikern internationaler Beziehungen heute zu überraschen – außer vielleicht die Menge an Tinte, die man auf Lamentos über diese Epoche verschwendet hat. In seiner elementarsten Form zeichnet der Realismus die Welt von Haus aus in dieser Weise: als anarchische Menagerie von Staaten im ständigen Gerangel um Macht, Sicherheit oder ihren jeweiligen Vorteil.[3] So unterschiedlich auch immer die Realisten ihre Landsleute behandeln, so fremd sie einander zu Hause erscheinen mögen – tun sie den Schritt nach draußen und betrachten einander, so gehorchen sie alle ein und derselben Logik, zwingt ihnen die Welt hier doch ihre absolute Indifferenz gegenüber jedweden Regeln auf. Sie sehen sich von ihr zum Wettbewerb verurteilt; wenn auch nicht notwendigerweise zum Krieg gegeneinander, da ihnen immer noch die Zuflucht zu Instrumenten bleibt, mit denen sich Bedrohungen wie die der Unterwanderung oder der Unterwerfung neutralisieren lassen. So können etwa zum Beispiel kleinere Staaten für einen Ausgleich sorgen, indem sie das Kräftegleichgewicht durch Zusammenschluss manipulieren, um der Herausbildung einer Hegemonialmacht in ihrer Mitte vorzubeugen; oder Staaten schrecken ihre gierigeren Nachbarn durch eine offen zur Schau getragene Kriegslust ab; darüber hinaus kann man sich heimlich zusammentun, um einen unverbesserlichen Störenfried in sich zu spalten oder zu eliminieren. Eine Garantie freilich bieten diese Methoden nicht. Der Realismus, nach wie vor die dominante Erklärung für das Verhalten einer Nation gegenüber den anderen, präsentiert eine Welt, anarchisch und kalkulierbar zugleich, in der den scharfsichtigeren unter den Chronisten launische Zufälle die wiederkehrende Sequenz von Bedrohung und Reaktion zu enthüllen vermögen.
So einige taten dies bereits unbewusst, schon bevor Realismus, Neorealismus und ihre Spielarten eine Prämisse in den Stand einer zunehmend anspruchsvollen Theorie erhoben. Gefeierte Darstellungen der Geschichte traditioneller Diplomatie präsentierten Krieg, Frieden und alles dazwischen als Ergebnisse des Ringens moderner Staaten um Überleben, Expansion oder Ruhe. »In dem von Hobbes imaginierten Naturzustand«, so begann eine von ihnen, »ist Gewalt das einzige Gesetz und das Leben ›ekelhaft, tierisch und kurz‹. Auch wenn der Einzelne nie in diesem Naturzustand existiert hat, für die Großmächte Europas gilt das sehr wohl und von Anfang an.«[4] Zweieinhalb Jahrtausende zuvor bereits hatte Thukydides den Mächten seiner Zeit in etwa dasselbe unterstellt.[5] Weder er noch seine Nachfolger wussten etwas vom realistischen Denken in Bezug auf internationale Beziehungen, zu schweigen von Theorien der rationalen Entscheidung oder der Spieltheorie, in der es in jüngerer Zeit teilweise aufgegangen ist; gemeinsam jedoch war ihnen eine hobbessche Prämisse bezüglich einer primitiven Anarchie in der Welt, die es irgendwie im Zaum zu halten galt, damit der Krieg aller gegen alle nicht einmal mehr zum Zuge kam.
Ebendiese Aussicht plagte die Zwischenkriegsjahre. Köpfe, die in den 1920er-Jahren auf den Großen Krieg als Abstieg in atavistische Zwietracht zurückgeblickt hatten, sahen in den 1930ern einem gar noch verhängnisvolleren Rückfall entgegen: dem Abstreifen jedweder verbliebener Hemmnisse gegenüber menschlicher Barbarei. Immer wieder warnten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vor dem Ende der Zivilisation. Den Völkermord sah merkwürdigerweise niemand voraus, sehr wohl aber die chemische Kriegführung und ein von Bombern verfinstertes Firmament – zwei der Innovationen des vorhergehenden Konflikts. Zugrunde zu liegen schien alledem die drohende Gefahr eines erneuten Aufflammens weltweiter Anarchie. Arnold Toynbee war nach einem eingehenden Blick auf die öffentliche Meinung des Jahres 1936 so resigniert wie entsetzt zu der düsteren Prognose gelangt, dass eine Situation, die nun vierhundert Jahre währte, durchaus weitere vierhundert Jahre anhalten könnte. Kurzfristig sah er eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass »die neue internationale Ära (falls sie denn tatsächlich neu war) auf dieselbe katastrophale Art wie ihre Vorgängerin im 19. Jahrhundert zu Ende kam«.[6]
Ob er sich nun, wie seine klassischen Vorläufer, dafür aussprach, aus der Not eine Tugend zu machen, oder ob er, wie es seine strukturell ausgerichteten Vertreter taten, die unerbittlichen Zwänge einer anarchischen Welt enthüllte, der Realismus empfahl die Wahrung des Gleichgewichts der Kräfte nicht nur, er sagte sie auch voraus.[7] Er sah eine unablässige Folge immer wieder aufs Neue geschaffener Kräftegleichgewichte in einer multipolaren, ja für einige sogar bipolaren Weltordnung, ohne sich um eine Erklärung für ihr Gedeihen oder Verkümmern zu bemühen oder dafür, ob Konflikte aus ihrer Entstehung oder aus ihrer Auflösung erwuchsen. In einem der Organisationstheorie entlehnten Schema würde dem Realismus zufolge alles bestimmten ungeschriebenen Regeln gehorchen, insofern die schwächeren Staaten es den erfolgreichsten gleichzutun versuchen. Nur trat in den Zwischenkriegsjahren dergleichen nicht ein. Die Bündnisse, die den Großen Krieg über gehalten hatten, lösten sich nach Kriegsende nach und nach auf, und kein neues nahm ihren Platz ein. Obwohl Großbritannien Deutschlands Rehabilitation zu befördern versuchte, während Frankreich ihr mit zunehmender Dringlichkeit Einhalt zu gebieten trachtete, kam jenes Irrlicht namens Gleichgewicht der Kräfte nie zustande. Die Sowjetunion, die morgens jedwedes Bündnis europäischer Mächte zu konterkarieren, mittags eines gegen Deutschland zu bewirken und abends selbst eines mit dem Reich zu schließen versuchte, schien der realistischen Logik am treuesten anzuhängen; aber es handelte sich hier um taktische Mittel, die ihr die eigene Militarisierung erlaubten, mit der man vor allen anderen Mächten begann. Und die Vereinigten Staaten interessierte ein Gleichgewicht der Kräfte erst gar nicht, egal welcher Art.
Später versuchten die Realisten die Instabilitäten der Zwischenkriegswelt strukturellen Mängeln zuzuschreiben – indem sie zum Beispiel erklärten, dass sich kein System herausgebildet habe, das den Frieden hätte bewahren können, wie es 1815 auf dem Wiener Kongress mit dem »Konzert der Mächte« erfolgt war, oder dass keine Weltmacht den Platz eingenommen habe, den Großbritannien im vorigen Jahrhundert innegehabt habe, oder dass die tripolare Welt vor dem Zweiten Weltkrieg eben gefährlicher gewesen sei als die bipolare danach.[8] Alle diese strukturellen Mängel waren ihrer Ansicht nach dazu angetan, einen weltweiten Zusammenstoß zu beschleunigen – in etwa so, wie ein Heer zu einer Bande von Plünderern verkommt, ist eine Stadt erst mal überrannt. Nur warum kam ein Konzert der Mächte nicht zustande? Warum wollten die Männer, die 1919 aus Versailles zurückkehrten, ein solches nicht im selben Maße wie ihre Vorgänger ein Jahrhundert zuvor in Wien? Und die Welt zwischen den Kriegen war auch keine tripolare; ihre Pole waren vielmehr in ständiger Veränderung begriffen hinsichtlich Zahl und Gewicht – Variablen, die der strukturelle Realismus zwar einräumt, aber nicht weiter erklärt.
Als Theorie erklärte der Realismus diese Welt kaum; als Rezept billigte er Isolationismus und Appeasement. Ersterer bemühte geopolitische Notwendigkeiten, Zweiteres berief sich auf die Realitäten der Macht. E.H. Carr, einer der renommiertesten frühen Realisten der Zwischenkriegszeit, sprach sich für eine Ermutigung Deutschlands zur Südost-Expansion aus und hielt noch im Frühjahr 1939 große Stücke auf den »Realisten« Neville Chamberlain. Später fragte er sich, wie er nur so blind hatte sein können. Und die Frage war berechtigt. Wie andere nach ihm hatte er die transformative Kraft des Glaubens oder des Fanatismus in der Geschichte verkannt. Würden allein internationale Strukturen das Verhalten von Staaten zueinander bestimmen, ein Gutteil der aufgezeichneten Geschichte hätte sich erst gar nicht ereignet. Carr selbst rückte bald von den Implikationen eines ungezügelten Realismus ab.[9]
Freilich herrschte die Doktrin, so beharrlich sie sich auch hielt, zu keinem Zeitpunkt unangefochten. Was auch für Hobbes’ Ansicht vom Naturzustand gilt. Über Jahrhunderte hinweg stellten Staatsphilosophen sich eine primitive Menschheit ganz anders vor und ersannen einen zivilisierten Gegenentwurf. Liberale Denker begannen eine Welt voll gegenseitiger Abhängigkeiten und Verflechtungen ins Auge zu fassen, in der Nationalstaaten Neid und Missgunst wenigstens teilweise überwinden, von einigen ihrer Vorrechte abrücken, sich eines Teils ihrer Waffen entledigen. In den Zwischenkriegsjahren hofften sie, der Katastrophe weniger durch die Ausbalancierung der Machtverhältnisse entgegenzuwirken als durch die Aufgabe des Primats absoluter nationalstaatlicher Souveränität – jenes irreduziblen Elements der modernen Welt und eines Gutteils realistischen Denkens. Was sie sich in Genf vorstellten, war ein System kollektiver Sicherheit, das jeden potenziellen Aggressor in ihrer Mitte in die Schranken verwies. Das Konzept war mit einem gerüttelt Maß an Unklarheiten verbunden: Würde eine Ächtung durch die Weltmeinung ausreichen, oder wäre es den Mitgliedern des Völkerbunds möglich, Gewaltmaßnahmen gegen den Missetäter zu ergreifen? Letzteres war eine Aussicht, an der so manches liberale Gewissen sich stieß. Der Glaube an die Vorstellung jedoch bewegte Millionen, ob sie ihn nun definieren konnten oder nicht. Der Marxismus, auf seine Weise nicht weniger optimistisch als der klassische Liberalismus, prophezeite die Auflösung des Nationalstaats durch das Fortschreiten des Kapitalismus. Und auch wenn der Chiliasmus der Internationalen letztlich zur Auflösung des Marxismus führen sollte, für den Augenblick leuchtete er so manchem Konvertiten, Renegaten oder Pilger den Weg zu einer klassen- und kriegslosen Welt.
Zum Ende des Großen Krieges proklamierte zunächst Woodrow Wilson, dann Wladimir Iljitsch Lenin eine solche freundliche Vision für die Welt. Beide sollten ihre Visionen binnen einiger Jahre und noch zu Lebzeiten sich wieder auflösen sehen, und in den 1930er-Jahren verschwanden sie endgültig. Ihre Jünger hielten ihnen zwar die Stange, aber die Welt blieb nicht stehen. Die Mächte, die in Genf der kollektiven Sicherheit einen Schrein errichtet hatten, unternahmen im Falle der Mandschurei nichts, um der Idee zu ihrem Recht zu verhelfen; sie hielt sich noch eine Weile, um schließlich vor den Provokationen der Italiener und der Deutschen in Afrika wie in Europa selbst zu kapitulieren. Wilson hatte das zweite Versprechen seines Traums, die nationale Selbstbestimmung, nur den Völkern des europäischen Kontinents angeboten, und einige von ihnen, neue Minderheiten in neuen Staaten, standen danach schlechter da als zuvor. Der Liberalismus von Freihandel und unsichtbarer Hand, dem der Realismus die Ansicht verdankte, alle Akteure arbeiteten unbewusst an einem internationalen System, das größer ausfallen würde als sie selbst und den Marxismus insofern widerspiegelte, als es die Erosion von Staaten und Grenzen durch die Gezeiten des Handels verhieß, verschwand unter den Trümmern der Depression.[10] Die Sowjetführung schloss sich dem internationalen System alsbald in dem Maße an, in dem sich für sie ein solches ausmachen ließ.
Mitte der 1930er-Jahre sah sich jeder, der die Staatslenker der Welt nach den sie bewegenden Kräften befragte, in einer Wüstenei von Antworten. Selbstredend zogen sie einer wie der andere die Selbsterhaltung der Auslöschung vor, aber sowohl das Versprechen als auch die Bedrohung, die sie in historischen Visionen jeglicher Art zum Ausdruck brachten – sei es unter den Aspekten von Raum und Rasse wie bei Deutschen oder Japanern, sei es in Form von Sehnsucht nach alter Größe wie im Falle von Italienern und Ungarn, sei es, wie im Falle der Briten und ihres unermesslichen Empires, in der Freiheit der Meere und allem, was damit einherging. Die Sowjets sorgten sich unentwegt um die Verteidigung ihres Mutterlands, Befürchtungen, die fast so berechtigt waren wie die von Franzosen oder Polen. Ähnliches galt für die Amerikaner, die fest entschlossen waren, sich fernzuhalten von den tückischen Fallstricken der alten Welt. Es musste nicht weiter überraschen, so unterschiedliche Protagonisten jeweils nach ihren eigenen diplomatischen und militärischen Sternen navigieren zu sehen. Briten und Franzosen verwarfen nach und nach die Schimäre kollektiver Sicherheit, hielten sich jedoch nach wie vor an die Staatskunst von Richelieu, Castlereagh und Bismarck, schlossen mit anderen Worten Verträge, verbuchten kleine Zugewinne, ließen sich auf Kompromisse ein; und sie fassten, falls denn doch einer kommen sollte, einen Krieg ins Auge, der zwar länger, aber dafür weniger grausam ausfallen und ihren Nationen die verheerende Wirkung ersparen würde, die sich nur allzu lebhaft ausmalen ließ. Deutschland und die Sowjetunion unterzeichneten Verträge und verkündeten dieselbe Art von Mäßigung, hielten den Frieden jedoch insgeheim für vorübergehend und bereiteten sich für den Fall des Falles auf einen Vernichtungskrieg vor.
Weder der Realismus noch die meisten konkurrierenden Theorien internationaler Politik müssen näher auf derlei nationale Eigenheiten eingehen. Die Theoretiker graben die Grammatik der internationalen Geschichte aus; die Historiker bergen ihre gesprochenen Sprachen. So wird etwa den Realisten zufolge internationales Verhalten ausschließlich von Macht, Sicherheit oder »Selbsthilfe« bestimmt. Auf welche Weise Veränderungen in Weltanschauung und Außenpolitik diese – und jeden anderen Impuls – ausdrücken, ist für sie bestenfalls von nachgeordnetem Interesse; der Begründer des strukturellen Realismus Kenneth Waltz schloss sie aus seinem theoretischen Ansatz aus.[11] Für den Historiker jedoch stehen sie im Mittelpunkt und damit ganz oben an – eher im Plural als im Singular, eher wechselhaft als beständig und nie und nimmer auf ein universales Verlangen, eine einzige Furcht oder die Unterwerfung unter einen eindeutigen und systemischen Deus ex Machina zurückzuführen. Von ihrem Ende des Teleskops aus beobachten Historiker, wie große und kleine Staaten – zuweilen auf bestürzende Weise – das Gesicht verändern, das sie der Welt präsentieren. Allein das 20. Jahrhundert könnte hierfür faszinierende Beispiele bieten. So übernahmen die Vereinigten Staaten innerhalb einer Dekade, der 1940er-Jahre, eine Rolle in der Weltpolitik, die sie ihre ganze Geschichte hindurch sorgsam gemieden hatten. In einer anderen Dekade, den 1980er-Jahren, machte die Sowjetunion sich ein neues Sicherheitskonzept zu eigen, das zu einer Veränderung ihrer Beziehungen nicht nur zu ihren Nachbarn, sondern auch zu ihrem wesentlichen Widersacher führte. Binnen einer Generation, lange vor der Wiedervereinigung, hatte Deutschland sich derart verändert, dass jemand, der mit dem Verhalten des Reichs in der ersten Hälfte des Jahrhunderts vertraut war, es nicht wiedererkannt hätte. War Deutschland einst begierig auf eine Position, die mit eigenen Ressourcen unmöglich zu halten war, schreckte die Bundesrepublik nun vor einer Stellung zurück, zu der sie geradezu prädestiniert schien. Japan entsagte der imperialen Eroberung nebst den Waffen, mit denen man diese garantiert hatte. Sicher erklären sich solche Verschiebungen durch besondere Umstände, aber eben auch durch bewusste Willensakte, durch die Anpassung eines nationalen Narrativs an ein neues Ziel. Der amerikanische Exzeptionalismus konnte sowohl zu Interventionismus als auch zu Isolationismus führen. Deutschland und Japan verzichteten auf die Sprache existenzieller Panik und trennten den nationalen Erfolg vom militärischen. Und die noch junge Sowjetunion hörte auf, die Welt nur unter dem Aspekt der Bedrohung zu sehen.
Hin und wieder beschließen Staaten, wie auch immer sie sich selbst sehen mögen, eine Veränderung des internationalen Systems, mittels dessen sie einander sehen. Sie definieren es lieber, als sich ihm zu unterwerfen. So etwa 1815, als die europäischen Mächte im Bund gegen Frankreich im kommenden Frieden Stabilität über individuelle Ausdehnung stellten. Sie entschlossen sich, den Gedanken des Kräftegleichgewichts und damit einen wettbewerbsorientierten Zeitvertreib aufzugeben, der seit 1763 nichts als Ungleichgewicht und endemische Kriege gebracht hatte, und sich stattdessen auf ein Konzert ineinander verschränkter Verpflichtungen und Restriktionen zu konzentrieren. Nicht jeder profitierte davon – Polen und Sachsen konnten ein Lied davon singen –, und das System baute mit Großbritannien und Russland auf zwei hegemoniale Flankenmächte, um die Länder dazwischen an der Kandare zu halten; sein Geist jedoch ersparte dem Kontinent über eine ganze Generation hinweg einen Krieg zwischen den Großmächten und gar ein Jahrhundert lang einen allgemeinen.[12] Nach 1945 hielt man es erneut so, als die USA zusammen mit ihren ehemaligen Verbündeten und Gegnern und den Ländern der sich herausbildenden Europäischen Gemeinschaft ein weiteres System internationaler Zusammenarbeit ersannen. Es glich keinem bis dahin bekannten, stellte aber einmal mehr das gemeinsame über das individuelle Ziel. Und wieder erbrachte es eine lange Friedenszeit. Der Kalte Krieg allein vermochte die Beteiligten nicht dazu zu bringen, auf kurzfristige zugunsten langfristiger Befriedigung zu verzichten – man hatte das bereits vor dem Einsetzen der Eiszeit in den späten 1940er-Jahren ins Auge gefasst und hielt das weiter so, als in den 1970er-Jahren Tauwetter einsetzte und der Kalte Krieg in den 1990ern zu Ende ging. Die Beteiligten hatten sich verändert.[13]
In den Zwischenkriegsjahren jedoch passierte das Gegenteil. Alle Anstrengungen, das internationale System zu verändern, jede Verhandlung in den 1920er- und Anfang der 1930er-Jahre, sei es in Washington, Genf, Genua, Locarno, Den Haag oder London – noch vor Mitte der 1930er-Jahre waren sie alle gescheitert. Die Probleme begannen zu Hause, im eigenen Land. Die größeren genauso wie die kleineren Mächte erfasste ein Gefühl interner wie externer Verwundbarkeit. Es war dies nicht das erste Mal, bereits 1914 war es einigen Kontinentalmächten so ergangen, aber nie hatte das Phänomen so viele sowohl in als auch außerhalb der Regierungskreise gleichzeitig im Griff, und das sowohl in Europa als auch in Nordamerika und Ostasien. Es markierte eine neue Art von Nationalismus, der weniger auf einen bestimmten Unterdrücker oder Erbfeind gerichtet war als auf eine feindliche Welt, die sich sowohl durch Akteure zu Hause – oder innerhalb eines Empires – als auch im Ausland manifestierte. Kommunismus, Zuwanderung, Kapitalismus, das Judentum, der Westen, Pazifismus, die existenzielle Bedrohung in all ihren Masken – derlei Schrecken überschritten mühelos Grenzen; und wo immer sie Fuß fassten, wer immer sie sich zunutze machte, sie schlichen sich sowohl in die Innen- wie in die Außenpolitik ein.
Eine Erklärung für die weltweite Verbreitung solcher Ängste könnte die Globalisierung liefern, zusammen mit der Verbreitung von politischen Sprachen, die Völkern, die einst taub gegenüber einander waren, verständlich waren. Die Ausbreitung der Demokratie, liberal oder nicht – die Erweiterung der politischen Nation – könnte ihre Wirkung erklären. Beide Phänomene sind jedoch keineswegs Neuerungen des 20. Jahrhunderts, sondern etablierten sich bereits im Jahrhundert zuvor. Und die Masse wartete nicht etwa darauf, als Kraft in den internationalen Beziehungen hier und da ihre Stimme zu erheben. Im 16. wie im 17. Jahrhundert, als Armeen durchaus Mobs ähneln konnten, hielten sowohl der Volkszorn als auch die Staatskunst die Religionskriege in West- und Mitteleuropa in Gang. Im 18. Jahrhundert unterbrach die Frankophobie beim britischen und die Austrophobie beim französischen Volk die Schachpartien der Diplomaten, und in der Mitte des 19. Jahrhunderts zog der Sog der Russophobie in London und des christlich-orthodoxen Eifers in Sankt Petersburg die Regierungen in einen Krimkrieg, den einige ihrer weiseren Mitglieder lieber vermieden hätten. Der Palast hörte, wenn auch oft nur ungern, auf den Mann auf der Straße. Und bald darauf auch auf Aufsichtsräte und Zeitungsleute. Eine ganze Schule deutscher Historiker, die sich für das Primat der Innenpolitik starkmachte, schreibt einen Gutteil des wilhelminischen Kriegsgehabes, ja überhaupt der Krise vom Sommer 1914, dem Kunstgriff zu, die öffentliche Meinung von heimischen auf ausländische Ziele zu lenken oder die mächtigen heimischen Lobbys zu beschwichtigen, die gefügigen Kanzlern schwindelerregende Ausblicke auf eine kontinentale Vorherrschaft schmackhaft zu machen versuchten.[14] Die Diplomaten von Wien hatten 1815 die heimische öffentliche Meinung noch größtenteils ignorieren können. Im Versailles von 1919 konnten sie das nicht mehr, wenngleich sie sich immer noch absonderten, als ob sie es nach wie vor könnten.
Das Neue an der Krise der Zwischenkriegszeit war mitnichten, dass die Kabinettsdiplomatie damals so passé war wie die Kabinettskriege; neu war vielmehr die Art, in der Massenpolitik endgültig gegen jedes über den augenfälligsten unmittelbaren Eigennutz hinausgehende internationale Engagement zu wirken begann. Damit hielten die kriegerischen Optionen Vermeiden oder Raubzug auch in der Friedenszeit Einzug. Die Aushärtung des Schemas erfolgte kurz nach der Halbzeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, Anfang der 1930er-Jahre, in ebendem Augenblick, den das vorliegende Buch beschreibt. »Der Rechtshistoriker«, so sagte der bedeutende englische Mediävist Frederic William Maitland im Rahmen seiner Antrittsvorlesung in Cambridge 1888, »wird oft vom Klaren hin zum Vagen arbeiten müssen, vom Bekannten zum Unbekannten«.[15] Er würde also gleichsam mit dem Ende beginnen müssen – und ebenso könnte der Historiker der frühen 1930er-Jahre zurück in die Vergangenheit reisen, ausgehend vom dokumentierten Scheitern internationaler Konferenzen, um dann über die vageren Terrains heimischen Widerstands gegen Verpflichtungen im Ausland schließlich auf das im Dunkeln liegende Territorium nationaler Kopfgeburten zu stoßen.
Letztere führten unter anderem zu Hitler, zur Flucht aus kollektiven Verpflichtungen, zur Passivität der Westmächte, zur japanischen Herausforderung und zum sowjetischen Verfolgungswahn. Desgleichen führten sie mit zum Zweiten Weltkrieg, auch wenn sie nicht unmittelbar zu seinen Ursachen zählen, die vielmehr in dem zu suchen sind, was in den folgenden Jahren getan respektive versäumt wurde. Ihren Ursprung hatten sie in der jüngsten Erfahrung, allen voran dem Großen Krieg und der Großen Depression, aber auch in der eher fernen Überlieferung nationaler Großtaten, Prüfungen oder Demütigungen; darüber hinaus schlugen sie eine Brücke über die Kluft zwischen gelebter und erdachter Geschichte. Unter Amerikanern war der Krieg in Europa eine Erinnerung, Isolation eine Illusion, Neutralität eine Politik, aber mochte ihre Sprache auch an Präzision gewinnen, die Zahl derer, die sich entsprechend äußerten, ging zurück. Im Raum zwischen den größtenteils schweigenden Millionen, die sich noch erinnerten, und der regierenden zungenfertigen Minderheit erhob sich das Stimmengewirr des öffentlichen Diskurses, in dem nationale Anschauungen Form annahmen und sich dominierende Motive herausbildeten: Deutschland als Opfer, Sowjetrussland als Erlöser und Paria, Japans Jahrtausendmission in Asien, sein Heil in der Mandschurei, Großbritanniens imperiale Freistatt – derlei kollektive Vorstellungen spielen eine große Rolle auf den kommenden Seiten, da man ohne sie unmöglich einen Einblick in die geistige Welt bekommt, in der sich selbst die pragmatischsten Staatsoberhäupter bewegten und einander begegneten und in der die Kinder des Ersten zu den Eltern des Zweiten Weltkrieges wurden.
Jahre später, nach Krieg und Völkermord, versuchte der eine oder andere Historiker sich an einer allgemeinen Erklärung für das, was der Welt da widerfahren war. Weit mehr jedoch versuchten sich an einer Erklärung für die europäische Katastrophe von 1914 als an einer für den weit größeren globalen Konflikt, der hier und da zwischen 1937 und 1941 ausbrach. Letzterer schien nationale oder regionale Konflikte zu vereinen, die man am besten einzeln, jeden für sich verstand. Außerdem erschien paradoxerweise die schrittweise Ausbreitung des Krieges über drei Kontinente auf den ersten Blick weniger mysteriös als die Angstattacke im Sommer 1914 ausgerechnet auf dem kleinsten von ihnen, Europa. Für die Nachwelt am verständlichsten waren die Kriegsherde in Ostasien 1937, in Europa 1939 und im Pazifik 1941, da sie eine Vorgeschichte hatten, die so bunt, kontrovers, in den Archiven nur allmählich zugänglich und in mancher Hinsicht auch ohne die nachfolgenden Konflikte die eingehendere Betrachtung wert war. Der Krieg verwüstete einen Gutteil des Planeten, und die großen oder gar weltweiten Strategien, die Verbindungen zwischen dem einen Kriegsschauplatz und dem anderen, zogen die Aufmerksamkeit so einiger Fachleute an; eine Suche von vergleichbarem Umfang nach den Ursachen hinkte da eher launisch hinterher.[16]
Die eine oder andere dieser Fragestellungen beschäftigte führende amerikanische und europäische Köpfe schon unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, wie einige – nicht alle – ihn damals bereits nannten.[17] Implizit oder explizit gaben sie die Schuld für den weltweiten Flächenbrand dem in den 1930er-Jahren erfolgten Zusammenbruch von liberaler Demokratie, Wirtschaftswachstum, internationaler Handels- und Investitionstätigkeit und eines kollektiven, alle einbeziehenden Sicherheitssystems. Sie sahen die einzelnen Faktoren als Vorbedingung für die anderen und dachten sich die neue Welt, die zu schaffen ihnen vorschwebte, als das schematische Gegenteil der alten. Es war kein Zufall, dass sie, ganz im Gegensatz zu 1815, sowohl die heimische als auch die internationale Gesellschaft zu verändern trachteten. Im Lauf der Zeit schienen Frieden und Wohlstand im Westen ihre Prämisse zu bestätigen, war sie doch als politische Richtlinie unanfechtbar, wenn auch solipsistisch als historisches Argument. Sicher, Zusammenbrüche hatten zum Zusammenbruch geführt. Es oblag den Historikern zu erklären, wieso die ökonomische Stagnation ausgerechnet diesmal, das war ja nicht immer so gewesen, zum Krieg geführt haben sollte; und warum der Rückzug der Demokratie zum Krieg geführt haben sollte, was ebenfalls kaum eine gesetzmäßige Folge war. Entsprechend tat man sich schwer mit Antworten, die auch über nationale Grenzen hinweg von überzeugender Gültigkeit waren.
Die Geschichte der Diplomatie führte den Versailler Vertrag ins Feld, was in der Gegenüberstellung von zufriedenen und unzufriedenen Signataren resultierte. Aber lange bevor Hitler 1939 seinen Krieg begann, hatte die Entwicklung so gut wie all die Bestimmungen, die die Deutschen als demütigend empfanden, null und nichtig gemacht. Warum verschärften sich die Spannungen erst, nachdem die aus dem Großen Krieg resultierenden Missstände – mit Einwilligung der Siegermächte – beseitigt waren? Die Wirtschaftshistoriker setzten auf die Depression, die auf der Rechten Nationalisten – in faschistischer, rassistischer oder militaristischer Form – hervorbrachte, die sich für die Einrichtung aggressiver Regime starkmachten, welche die Expansion verfolgten und das Heil im Ausland sahen. Aber die Depression vermochte ebenso wenig zu erklären, warum sich solche Nationalismen so beharrlich hielten, noch den Umstand, dass sie sich sogar noch verfestigten, wo sich doch gerade einige der verbittertsten Kläger – Japan und Deutschland – stetiger als andere von der ökonomischen Katastrophe der frühen 1930er-Jahre erholten. Eine psychosoziale Geschichtsschreibung baute auf die entwürdigenden Auswirkungen des totalen Krieges und ging davon aus, dass sechzig bis siebzig Millionen Veteranen die Brutalität, die ihnen im Großen Krieg begegnet war, auf ihre zivile Welt übertrugen. Die Massendiagnose erklärte freilich nicht, warum so viele stattdessen zu Pazifisten wurden oder warum deutschen, italienischen oder russischen Kriegsheimkehrern Brutaleres widerfahren sein sollte als ihren französischen oder britischen Pendants.[18] Der Übergang vom Frieden zum Krieg gestaltete sich unterschiedlich von Nation zu Nation; jede folgte ihrem eigenen Weg von gemeinsamen Bedingungen hin zu individuellen Entscheidungen. Kein Wunder, dass Historiker vor der Suche nach gemeinsamen Ursprüngen zurückscheuten, die bei der Beschäftigung mit dem Juli 1914 so vielen zur Versuchung geworden war.
Das vorliegende Buch baut auf der These auf, dass jeder dieser Wege über nationale, in den Zwischenkriegsjahren in die Massenpolitik übergegangene Mythologien führte, die, so einzigartig jede für sich sein mochte, allenthalben dieselbe Folge hatten – sie setzten jede Nation auf die eine oder andere Weise gegen den Rest der Welt. Jede machte internationale Regeln und Normen, wenn schon nicht irrelevant, so doch zur Ermessensfrage. Einer anderen, jüngeren Schule der Theorie internationaler Beziehung dürfte die These durchaus willkommen sein. »Anarchie ist«, dem Konstruktivismus zufolge, »was der Staat im Einzelnen daraus macht.« Sie mag von Anfang an gegeben sein, wie die Realisten behaupten, ist aber auch formbar und kann durchaus zu mehr taugen als zur bloßen amoralischen Selbsthilfe. So kann sie unter Freunden zu kooperativeren Arrangements führen, zu weniger Kriegslüsternheit unter Feinden, je nach Identität, sei diese nun gewachsen oder modifiziert. Identität als Konstrukt ist zu vielgestaltig, um hier damit zu arbeiten, aber der Gedanke ist derselbe: Für wen oder was eine Nation sich hält, vermag zu bestimmen, wonach ihr ist.[19]
Zuweilen verbreiten sich, einer ansteckenden Krankheit gleich, Ressentiments gegen eine Beleidigung, Demütigung oder Entwürdigung der Nation; Klagen aller Art beginnen zu schwären und volksnahe Führer sprechen sie aus. »Hört sich ganz nach heute an« – in derlei überaus gefährlichen Übertragungen von Regimen oder Parteien von »damals« auf ein anderes »Heute« klingt – in einem beunruhigenden Echo – das »Heute« der 1930er-Jahre nach. Derlei Töne machen nervös: ein geopolitisches Geburtsrecht, wie es damals Japan einforderte und heute China; grenzübergreifende ethnische Parolen wie die der Deutschen von damals und der Russen von heute; die Absage des amerikanischen Wohltäters an undankbare Verbündete, Nationen, die, damals wie heute, im Krieg wie im Frieden seine Großzügigkeit ausnutz(t)en. Die Kläger mögen verschwinden oder gar auf andere Klagen verfallen, aber die Verbitterung bleibt.
Die transnationalen Neuerungen der 1930er-Jahre unterschieden sich grundlegend von den heutigen. Angesichts der Aufteilung der Macht unter zahllosen staatlichen und nicht staatlichen Akteuren sowie einer unüberschaubaren Zahl multilateraler Organisationen gestaltet sich die Welt heute weder multipolar wie in den 1930er- noch unipolar wie in den 1990er-Jahren, sondern schlicht »apolar«.[20] Die heutige Weltwirtschaft lähmt keine Depression. Aggressive Diktaturen und die ideologische Herausforderung durch Kommunismus und Faschismus verliehen den 1930ern ein einzigartiges Gesicht, während die Schreckgespenster von Umweltkrise, Proliferation und Cyber-Dschungel unserer eigenen Dekade ein ganz anderes, unliebiges Gepräge verleihen. Nur müssen nationale Paniken nicht in identischen Umständen entstehen. Sie entstehen jedoch zur selben Zeit, da sie sowohl miteinander konspirieren als auch im Wettstreit stehen. Sie wirken gemeinsam, obwohl sie einander abstoßen – als rezitierten sie unisono den Internationalismus ihrer Altvorderen, während sie sich gleichzeitig schon gegen die bloße Andeutung einer neugefundenen Gemeinschaftlichkeit wehren.
In den 1930er-Jahren trugen Regime aller Art, sei es aus Verlegenheit, sei es aus Verachtung, die Reste kollektiver Sicherheit und gemeinsamer Normen zu Grabe. In den Zehnerjahren des 21. Jahrhunderts vertagten ihre zahlreichen Nachkommen auf unbestimmte Zeit eine globale Agenda, die das neue Millennium mit den Versprechen auf Freihandel, nationale Selbstbestimmung und Achtung der Menschenrechte begann. Ersteres fiel dem ökonomischen Nationalismus zum Opfer – einer Studie zufolge drohten die Vereinigten Staaten 2019 China mit Zöllen in Höhe derer des Smoot-Hawley-Zollgesetzes von 1930, dem unüberhörbaren ersten Schuss im folgenden Handelskrieg.[21] Das Zweite öffnete eine Pandora-Büchse von Subnationalismen und ethnischen Separationsbewegungen, die sich Sympathie heuchelnde Nachbarn zunutze machten, denen allein um die Macht zu tun war. Auch das dritte Versprechen appellierte an die Verantwortung der internationalen Gemeinde, diesmal zum Schutz von Minderheiten vor ihren eigenen Staaten; es sah in einem ebenso neuen wie kühnen Schritt das Recht auf das militärische Einschreiten gegen die Unterdrücker vor, aber die Staaten überlegten sich das bald anders.[22] Die Ordnung, die dem Kalten Krieg folgen sollte, erwies sich ebenso als Schimäre wie die nach dem Großen Krieg und als nicht weniger kurzlebig. Was ist noch zu erwarten?
Niemand vermöchte das zu sagen, nicht angesichts des resoluten Widerstands gegen die Regression zum Nationalismus, vor allem in Europa – aber selbst dort geraten die Disputanten in jedem Land über die Frage nach der nationalen Identität aneinander, und das nicht etwa wegen kontinentaler oder gar globaler Probleme. Wir wissen, dass die Ausbreitung der Unordnung der 1930er-Jahre im Zweiten Weltkrieg gipfelte. Das hätte nicht sein müssen. Die künftigen Kombattanten hatten es in der Hand, im Lauf der Dekade mit entsprechenden Entscheidungen ihrer jeweiligen nationalen Geschichte eine andere Richtung zu geben. Sie taten es nicht. Das ist das Einzige, was es uns erlaubt, eine Parallele zu heute zu ziehen. Anarchie ist in der Tat das, was Staaten im Einzelnen daraus machen.
Prolog
Genf und Schanghai
2. Februar 1932
Einmal mehr war die Stadt beflaggt, die offiziellen Bauten mit Bannern und etwas diskreter die grandiosen Limousinen, in denen man die Delegierten den Genfer See entlang zu den Abendgesellschaften im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten fuhr. Genf erstrahlte am Vorabend der Abrüstungskonferenz noch einmal im alten Glanz seiner heroischen Zeit in den Mittzwanzigerjahren, als der Völkerbund es für kurze Zeit zur Hauptstadt eines befriedeten Kontinents gemacht hatte und selbst die Hotelfenster mit Flaggen geschmückt waren. Am Bahnhof hatte eine jubelnde Menschenmenge die Friedensstifter – ein Trio von Außenministern mit einem gemeinsamen Nobelpreis – empfangen: Aristide Briand, Austen Chamberlain und Gustav Stresemann. Besucher hatten sich auf den Straßen gedrängt, Journalisten aus aller Welt sich eingefunden. »Zu Ende ist der Krieg zwischen uns!«, hatte Briand 1926 bei seiner Rede vor der Vollversammlung des Völkerbunds den deutschen Außenminister Stresemann und sein Land willkommen geheißen; Filmkameras hatten den Augenblick in flimmernden Bildern für die Wochenschauen der Kinos ferner Länder auf Zelluloid gebannt. Der Augenblick hatte die Krönung der im Vorjahr in Locarno, an einem anderen teils in der Schweiz gelegenen See, getroffenen Vereinbarungen zwischen ehemaligen Feinden markiert und eine versöhnlichere Version des Versailler Vertrags verheißen, die, als die Leidenschaften allmählich abkühlten, eine einvernehmliche und friedliche Revision einiger der härteren seiner Bestimmungen in Betracht zog. Jetzt, im Februar 1932, hatte der Völkerbund vierundsechzig Mitgliedsländer und andere Nationen eingeladen, mit der »Herabsetzung der nationalen Rüstungen auf das Mindestmaß …, das mit der nationalen Sicherheit und mit der Erzwingung internationaler Verpflichtungen durch gemeinschaftliches Vorgehen vereinbar« sei, endlich eines der Versprechen seiner Satzung zu verwirklichen. Und die meisten hatten die Einladung angenommen, so viele gar, dass man, um die Verhandlungen zu beherbergen, dem umfunktionierten ehemaligen Hôtel National, nun Palais Wilson, wo die Offiziellen des Völkerbunds damals noch zur Arbeit zusammenkamen, einen modernen Annex aus Glas, Metall und Beton zur Seite stellte, ein gutes Stück unterhalb des Parks, wo sein strahlend weißes neues Domizil – das Palais des Nations – im Entstehen begriffen war.[1]
Stresemann war 1929 verstorben, Briand lag im Sterben, Chamberlain war endgültig in den Ruhestand getreten, und über den Völkerbund und seine Projekte hatte sich jüngst ein bleierner Schatten gelegt. »Die beherrschende Wirklichkeit der heutigen Welt«, so sagte der damalige Erzbischof von York am Vorabend des Konferenzbeginns einer englischsprachigen Gemeinde in der Genfer Kathedrale Saint-Pierre, »ist die Angst.« Ein Lokalblatt sprach von einer ansteckenden Krankheit. Jeder habe Angst vor jedem.[2] Absurd oder nicht, die Sowjets hatten Angst vor einer Invasion der kapitalistischen Mächte unter der Führung Polens, das seinerseits eine weitere Aufteilung zwischen Russen und Deutschen befürchtete, während Letztere bereits den Einmarsch der Polen in Ostpreußen sahen; in fast allen Balkanstaaten herrschte die Furcht vor einer Unterwanderung oder Isolation durch andere Staaten, in Italien die Umzingelung durch Jugoslawien und Frankreich, dem wiederum vor dem Wiedererstarken Deutschlands und dem nächsten Verrat durch die »Angelsachsen« graute, das heißt auf der einen Seite Großbritannien, das Angst vor kontinentalen Verstrickungen hatte, und die Vereinigten Staaten von Amerika mit ihrer Angst vor Verstrickungen außerhalb Lateinamerikas auf der anderen. China hatte Angst vor dem japanischen Militarismus; Japan vor dem chinesischen Nationalismus, dem Sowjetkommunismus und dem Ausschluss durch den Westen. Und auch die Ängste schwächerer Länder, die sich vom Völkerbund Versicherungen erhofften, hatten sich in jüngerer Zeit verstärkt. Teile der japanischen Kwantung-Armee waren in die Mandschurei eingefallen, und weder ihre eigene Regierung noch die westlichen Mächte, geschweige denn der Rat des Völkerbunds, den diese dominierten, hatten sie zu zügeln vermocht oder zügeln wollen. Im Juni sollte es zum Krieg zwischen Bolivien und Paraguay um den Gran Chaco kommen, eines größtenteils trockenen Ödlands. Offensichtlich so überrascht wie peinlich berührt, lauschte der Rat des Völkerbunds einmal mehr einer bloßen Aufzählung der Ereignisse, während das amerikanische Außenministerium über die Panamerikanische Union Einfluss zu nehmen versuchte, was einige Offizielle des Völkerbunds als Versuch der Amerikaner werteten, auf die Unantastbarkeit ihrer Hemisphäre zu pochen.[3] Dreizehn Jahre zuvor hatte Woodrow Wilson die Monroe-Doktrin in die Satzung des Völkerbunds namentlich eingebracht. Der Chaco-Krieg sollte sich über drei Jahre hinziehen. Dem elf Jahre alten Bund drohte das Schreckgespenst der Bedeutungslosigkeit, was insbesondere einige seiner kleineren Mitglieder wie etwa die Tschechoslowakei verängstigte, die von ihm die Garantie ihrer Territorien, wie sie nach dem Krieg festgelegt worden waren und denen sie ihre Existenz verdankten, erwarteten; auf der anderen Seite wurden so einige Unzufriedene wie Ungarn oder Deutschland, die keine Gelegenheit ausließen, sie zu überwinden, ermuntert. Kaum einer erwog eine bewaffnete Aggression, aber viele befürchteten sie.
Die Farbe war noch nicht trocken, Teppiche wurden ausgelegt, noch waren die Handwerker zugange in dem lichten, an einen generalüberholten Ozeanriesen gemahnenden neuen Annex. Derweil fielen bereits Bomben auf Schanghai; nur wenige Tage zuvor waren von den japanischen Flugzeugträgern vor der Mündung des Jangtsekiang Bomber aufgestiegen, der Stadtteil Zhabei stand in Flammen, der in ihm befindliche Nordbahnhof lag in Trümmern; allenthalben stiegen schwarze Rauchsäulen auf. Die japanische Marine führte denselben Vorwand an wie die Armee in der Mandschurei ein halbes Jahr zuvor: die Sicherheit japanischer Einwohner und japanischen Eigentums, die man nicht nur durch den Wirtschaftsboykott der Chinesen, sondern auch durch willkürliche Akte der Gewalt bedroht sah. Die Regierung sah tatenlos zu. Einige tausend japanische Marineinfanteristen waren in die Stadt eingedrungen, hatten sich aber nach erbittertem Widerstand der Chinesen in den Hafen und das internationale Viertel zurückgezogen, wo gelegentliches Artillerie- und MG-Feuer die chinesischen Flüchtlinge in Schrecken versetzte, die sich vor den Konsulaten drängten. Für Mitternacht ausgehandelte Waffenruhen waren im Morgengrauen bereits wieder gebrochen. Es kam zu Tumulten. Auf dem Seeweg waren britische und amerikanische Truppen aus Hongkong und Manila unterwegs, um die Verteidigungseinrichtungen zu bemannen und ihre Landsleute zu schützen. Die Regierung in Nanking appellierte an Völkerbund und Großmächte, und man munkelte gar, sie könnte den Krieg erklären, just in dem Augenblick, in dem die Welt in Genf zusammengekommen war, um ihm abzuschwören.[4]
Am Dienstag, dem 2. Februar, waren zweitausend Delegierte, Fachleute, Journalisten und wohlmeinende Interessierte aller Art unterwegs zum hoch in der Genfer Altstadt gelegenen Bâtiment électoral. Das seines Mangels an Eleganz wegen bei den Genfern nie sehr beliebte Gebäude, das unter anderem als Konzertsaal, Messehalle und Lokal für die Kantonswahlen diente, beherbergte seit 1930 die Jahresversammlungen des Völkerbunds, die zuvor in der luftlosen calvinistischen Strenge der Salle de la Réformation zwischen der Rue du Rhône und der Rue Versonnex stattgefunden hatten. Für den heutigen Tag war im Bâtiment électoral die Eröffnungssitzung der Abrüstungskonferenz angesetzt, Beginn sollte um 15.30 Uhr sein. Vor dem nüchtern-kantigen Monumentalbau drängten sich die Schaulustigen; im nicht weniger schmucklosen Saal selbst harrten Gesandte wie Journalisten, Publikum und das Präsidium der Konferenz auf der Estrade dem Beginn der Sitzung. Hinter dem Ereignis standen sieben Jahre obskurer militärischer und diplomatischer Vorbereitungen, die man jetzt fast über Nacht durch die Kampfhandlungen in Schanghai gefährdet sah. Den ganzen Montag über sahen die auswärtigen Ämter sich mit Depeschen aus dem umkämpften Hafenviertel der Stadt überflutet, und an diesem Dienstagvormittag hatten die Vertreter der Ratsmächte bereits fieberhaft per Telefon mit ihren Regierungen konferiert. Gegen Mittag hatte man sich entschlossen, den Rat zu einer Notsitzung einzuberufen und die Eröffnungsveranstaltung auf der anderen Seite der Rhône zu verschieben, nur um eine Stunde zwar, aber immerhin – in einem Augenblick so schrecklicher wie vielsagender Ironie – unter dem Zwang ebender Gewalt, die zu zügeln man hier zusammengekommen war.[5]
Die eher symbolische Verzögerung gemahnte die Abrüster daran, dass es so lange Panzer, Flugzeuge und weittragende Artillerie geben würde, solange es Angst und Befürchtungen gab. Darüber hinaus machte sie deutlich, dass die alte Frage »Huhn oder Ei« – ob nun Waffen Unsicherheit oder Unsicherheit Waffen gebiert – kaum eine Rolle spielte, solange das Vertrauen zueinander nicht wiederhergestellt war. Die Gläubigen hielten dagegen, man bräuchte Panzer, Flugzeuge und weittragende Artillerie nur zu beseitigen, um den kollektiven Selbstmord abzuwenden, den der Erste Weltkrieg in Aussicht gestellt hatte. Die Logik der Skeptiker auf den Kopf stellend, versicherten sie diesen, dass Feindschaften sich von selbst legen würden, hätten die Gegner sich erst einmal ihrer Waffen entledigt. So entschlossen waren sie, nationale Animositäten aus ihrer Mitte zu verbannen und sich – um das Politische, sofern das irgend möglich war, vom Materiellen zu trennen – auf eine Reduzierung quantitativ messbarer Größen zu konzentrieren, dass sie sich aus dem Schoß des Bundes absetzten, um sich – mit dessen Segen – an dem neuen – nahe gelegenen, aber doch autonomen – Veranstaltungsort ihrem Unterfangen zu widmen. Am Montag jedoch verbreitete sich das Gerücht, der stämmige, bebrillte sowjetische Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten – oder Außenminister – Maxim Litwinow, der an der Spitze einer fünfundzwanzigköpfigen Delegation nach Genf gekommen war, spiele nicht mit. Es hieß, er beabsichtige vom Podium aus den imperialistischen Mächten des Völkerbunds die stillschweigende Duldung der japanischen Aggression vorzuwerfen, die Eröffnungssitzung selbst zu sabotieren und damit die unabhängigen Bemühungen um eine Reduzierung der Rüstungen zur Farce zu machen, bevor sie überhaupt begonnen hätten. So tagte denn der Rat, von einem neuen Vorsitzenden hastig einberufen, so unvermutet wie übereilt. Anstelle seines Präsidenten pro tempore, des französischen Außenministers, der aus gesundheitlichen Gründen in Paris festsaß, war sein Kollege André Tardieu – der Kriegsminister – in Genf.[6]
Der Ironie nicht genug, spielte das Schicksal der Konferenz gleich den nächsten Streich – nur dass der Rat diesmal ausnahmsweise prompt reagierte. Im September, während der Mandschurei-Krise, hatte man sich herumgequält, war der Rat doch wegen der internen Zerstrittenheit seiner ständigen Mitglieder und der externen Widerspenstigkeit der USA handlungsunfähig gewesen. Weder die Briten noch die Amerikaner, deren beider Flotten die Japaner als einzige hätten einschüchtern können, sahen sich damals zum Handeln genötigt, beide mit gutem Grund. Jetzt trafen die vierzehn Mitglieder des Rats sich eine Stunde lang, unter den Augen eines handverlesenen Publikums, im Crystal Chamber, dem glasgesäumten ehemaligen Speisesaal des Hôtel National. Rasch hatte man seine Unterstützung der Westmächte zum Ausdruck gebracht, die die Ordnung in Schanghai wiederherstellen sollten, und billigte, fast wie in wehmütigem Gedenken an die internationale Macht, die dem Völkerbund zunächst verwehrt gewesen war, für diesen Ausnahmefall die finanziellen Mittel für eine dem Konflikt gewidmete Kommission. Selbst der japanische Delegierte sprach sich dafür aus. Reglos saß er da, zögerte einen Augenblick und stimmte dann wortlos für die Resolution »gegen den chinesischen Aggressor«. Ein Lachen ging durch das Publikum. Für den Augenblick war das Prestige des Rats wiederhergestellt. »Hätte man doch damit nur im September begonnen!«, hörte ein Reporter einen der Zuschauer ausrufen, als Rat und Publikum den Saal verließen, um sich auf den Weg zur Konferenz auf der anderen Seite der Rhône zu machen.[7]
Die Kampfhandlungen in Schanghai freilich hielten an. Und sie breiteten sich ins Landesinnere aus. An den Genfer Hauswänden sah man Reklameplakate für das Journal de Genève:
Die Neue Friedenskonferenz
Japaner bombardieren Nanking[8]
Polizisten in weißen Handschuhen dirigierten den Verkehr, der sich auf der Suche nach Parkplätzen durch die Altstadt schob, und die Straßen rund um das Bâtiment électoral verdunkelten sich mit dem Gedränge der Schaulustigen. Einige hatten schon Stunden gewartet; der eine oder andere zog den Hut, wenn einer der bekannteren Delegierten eintraf. Das Geläut von Saint-Pierre erklang. Genf, an die Versammlungen des Völkerbunds gewöhnt, hatte dergleichen noch nie gesehen. Es war die größte Zusammenkunft von Nationen aus aller Welt seit Versailles.[9]
Sie begann damit, dass man der Weltpresse die Türen öffnete. Die denn auch kam – zwischen fünf- und sechshundert Journalisten füllten die Sitzreihen, die die Wände entlang für sie reserviert waren. Und die Ausrichter der Konferenz hatten sie nicht nur für die Eröffnungsveranstaltung eingeplant, sondern für die ganze Dauer der Konferenz am westlichen Ufer des Genfer Sees. Dort hielt man in dem neuen, modernen Glas- und Stahlannex des alten Hôtel National über den Zugang zu allen Sitzungsräumen hinaus allerhand weitere Annehmlichkeiten für sie bereit: einen großzügig bemessenen Presseraum zum Beispiel, eine eigene Post- und Telegraphenstelle sowie vierzig Telefonzellen. Außerdem konnten sie über den neuen Kurzwellensender des Völkerbunds Radio-Nations bei Prangins, ein Stück den See hinauf, nach Nord- und Südamerika und – eine weitere Ironie – nach China und Japan senden. Damit hatte auch die Diplomatie die Massenpolitik akzeptiert. Ein Jahrhundert zuvor hatten die Herrscher ihre Gesandten zu gemeinsamen Konferenzen in die verschwiegenen Paläste von Wien, Verona oder Aix-en-Provence geschickt. In jüngerer Zeit hatte man in Versailles oder den Palazzi von San Remo und Genua getagt. Zwar hatte auch dort in unmittelbarer Nähe die Presse gelauert, aber man hatte sie auf Distanz gehalten. Jetzt war sie mit im Sitzungssaal, und was an Eleganz verlorengegangen sein mochte, glich das Versprechen von Transparenz wieder aus.[10]
In den 1920er-Jahren hatte ein kosmopolitisches Völkchen von Reportern, Delegierten und Staatsmännern Calvins Bastion der Askese in der Welt liebstes Kaffeehaus verwandelt, zumal bei den Tagungen der Vollversammlung einmal im Jahr. Die Diplomaten blieben freilich selten lange genug in der Stadt, um jenen Korpsgeist zu entwickeln, mit dem sie sich sonst auf ganz natürliche Weise abheben, wenn sie in fremden Hauptstädten im Dienste ihrer jeweiligen Regierung ansässig sind. Stattdessen kamen und gingen sie hier, ganz wie die Journalisten, die ihnen durchaus einen Gruß zuriefen, wenn man sich sah. Stresemann, zum Beispiel, traf sich, wann immer es seine Gesundheit erlaubte, mit ihnen auf ein Bier an der Bar des Café Bavaria; nicht selten saß Briand, nicht weniger gesellig und ständig in eine Wolke Zigarettenrauchs gehüllt, zusammen mit ihm im altbackenen Ambiente aus rotem Rips, verblichener Spitze und grünem Plüsch des Salons im gleich neben der Salle de la Réformation gelegenen Hôtel Victoria. Während der Vollversammlungen drängten sich im Hotel Stenotypistinnen, Völkerbundoffizielle und Fanatiker für jede nur denkbare Sache auf dieser Welt, zu schweigen von den Journalisten, die nachts im Schreibzimmer gleich hinter der Portiersloge Poker und Chemin de Fer spielten. In ihrer bevorzugten Schenke, dem Café Bavaria, dessen Wände mit politischen Karikaturen tapeziert waren, kreierten die Korrespondenten inmitten von Stimmengewirr und dem Klappern von Gläsern und Geschirr ihre Berichte über Friedensverhandlungen und von Kompromissen geprägte Resolutionen, die sie dann an ihre Redaktionen kabelten. Angesichts des lebhaften Treibens dort konnte einer von ihnen sich für einen Augenblick im Zentrum des Geschehens wähnen: »Hier wusste man, was passiert, hatte den Finger am Puls der Welt und lauschte auf ihren Herzschlag.«[11]
Selbst wenn die Vollversammlung nicht tagte und wenn sich, wie gewöhnlich, auch sonst nichts tat, drängten sich auf den Korridoren des Sekretariats frustrierte Enthusiasten, Grüppchen verärgerter Minderheiten und Presseleute auf der Suche nach Stoff für ein Bulletin. An diesem Februarnachmittag jedoch hatte sich alles im Bâtiment électoral eingefunden, wo sich ein Stimmengewirr aus allen möglichen Sprachen erhob, als die Delegierten ihre Plätze einnahmen. In New York läuteten am späten Vormittag mit ganz bewusstem Timing die Glocken: Saint Patrick auf der einen Seite des Atlantiks, Saint-Pierre auf der anderen. Vier Tage später, am Samstagmorgen, präsentierten die Sprecher von Millionen ihre Petitionen dem Präsidium auf der Estrade, von wo aus sie der jetzige Vorsitzende der Konferenz, der ehemalige britische Außenminister Arthur Henderson, zu einer Sondersitzung willkommen hieß. Sie vertraten Frauen-, Veteranen- und Jugendgruppen, politische Parteien, Gewerkschaften und studentische Verbindungen, Kirchen, pazifistische Bewegungen, Einrichtungen des Völkerbunds und viele mehr; sie vermittelten den fernen Lärm der Zivilgesellschaft sowie der Stimmen, so jedenfalls ging das Gerücht, von alles in allem zweihundert Millionen Mitgliedern – etwa zehn Prozent der Weltbevölkerung. Die Frauen, dünn gesät unter den Delegierten, dafür im Publikum umso zahlreicher, beherrschten die Umzüge. Ein PAX auf dem weißen Armband, der Name ihres Herkunftslands auf der grünen Schärpe, überbrachten sie Petitionen mit fast sechs Millionen Unterschriften; auf fernen Bahnhöfen waren sie kistenweise nach Genf verschickt und von bannertragenden Frauen verabschiedet worden. Die großen und kleinen Packen, ordentlich zusammengebunden oder simpel verschnürt, häuften sich nach und nach auf dem Tisch des Präsidenten. In den Augen der Gläubigen dämmerte hier, an den Gestaden des Genfer Sees, eine internationale Öffentlichkeit, die die Nationen der Welt zur Vernunft aufrief.[12]
Nur war dem nicht so. Die »Meinung der Weltöffentlichkeit«, wie Aktivisten sie sich an diesem Tag in Genf vorstellten, mochte sich eines transnationalen Augenblicks erfreuen, aber sie war alles andere als einig, sogar eher fragmentarisch und episodenhaft, setzte sie sich doch aus lokalen Stimmen zusammen, die letztlich nur ihre Aversion gegen das emblematischste aller Übel in ihren jeweiligen Nationen – namentlich die Kriegswaffen – verband. In Frankreich waren die lautesten Stimmen nicht selten die der Radikalen, unter denen einige Pazifisten, aber nur wenige Internationalisten waren, sowie die der Kommunisten, die internationalistisch, aber keineswegs pazifistisch eingestellt waren; und schließlich gab es noch eine Handvoll politischer Nonkonformisten, die weder das eine noch das andere waren. In Großbritannien kamen sie von Atheisten und Kirchenleuten, von der Labour Party wie von Konservativen, von agnostischen Unabhängigen und vielen mehr. War eine solche Gemeinschaftlichkeit schon innerhalb einer Nation anfällig, so galt das doppelt für die Nationen untereinander. Überproportional anglo-amerikanisch besetzt, voll nationaler Widersprüche hinsichtlich der angezeigten Abrüstungsansätze, oftmals dissonant und ideologisch diffus, sprach aus diesem Chor in erster Linie ein ungeheures Gefühl – dass die Staatsmänner dieser Welt eine neue Katastrophe irgendwie vermeiden könnten. Aber handelte es sich hier tatsächlich um eine neue Öffentlichkeit, die dem Kokon der alten zu entschlüpfen versuchte?[13] Diversität hatte der Herausbildung neuer Öffentlichkeiten innerhalb von Nationen und einigen ihrer Kolonien seit dem 18. Jahrhundert nicht mehr im Wege gestanden; sie hatte sie sogar begünstigt; allerdings hatten sie einen gemeinsamen Raum beherrscht, in dem es sich im Lauf der Zeit wachsen und den jeweiligen Fürsten bedeuten ließ, sich anzupassen oder zu gehen. Dem war in Genf nicht so.
Die Petenten traten hier eher als Bittsteller denn als Herausforderer auf und beriefen sich einmal mehr auf ihre zahlenmäßige Überlegenheit und »das Volk«, aber eben nur, um den Offiziellen zuzureden, bevor sie sich wieder zerstreuten. Und die Offiziellen strahlten; der Völkerbund nahm sich der Sache der Besucher an; die Konferenz öffnete ihnen die Türen. Wir sprechen hier nicht von internationalen Generalständen nach Art von 1789, wo sich Frankreichs tausendjährige königliche Ordnung auf eigene Veranlassung einer Versammlung ebenso unfügsamer wie eloquenter Unzufriedener gestellt hatte. Die meisten derer, die 1932 Genf besuchten, kamen nicht wieder, obwohl der Strom der Resolutionen und Petitionen aus aller Welt nicht abreißen wollte.[14] Noch im selben Monat machten britische Freiwillige das Angebot, sich im Rahmen einer »Friedensarmee« unbewaffnet in einem gedachten »Niemandsland« zwischen chinesischen und japanischen Kräften zu postieren, während die Konferenz aushandelte, was ihr Landsmann Henderson als »Wendepunkt in der Geschichte der Welt« bezeichnen sollte. Aber der Augenblick war so schnell wieder vorbei, wie er sich ergeben hatte. Und was war mit dem Morgen danach? Die Delegierten, mit ihren ebenso undankbaren wie unlösbaren Aufgaben in den technischen Kommissionen befasst, hatten erhebliche Bedenken, noch während sie sich abmühten, die Masse von Panzern, das Kaliber von Haubitzen, die Zahl von Ausgehobenen und Freiwilligen zu reduzieren. Es war alles, wie einer schrieb, eine einzige ungeheure Spiegelfechterei. Im Namen Frankreichs überraschte André Tardieu die Konferenz bei der Eröffnung mit der Vorlage eines eigenen Plans. Freilich hatte ein leitender Berater bei der Arbeit an der Rede einige Wochen zuvor darauf hingewiesen, dass »die Realität der Konferenz … eine demagogische und theatralische Realität« sei.[15] Manöver zur Eroberung der öffentlichen Meinung, so hatte er seine Regierung wissen lassen, würden die Konferenz beherrschen. Es dauerte nicht lange, und welterfahrene Reporter, die in Erwartung von Nachrichten nach Genf gekommen waren, sahen sich bitter enttäuscht, und hin und wieder trat einer aus der alkoholseligen Wärme des Café Bavaria nach draußen, um in der ernüchternden Nachtluft seine Gedanken zu klären.[16]
Damals und im Folgenden begann ein merkwürdiger Irrglaube um sich zu greifen – in Genf hätten Staatsräson und die gewohnheitsmäßige Habsucht souveräner Staaten den Willen der Welt durchkreuzt. »Die Delegierten der Regierung«, so schrieb ein allseits geschätzter Korrespondent des Manchester Guardian nach seinem Einsatz in Genf, »spielten das Spiel der Machtpolitik ohne die geringste Rücksicht auf die allgemeinen Interessen der Welt und zeigten auch nicht den Hauch eines internationalen Geistes.« Sein Kollege von der Londoner Sunday Times sah den Schuldigen im nationalen Interesse selbst; seiner Ansicht nach triumphierte in Genf die Unaufrichtigkeit, war der Völkerbund eine Scharade und Genf die Bühne dafür. Aber auch dem war nicht so.[17] Die Regierungen kamen keineswegs zum Völkerbund, um ihn zu unterminieren, und noch weniger, um auch nur einen Teil ihrer Souveränität aufzugeben, nein, sie kamen, um sich seiner zu bedienen. Inmitten der Trümmer des Großen Krieges war Großbritannien vor allem daran gelegen, verbindliche bilaterale europäische Verpflichtungen zu vermeiden; Frankreich dagegen wollte seinen Status und seine Sicherheit garantiert sehen; den Regierungen der kleineren Mächte wiederum lag daran, ihr Überleben durch ein Rahmenwerk sicherzustellen, an dem auch die anderen beteiligt waren. Dem Konzept der kollektiven Sicherheit, das keiner der wesentlichen Interessen im Wege stand und obendrein elastisch genug für jegliche Auslegung war, konnte sich niemand entziehen. Zu Hause jedoch schlug die Stunde des nationalen Vorrangs, und das allenthalben; es kam schier zu Wettbewerben, sich seine Vorzüge auszumalen, was die Stimmen aus Genf noch fremder, noch exotischer klingen ließ.
In Schanghai verschleierten Rauchwolken und Pulverdampf die widerstreitenden Faktionen, die auf jeder der gegnerischen Seiten die Führung eines nationalen Kreuzzugs an sich zu reißen versuchten. Die Kampfhandlungen dauerten noch an, als in Japan die regierende Minseito-Partei die Mehrheit an ihre Rivalin, die Seiyukai, verlor, die nicht nur Wohlstand, sondern auch den Sieg in China versprach. Die Wähler warfen der scheidenden Regierung ihre Konzessionen an China ebenso vor wie ihre fruchtlosen Annäherungsversuche gegenüber den Amerikanern und ihr bescheidenes Auftreten beim Völkerbund. Über das Japanische Meer kam die Demagogie aus der Mandschurei, wo General Honjo Shigeru und seine Offiziere der Kwantung-Armee vollmundig die Besiedlung der riesigen Provinz mit den Familien von Reservisten ebenso versprachen wie die Befreiung Japans von den Trusts, den Mitsuis und Mitsubishis, und den Finanzmagnaten, die für sie für die Weltwirtschaft standen; ihr Ziel war es, in Tokio eine Regierung der verarmten Bauernmassen zu installieren, aus denen so viele von ihnen stammten. Japanische





























