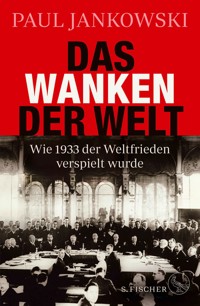14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
+++ Verdun, die blutigste Schlacht des Ersten Weltkriegs, in einer fesselnden Geschichtserzählung dargestellt – von den Kämpfen selbst bis zur Erinnerungskultur in Frankreich und Deutschland +++ An einem kalten Februarmorgen 1916 eröffneten mehr als 1000 deutsche Geschütze das Feuer auf französische Stellungen rund um Verdun. Zehn Monate wurde erbittert gekämpft, 300 000 Soldaten fanden den Tod. Verdun gilt bis heute als Symbol für sinnloses Sterben und zermürbenden Stellungskrieg. In seiner brillanten Darstellung führt der amerikanische Historiker und exzellente Kenner der französischen Geschichte Paul Jankowski mitten ins Geschehen und lässt die Ängste und Hoffnungen der Kämpfenden spürbar werden. Doch er schildert ebenso, wie die »Jahrhundertschlacht« in beiden Ländern wahrgenommen und von Beginn an politisch vereinnahmt wurde. Eine große Gesellschaftsgeschichte des Ersten Weltkriegs und eine neue, moderne Sicht auf dessen längste und grausamste Schlacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Paul Jankowski
Verdun
Die Jahrhundertschlacht
Über dieses Buch
Verdun, die blutigste Schlacht des Ersten Weltkriegs, in einer fesselnden Geschichtserzählung dargestellt
An einem kalten Februarmorgen 1916 eröffneten mehr als 1000 deutsche Geschütze das Feuer auf französische Stellungen rund um Verdun. Zehn Monate wurde erbittert gekämpft, 300 000 Soldaten fanden den Tod. Verdun gilt bis heute als Symbol für sinnloses Sterben und zermürbenden Stellungskrieg. In seiner brillanten Darstellung führt der amerikanische Historiker und exzellente Kenner der französischen Geschichte Paul Jankowski mitten ins Geschehen und lässt die Ängste und Hoffnungen der Kämpfenden spürbar werden. Doch er schildert ebenso, wie die »Jahrhundertschlacht« in beiden Ländern wahrgenommen und von Beginn an politisch vereinnahmt wurde.
Eine große Gesellschaftsgeschichte des Ersten Weltkriegs und eine neue, moderne Sicht auf dessen längste und grausamste Schlacht.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Paul Jankowski, geboren 1950, studierte und promovierte in Oxford und ist Raymond Ginger Professor für Geschichte an der Brandeis University in Boston/USA. Sein Schwerpunkt ist die Geschichte Frankreichs im 19. und 20. Jahrhundert. 2000 erschien von ihm ›Cette vilaine affaire Stavisky. Histoire d'un scandale politique‹, 2008 ›Shades of Indignation. Political Scandals in France‹. Für ›Verdun‹ erhielt er von der World War I Historical Association 2014 den Preis für das beste Buch zum Thema.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg / Sybille Dörfler
Coverabbildung: akg-images
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die französische Originalausgabe erschien 2013 als Übersetzung aus dem Englischen unter dem Titel »Verdun 21 février 1916« bei Éditions Gallimard, Paris.
© Éditions Gallimard 2013
Für die deutsche Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402968-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
In memoriam
[Karten]
Einleitung
1 Die dreihundert Tage von Verdun
2 Verdun aus deutscher Sicht
3 Verdun aus französischer Sicht
4 Die Offensivfalle
5 Die Prestigefalle
6 Die Zermürbungsfalle
7 Der Albtraum
8 Unmut
9 Warnsignale
10 Feinde
11 Loyalitäten
Epilog
Anhang
Dank
Zu den Quellen
Verluste
Memoiren und Tagebücher
Zensoren der Briefpost
Bibliographie
Unveröffentlichte Primärquellen
Veröffentlichte Primärquellen
Sekundärliteratur
Abkürzungen
Zeittafel
1914. Kapitel
1915. Kapitel
1916. Kapitel
1917. Kapitel
1918. Kapitel
In memoriam
Richard Cobb 1917–1996
Maurice Keen 1933–2012
Historiker und Tutoren am Balliol College in Oxford
Einleitung
Am 21. Februar 1916, 18 Monate nach Beginn des Ersten Weltkrieges, griffen deutsche Truppen französische Stellungen nördlich und nordöstlich von Verdun an, der alten Festung an der Maas (französisch: Meuse) im Nordosten Frankreichs. Damit leiteten sie die »Symbolschlacht des ganzen Krieges 1914–1918« ein, wie der Romanautor und Kriegsveteran Maurice Genevoix es formulierte. Der zehnmonatige Stellungskrieg, der mit dem Begriff »Verdun« verbunden ist, hat dem Ort eine besondere Größe verliehen, und schon vor dem Ende der Schlacht fiel auf die in Trümmern liegende Stadt und ihre Umgebung der erste Glanz eines posthumen Ruhmes. Es gibt immer wieder Kriegsschauplätze, die eine weit über ihren strategischen Wert hinausgehende Bedeutung und einen geradezu legendären Symbolcharakter erlangen. Die Verteidiger von Saragossa im Jahr 1808 und von Stalingrad 1942/43 etwa wurden zu nationalen Rettern stilisiert. Auch Verdun, ein Ort, an dem so viele Franzosen und Deutsche ihr Leben verloren – insgesamt 300000 –, dass das riesige Beinhaus, das dort nach dem Krieg errichtet wurde, nur einen Bruchteil der zersplitterten und verstreuten Überreste aufnehmen konnte, wurde zum nationalen Symbol. Daher musste Genevoix seinen Ausspruch nicht weiter erklären: Niemand hätte gewagt, den Glorienschein, der die gemarterte Stadt umgab, anzukratzen.[1]
Auf den ersten Blick scheint der Rang, den die Franzosen Verdun beimessen, unbestreitbar. Die Schlacht dauerte länger als jede andere des Ersten Weltkrieges – mindestens bis Dezember 1916, als die Franzosen den größten Teil des im Februar verlorenen Terrains zurückerobert hatten. Doch auch danach gingen die Kämpfe weiter, so dass die Schlacht ein Sinnbild für das unaufhörliche und eintönige Blutvergießen des gesamten Krieges wurde. Zweitens stand Verdun als Abwehrschlacht, die die Franzosen nicht begonnen hatten, stellvertretend für ihre Lage in einem Krieg, den sie ebenfalls nicht angefangen hatten. Und drittens war es eine einsame Schlacht, denn sie wurde von den Franzosen ohne Verbündete ausgefochten. Die Briten bereiteten in einem anderen Sektor der Westfront ihre eigenen Offensiven vor, Russen und Italiener kämpften an weit entfernten Fronten, und die Amerikaner traten erst in den Krieg ein, als die Schlacht um Verdun bereits vorüber war. Das unterschied Verdun von den meisten anderen großen Schlachten und spiegelte eine weitere Realität des Ersten Weltkrieges wider: In seinem Verlauf verloren die Franzosen weit mehr Männer als ihre Bündnispartner an der Westfront, fast doppelt so viele wie die Briten und über zwölfmal so viele wie die Amerikaner. Verdun stand in der Tat sinnbildlich für die französische Kriegserfahrung.
Obwohl Verdun also eng mit der französischen Geschichte verbunden ist, reicht der Rang der Schlacht doch weit darüber hinaus. »Verdun wird einst als das Schlachthaus der Welt in die Geschichte eingehen«, schrieb ein amerikanischer Sanitätsfahrer nach seiner Ankunft im August 1917, als die Franzosen endgültig die Rücken der Höhe 304 und des Toten Mannes von den Deutschen zurückeroberten. Wenn man das Geschehen etwas nüchterner betrachtet, dann wundert man sich jedoch ein wenig über die Berühmtheit der Schlacht, sogar aus französischer Sicht. Es war keine Entscheidungsschlacht – kein Waterloo, Sedan oder Kursk, die allesamt für einen Moment des Krieges stehen, in dem eine Seite die Initiative verlor und in der Folge nicht mehr wiedererlangte. Die frühere Schlacht an der Marne hatte eine entscheidendere Bedeutung gehabt und das Land auf dramatischere Weise gerettet: Sie hatte die vorrückenden deutschen Truppen gestoppt und sogar zurückgedrängt. Das Gleiche galt für die Gegenoffensiven von 1918, die außerdem im Gegensatz zur Erfahrung von Verdun die künftige französische Militärdoktrin mit ihrer Betonung langer, aus der Defensive geführter Kriege und einer methodischen Kampfführung prägten. Und auch die tatsächliche strategische Bedeutung Verduns erschien manchen Verteidigern schon zweifelhaft, während sie noch die Angreifer abzuwehren versuchten.
Weder die Franzosen noch die Deutschen erholten sich jemals wieder von ihren Verlusten bei Verdun. Dennoch ist im Krieg alles relativ: Hatte diese Schlacht eine Seite mehr als die andere geschwächt? Die Antwort auf diese Frage, die im selben Jahr an der Somme gegeben werden sollte, erwies sich als längst nicht eindeutig. Und Verdun war auch nicht die blutigste Episode des Krieges, die sich durch das Ausmaß des Gemetzels von allen anderen abhob. Im Bewegungskrieg um die Ardennen und die belgische Grenze im August und September 1914 starben viel mehr Soldaten. Die französischen Verluste bei ihren Offensiven zuvor in der Champagne 1915 und danach an der Aisne im Jahr 1917 übertrafen ebenfalls phasenweise die in Verdun. »Aus Gründen, die nicht schwer zu finden sind«, hatte Jules Romains, wie er selbst sagt, Verdun ins Zentrum seines gewaltigen, historischen Romanzyklus »Les Hommes de bonne volonté« (»Die guten Willens sind«) gerückt. Je genauer man hinschaut, desto schwerer fällt es jedoch, diese Gründe auszumachen, und die Vorrangstellung Verduns erscheint alles andere als selbstverständlich.[2]
Verdun hatte keine großen politischen Auswirkungen. Weder rettete die Schlacht einen Herrscher, noch führte sie zu seinem Sturz – sie war kein Bouvines anno 1214, das einen französischen Monarchen, Philipp August, stärkte, noch war sie ein Rossbach anno 1757, das dazu beitrug, einen anderen, nämlich Ludwig XV., zu schwächen, und sie war schon gar kein Waterloo 1815 oder Sedan 1870, die zwei weitere entthronten: die eine Napoleon, die andere dessen Neffen. Die Dritte Republik sah nach der Schlacht von Verdun nicht wesentlich anders aus als zuvor. Der Ministerpräsident (oder Président du Conseil, wie er damals genannt wurde) Aristide Briand blieb im Amt, wie auch das Staatsoberhaupt Raymond Poincaré. Die Schlacht schwächte die Stellung General Joseph Joffres, des Generalstabschefs, dem seine Kritiker im Abgeordnetenhaus vorwarfen, er habe Verdun nicht mit genügend starken Kräften verteidigt. Dass Joffre abgesetzt wurde, war aber letztlich eher auf die enttäuschende französisch-britische Offensive an der Somme im Sommer und Herbst desselben Jahres zurückzuführen als auf Verdun. Vorübergehend beförderte Verdun zwar die Karriere General Robert Nivelles, der Joffre ablöste, allerdings behielt er das Kommando nur bis zur kläglich gescheiterten Offensive am Höhenzug Chemin des Dames im Frühjahr 1917. Aus politischer Sicht hatte die lange Schlacht keine Folgen.
Wenn Verdun tatsächlich Frankreich »gestaltete«, so geschah dies nicht durch eine unmittelbare militärische oder politische Auswirkung, eine Kapitulation oder einen Rücktritt, eine Krise oder einen Aufstand, aus dem ein anderes Land hervorgegangen wäre. Es geschah vielmehr langsam, über Jahrzehnte hinweg, indem die nachfolgenden Generationen den Ort mit immer mehr Bedeutungen aufluden. Sein Einfluss auf das Nationalbewusstsein entwickelte sich erst im Lauf der Zeit, weil sich nach und nach herausstellte, dass Verdun der letzte große Sieg französischer Truppen in einer Schlacht bleiben sollte. Etwas Vergleichbares ereignete sich nie wieder, weder 1917 oder 1918 noch zwischen 1939 und 1945 und schon gar nicht während der schmutzigen Kolonialkriege, die darauf folgten. Damit erlangte die Schlacht sogar eine größere Bedeutung als der Erste Weltkrieg selbst. Diejenigen, die das sogenannte kollektive Gedächtnis – beziehungsweise die öffentliche Auffassung von Geschichte – prägen, verklärten Verdun konsequent und lösten es aus dem zeitlichen Kontext. Die Schulbücher, politischen Reden, Presseartikel und audiovisuellen Berichte, Gedenkfeiern, populären Geschichten, Filme, Romane und Lieder – all jene Medien, die den Millionen, die kaum etwas darüber wussten, den Eindruck eines großartigen Ereignisses vermittelten – sprachen von »Einigkeit«, »Volk«, »Vaterland«, »Widerstand«, »Boden«, als handle es sich um einen Moment der Wiedergeburt. Verdun wurde zu einem beliebten Bezugspunkt für jeden – und das waren viele –, der in den Jahren und Jahrzehnten nach 1918 die These belegen wollte, dass das Land dabei sei, vom Kurs abzukommen. Keine andere Schlacht, weder eine aktuelle noch eine historische, erfüllte diesen Zweck. So gesehen, ist die Frage, inwiefern Verdun Frankreich »gestaltete«, gleichbedeutend mit der Frage, was Frankreich aus Verdun machte. Und die zweite Frage wäre: Wie weit entfernte sich das so entstandene Konstrukt von der Schlacht selbst?
Die Deutschen befassen sich ihrerseits ebenfalls intensiv mit Verdun, das ihnen mehr Kopfzerbrechen bereitet als etwa die Schlacht an der Somme, deren Ausgang für sie günstiger war. Sie verloren bei Verdun fast ebenso viele Männer wie die Franzosen, unter ebenso grauenhaften, wenn nicht noch schlimmeren Bedingungen: Im Gegensatz zu den Franzosen hatten ihre Soldaten kaum Forts, in denen sie Schutz vor dem Artilleriefeuer, den Granatsplittern und dem Wetter suchen konnten. Ebenso sehr wie die Franzosen leiteten die Deutschen aus dem Gemetzel eine Parabel menschlicher Willenskraft ab. Anders als die Schlacht an der Somme brachte Verdun jedoch keinen Ernst Jünger hervor, den Autor des gefeierten Kriegstagebuchs »In Stahlgewittern«. Überhaupt entstand auf der anderen Rheinseite kein mit dem Französischen vergleichbares literarisches und dokumentarisches Werk. Dieser Mangel an Quellen wurde zum Leidwesen der Historiker durch die Zerstörung der Archive des kaiserlichen deutschen Heeres bei einem alliierten Bombenangriff auf Potsdam 1945 noch verschärft. Nichtsdestotrotz inspirierte die Schlacht eine eigene Heldenliteratur, die den einfachen Soldaten verklärte. Fiktive und halbfiktive Darstellungen priesen seine Entschlossenheit und Kameradschaft oder ließen eine vermeintliche innere Stimme des Volkes über dem Schlachtenlärm erklingen. Manche dieser Darstellungen feierten, im Gegensatz zu den französischen, nicht die Einheit, sondern tadelten den Verrat am einfachen Soldaten durch die Oberste Heeresleitung oder die Heimatfront; und offizielle Verlautbarungen, nationalistische, revanchistische oder gar nationalsozialistische, griffen solche Themen eifrig auf. Sie alle durchzog ein Leitmotiv, das vermuten lässt, dass Verdun auch für die Deutschen ein Symbol für den gesamten Krieg war: das Motiv der Tragik oder des edlen Scheiterns.[3]
Abgesehen von den jeweiligen nationalen Perspektiven, besetzte Verdun, insbesondere in der Presse und in populärwissenschaftlichen Darstellungen britischer und amerikanischer Autoren, nach und nach eine weitere symbolische Nische. Ihnen erschien Verdun als einzigartig grausame Schlacht, womöglich die grausamste aller Zeiten, wie es in einer Schilderung heißt.[4] Andere Autoren vom gleichen Schlag erkannten darin eine archetypische Materialschlacht, einen technokratischen Moloch, der die eigenen Kinder frisst, »das Symbol für die Schrecklichkeit der modernen, industriellen Kriegführung, für das es praktisch keine Parallele gab«.[5] Von der Fabrik direkt in den Schützengraben – an jenen engen, von rauchenden oder brennenden Anhöhen umgebenen Schauplatz – ergoss sich der Rekordausstoß der Waffenschmieden, ergoss sich all das, was nationale Findigkeit und Produktivität hervorzubringen vermochte, so dass ein britischer Autor viele Jahre später von »einer völlig neuartigen Schlacht« sprach, »einer Vernichtungsschlacht«.[6] Derartige Formulierungen umgeben Verdun mit einem nationalen und historischen Nimbus, der symbolhaft für die Sinnlosigkeit des industriellen Krieges und in manchen Fällen sogar des Krieges an sich steht.[7]
»Aus einem Symbol müssen wir die Substanz herausfiltern«, schrieb einst ein französischer Historiker, und Verdun ist hier keine Ausnahme. All diese Verklärungen Verduns oder irgendeiner anderen vergleichbaren Schlacht resultieren aber nicht zwangsläufig aus dem bewussten Versuch, sie einseitig zu instrumentalisieren, einen nationalen Konsens durchzusetzen oder abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen. Genauso wenig, wie sich darin ein Angriff der Gegenwart auf die Vergangenheit verbergen muss, ganz so, als wäre jeder Versuch, Ereignissen rückblickend Bedeutung zuzuweisen, unweigerlich anachronistisch. Der Mythos enthält seine eigene Realität, ebenso wie die Schlacht, und die Geschichte des Ersteren berührt nicht nur die Geschichte der Letzteren; sie kommt ohne sie nicht aus.[8]
Genau darum geht es in diesem Buch. Es gibt viele Geschichten von Verdun. Bücher oder Broschüren über die Schlacht erschienen schon vor ihrem Ende, und der Strom ist nie versiegt. Die konzeptionelle Bandbreite ist überaus vielfältig, von populärwissenschaftlichen Darstellungen bis hin zu analytischen Studien, die sich auf die Militärarchive stützen, wobei jedes Genre herausragende oder modellhafte Exemplare vorzuweisen hat, an erster Stelle Alistair Hornes »The Price of Glory« beziehungsweise Gérard Caninis »Combattre à Verdun«. Zwischen 1983 und 1998 befasste sich mehr als ein Viertel aller französischen Publikationen über die Schlachten des Ersten Weltkrieges mit Verdun. Seit den 1920er Jahren fiel diese Aufmerksamkeit in den Printmedien offenbar regelmäßig mit den zehnjährigen Jubiläen der Schlacht zusammen. Sie verweisen insgesamt auf den unersättlichen Durst der Leser nach detaillierten Beschreibungen des Schreckens. Was mag dort passiert sein, so werden sie sich gefragt haben.[9]
In den 1980er und 1990er Jahren verloren Historiker jedoch allgemein das Interesse an Schlachten, was trotz seiner herausragenden Bedeutung auch für Verdun galt. Zugleich büßte die herkömmliche Militärgeschichte Bedeutung ein, die sich in erster Linie mit Taktik, Kommandostrukturen, Logistik und allen unmittelbaren oder mittelbaren Gründen für einen bestimmten Ausgang auf dem Schlachtfeld beschäftigte. Stattdessen gerieten die Heimatfront samt Zivilisten, die Kolonien und ihre Bewohner, die Mentalitäten und die physische Verfassung der Soldaten, die Kriegserfahrung und vor allem das kulturelle Nachspiel in den Blickpunkt einer jüngeren Historikergeneration. In Frankreich wurden eigene Zentren und Organisationen zur Erforschung des Krieges ins Leben gerufen, was einer modernisierten Militärgeschichte Auftrieb gab. Zwar beschäftigte man sich immer noch mit der einen oder anderen Schlacht, einem Gefecht oder Frontabschnitt, doch hielt man die Marne, die Somme oder Verdun im Gegensatz zu früher keiner eigenen Studien mehr wert. Die »Schlachtengeschichte«, die unter britischen und amerikanischen Historikern gelegentlich abschätzig als »Trommeln-und-Trompeten-Geschichte« bezeichnet wird, verschwand allmählich aus den akademischen Regalen, nachdem ihre schärfsten Kritiker sie auf die Beistelltischchen der reichen Vororte verbannt hatten.
Dabei bleibt die Schlachtengeschichte weiterhin die Grundlage von allem und ermöglicht erst die feinsinnigen Überlegungen, die sich daraus ergeben können: die »Anthropologie des Soldaten«, Debatten um ein kulturelles »Gedächtnis«, die Neuordnung der Geschlechterbeziehungen; ohne den Tag (oder wie in Verdun die Monate) der Schlacht und deren Fakten und Realitäten gäbe es gar keine weiterführenden Fragen, die zu erörtern wären. In der Regel widmen sich Historiker diesen und anderen Fragen in Einzelstudien, doch im Idealfall sollten sie alle zusammen behandelt werden. Und wo sonst als in der Schlacht kommen all diese Themen zusammen? Doch lässt sich das Ereignis nur dann umfassend erschließen, wenn auch die grundlegenderen Fragen nach dem Warum und Wie gestellt werden. Ich möchte in diesem Buch die Geschichte von Verdun erzählen, indem ich die alte Geschichte mit der neuen kombiniere, das kalte Kalkül des Geländegewinns, der verschossenen Granaten und verlorenen Menschenleben mit den Tiefen der menschlichen Erfahrung auf beiden Seiten. Es soll die umfassende Geschichte einer Schlacht erzählt werden.
Mit Hilfe von Zahlen kann man die Schlacht nach objektiven Kriterien erfassen, aber sie sind völlig nutzlos, wenn es darum geht, Stimmungen und Mentalitäten einzufangen. Zahlen hinterlassen Spuren, die gelegentlich bestimmte Vermutungen gestatten: über die Ernüchterung, die sich etwa in der Quote der Deserteure widerspiegelt, oder über die Konjunkturen der Nachkriegserinnerung, die sich aus Besucherzahlen an Gedenkorten ableiten lassen. Doch die subjektiven Dimensionen der Schlacht erschließen sich dem Historiker nur durch persönliche Geschichten, die über alle Regimenter und Monate verstreut sind. Wellington, der auf beiden Feldern eine gute Figur zu machen verstand, sagte einmal, eine Schlacht gleiche einem Tanz im Ballsaal: Die eigentümliche Verbindung von Vielfalt und Monotonie, die damit angedeutet ist, spiegelt sich auch in den meisten Quellen zur Schlacht von Verdun, aus denen uns Erfahrungsmuster entgegentreten, die der Historiker zwar imstande ist zu erkennen, aber selten genau auszumessen. All die Gefühle und Erfahrungen jener, die bei Verdun auf beiden Seiten der Maas über Monate hinweg lebten und starben, zahlenmäßig zu erfassen wäre pedantisch und sinnlos. Ihre Worte, die die Zeit überdauert haben, werden hier fast hundert Jahre später wiedergegeben, um dem Leser so nahe wie möglich zu bringen, was diese Menschen in Verdun erlebt haben.
1Die dreihundert Tage von Verdun
Februar 1916: Den ganzen Monat hatten sich an den Fronten in der Champagne und in den Argonnen Nebel, Regen und Schnee abgewechselt. In der Nacht vom 19. auf den 20. brachte ein Ostwind die Sterne und den Mond wieder zum Vorschein, und der Morgen überraschte mit einem wolkenlosen, blauen Himmel.[1] Einen Tag später, am Montag, dem 21., bebte die Erde. Weiter nördlich hörten die Soldaten in ihren Unterständen an der Aisne das dumpfe Rollen und spürten den Boden erzittern – weit stärker als bei ihrer Offensive im Artois ein Jahr zuvor. An jenem Abend sahen sie im Südosten am Horizont vielfarbige Blitze aufleuchten, und am nächsten Morgen erfuhren sie, dass die Deutschen das knapp 100 Kilometer entfernte Verdun angriffen. Auf der anderen Seite der Stadt, weit im Süden, hallte von den Vogesen ein ferner Trommelwirbel wider, durchsetzt von regelmäßigen dumpfen Schlägen. Etwas näher, oberhalb von Bar-le-Duc, hörte ein Sanitätsfahrer ein unheilvolles Donnern, das nicht von der französischen Artillerie stammen konnte, und die Scheune, in der er in jener Nacht schlief, wackelte wie bei einem Erdbeben oder Vulkanausbruch.[2]
Kurz nach sieben Uhr hatten an jenem Morgen über 1200 deutsche Geschütze angefangen, französische Stellungen in und um Verdun zu beschießen; einzelne Salven waren in der Nacht vorausgegangen. Um vier Uhr morgens zerriss ein riesiger Irrläufer, eine 380-mm-Granate mit einem Gewicht von rund 750 Kilo, die Dunkelheit, streifte die Kathedrale und schlug im Hof des Pfarrhauses auf. Es war nur das jüngste Beispiel in der langen Reihe der seit den ersten Kriegstagen in Belgien geschändeten und verwüsteten Gotteshäuser. Der Erzpriester hob ein Stück des Granatenmantels in seinem Garten auf. Im Laufe des Morgens wurde der Beschuss verstärkt, und deutsche Späher verfolgten von ihren Beobachtungsposten aus, wie sich die französischen Erdwälle und Gefechtsstände einer nach dem anderen in Wolken aus Rauch und Staub auflösten. Ein Artillerist empfand eine »wahre Lust – wir schießen, schießen, schießen, ohne Unterbrechung«, eine Salve nach der anderen, Granate um Granate, Stunde um Stunde. Selbst in der kalten Winterluft rann ihm der Schweiß übers Gesicht. Gegen Mittag verstärkte sich der Schlachtenlärm, als die Mörser in den Schützengräben das Feuer eröffneten, und steigerte sich gegen 16 Uhr zu einem unheilvollen Crescendo, als das sogenannte Trommelfeuer einsetzte, bei dem die Batterien alle 15 Sekunden feuerten. Nach einer Stunde ebbte der Beschuss wieder ab. Etwas Vergleichbares hatte es in den Annalen des Krieges noch nicht gegeben. Allein an diesem Tag, dem ersten Tag der Schlacht von Verdun, waren eine Million Granaten niedergegangen.[3]
Einem Künstler in einem deutschen Flugzeug knapp 2000 Meter über dem Boden kamen die Detonationen so laut und so nah vor, dass er meinte, sie selbst befänden sich unter feindlichem Beschuss. Dabei stammten die Granaten von ihren eigenen Geschützen. Er war gekommen, um die Szenerie unter ihm festzuhalten. Die Maas und ihre überfluteten Ufer spiegelten die helle Wintersonne wider; die deutschen Geschütze blitzten entlang des bewaldeten Bogens auf; die winzige Stadt in der Ferne, die von vier dicken Rauchwolken verhüllt wurde, sagte ihm nichts, bis der vordere Schütze es aufgab, gegen den Lärm der Doppelpropeller anzubrüllen, und ihm auf der Karte den Ort Verdun zeigte.
Ballone und wurstförmige Luftschiffe trieben unter ihnen, und die eigenen Flugzeuggeschwader schossen durch aufsteigende Rauchwolken und zerplatzende Schrapnellgranaten. Am Nachmittag brachen in der Stadt die ersten Brände aus. Granaten schlugen neben den Brücken und im Fluss ein und ließen zwischen den blaugrauen Rauchschwaden Wassersäulen aufsteigen. Aber ansonsten schien es ihm, als würde in der Luft intensiver gekämpft als am Boden. Hatte die dreidimensionale Kriegführung bereits die lineare Variante abgelöst, die den Bewegungskrieg von 1914 und die Offensiven des Jahres 1915 so sehr geprägt hatte? Der Künstler am Himmel machte durch sein Fernglas nirgendwo französische Soldaten am Boden aus; und später, als er die Aquarelle signierte, die seine Eindrücke vom Tag wiedergaben, waren auf seinen Leinwänden keine blaugrauen Uniformen zu sehen.[4]
Das war auch kein Wunder: Die französischen poilus – die »Behaarten«, wie Soldaten der Infanterie wegen ihres zum Teil unrasierten Äußeren und anfangs sehr zu ihrem Ärger genannt wurden – waren größtenteils unter der Erde oder unter irgendeiner Tarnung versteckt. Sie waren nicht zu sehen, von ihren Kommandeuren und sogar voneinander isoliert. Im Hauptquartier des 30. Korps[*] im Bois de la Chaume nordöstlich von Verdun sah es so aus, als würden die bewaldeten Hügel und Schluchten im Norden auf einer Front von etwa 13 Kilometern in Flammen stehen, und schon vor zehn Uhr am Morgen hatte man jeden Kontakt zu den dort stationierten Einheiten verloren. Kabel rissen, Kuriere und Kradfahrer verschwanden spurlos, Lichtsignale gingen in den Rauch- und Staubwolken unter. Der Nachschub konnte die Männer weder mit Proviant noch mit Munition versorgen. Aber selbst wenn der Zugang offen gewesen wäre, so bombardierten die nach Belieben in der Höhe kreisenden deutschen Flugzeuge doch die Bahnhöfe in Verdun, Chagny im Norden und Revigny im Süden, weshalb man die Züge mit ihrer kostbaren Fracht wohlweislich in weitem Abstand angehalten hatte, außer Reichweite.
Unterdessen blieb die französische Artillerie überwiegend stumm. Feindliche Gaswolken hatte einen scharfen Geruch nach Chlor, Äther und gebrannten Mandeln unter den Batterien in den Wäldern und an den Hängen zwischen dem Bois d’Haumont im Norden und Vacherauville an der Maas verbreitet. Die Artilleristen bedeckten Nase und Mund mit Baumwolle, setzten Fahrerbrillen auf und scherten sich nicht darum, dass ihr Blickfeld dadurch eingeschränkt wurde, denn bei dem vielen Rauch und den Flammen überall war es ohnehin nicht möglich, genau zu zielen. Anfangs hatten sie noch versucht, selbst Gasgranaten auf die deutschen Geschützstellungen abzufeuern, aber es waren zu viele, oder sie waren zu weit entfernt, um sie zu lokalisieren. Außerdem gab es Probleme mit dem Nachschub an Munition: So musste sich in Cumières, am linken Flussufer, ein Fahrer, der schwere Artilleriegranaten geladen hatte, auf den Boden werfen und sich, so gut es ging, mit Laub und Zweigen tarnen. Da den französischen Artilleristen allmählich die Granaten ausgingen und sie nicht wussten, was die nächsten Tage noch bringen mochten, hielten sie sich an die strenge Order aus dem Hauptquartier und sparten Munition. Die Infanterie blieb vorläufig auf sich gestellt und musste allein kämpfen.[5]
Und das taten die Soldaten auch. Von den Kommandostellen ihrer Divisionen und Regimenter abgeschnitten, ohne Nachschub oder Verstärkung, duckten sie sich in die Schützengräben, Unterstände und notdürftigen Bunker in dem halben Dutzend bewaldeter Enklaven entlang des Niemandslands zwischen den französischen und deutschen Truppen. Das Artilleriefeuer fegte anfangs wie ein gigantischer Mähdrescher systematisch über den Frontabschnitt hinweg und überzog sie etwa alle 15 Minuten mit Donner und Erdbeben; später steigerte es sich zu einem ununterbrochenen Trommelfeuer, das sie bis in ihre Eingeweide durchschüttelte und sie zitternd und benommen zurückließ. Sie hörten das grausame Getöse der Zwei-Tonnen-Granaten, die die Erde aufrissen, und der schweren Mörser, die Schützengräben und Unterstände dem Erdboden gleichmachten, und nahmen ihren betäubend scharfen Säuregeruch wahr. Sie verfolgten die Flugbahnen der 380er- und 420er-Granaten – wahre Ungeheuer aus Chromstahl, deren Splitter wie Rasiermesser selbst die dicksten Baumstämme durchschlugen –, sahen die Bahnen kleinerer Geschosse wie der 210er kreuzen, die immer noch mit der Wucht eines mit 80 Stundenkilometern heranrasenden Zuges einschlugen, und schließlich in riesigen Erdhaufen zur Ruhe kommen. »Man stelle sich, sofern man dazu imstande ist«, schrieb Marc Stéphane, »einen sich steigernden Sturm vor, der nichts als Pflastersteine und Bausteine regnet.«[6]
Blockhütten und Unterstände bebten, hoben und senkten sich oder fielen einfach in sich zusammen. Gegen zehn Uhr erreichten die ersten Verwundeten den Bois des Caures. Ein Chasseur (Jäger) mit einer Kopfwunde drehte durch und musste fixiert werden. Dort und in den benachbarten Wäldern hörten die Männer oder mussten hilflos mit ansehen, wie ihre Kameraden unter einstürzenden Mauern und Dächern aus Erde und Blättern begraben wurden. Ein anderer Jäger im Bois des Caures, ein kampferprobter Unteroffizier, sah, wie vier Träger, die Überlebenden einer einzigen vulkanartigen Explosion, die ihren gut drei Meter unter der Erde liegenden Unterschlupf zerstört hatte, durch das »Wolfsloch« seines bereits überbevölkerten Schlupfwinkels krochen. »Jetzt sind wir sechzehn.« Dem Unteroffizier gefielen die geflüchteten Sanitäter gar nicht, die sich, instinktiv beieinander Schutz suchend, zitternd und mit den Zähnen klappernd zusammendrängten.[7]
Schon bald konnte man den Bois des Caures, den Bois d’Haumont und den Bois de Ville über und jenseits von ihnen nicht länger als Wälder bezeichnen – bei Einbruch der Dunkelheit ähnelten sie den Abraumhalden verlassener Sägemühlen, das reinste Wirrwarr aus Baumstümpfen und Stacheldraht. Eingestürzte Wälle, ausgerissene Bäume, zerfetzte Äste und gefährliche Krater machten die Schützengräben unpassierbar. Die Hänge hätten gut in eine zerklüftete Mondlandschaft gepasst, wenn nicht die Trümmer der Befestigungen und das Blattwerk gewesen wären, das sie bedeckte – ein ebenso dämonischer wie einzigartiger Anblick.[8]
Kurz nach fünf, als die deutschen Geschütze das Feuer weiter nach vorn verlegten oder zeitweilig einstellten, regten sich in den zerstörten Wäldern die ersten gut bewaffneten Eindringlinge. Die Deutschen waren aus ihren eigenen Wäldern und Unterständen hervorgekrochen und tasteten sich in der einbrechenden Dunkelheit langsam vor. Manche hatten tagelang in feuchten Schützengräben oder eisig kalten Unterständen ausgeharrt, und noch am Abend zuvor waren Lieder und Akkordeonklänge zu den französischen Gräben hinübergeschallt. Andere hatten bei Tagesanbruch ihre Lager weiter nördlich und westlich verlassen und waren durch eine schneebedeckte Landschaft marschiert, die vom Sonnenaufgang blutrot gefärbt wurde. Einer von ihnen, ein Maschinengewehrschütze, hatte mit wachsender Zuversicht auf das Artilleriefeuer gelauscht, das durch die umliegenden Hügel und Täler hallte.[9]
In Gruppen von 50 oder 60 Mann fingen die Deutschen an, das Gelände zu erkunden, das sie von den französischen Linien in 750 Metern Entfernung trennte. Sie vergrößerten die Lücken im Stacheldrahtverhau mit Bolzenschneidern und steckten die Trümmer der Unterstände und die umgefallenen Stämme und Äste mit Flammenwerfern in Brand. Sie fühlten sich auf ihrem Weg so sicher, dass manch einer sich nicht einmal die Mühe machte, das Gewehr von der Schulter zu nehmen. In den folgenden zwei Tagen rückten sie in kleinen Wellen, in Kolonnen, kleinen Gruppen und sogar einzeln und paarweise vor. Sie schlüpften durch die Lücken zwischen den Blockhütten oder dem, was noch von ihnen übrig war, bewegten sich von Krater zu Krater; sie umgingen zerstörte Gräben oder hackten und buddelten sich einen Weg durch sie hindurch. Manche trugen Handgranaten, aber keine Gewehre, andere schwangen Messer und kleine Äxte, und wieder andere hatten gelbe Masken aufgesetzt und trugen Flammenwerfer, die einen über 20 Meter langen Feuerstrahl ausspeien konnten. Pioniere arbeiteten daran, die Schützengräben wiederherzustellen und Granattrichter zu halbwegs passablen Gräben zu verbinden. Wenn die Männer auf Widerstand stießen, hielten sie wie befohlen inne und warteten ab, während Offiziere mit Pistolen weiße Leuchtkugeln abfeuerten, um Artilleriefeuer anzufordern. Sobald der Beschuss wieder einsetzte, marschierten sie weiter, in feindliches Territorium hinein, manchmal sogar im Laufschritt.[10]
Da man ihnen einen Spaziergang versprochen hatte, waren sie hochmotiviert, bewegten sich aber dennoch vorsichtig und wohlüberlegt vorwärts. Dabei stießen sie auf völlig verstörte Überlebende, die sich in kleinen Gruppen ergaben. Ein französischer Hauptmann, der womöglich aufgrund der schrecklichen Erlebnisse dieses Tages oder auch nur angesichts der drohenden Gefangenschaft den Verstand verloren hatte, erschoss sich vor ihren Augen. In zerstörten Bunkern fanden sie Weißbrot, Schokolade, Wein, Decken, Strohmatratzen – eindeutige Anzeichen einer überhasteten Flucht; und aus den Ruinen des Dorfes Haumont sahen sie, wie nördlich von ihnen Scharen französischer Soldaten von den Höhen bei Brabant in Richtung des ebenfalls an der Maas gelegenen Dorfes Samogneux flohen. Bis sechs Uhr waren die meisten Schützengräben und Vorposten in den Wäldern der ersten Linie gefallen. An jenem Abend hörten die deutschen Infanteristen in den eroberten Unterständen das Heulen und die Einschläge der Granaten sowie die Detonationen der Munitionsdepots und sahen Himmel und Dörfer in Flammen stehen.[11]
Aber sie waren an jenem Tag auch auf Widerstand gestoßen. »Ich glaube, die Deutschen erlebten eine hässliche Überraschung«, erinnerte sich ein französischer Jäger viele Jahre später. »Sie gingen davon aus, dass ihnen nichts mehr begegnen würde, und fanden stattdessen Überlebende.« In der Dämmerung eröffnete die französische Artillerie das Feuer auf die Deutschen. Zur gleichen Zeit errichteten abgeschnittene und zahlenmäßig unterlegene Gruppen von Überlebenden im Bois des Caures und Bois d’Haumont Verteidigungsstellungen zwischen ausgerissenen Bäumen und den Ruinen der Höfe, sogar während sie sich zurückzogen. Das überraschte die Angreifer. Als sie sich in Haumont über Krater und Wälle voranarbeiteten, stießen sie zunächst nur auf wenige Überlebende, die von dem tagelangen Artilleriefeuer verstört und außerstande waren, sich zu verteidigen. Aber aus den Ruinen der Kirche und des Friedhofs weiter oben, aus Kellern und von den zur Maas hin abfallenden Gegenhängen empfing sie das Gewehr- und Maschinengewehrfeuer eines immer noch in Deckung befindlichen, immer noch widerstandsfähigen Feindes. Nunmehr waren die Angreifer hier und an anderen Orten selbst verwundbar, fanden sich wider Erwarten einem unsichtbaren Gegner ausgesetzt. Ihre vielgerühmte Artillerie hatte sie im Stich gelassen, und ihre eigenen Waffen kehrten sich nun gegen sie: Flammenwerfer, die eigentlich den hilflosen Bewohnern unterirdischer Bunker den Rest geben sollten, wurden unter dem feindlichen Feuer zu tragbaren Bomben, die ihre eigenen Träger in Brand steckten. Manche zogen sich zurück und gaben die kostbaren Gewinne des Abends wieder auf. Und mit der langsam eintreffenden Verstärkung in den nächsten Tagen gewann der französische Widerstand allmählich wieder an Kraft. Die Franzosen erlitten dabei hohe Verluste; eine Division, die 72., verlor über die Hälfte ihrer Männer, gefallen, verwundet oder vermisst, aber mit ihrem Leben erkauften sie Zeit.[12]
Aber Zeit wofür? War Verdun wirklich so wichtig? Ein französischer Leutnant, der an einer anderen Front stationiert war, schrieb an seine Mutter, dass an jenem Tag in der Ferne, in der Gegend von Verdun, etwas Wichtiges im Gange sei, aber er fragte sich, warum die Deutschen beschlossen hatten, ausgerechnet dort anzugreifen. Selbst wenn die alte Stadt an der Maas fallen sollte, so meinte er, wäre das lediglich eine Art moralischer Sieg.[13]
Kronprinz Wilhelm, der Befehlshaber der deutschen 5. Armee, die Verdun angriff, war begeistert von der Aussicht auf einen grandiosen Sieg. Aber kein Mensch, einmal abgesehen von Generalstabschef Erich von Falkenhayn, konnte die Frage nach dem Warum beantworten. Und womöglich nicht einmal der General: Er schaffte das Kunststück, nicht nur den Gegner, sondern auch seine Landsleute, Zeitgenossen und Nachkommen über seine wahren Absichten an jenem Tag im Dunkeln zu lassen. Welches Ziel hatte er bei diesem Unterfangen vor Augen? Oder besser, welche Ziele – denn Falkenhayn wäre nicht der erste Oberbefehlshaber gewesen, der mit verschiedenen Ausgängen einer Operation gerechnet hätte. Jedenfalls war es dem Kommandanten des »befestigten Lagers« Verdun, General Frédéric Herr, der von seinem Hauptquartier aus schon seit über einem Monat vor einem Angriff gewarnt hatte, an jenem Tag nicht möglich, aus dem Bombardement Rückschlüsse auf die weiteren Pläne der Deutschen zu ziehen. Im Schloss Chantilly in der Nähe von Paris, wo der Generalstab der französischen Armee im November 1914 nach der Stabilisierung der Front sein ständiges Hauptquartier eingerichtet hatte, traute auch General Joseph Joffre den Deutschen nicht. Eine Woche zuvor, am 15. Februar, hatte er zähneknirschend zugeben müssen, was er und sein Stab im Januar noch abgestritten hatten: dass die Deutschen bei Verdun angreifen könnten. Aber sie konnten ebenso gut bei Nancy oder in der Champagne oder im Norden angreifen oder irgendwo anders an der 1000 Kilometer langen Front vom Ärmelkanal bis zu den Bergen an der schweizerischen Grenze. Joffre vermutete ein Ablenkungsmanöver bei Verdun, das lediglich seine Kräfte von dem Ort einer späteren Offensive abziehen sollte, oder allenfalls einen psychologischen, gegen die französische Kampfmoral gerichteten Schlag, der keinerlei militärische Konsequenzen haben würde.[14]
Warum also griffen die Deutschen einen Ort von so zweifelhafter strategischer, ja nicht einmal symbolischer Bedeutung an, noch dazu so heftig? Noch Jahre nach dem Krieg sollten sich Falkenhayns Freunde und Gegner über seine Motive streiten, und selbst die unparteiischsten Historiker waren sich nicht einig. Doch die französischen Gründe, für die Verteidigung Verduns eine ganze Armee – die 2. unter Philippe Pétain – einzusetzen, erscheinen fast ebenso schwerverständlich wie die für den deutschen Angriff. Volle 18 Monate lang hatten sie Geschütze und Truppen aus der Region abgezogen, als wollten sie die Bedeutung des einst mächtigen Befestigungsrings herunterspielen, der vor der Jahrhundertwende errichtet worden war, also lange vor dem neuen Krieg der Schützengräben und schweren Artillerie. Erst als die Zeichen unmissverständlich auf einen Angriff hindeuteten, beschlossen sie auf einmal, jeden Zoll Boden zu verteidigen, und verwarfen sämtliche militärischen Überlegungen, die für einen Teilabzug, eine flexible Verteidigung oder gar einen strategischen Rückzug gesprochen hätten. Trotzdem haushalteten sie, genau wie ihr Gegner, sorgfältig mit den Ressourcen dort, denn sie hatten auch anderswo Ambitionen. Wo blieb die Konsequenz? Wo blieben das berechnende Kalkül und der Nutzen des Ganzen?
Diese Fragen, die auch am Abend des 21. Februar in der Luft lagen, deuten in verstörender Weise darauf hin, dass menschliche Entscheidungen in dieser Schlacht womöglich von geringerer Bedeutung waren als üblich. Vielleicht hielten am 21. Februar sowohl Falkenhayn als auch Joffre Verdun lediglich für einen Nebenkriegsschauplatz, den erst Kräfte, auf die sie keinen Einfluss hatten, zu einem Hauptschauplatz machten. Doch mit derartigen Vermutungen hielten sich die Historiker nie allzu lange auf, geschweige dass sie die regelmäßigen Feierlichkeiten des nationalen Gedenkens überdauerten. In der Erinnerung und Nacherzählung wurde der Schlacht selbstverständlich entscheidende Bedeutung beigemessen, denn so viele Menschen konnten schließlich nicht für eine Nebensache gestorben sein. »Verdun war das Tor«, sagt der Verdun-Veteran den Pfadfindern zu Beginn von Léon Poiriers Film »Verdun: souvenirs d’histoire« aus dem Jahr 1931. »Sobald der Feind bei Verdun durchgebrochen wäre, wäre er unter uns gewesen. 600000 Franzosen ließen dort ihr Leben, um ihn aufzuhalten.« Die deutschen Memoirenschreiber und Erzähler stimmten dem voll und ganz zu. »Mit Verdun stand oder fiel Frankreich«, erklärte Paul Ettighoffer, ein deutscher Überlebender, auf der ersten Seite seiner Schilderung aus dem Jahr 1936. Doch am 21. Februar 1916 war für Falkenhayn, der angriff, und für Joffre, der verteidigte, Verdun alles andere als ein Schicksalsort.[15]
An jenem Tag erschien dieser Ort auch keinem von beiden als das kostbare Symbol eines Jahrhunderte währenden Kampfes, ein Symbol, das die Emotionen der Protagonisten wie in einem Brennglas bündelte. Falkenhayn war überzeugt, dass die Franzosen große Opfer in Kauf nehmen würden, um den Ort zu verteidigen, aber wenn er die Front nach einem altehrwürdigen oder symbolträchtigen Träger der nationalen Identität abgesucht hätte, dann hätte er sich wohl eher auf Reims konzentriert, das sich um die zerstörte Kathedrale scharte, in der die Geister von 30 gesalbten Königen ihr Unwesen trieben, oder auch Nancy, das die Deutschen im Jahr 1871 als Trostpflaster an Frankreich abtraten, nachdem sie das Elsass und einen großen Teil Lothringens annektiert hatten. Er erwähnte mit keinem Wort Verduns Vergangenheit. Das galt auch für Joffre. Aber schon bald wurde Verdun eine historische Rolle zugeschrieben, die der Ort zuvor nie innegehabt hatte – als wollte man die ohnehin rätselhaft erscheinenden strategischen Überlegungen gänzlich in den Hintergrund treten lassen.[16]
Seit Jahrhunderten hätten die Lateiner und Teutonen einander hier bekämpft, wie sich die Chronisten mit einem Mal erinnerten. Moral war in diesem Krieg alles, und die Moral verlangte, dass diese Stadt Widerstand leistete – dieser ehemalige römische Vorposten namens Virodunum am Ort einer keltischen Hügelburg, der seit dem 4. Jahrhundert von wehrhaften Bischöfen beschützt wurde, der vom französischen Festungsbaumeister Vauban im 17. Jahrhundert befestigt und von preußischen Eindringlingen im 18. und erneut im 19. Jahrhundert belagert worden war. Dieser Vorposten musste einmal mehr standhalten, als nun die Deutschen am 21. Februar 1916 herangestürmt kamen.
Einige Landsleute der Angreifer beanspruchten ihrerseits den Ort und behaupteten, dass sie in Wirklichkeit eine nationale Stätte wieder in Besitz nehmen würden. Über Jahrhunderte, so erinnerten deutsche Gazetten ihre Leser in den ersten Tagen der Schlacht, sei das Bistum in deutschem Besitz gewesen, eine freie Reichsstadt im Heiligen Römischen Reich, bis die Franzosen sie im 16. Jahrhundert gewaltsam an sich gerissen und sich im 17. Jahrhundert vertraglich angeeignet hätten. Ein deutscher Major und Veteran der Schlacht fragte sich nach dem Krieg, wie viele seiner Landsleute wohl den Text der Nationalhymne »Von der Maas bis an die Memel« sangen, ohne zu wissen, dass die üppige »Maaslandschaft« bis zum Westfälischen Frieden im Jahr 1648 deutsch gewesen war? Im Jahr 1916 wurde Verdun unter den Händen der deutschen Legendenbastler für kurze Zeit zu dem, was Tannenberg dauerhafter im Jahr 1914 geworden war, als die deutsche 8. Armee die russische 2. Armee vernichtend geschlagen hatte: der erdichtete Schauplatz einer historischen Revanche. Dort im Osten hatten sie mit toponymischer Taschenspielerei kurzerhand einen der beiden Ortsnamen (Tannenberg oder Grunwald) einer deutschen Niederlage gegen Polen und Litauen im Jahr 1410 ihrem eigenen Sieg über die Russen in unmittelbarer Nähe zu Beginn des Ersten Weltkrieges angeheftet. Im Westen sahen sie nunmehr im Angriff auf Verdun die Chance, eine fast ebenso alte Schmach zu tilgen. Nichts jedoch hätte an jenem Morgen Joffre und Falkenhayn ferner liegen können als die Verteidigung oder die Befreiung einer einzigartigen Weihestätte nationalen Gedenkens.[17]
Der »Schall und Wahn« des 21. Februar – um es mit Macbeth zu sagen – erschütterte das Land wie eine halluzinierte Prophezeiung. Für den Rest des Jahres und noch darüber hinaus tobte sich jener Tag weiter aus, in einer Flut aus Stahl und Schrapnell, die die Front auseinandersprengte, sie von der Nachhut und einen Teil der Armee vom anderen trennte. Widerstand blieb, genau wie das Überleben, der Initiative der Soldaten selbst überlassen. Der Tag war auch ein Vorbote für die mit der Zeit immer geringer werdenden Geländegewinne einer jeden Offensive und die entstehende Pattsituation, die nur eine überwältigende Überlegenheit an Männern und Material hätte auflösen können. Es deutete sich hier bereits die eiserne Logik des Stellungskriegs an, der schon bald weder in Falkenhayn noch in Joffre, sondern in Philippe Pétain sein Aushängeschild finden sollte, in einem Mann mit beschränktem Einfallsreichtum.
Der 21. Februar stellte auch die große Frage nach der Innovation. Die deutsche 5. Armee hatte einen neuartigen Einsatz der Artillerie getestet – ein massiver und vergleichsweise kurzer Beschuss –, begleitet von einigen behutsam kreativen Taktiken für die Infanterie – ein vorsichtiges, zögerliches Vorrücken, das im Grunde das genaue Gegenteil von dem darstellte, was beiden Armeen im Jahr 1914 so wenig genützt hatte. Hatten die neuen Taktiken Erfolg? Die Entwicklungen des Tages ließen keine eindeutigen Schlüsse zu. Würden die Truppen auf beiden Seiten schrecklicher zu leiden haben, beharrlicher kämpfen oder sich noch mürrischer zu drücken versuchen als an anderen Stellen der Westfront? An jenem Tag hatten die meisten Franzosen gekämpft. Manche waren jedoch geflohen, andere hatten kapituliert, was unweigerlich die Frage nach der Motivation der Männer aufwarf – eine Frage, die bald unter einem Chorus von Glückwünschen und Dank verschwand. Warum die Soldaten kämpften und wofür oder gar für wen sie selbst glaubten zu kämpfen, schien den Historikern auf beiden Seiten so offensichtlich, dass sie sich selten Gedanken über Fälle von Insubordination oder Disziplinlosigkeit machten. Geschweige denn, dass sie sich fragten, welche Motive – wenn denn die Verteidigung von Haus und Hof die französische Hartnäckigkeit erklären sollte – der ebenso hartnäckigen Zähigkeit der Gegenseite zugrunde liegen mochten. Und sie fragten auch nicht nach den Ängsten, der Resignation oder dem Unverständnis, mit dem Zivilisten östlich und westlich des Rheins die Meldungen von dieser überaus seltsamen Schlacht aufnahmen.
Rückblickend stand bereits jener erste Tag für die Konfusion und Rätselhaftigkeit der gesamten Schlacht. Aber unter den Händen der Künstler und auserwählten Propagandisten wurde er schnell symbolisch und allegorisch überfrachtet. In Poiriers Film von 1931 griff zum Beispiel an jenem Morgen die »Technokratie« die »Dorfidylle« an; die riesigen Geschütze auf der einen Seite wurden den niedlichen Dörfern auf der anderen gegenübergestellt, ebenso die aufgezwungene Disziplin der »Feldgrauen« der spontanen Fröhlichkeit der poilus. Die erste Granate dieses Morgens landete im Film auf dem Dach eines streitbaren Hausbewohners. Selbst Heinz Pauls Film, der im selben Jahr wie Poiriers Tonfilmversion erschien und von den Nazis wegen der nüchternen Darstellung der Niederlage kritisiert wurde, überging kurzerhand das achtstündige Bombardement und zeigte stattdessen vergnügte und lautstarke deutsche Infanteristen, die einen abwartenden, sich nur halbherzig wehrenden Gegner angriffen, der nur wegen einer witterungsbedingten Verzögerung verschont geblieben war. Die Filmregisseure richteten die Kameras auf die menschlichen Emotionen, das epische Element. Und Jules Romains, der fast ein Drittel seines Romans »Verdun« von 1938 jenem 21. Februar widmete, komprimierte in seiner Schilderung dieses Tages bewusst die ganze Schlacht und den gesamten Krieg in einer einzigen von maschinellem Gemetzel, heldenhaften Fußsoldaten und blasierten Kommandeuren in abgelegenen Schlössern geprägten Vision.[18]
Bei Sonnenuntergang ergaben die Geschehnisse für die Zeitgenossen jedoch wenig Sinn. Die kryptischen Lageberichte beider Seiten am nächsten Tag ließen lediglich auf intensive Artillerieaktivität an diesem Frontabschnitt schließen sowie auf die Anzahl der Kriegsgefangenen und die eroberten, verlorengegangenen oder zurückeroberten Stellungen. Niemand konnte wissen, dass der 21. Februar 1916 nur der erste von 300 weiteren Tagen sein sollte – Tagen der Belagerung und der Gegenbelagerung – und der Beginn einer Schlacht, die aus der historischen Distanz betrachtet den Anschein erweckt, als sei sie nach ihrer eigenen infernalischen Logik abgelaufen.
»Diese Schlacht von Verdun kann sich länger als jede andere Schlacht hinziehen, länger etwa als Mukden«, schrieb Maurice Barrès bereits am 26. Februar. Der nationalistische Schriftsteller, der sich inzwischen eher mit entfernten als mit kurz bevorstehenden Siegen befasste, beschwor das Schreckgespenst des russisch-japanischen Krieges von 1904/05 herauf, als moderne Feuerkraft und Truppenstärken erstmals sowohl die Dauer der Schlacht verlängert als auch ihren Blutzoll in die Höhe getrieben hatten. Die Russen gaben die Stadt Mukden nach zwei Monaten auf und traten Port Arthur nach fünf Monaten ab. Beide Seiten erlitten enorme Verluste, aber weder die eine noch die andere – das verschwieg Barrès – konnte am Boden einen entscheidenden Sieg erringen.
Wie lange dauerte die Schlacht von Verdun? Bis Juli 1916, als die Deutschen größere Offensivoperationen abbrachen? Oder bis September, als sie offiziell auf sie verzichteten? Bis Oktober, als die Franzosen das Fort Douaumont zurückeroberten, oder bis Dezember, als sie den größten Teil der übrigen Stellungen einnahmen, die sie im Februar verloren hatten? Oder gar bis August des folgenden Jahres, als sie die Deutschen endlich von der Höhe des Toten Mannes vertrieben? Noch im November 1917 befanden sich Stellungen, die die Franzosen im Februar des Vorjahres verloren hatten, in feindlicher Hand, und ein Beobachter konnte lediglich davon sprechen, die Schlacht sei »im Grunde vorbei«.[19] Während der gesamten Schlacht kam es immer wieder zu einem vermeintlichen Ende, bis den Chronisten schließlich ihre Einzigartigkeit bewusst wurde: Verdun war in der Tat die längste Schlacht, viel länger als Mukden.
Die Antwort auf die Frage, wie viele Menschen dort starben, verwundet wurden oder in Gefangenschaft gerieten, hängt von den Daten, Quellen und der Definition ab; unterschiedliche Methoden, die Verluste zu zählen, führten zu aufgeblähten Schätzungen und trügerischen Vergleichen. Im Laufe der Zeit verlor Verdun seinen mythischen Status als mörderischste Schlacht der Westfront, ja der Geschichte, doch die Zahlen bargen gleichwohl ein schlichtes Geheimnis: Die Verluste waren so hoch, weil die Schlacht so lange währte.
Eine Schlacht endet dann, wenn eine Seite sich durchsetzt oder die andere freiwillig abzieht. Sie wird endlos, wenn der Vormarsch unmöglich, ein Rückzug hingegen undenkbar ist, wenn Feuerpausen nicht von Dauer sind und Waffenstillstände nicht halten, wenn die Protagonisten ihre Ziele weder erreichen noch revidieren können, Männer und Material aber dennoch weiter fließen. Die Schlacht ist ein sich selbst nährendes Feuer.
Ein plötzlicher Angriff, ein unvermuteter Vorstoß, um die französischen Linien zu zerreißen, wurde rasch gestoppt, und über mehr als zehn Monate wiederholte die Schlacht von Verdun wie in Zeitlupe die gleiche Episode immer wieder in beide Richtungen. Letztlich spielte der Ausgang – negativ, ohne jede Endgültigkeit, eher ein Borodino[*] als ein Waterloo – eine geringere Rolle als die Heldentat des Überlebens. Die Franzosen hatten eher die widrigen Umstände besiegt als ihren Gegner, und an widrigen Umständen mangelte es gewiss nicht: ein anfänglicher Verlust an Manövrierraum; eine Verteidigungsstellung zu beiden Seiten eines Flusses, noch dazu in einen Frontvorsprung gezwängt; so beengte rückwärtige Verbindungen, dass nur ein beispielloser Einsatz von Lastwagen, von Verbrennungsmotoren, anstelle von Lokomotiven, die Rettung brachte; sowie eine Unterlegenheit bei der schweren Artillerie. Insgesamt schien alles gegen die Franzosen zu sprechen. Der Umstand, dass sie standhielten und im Juli an der Somme gar in die Offensive gingen, sprach Bände über einen Feind, dessen Überheblichkeit die eigene Taktik ad absurdum führte: Worauf immer Falkenhayn gesetzt haben mochte, er glaubte jedenfalls, dass die Franzosen am Ende ihrer Kräfte wären. Die Nation würde, so dachte er, bei Verdun ausbluten. Ohnehin hatte er Frankreich stets als zweitklassige Militärmacht eingestuft. Nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal hatten deutsche Militärs den Gegner unterschätzt.[20]
Angst breitete sich bis zum 24. Februar in der Armee von Verdun aus, als der Gegner sie bis zum zweiten Bogen der konzentrisch angelegten Verteidigungslinien circa zehn Kilometer vor der Stadt zurückdrängte. Von den Gegenangriffen der Überreste der 72. Infanteriedivision gebremst, aber nicht gestoppt, überrannten die Feldgrauen den Bois des Fosses, den Bois des Chaumes, den Bois des Caurières, umstellten das Dorf Louvemont, machten einen Weg frei zum Dorf Douaumont und zu dem mächtigen, aber schlecht ausgerüsteten und kläglich besetzten gleichnamigen Fort, das einen Tag später fiel. Da weitere Einkesselungen drohten, räumten die Franzosen die Hügel im Norden und Westen, den Pfefferrücken und die Höhe von Talou sowie die offene Woëvre-Ebene im Süden. Doch aus dem Spaziergang, von dem die Angreifer geträumt hatten, wurde nichts. Er wurde zunichtegemacht durch den hartnäckigen Widerstand der frisch eingetroffenen Verteidiger. Obwohl die Deutschen das Fort unter Kontrolle hatten, gelang es ihnen erst, das Dorf Douaumont einzunehmen, als ihre Granaten es in Schutt und Asche gelegt und ihre Männer zehnmal dagegen angerannt waren. Und selbst dann, am 6. März, konnten sie nicht weiter vorrücken und wurden in ihren Stellungen dort und anderswo an den Hängen des Maastals von ihrem immer zuversichtlicher werdenden Gegner festgehalten. Von seiner starrsinnigen Regierung gedrängt, hatte der französische Generalstab inzwischen beschlossen, Verdun zu verteidigen, und deshalb fortlaufend Verstärkungen geschickt sowie die Generäle Castelnau und anschließend Pétain. Niemand erwartete hier einen schicksalhaften Sieg, gar ein unwahrscheinliches Rocroi[*] oder Austerlitz; vielmehr hatte man nur die bescheidene Hoffnung, durch erbitterte Gegenwehr den Eroberungsdrang des Gegners so lange wie möglich aufzuhalten. »Die Mission der 2. Armee ist es, um jeden Preis die Anstrengungen, die der Feind unternimmt, zu vereiteln«, hatte Pétain bei der Ankunft in Verdun mit entschlossenen, aber nüchternen Worten erklärt, die anstelle von Elan eher von Geduld zeugten und eher Grenzen aufzeigten als Visionen.[21]
Da die deutsche 5. Armee außerstande war, die Erfolge der ersten Tage am rechten Flussufer auszunutzen, griff sie am linken Ufer an. Im März und April versuchte sie immer wieder, die Höhenzüge auf beiden Seiten des Flusses einzunehmen – Höhenzüge, von denen aus die Festung Verdun ihnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert gewesen wäre. Und immer wieder scheiterte sie. In der Regel zogen sich die Deutschen, erschöpft oder ausgeblutet von den neuerlichen Angriffen auf das Dorf Vaux, die Höhe des Toten Mannes oder die Höhe 304, den Bois des Corbeaux oder den Bois d’Avocourt, wieder zurück und klammerten sich, so gut es ging, an die kümmerlichen Geländegewinne, an mit Kratern durchlöcherte Hänge, zerstörte Wälder und von Trümmern übersäte Keller. »So sind wir frühestens 1920 in Verdun!«, rief der deutsche Kommandeur am linken Ufer, General Max von Gallwitz, aus: Die erbitterten Kämpfe um die Höhe 304, das war ihm klargeworden, ließen noch Schlimmeres befürchten. Verteidiger wurden zu Angreifern, tauschten in einem geradezu makabren Wechselspiel unablässig die Rollen. Mal gelang es den Angreifern, einen Tag lang die Stellung zu halten, nur um am nächsten Tag wieder vertrieben zu werden, häufig in Nahkämpfen, nach denen die Straßen und Hänge mit Leichen übersät waren. Am 9. April griffen elf deutsche Regimenter am linken Ufer entlang einer elf Kilometer breiten Front zwischen Avocourt und Cumières an; einmal mehr hielten die Franzosen größtenteils stand, verloren zwar eine Höhe oberhalb des Toten Mannes, hielten aber das Dorf Cumières, nachdem sie zehn Angriffe nacheinander abgewehrt hatten. Dieser Tag veranlasste Pétain zu seinem berühmten Ausspruch: »Courage! On les aura!« (»Mut! Wir kriegen sie!«), auf unzähligen Plakaten verewigt und ein vielzitierter Aufruf, Kriegsanleihen zu kaufen, obwohl zu jener Zeit, nach sechs Wochen, noch längst kein Ende in Sicht war.[22]
De facto setzte ein Zermürbungskrieg ein, jener Zustand, den die Befehlshaber dieses Krieges, auch Falkenhayn, nach ihrem eigenen Bekunden die ganze Zeit beabsichtigt hatten. Er bestand aus lokalen Angriffen und Gegenangriffen, verknüpft mit der für gewöhnlich unbegründeten Überzeugung, dass die dem Gegner beigebrachten Verluste die eigenen überstiegen. Falkenhayn und Joffre ließen erste Anzeichen von Ungeduld mit den Befehlshabern vor Ort erkennen, die ihrerseits über die dürftige Zuteilung von Truppen und Material klagten. Ende Mai vertrieben Maschinengewehrgarben französische Angreifer von den Dächern von Douaumont; zwei Wochen danach nahmen die Deutschen das benachbarte Fort Vaux ein. Die fiebergeschüttelte und dem Verdursten nahe Besatzung wurde am siebten Tag der Belagerung mit Granaten und giftigen Dämpfen, die man über Öffnungen und Belüftungskanäle ins Innere leitete, ausgeschaltet. Flammenwerfer erledigten den Rest. Mit solchen lokalen Triumphen und Tragödien hätte die blutige, aber unentschiedene Schlacht von Verdun endlos weitergehen können, wenn die unübersehbaren Vorzeichen der bevorstehenden alliierten Offensive an der Somme die deutsche Heeresleitung nicht veranlasst hätten, die Entscheidung zu suchen. In der letzten Juniwoche, als britische und französische Geschütze das Feuer auf die deutsche 3. Armee an der Somme eröffneten, unternahm die 5. Armee einen letzten verzweifelten Versuch, an der Maas die Oberhand zu gewinnen. Sechs Divisionen griffen entlang einer vier Kilometer breiten Front auf beiden Seiten des Kamms an, der südwestlich von Douaumont nach Froideterre verlief. Bayerische Einheiten eroberten einen Teil des Dorfes Fleury und verschüttete Teile des Forts Souville, nur knapp fünf Kilometer vor Verdun. Ihre Leichen säumten die Bazil-Schlucht und die Chambitoux-Schlucht als vielsagendes Zeugnis für die Vergeblichkeit des Unterfangens, denn im Juli und August vertrieben französische Gegenangriffe, teilweise aus der Luft, die Überlebenden aus den Gräben und Vorwerken von Souville und aus den Ruinen von Fleury. Näher sollte die 5. Armee nie an Verdun herankommen. Von diesem Moment an wurden ihre Soldaten und Geschütze langsam nach Westen und Norden an die Somme verlegt, wo die Kämpfe zwar das Ausmaß, aber selten die Intensität der Kämpfe in der von den Deutschen sogenannten »Maasmühle« übertrafen.
Im Spätsommer schwang das Pendel bei Verdun bereits wieder zurück – es wechselte seine Richtung zunächst unmerklich, in einer schleppenden, tastenden Bewegung durch eine Landschaft, in der es keine Vegetation mehr gab, nicht einmal den Stacheldraht, den Soldaten früher im Jahr hier verlegt hatten. Jeder einzelne Meter der Front war, nach den meisten Berechnungen, von einer Tonne Granaten verwüstet worden. Da gab es nichts mehr zu entwurzeln. Drei Monate lang bekämpften sich die Soldaten von Trichter zu Trichter, führten in einem Hagel aus Granaten kleine Überfälle durch, ohne Schutz, ohne Pause und manchmal ohne Proviant und Wasser. Ständig waren sie in Alarmbereitschaft und hatten mittlerweile selbst die behelfsmäßigen Unterstände eingebüßt, in denen sie sich im Winter eingerichtet hatten. Und das Kriegsglück wechselte. Die Franzosen eröffneten Ende Oktober bis ins Kleinste geplante Teiloffensiven, bei denen kaum etwas dem Zufall überlassen blieb. Sie eroberten Ende Oktober das Fort Douaumont, Fort Vaux Anfang November und den Bois des Caures und die benachbarten Wälder Mitte Dezember zurück. Am Ende des Jahres verliefen die Frontlinien wiederum mehr oder weniger genauso wie im Februar zu Beginn des Unternehmens »Gericht«; und in einem Zermürbungskrieg gewinnt bei einem Patt meist der Verteidiger.[23]
Es wirkte wie eine gelungene Abrechnung: Im Oktober nahm die französische schwere Artillerie drei Tage lang die deutschen Verteidiger von Douaumont unter Beschuss, steckte Gebäude im Fort in Brand und zerstörte die Bunker in den Steinbrüchen von Hardaumont zur Rechten sowie die Batterien von Damloup zur Linken. Am Himmel patrouillierten französische Nieuports und Farmans ebenso ungehindert wie die deutschen Fokker und Fesselballone einst im Februar und März. Geordnet, nach dem Kompass und angekündigt durch ein Sperrfeuer der Artillerie rückten drei Infanteriedivisionen planmäßig durch den Nebel vor, bis die ersten Bataillone das Fort und die demoralisierten Verteidiger überrollten. »Der Feind hat kein Monopol auf diese Taktik«, bemerkte ein Beobachter knapp, und die Rückeroberung von Douaumont, gefolgt von Vaux zwei Wochen später, schien zu bestätigen, was begrenzte Erfolge an der Somme zuvor bereits angedeutet hatten: Die Franzosen hatten, schon vor den Briten, die Taktik der Materialschlacht verinnerlicht.[24]
Im Dezember 1916 beobachtete ein französischer Pilot im Tiefflug, wie Zuaven aus Nordafrika – anstelle des charakteristischen roten Fez trugen sie nunmehr den Stahlhelm – durch die Krater kletterten und vorrückten, begleitet von Flugzeugen und gefolgt von Nachschubeinheiten. Halbherziges deutsches Geschützfeuer, schwach und ungenau, empfing den systematischen Vormarsch der französischen Truppen. Die Armee, die diese Höhen und Schluchten im Februar voller Schwung erobert hatte, machte nunmehr wenig Anstalten, sie zu halten. Ihre Kampfmoral war schlecht, so schlecht, dass sich Tausende allein in diesem Monat ergaben. Der Pilot sah sie in langen Kolonnen aus Douaumont hinausmarschieren, bewacht von nur leicht verwundeten französischen Soldaten. Wie im Februar, als die Deutschen die Lufthoheit hatten und die Rollen am Boden umgekehrt verteilt waren, legt der Blick aus der Vogelperspektive die Vermutung nahe, dass eine ausreichende Menge an Material letztlich selbst die zähesten und erfahrensten Verteidiger mürbe macht.[25]
Doch erst acht Monate später, im August 1917, eroberten die Franzosen die restlichen Beobachtungspunkte zurück, die die Deutschen noch am linken Ufer hielten: auf der Höhe 304 und dem Toten Mann. Sie überrollten die Verteidiger nicht mit einer Tonne Stahl pro Quadratmeter, sondern mit sechs Tonnen, und nicht mit 50 Geschützen auf jeder halben Meile der Front wie in der Champagne im Jahr 1915, und auch nicht mit 70 wie bei Verdun oder an der Somme im Jahr zuvor, sondern mit fast 150. Die Geschütze schalteten die unterlegene deutsche Artillerie mit schweren Gasangriffen bei Morgengrauen aus, die Infanterie nahm rasch die Angriffsziele ein, 100 feindliche Geschütze und 10000 Soldaten fielen ihnen in die Hände. Zeugnisse der Schlacht lagen nunmehr über das ganze Gelände verstreut, meilenweit, ein regloses Gewirr aus Schuhen, Granaten, leeren Flaschen, Signalraketen, durchlöcherten Helmen, Gewehren, verwesenden Leichnamen und Körperteilen, die in der Nacht phosphoreszierend leuchteten.[26]
Falkenhayn und Joffre, die sich ohnehin selten vor Ort hatten blicken lassen, waren längst abgetreten. Ein Jahr zuvor, Ende August 1916, hatten Feldmarschall Paul von Hindenburg und General Erich Ludendorff ihren Rivalen Falkenhayn zu Fall gebracht. Nichts war 1916 so gekommen, wie er es sich gedacht hatte. Vor Verdun hatte er Russland für kampfunfähig erklärt, Frankreich war seiner Meinung nach am Rande der Erschöpfung, England werde höchstwahrscheinlich voreilige Gegenangriffe unternehmen, und es sei unwahrscheinlich, dass Rumänien gegen die Deutschen in den Krieg eintreten werde. Stattdessen hatten die Russen im Juni angegriffen, die Engländer hatten bis Juli abgewartet und dann gemeinsam mit den Franzosen eine Offensive eingeleitet, die alles andere als übereilt war, Verdun war weder gefallen noch war Frankreich dort ausgeblutet, und inzwischen kämpfte Rumänien an der Seite der Gegner des Deutschen Reichs. Hindenburg und Ludendorff überzeugten den Kaiser, sämtliche Pläne für eine erneute Offensive bei Verdun abzublasen. Joffre war im Dezember aus dem Generalstab ausgeschieden, nicht zuletzt wegen des enttäuschenden Verlaufs der Offensive an der Somme, die man einen Monat zuvor abgebrochen hatte. Beide Generäle hatten sich mit Würde verabschiedet, hatten den Schein zu wahren gewusst. Verdun hatte ihren Gegnern und Rivalen Munition für ihre Absetzung geliefert: Dem Deutschen wurde ein gescheiterter Angriff vorgeworfen, dem Franzosen eine riskante Verteidigung.
Aber hatte einer der Kritiker wirklich die Bedeutung dessen begriffen, was bei Verdun passiert war? Begriffen sie, dass es ohne Verbündete mit gewaltigen Ressourcen aussichtslos war, jetzt oder in Zukunft, einen solchen Krieg gegen eine Industriemacht oder eine Koalition aus Mächten zu gewinnen, deren Möglichkeiten den eigenen um ein Vielfaches überlegen waren? Die großkalibrigen deutschen Geschütze hatten die Frage am 21. Februar mit roher Gewalt aufgeworfen, und sie blieb am Ende des Jahres noch offen – blieb genau genommen noch lange nach dem Krieg unbeantwortet.
Jahre später wurde ein Teil der einander überlappenden Krater aufgefüllt, die Vegetation kehrte hier und da zurück, sogar die eine oder andere Blume blühte wieder. Einzelne Dörfer erstanden aus den Ruinen. Ein provisorisches Beinhaus nahm die Überreste der namenlosen Toten auf, die auf ihre dauerhafte Ruhestätte in dem großen Bauwerk warteten, das am Ende des Jahrzehnts errichtet werden und die ganze Gegend überragen sollte. Touristen, Veteranen und Angehörige der Gefallenen kamen hierher – manche aus Neugier, so wie sie womöglich auch die Ruinen von Karthago oder Pompeji besichtigt hätten –, während zwei Offiziere der Nachkriegsarmee abgeordnet wurden, um für sie die Ereignisse von 1916 zu rekonstruieren.[27]
Eine Frage jedoch blieb: Welchen der über 300 Tage, die zur Auswahl standen, sollte die Stadt oder die Nation auswählen, um der Schlacht zu gedenken? In den ersten Nachkriegsjahren eigneten sich lediglich der Kriegsausbruch am 4. August und sein Ende am 11. November zum kollektiven Gedenken. Der Krieg war noch zu frisch, die Fülle an individuellen Erinnerungen noch zu aktuell, um sich auf einen anderen Anlass zu einigen. Außerdem hatte die Schlacht um Verdun mit ihren verschiedenen Konstellationen und Konjunkturen so lange gedauert, dass eine Frage, die für den Krieg insgesamt schon schwer zu beantworten war, sich in diesem Fall als doppelt schwierig erwies.[28]
Mit der Zeit kristallisierte sich aus allen Daten, an denen man der großen Schlacht hätte gedenken können, der 21. Februar heraus. Kein anderes Datum drängte sich so konsequent auf, nicht die Tage des Triumphs oder der Vergeltung, als die Franzosen etwa den Vormarsch des Gegners gestoppt oder Fort Douaumont zurückerobert oder gar die Deutschen auf die ursprünglichen Linien zurückgedrängt hatten. Stattdessen rief man sich nun einen Tag der Katastrophen und der Verzweiflung in Erinnerung, den ersten Tag der Schlacht. Selbst in den Jahren, als Würdenträger zu Gedenkfeiern im Juni, Juli oder November anreisten, gedachten Stadt, Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen – wie im stillschweigenden Einvernehmen – des Geschehens am 21. Februar. Als wohne Angst und Leid eine bleibendere Kraft inne als dem Erfolg. Jules Romains lässt seinen Roman »Verdun« mit dem französischen Gegenangriff auf den Toten Mann am 9. April und Pétains berühmtem Ausspruch vom selben Tag enden. Doch er räumt dem Ereignis nur einen Bruchteil des Raums ein, den er in den Anfangskapiteln dem ersten Tag widmet. Genauso war es auch mit den sich allmählich ausbildenden Formen des öffentlichen Gedenkens. Es gibt bis heute keinen offiziellen Tag von Verdun in Frankreich. Aber wenn es einen gäbe, dann würde er zweifellos auf den 21. Februar fallen.[29]
Noch vor Kriegsende hatte der Sänger Theodore Botrel, den die Regierung aufgefordert hatte, ein Lied zu komponieren und es an der Front und in der Heimat vorzutragen, den Tag in der zweiten Strophe seines »Les chasseurs de Driant« gewürdigt:
Ein tödlicher »Strahl«
ertränkt den düsteren Hain
am 21. Februar
neunzehnhundertsechzehn.