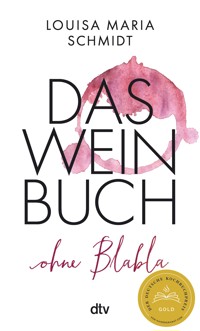
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Deutscher Kochbuchpreis 2023 in der Kategorie »Die besten Bücher über Wein« »Wenn du mich fragst, ist Wein nicht einfach nur ein Getränk. Wein ist das faszinierendste Gesöff der Welt. Kein anderes alkoholisches Getränk kann meiner Meinung nach ein so beeindruckender Vermittler von Herkunft, Handwerk und Tradition sein wie Wein. So kitschig es vielleicht klingen mag: Für mich erzählt Wein Geschichten, bringt Menschen an einen Tisch und schafft Momente. Wein macht nicht einfach nur schwindelig im Kopp. Wein bedeutet Reisen, Kultur und Genuss – Wein verbindet! Aber genug mit dem Geplänkel …« Noch ein Buch über Wein? Ja, aber anders als bisher – intelligent, cool und zeitgemäß! Frisch, energisch und mit viel Spaß macht Lou reinen Tisch und zeigt jungen Weinfans, dass man sich vor Wein nicht fürchten muss. Fachlich avisiert führt die studierte Weinexpertin und Weinbloggerin Lou durch die Welt des Weins, nimmt sich dabei selbst nicht so ernst und gibt locker und schwungvoll Anekdoten und Weinwissen zum Besten: Von B wie Bubbles über N wie Naturwein und T wie Tannine. Geballtes Weinwissen eben, aber ohne Blabla! Denn am Ende des Tages soll Wein Spaß machen und Menschen an einen Tisch bringen. Wein ohne Blabla – mit praktischen Anleitungen, Spickzetteln und Probiertipps
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
»Wenn du mich fragst, ist Wein nicht einfach nur ein Getränk. Wein ist das faszinierendste Gesöff der Welt. Kein anderes alkoholisches Getränk kann meiner Meinung nach ein so beeindruckender Vermittler von Herkunft, Handwerk und Tradition sein wie Wein. So kitschig es vielleicht klingen mag: Für mich erzählt Wein Geschichten, bringt Menschen an einen Tisch und schafft Momente. Wein macht nicht einfach nur schwindelig im Kopp. Wein bedeutet Reisen, Kultur und Genuss – Wein verbindet! Aber genug mit dem Geplänkel …«
WEIN OHNE BLABLA - MIT PRAKTISCHEN ANLEITUNGEN, SPICKZETTELN UND PROBIERTIPPS
LOUISA MARIA SCHMIDT
DAS WEINBUCH
ohne Blabla
Für Papa. Was würde ich dafür geben, mit dir noch mal ein Glas Wein trinken zu dürfen.
PROLOG
Als ich anfing, dieses Buch zu schreiben, wusste ich ganz oft nicht, wie weit ich ins Detail gehen soll. Welche Informationen ich drin haben muss, welche ich drin haben will und auf welche ich besser verzichte. Ob ich dich, die Leserin oder den Leser, bereits langweile oder aber gänzlich überfordere. Ehrlich gesagt, hatte ich auch nie vor, ein Buch über Wein zu schreiben. Es gibt bereits etliche Werke von weltberühmten Weinjournalist:innen, die im Grunde genommen alles zum Thema gesagt haben. Wozu sollte ich dann bitte noch ein Buch schreiben? Nur um mir ein Denkmal zu setzen? Nein, danke. Auch hatte ich vor der Aufgabe an sich einen Heidenrespekt. Man schreibt ja nicht jeden Tag einfach mal so ein Buch. Noch dazu bin ich eine völlig beratungsresistente Perfektionistin und möchte es am liebsten allen recht machen. Eine negative Kritik hat bei mir mehr Gewicht als neunundneunzig positive Feedbacks. Ich weiß, völlig plemplem.
Beim Schreiben habe ich dann jedoch festgestellt, dass es niemals das perfekte Buch über Wein geben wird. Denn jede:r hat eine andere Sicht auf die Dinge, setzt andere Schwerpunkte und hat einen völlig anderen Wissensstand. Was die eine als wichtig erachtet, ist für den anderen nicht von Bedeutung. Und dann auch noch Wein als Thema – emotional geladener geht’s ja wohl kaum. Schubladendenken und Rechthaberei, gepaart mit jeder Menge unreflektierter Aussagen. Also, was tun?
Ganz einfach: Ich habe ein Weinbuch für mein früheres Ich geschrieben. Ja, mir ist klar, wie das klingt. Als hätte ich nicht mehr alle Latten am Zaun und irgendwie auch dezent selbstverliebt. Meine Community aber, und im besten Fall auch du, steht vor den gleichen Herausforderungen und Fragen wie ich zu Beginn meiner Weinreise. Und glaub mir, Fragen hatte ich etliche. Während Weinproben, Gesprächen mit Winzer:innen, im Restaurant und auf Weinreisen war permanent ein großes Fragezeichen auf meine Stirn getackert. Damals hätte ich mir als Ergänzung zu den ganzen Weinwälzern, die bei mir zu Hause rumlagen, ein kleines, kompaktes Buch gewünscht, auf das man sich dennoch fachlich verlassen kann. Eines, in dem es kleine Spickzettel mit Produzent:innen gibt, von denen ich mal etwas gehört haben sollte, und jede Menge konkrete Probiertipps. Ein Weinbuch, das mir die wichtigsten Fragen aus der Praxis verständlich beantwortet und bei dem ich, wenn ich denn will, tiefer in Details eintauchen kann, aber nicht muss. Ein Weinbuch, in dem man unterwegs auch mal schnell was nachschlagen kann, um mitreden zu können. Ein Weinbuch eben, das man immer dabeihaben möchte.
Ein Weinbuch ohne Blabla
GEBRAUCHSANWEISUNG
Meiner Meinung nach hat nicht alles, aber vieles seine Daseinsberechtigung. Deshalb zeige ich in diesem Buch weder mit dem Finger auf bestimmte weinbauliche oder kellertechnische Praktiken noch auf anderer Leute Wein. Ich würde also behaupten, dass du –mit Ausnahme einiger weniger Passagen – ein »diplomatisches« Weinbuch in den Händen hältst.
In diesem Buch habe ich ganz bewusst auf Grafiken verzichtet. Kritzle dir als Gedankenstütze einfach selbst Zeichnungen neben den Text, kleb dir Notizen rein, nimm dir einen Marker zur Hand und entscheide selbst, was für dich wichtig ist. Dann bleibt auch mehr hängen. Zumindest geht es mir immer so. Mach dieses Buch zu
DEINEM
Weinbuch.
Ich behandle nur Themen, zu denen ich auch etwas zu sagen habe. Über die ich bereits früher gerne mehr gewusst hätte, für die ich heute brenne oder bei denen ich der Meinung bin, dass sie ganz einfach wichtig sind.
Bei den von mir ausgesprochenen Probiertipps handelt es sich um empfehlenswerte Produzent:innen. Die Aufzählung entspricht dabei keiner Wertung. Wenn bei der Rebsorte Blaufränkisch z.B. der Name Wachter-Wiesler steht, dann finde ich fast alles geil, was das Weingut mit der Rebsorte anstellt. Du kannst also immer lässig im Sortiment des jeweiligen Weinguts ganz unten einsteigen und dich Wein für Wein an die Spitze arbeiten. Bei einigen Probiertipps handelt es sich bei den genannten Produzent:innen um solche, von denen du definitiv mal etwas gehört haben solltest, deren Weine allerdings nicht ganz preiswert sind. Ob du dir diese Weine leisten möchtest, bleibt dir überlassen. In manchen Kapiteln nenne ich dir auch einige konkrete Probiertipps der jeweiligen Weingüter.
Zudem habe ich versucht, dir für fast jedes Weinanbauland Jahrgangsempfehlungen aufzuschreiben. Sie beziehen sich bis auf einige Ausnahmen immer auf das ganze Land und nicht auf die einzelnen Regionen und sollen dir bei der Weinauswahl im Restaurant oder beim Weineinkauf als Unterstützung dienen. Dabei handelt es sich nicht um von irgendwelchen Kritiker:innen hochgelobte Jahrgänge, deren präferierte Stilistik ich ohnehin nicht leiden kann. Es sind alles Jahrgänge, die ich persönlich gerne im Glas habe – knackig und frisch! Blockbuster-Weine, die fett und konzentriert ins Glas laufen, sind einfach nicht mein Vibe!
Einer der häufigsten Kommentare meiner Lektorin Melli in meinem Word-Dokument war die Frage, welche Reihenfolge meinen Aufzählungen von Weinanbauländern, Weinanbaugebieten, den Rebsorten, Weinarten, Glossaren und Probiertipps zugrunde liegt. Ob ich nach Häufigkeit, Wichtigkeit, persönlichen Präferenzen oder was auch immer vorgegangen bin. Nein, ich habe einfach getippt. Die Abfolge meiner Reihenfolgen sind absolut wertfrei. Habe mir dann aber die Mühe gemacht und dir zumindest das Glossar alphabetisch geordnet. Gern geschehen.
LOUS (WEIN-)MERKSÄTZE*
Immer locker durch die Hose atmen, es ist nur Wein!
◆
Du kannst nicht alles über Wein wissen – und das ist okay.
◆
Leute, die dich für deinen Wissensstand auslachen, sind nicht cool und haben in der Weinbranche nichts verloren! Gleiches gilt für dich: Sei kein Arschloch!
◆
Wenn dir ein Wein schmeckt, frag dich, warum.
◆
Wenn dir ein Wein nicht schmeckt, frag dich, warum.
◆
Hör immer auf dein Bauchgefühl!
◆
Der erste Eindruck ist oft der richtige.
◆
Halt dich nicht künstlich dumm, indem du vorgibst, einen Wein zu kennen, den du gar nicht kennst.
◆
Erlaubt ist, was schmeckt.
WAS IST WEIN?
Laut dem Sprachgebrauch der europäischen Gesetzeshüter ist Wein erst einmal nichts anderes als ein alkoholisches Getränk aus Weintrauben. Klingt zugegebenermaßen nicht sonderlich berauschend, sondern ziemlich ernüchternd. Wenn du mich fragst, ist Wein nicht einfach nur ein Getränk. Wein ist das faszinierendste Gesöff der Welt. Kein anderes alkoholisches Getränk kann meiner Meinung nach ein so beeindruckender Vermittler von Herkunft, Handwerk und Tradition sein wie Wein. So kitschig es vielleicht klingen mag: Für mich erzählt Wein Geschichten, bringt Menschen an einen Tisch und schafft Momente. Wein macht nicht einfach nur schwindelig im Kopp. Wein bedeutet Reisen, Kultur und Genuss – Wein verbindet! Aber genug mit dem Geplänkel. Es gibt nicht nur Wein. Es gibt Weißwein, Rotwein, Roséwein, Schaumwein, Süßwein, aufgespriteten Wein wie z.B. Sherry, Madeira & Co. und ja, auch Orange Wine und Naturwein. Wäre ansonsten ja auch alles viel zu einfach. Bevor ich dich aber an die Hand nehme und wir uns gemeinsam so richtig tief in die Materie knien, lass uns erst einmal das Fundament legen. Wie wird Wein eigentlich gemacht?
WIE WIRD WEISSWEIN HERGESTELLT?
DIE ARBEIT IM WEINBERG
Bevor die Träubchen ins Trockene geholt werden und wir Wein machen können, steht erst einmal jede Menge Arbeit im Weinberg an. Das Weinjahr beginnt mit dem Rebschnitt. Dieser erfolgt normalerweise nach dem ersten Frost und ist für die Ertrags- und Qualitätsleistung sowie für die Formerhaltung des Weinstocks sehr wichtig. Im Frühjahr beginnt der Austrieb, es folgen die Gescheine aus denen sich später die Rebblüten und die Trauben bilden. Mit der Blüte fangen auch die Triebe und das Laub an zu wachsen.
Alle Laubarbeiten, die anschließend anfallen, wie z.B. Ausbrechen, Heften, Entblättern oder das Kürzen der obersten Triebe, werden zum Wohle der Trauben durchgeführt. Die Oberfläche der jungen Blätter ist nämlich das Futter für die Rebe. Denn durch das Sonnenlicht, das auf die Blätter trifft, werden im Zuge der Photosynthese Assimilate (Zucker+Stärke) gebildet, die die Rebe für das Traubenwachstum mit Energie versorgen. Auch der Ertrag kann zu dieser Zeit (ca. 2–4 Wochen nach der Blüte) z.B. durch das Halbieren oder Herausschneiden ganzer Trauben gesteuert werden. Neben diesen Maßnahmen müssen sich die Winzer:innen auch um den Pflanzenschutz und das Entfernen von Unkraut kümmern. Sie müssen die Böden bearbeiten und vital halten. Mit Beginn der Färbung und Reifung der Beeren (aka Véraison) beginnt für viele Betriebe nochmals eine intensivere Phase des Pflanzenschutzes. Danach wird es im Weinberg allmählich ruhiger und alle bereiten sich auf die Terminierung und Durchführung der Weinlese vor.
GUT ZU WISSEN: Der Spätfrost nach dem Austrieb der Rebblüte ist von allen Winzer:innen besonders stark gefürchtet. Denn wenn die Blüte infolge von Frost, Hagel oder ganz einfach Starkregen »verrieselt« (das heißt, wenn viele Blüten oder bereits kleine Beeren von den Stielen abgetrennt werden) oder sie vollständig zerstört wird, heißt das wenig bis kein Ertrag.
WEINLESE
Der Zeitpunkt der Weinlese, also der Ernte der Trauben, hängt maßgeblich von der physiologischen Reife der Beeren, dem Mostgewicht und der angestrebten Stilistik der Winzer:innen ab. Dabei kann die Weinlese entweder händisch (aka Handlese) oder mit der Maschine (aka Maschinenlese) durchgeführt werden. Sobald die Träubchen geerntet worden sind, beginnt die Weiterverarbeitung. Da das Stielgerüst der Trauben (aka Rappen) sehr viel Gerbstoff enthält und nicht in den Saft der Trauben bzw. den Wein übergehen soll, werden die Beeren häufig davon entfernt. Wird das Stielgerüst nicht entfernt und die Trauben werden im Ganzen gepresst, spricht man von der sogenannten Ganztraubenpressung.
QUETSCHEN, MAISCHESTANDZEIT & KELTERN
Die Trauben – mit oder ohne Rappen – werden nachfolgend behutsam mithilfe einer Traubenmühle angequetscht oder mit den Füßen in einem dafür vorgesehenen Behältnis »gestampft«, sodass der Saft aus der Beere tritt. Je länger jetzt der Kontakt zwischen dem Saft, den Beerenschalen, den Beerenkernen sowie gegebenenfalls den Rappen ist, desto höher ist auch die potenzielle Extraktion von Farbstoff, Gerbstoff und weiteren geschmacksgebenden Stoffen später im Saft. Das ist in etwa vergleichbar mit der Zubereitung einer Kanne Tee: Je länger du den Beutel in der Kanne hängen lässt, desto farb- und geschmacksintensiver, aber vielleicht auch bitterer schmeckt er schlussendlich. Dieses Prozedere wird als Maischestandzeit bezeichnet, und der ganze Haufen aus Saft, Beerenschalen, Kernen, Fruchtfleisch und je nachdem auch Stielgerüsten heißt Maische. Egal ob der Winzer oder die Winzerin sich für oder gegen eine Maischestandzeit entschieden hat – irgendwann muss der ganze Bums mit der Kelter (aka Presse) abgepresst werden.
GÄRUNG
Um eine stürmische Gärung zu vermeiden, wird der unvergorene Most vor der Gärung verschiedenen Behandlungen wie z.B. einer Mostvorklärung unterzogen. Dabei werden die Trubstoffe, bestehend aus Fruchtfleisch, Kernen, Beerenschalen und Stielen, aus dem Most entfernt. Erst danach geht es für ihn ab in einen Gärbehälter. Ein Gärbehälter kann z.B. ein Edelstahltank, ein Holzfass, eine Amphore oder – ganz fancy – ein Beton-Ei sein. Welcher Gärbehälter zum Einsatz kommt, entscheiden die Winzer:innen.
Der unvergorene Most fängt jetzt entweder durch wilde Hefen spontan an zu gären, oder es werden ihm für eine kontrollierte Gärführung Rein- und/oder Aromazuchthefen zugefügt. Die Hefen fangen dann an, den Zucker im Saft aufzufressen. Infolgedessen entstehen Alkohol und CO2. Hat die Hefe den ganzen Zucker aufgefressen, haben wir einen durchgegorenen, also trockenen Wein. Will der Winzer oder die Winzerin hingegen einen halbtrockenen oder lieblichen Wein erzeugen, muss die Gärung gestoppt werden, bevor die Hefen den ganzen Zucker aufgefressen haben. Das passiert z.B. mittels Kühlung, Filtration und Schwefelung.
Nach der Gärung entscheiden die Winzer:innen, wie es mit dem Wein weitergehen soll. Ein Weißwein muss nicht zwangsläufig lagern, sondern kann bereits kurz nach der Gärung abgefüllt werden. Andere Winzer:innen möchten, dass ihr Weißwein noch einige Zeit auf der Voll- oder Feinhefe lagert (aka Hefesatzlagerung, sur lie), was zu einem frischen und oft leicht hefigen Ton führen und der Textur des Weins mehr Fülle, Komplexität und Cremigkeit verleihen kann. Je nach angestrebter Stilistik wird der Wein auch von vielen Winzer:innen zur Aromatisierung, Harmonisierung und/oder Komplexitätsgewinnung in ein Holzfass gelegt.
FILTRATION
Um Trubstoffe (aka Schwebstoffe) aus dem Weißwein zu entfernen, kann der Wein vor der Abfüllung filtriert oder mehrmals abgestochen (siehe »Abstich«) werden. Es gibt aber auch unfiltrierte und demnach trübe Weine. In dem Fall handelt es sich weder um einen Weinfehler noch um einen Qualitätsmangel. Bevor der Wein auf die Flasche kommt, muss entschieden werden, ob er reinsortig abgefüllt oder noch mit Weinen einer anderen Rebsorte, eines anderen Jahrgangs und/oder einer anderen Weinbergslage »verschnitten« (aka gemischt) werden soll.
ABFÜLLUNG
Schließlich wird der Wein abgefüllt, die Flasche mit einem beliebigen Verschluss, z.B. aus Naturkorken oder mit einem Schraubverschluss, verschlossen und mit einem Weinetikett versehen. Damit der Wein nicht vollkommen durchgeschüttelt in den Verkauf kommt, wird der Wein oft zur »Beruhigung« nochmals für kurze Zeit (ca. 1–4 Monate) gelagert. Vielleicht hast du schon einmal an einer Weinprobe mit Winzer:innen teilgenommen und folgenden Satz gehört: »Der Wein ist gerade erst gefüllt worden!« Weine, die vor der Abfüllung geschwefelt werden und zu schnell auf den Markt kommen, können sich in ihrer Aromatik nämlich gänzlich verschlossen präsentieren. Solche Weine werden auch als füllkrank bezeichnet. Dieser Zustand hält im Normalfall aber nicht lange an und legt sich nach einigen Wochen.
WIE WIRD ROTWEIN HERGESTELLT?
Der wesentliche Unterschied bei der Herstellung von Weißwein und Rotwein ist die Maischegärung. Dabei gärt der Saft ca. 2–3 Wochen zusammen mit den Beerenschalen und dem Fruchtfleisch, den Kernen und gegebenenfalls den Rappen bei einer Temperatur von ca. 20–26°C in einem Gärbottich. Die Maischegärung sorgt dafür, dass der Farbstoff aus den blauen Beerenschalen ausgelaugt wird und in den Saft übergeht. Bei der Herstellung von Rotwein wird im Unterschied zur Weißweinherstellung die Maische also erst nach der Gärung abgepresst.
GUT ZU WISSEN: Das Fruchtfleisch jeder Rebsorte ist bis auf wenige Ausnahmen immer weiß bzw. grün-gräulich. Die Farbe, egal ob weiße oder rote Rebsorte, sitzt dabei immer in den Beerenschalen. Das erklärt, warum man aus blauen Trauben auch Weißwein, den sogenannten Blanc de Noirs (frz. »Weißer aus schwarzen«), herstellen kann.
LousPROBIERTIPPS FÜR ROTWEIN-ANFÄNGER:INNEN: Weingut Wachter-Wiesler, z.B. Béla-Jóska; Weingut Helmut Christ, z.B. Blaufränkisch; Weingut Rings, z.B. Portugieser Sand & Kiesel; Weingut A. Christmann, z.B. Spätburgunder Aus den Lagen; Domaine A. Chopin et Fils, z.B. Bourgogne Rouge; Weingut Sermann, z.B. Marienthaler Frühburgunder; Weingut Prieler, z.B. Sankt Laurent; Weingut Rosi Schuster, z.B. Aus den Dörfern Rot; Descendientes de J. Palacios, z.B. Pétalos del Bierzo D.O.; Alegre Valganon, z.B. Garnacha Tinto; Palacios Remondo, z.B. Propiedad; Vinas Mora, z.B. Kaamen II; Roberto Voerzio, z.B. Dolcetto d’Alba; Vietti, z.B. Tre Vigne Dolcetto d’Alba; Bruno Giacosa, z.B. Dolcetto d’Alba Falletto di Serralunga; Giuseppe Mascarello, z.B. Dolcetto d’Alba Bricco Mirasole; Weingut Schnaitmann, z.B. Trollinger Alte Reben; Weingut Pfannenstielhof, z.B. St. Magdalener Classico; Weingut Alois Lageder, z.B. Vernatsch Römigberg; Yvon Métras, z.B. Beaujolais; Domaine Julien Sunier, z.B. Fleurie; Filipa Pato & William Wouters, z.B. Bairrada; Niepoort, z.B. Bairrada Quinta de Baixo Poeirinho Baga; Vito Lauria, z.B. Nero d’Avola; Chiara Condello, z.B. Romagna Sangiovese Predappio; Domaine Ballorin & F, z.B. Les Chenevières
… UND ROSÉWEIN?
Rosé ist en vogue! Das pinkige Etwas ist schon längst nicht mehr nur Trendgetränk für die warmen Monate, sondern wird das ganze Jahr über gesüffelt. Wen wundert’s? Die Weinart hat in den vergangenen Jahren einen ganz schön großen Qualitätssprung aufs Parkett gelegt und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Vorbei sind die Zeiten von »nettes Weinchen«, »verzweifelt auf trinkbar gemacht« und »rosa Bonbonwasser«. Es gibt Winzer:innen, die Rosé mit so viel Ernsthaftigkeit in die Flasche bringen, dass man anfängt, an allem zu zweifeln, was vorher als Rosé betitelt wurde. Doch wie wird Roséwein gemacht?
Das Prinzip der Herstellung ist fast immer gleich. Roséwein wird aus blauen Trauben gewonnen, also aus Rotweinsorten. Wir wissen ja jetzt, dass der Saft einer Beere – unabhängig davon, ob blaue oder weiße Traube – in der Regel immer weiß ist. Die Farbpigmente, die dem Rosé oder Rotwein die Farbe verleihen, sitzen mit vielen anderen geschmacksgebenden Stoffen in den Beerenschalen. Je länger der Kontakt zwischen Beerenschale und Saft ist, desto intensiver der Geschmack und desto abgefahrener die Farbe. Doch nicht nur die Dauer des Kontakts, sondern auch die Rebsorte selbst ist maßgeblich entscheidend für den Geschmack und die Farbtiefe eines Roséweins. Es gibt Rebsorten, die von Natur aus eine sehr dünne Beerenschale und wenig Farbstoff besitzen, und es gibt dickschalige und farbintensive Rebsorten, die einem bereits die komplette Hand verfärben, wenn man die Beere zwischen Daumen und Zeigefinger zerquetscht. Spätburgunder, Trollinger & Co. sind verantwortlich für ein zartes Rosa. Cabernet Sauvignon oder Zinfandel sorgen für das quietschpinke Vergnügen, und wiederum andere Rebsorten wie Garnacha oder Tempranillo können so farbtiefe Roséweine ins Glas bringen, dass sie einen im ersten Augenblick eher an leichte Rotweine denn an einen Roséwein erinnern. Summa summarum werden vier Methoden zur Herstellung eines Roséweins unterschieden:
MISCHUNG VON ROT- UND WEISSWEIN
Was in der EU bis auf wenige Ausnahmen verboten ist, ist in einigen Ländern in Übersee gängige Praxis, um möglichst preisgünstige Roséweine herzustellen.
DIREKTPRESSUNG
Die Trauben werden sofort, aber langsam und schonend gepresst. Der Kontakt zwischen Beerenschale und Saft ist nur von kurzer Dauer – der Most läuft »direkt« ab. Das Ergebnis, je nach Rebsorte, sind sehr helle, fast weiße Weine mit oft roséfarbenen Reflexen. Ein Paradebeispiel für die Direktpressung ist der Blanc de Noirs. Wobei man an dieser Stelle erwähnen muss, dass ein Blanc de Noirs im Volksmund zwar fast immer in die Kategorie Roséwein geschmissen wird, es sich offiziell aber um einen Weißwein aus blauen Trauben handelt, der seit Änderung des Weingesetzes 2021 auch die für Weißwein typische Farbe aufweisen muss.
KURZE MAISCHESTANDZEIT
Dieses Verfahren ist eine Anlehnung an die Rotweinherstellung. Die Beeren kommen in die Traubenmühle und werden angequetscht. Danach landet der ganze Bums für ca. 6–24 Stunden in einer Bütte. Je länger der Kontakt zwischen Saft und Beerenschalen, desto intensiver die Farbe, der Geschmack, die Tanninstruktur …! Sobald das gewünschte Ergebnis erzielt ist, wird der Saft von der Maische abgezogen und landet zur Fermentation in einem Gärbehälter. Ein klassisches Verfahren für alle gängigen Roséweine.
SAIGNÉE-VERFAHREN
Beim Saignée-Verfahren, auch Salasso-Verfahren oder Saftabzug genannt, passiert im Prinzip genau dasselbe wie bei der kurzen Maischestandzeit. Mit dem einzigen Unterschied, dass hier i.d.R. zwei Weinarten gewonnen werden: Roséwein und Rotwein. Der Rotweinmaische werden ca. 10–20% Saft entzogen. Diese – sagen wir mal – 20% werden zu Roséwein weiterverarbeitet. Aus dem anderen Teil wird Rotwein gemacht. Das Ergebnis sind farbintensivere Rotweine, da ja nur ca. 80% Saft auf 100% Maische treffen. Die potenzielle Extraktion von Farbstoff und Geschmack ist demnach höher als ohne Saftabzug. Der daraus entstandene Rosé ist sozusagen nur Mittel zum Zweck.
LousPROBIERTIPPS: Bertram Baltes, z.B. Blanc de Noirs Handwerk (oh, mein Gott – sie packt einfach Blanc de Noirs in die »Roséwein-Probiertipps« – hat sie nicht gemacht?!); Weingut Weninger, z.B. Rózsa Petsovits; Weingut Jurtschisch, z.B. Rosé Belle Naturelle; Weingut Katharina Wechsler, z.B. Rosé Pouch Wildmark im 1,5-Liter-Weinbeutel (ja, richtig gelesen: Weinbeutel – siehe »Alternative Verpackungsmaterialien«); Weingut Gerhard Pittnauer, z.B. Dogma Rosé; Brand Bros, z.B. Wildrosé; Weingut Rainer Schnaitmann, z.B. Steinwiege Muskattrollinger Rosé; Weingut Maria und Sepp Muster, z.B. Rosé vom Opok
ORANGE WINE
Orange Wine ist nichts anderes als Weißwein, der wie Rotwein hergestellt wird. Stichwort: Maischegärung. Durch die Gärung oder eine längere Standzeit auf der Maische wird nicht nur der Farbstoff aus den weißen Beerenschalen entzogen, auch Aromastoffe und Gerbstoffe werden extrahiert. Das Ergebnis ist ein Weißwein, der intensiv, mitunter orange in der Farbe ist und geschmacklich ordentlich Power hat. Auch wenn Orange Wine aus vermarktungstechnischen Gründen gerne im Kontext mit Naturwein, schwefelfreiem Wein, ökologisch oder gar biodynamisch erzeugtem Wein genannt wird, ist das nicht zwangsläufig der Fall. Bei Orange Wine – alle Emotionen an die Seite gepackt – handelt es sich schlicht und ergreifend um eine Weinbereitungsmethode. Je nach Rebsorteneinsatz sind Aromen – Achtung, der kommt flach! – von Trauben, Zitrusfrüchten, reifem Steinobst oder Trockenobst, Honig und den verschiedensten krautigen, herben Noten wie Salbei, Malz, Sauerteig & Co. ganz typisch. Orange Wines solltest du im Idealfall wie Rotweine behandeln. Das heißt, gegebenenfalls Luft dran lassen (aka karaffieren), nicht zu kalt und nicht zu warm servieren. Durch die Power und Präsenz, die diese Weine oft mit sich bringen, sind Orange Wines genial zu Gerichten, die vor Aromen nur so strotzen. Hammermäßig zu orientalischen Klassikern wie z.B. einer marokkanischen Tajine.
LousPROBIERTIPPS FÜR ORANGE-ANFÄNGER:INNEN: Saša Radikon, z.B. Slatnik und Ribolla Gialla; Azienda Agricola Zidarich, z.B. Vitovska Carso Bianco; Testalonga (Craig und Carla Hawkins), z.B. El Bandito Skin; Weingut Pranzegg, z.B. Tonsur; Weingut Michael Wenzel, z.B. Lockvogel; Azienda Agricola Aldo Viola, z.B. Egesta; Weingut Markus Ruch, z.B. Klettgau Amphore
NATURWEIN
Ganz ehrlich? Leidiges Thema. Leidig, weil ich den Begriff wirklich ätzend finde. Leidig auch, weil so viele schlecht gemachte Weine unter dem Deckmantel »Naturwein« (aka Natural Wine, Vin Naturel, naturbelassene Weine, Low Intervention Wines, Vins Vivants, Vini Veri, reduzierter Wein, lebendiger Wein) vermarktet werden, dass sich mir und etlichen meiner Winzerkolleg:innen die Nackenhaare aufstellen. »Der muss so schmecken, das ist Naturwein!« Bullshit. Hier nun mein Versuch, etwas Licht ins immer noch Dunkle zu bringen. Also, Ohren spitzen und zuhören – äh, Augen auf und Textmarker rauskramen:
Allein der Begriff Naturwein sorgt bereits allseits für Verwirrung. Wein ist doch Natur, wird aus Trauben gemacht – oder etwa nicht? Ja, Wein wird aus Trauben gemacht. Genauso wie Joghurt eigentlich aus Milch gewonnen werden sollte. Und dennoch: Wie in der Lebensmittelindustrie üblich, sind auch in der Weinbranche weit über 50 Zusatzstoffe erlaubt. Der Unterschied? Bis auf wenige Ausnahmen sind diese bei Wein noch nicht deklarierungspflichtig. Yep, richtig gelesen. Und eigentlich sollte genau dieser Umstand zum Nach- und Umdenken anregen. Da hört sich die Sache mit dem Naturwein doch eigentlich ganz gut an:
WAS IST NATURWEIN?
Naturwein ist Wein, der möglichst ohne bzw. durch den reduzierten Einsatz von kellertechnischen bzw. önologischen Verfahren sowie Behandlungs- und Zusatzmitteln hergestellt wurde. In der Naturweinherstellung soll zudem besonders viel Wert auf die naturnahe Bewirtschaftung nach ökologischen und/oder biodynamischen Leitsätzen gelegt werden. Die Trauben sollen händisch gelesen und spontan, also ohne den Einsatz von Reinzucht- oder Aromahefen, vergären. Während der Verarbeitung des Traubenmaterials und des Weinbereitungsprozesses soll der Gebrauch von Behandlungsmitteln sowie von Hilfs- und Zusatzstoffen weitestgehend reduziert werden. Und auch auf mechanische Abläufe wie übermäßiges Pumpen (z.B. Umpumpen von einem Tank in einen anderen) der Grundweine und weitere kellertechnische Verfahren sollte nach Möglichkeit verzichtet werden.
Eigentlich lässt sich Naturwein also im Grunde sehr einfach zusammenfassen: »So wenig wie möglich, so viel wie nötig!« Dennoch ist es Naturwein, der zwar seit Jahren in aller Munde ist, aber immer noch regelmäßig für hitzige Diskussionen sorgt. Denn über Naturwein kursiert extrem viel Halbwissen. Es wird viel Richtiges, aber leider auch eine Menge Blödsinn erzählt. Spätestens wenn ich mir dann auch noch das idealismusgeladene Geschwafel von irgendwelchen dahergelaufenen Freaks anhören muss, die nichts gelten lassen außer ihrer eigenen Weltanschauung und neunmalklug eine polemische Äußerung nach der anderen rausballern, könnte ich schreiend im Kreis laufen. Das Problem ist auch: Der Begriff Naturwein ist noch nicht verbindlich determiniert, basiert also nicht auf einer rechtlichen Grundlage. Alle Winzer:innen definieren ihre Arbeit bzw. Auffassung der Naturweinbereitung anders. Auch stammt ein Wein, der als Naturwein vermarktet wird, nicht automatisch aus ökologischer oder biodynamischer Landwirtschaft, ist also nicht automatisch ökologisch und/oder biodynamisch zertifiziert. Du siehst, ganz so einfach ist die Sache mit dem Naturwein dann doch nicht.
NATURWEIN – NUR EIN HYPE?
Mit Beginn der Naturweinbewegung und dem Hype um naturbelassene Weine mit freaky Etiketten und Schaumweinen mit Kronkorken insbesondere in den hippen Städten Europas kam auch bei jungen Menschen wieder eine neue Begeisterung für das Thema Wein auf. Dabei ging es weniger um das »Wie« und »Was« als vielmehr um den Inhalt der Weinflasche. Auch ging es nicht darum, die großen Weinnamen und Appellationen aus Frankreich und Italien auswendig zu kennen. Es war auch völlig egal, wie viel Gaja, Rinaldi, Armand Rousseau oder Coche-Dury du bis dato gesoffen hattest und wie dick dein Portemonnaie ist – es ging um Wein, und zwar ohne Schlips und Kragen, dafür mit Flipflops und Shorts. Wein wurde endlich »barrierefrei« gemacht. Dieses fast schon soziokulturelle Phänomen der Naturweinbewegung ermöglichte vielen Winzer:innen und Händler:innen einen ganz neuen und nie zuvor dagewesenen Zugang zum Markt.
Im Zuge der Naturweinbewegung gab es aber auch einige Winzer:innen, die einfach nur auf den »Naturweinzug« mit aufspringen wollten. Trittbrettfahrer, nämlich – in dem Falle – solche Winzer:innen, die fachliches Versagen und die daraus resultierenden Weinfehler und Weinkrankheiten unter dem Deckmantel von Naturwein vermarkteten. Den »Wein-Zivilist:innen«, vielen Sommelièren und Sommeliers sowie Weinverkäufer:innen wurde im gleichen Atemzug eingebläut, dass der Wein genau so zu schmecken habe, da es sich hierbei schließlich um Naturwein handele. Weinfehler und Weinkrankheiten waren plötzlich aus vermarktungstechnischen Gründen vollkommen in Ordnung. Ein Schlag ins Gesicht. Erstens für die Önologie und zweitens für all diejenigen Winzer:innen, die souveräne Naturweine auf die Flasche ziehen und ihr Handwerk in Perfektion beherrschen. Nicht zuletzt wurde dadurch die »Naturwein-Gerüchteküche« angekurbelt und sorgt damit bei dir als Konsument:in für maximale Verwirrung. Aussagen wie »Naturwein? Den Essig kannst du schön alleine trinken!« sind die Folge. Dabei stammen einige der begehrtesten Weine der Welt von Betrieben, die extrem reduziert in Weinberg und Keller arbeiten.
Viel wichtiger aber als diese negativen Begleiterscheinungen ist der positive Effekt, dass die Pionierarbeit vieler Naturweinwinzer:innen erfolgreich dazu beigetragen hat, dass Weingüter ihr bisheriges Handeln im Keller und insbesondere im Weinberg mit Blick auf die Nährstoffversorgung der Böden und Reben sowie den unkontrollierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln & Co. kritisch hinterfragen und ihre Betriebe auf eine nachhaltigere Bewirtschaftungsform umstellen.
GUT ZU WISSEN: Wein im Herstellungsprozess – vom Weinberg bis zum Keller – ist ein sehr komplexes Unterfangen. Die Ausgangsbasis muss stimmen. Nur Know-how, perfektes Weinbergmanagement und die Verarbeitung von gesundem Traubenmaterial geben Winzer:innen die Freiheit, möglichst reduziert arbeiten zu können. Erst durch Perfektion und gute fachliche Praxis wird ihnen das »kontrollierte Nichtstun« ermöglicht.
WIE SCHMECKT NATURWEIN?
Naturbelassene Weine riechen und schmecken mitunter komplett anders und sehen auch anders aus als das, was du vielleicht bis dato im Glas hattest. Im Aussehen hat Naturwein oft eine kräftige Farbe und kann trüb bis sehr trüb sein – muss er aber nicht. Denn es gibt auch etliche Naturweine, die glasklar ins Glas laufen, und zwar gänzlich ohne den Einsatz von Behandlungsmitteln, Filtration & Co.
Ganz grundsätzlich kann man durchaus sagen, dass der Duft und der Geschmack eines Naturweins weniger durch fruchtige als vielmehr durch vegetative und mikrobiologische Aromen wie z.B. Heu, Tee, Kräuter, Waldboden, Malz oder Hefe geprägt ist. Oft wird der Geruch von Naturweinen, insbesondere bei Weißwein, auch mit dem eines Apfelweins bzw. Apfelmosts verglichen. Geschmacklich kann er – je nach Ausbau der Weine – mitunter von einer kräftigen Säure- und Tanninstruktur sein. Naturweine sind wilder und … ja, irgendwie ungeschliffener. Dann wiederum unfassbar elegant, charakterstark und sehr differenziert in Geruch und Geschmack. Will meinen: Naturwein lässt sich nur schwer in eine Schublade stecken und ist nicht immer extrem. Alles kann, nichts muss.
LousPROBIERTIPPS FÜR NATURWEIN-ANFÄNGER:INNEN: Weingut Claus Preisinger, z.B. Kalk und Kiesel; Weingut Maria und Sepp Muster, z.B. Gelber Muskateller vom Opok; Weingut Werlitsch, z.B. Morillon vom Opok; Weingut Judith Beck, z.B. Koreaa; Weingut Heinrich, z.B. Naked White; Weingut Christian Tschida, z.B. Himmel auf Erden Rosé; Weingut Nusserhof, z.B. Elda Vernatsch; Weingut Rebenhof (Inh. Hartmut Aubell), z.B. Silt Lieu Dit; Domaine Labet, z.B. Gamay La Reine; Domaine Les Bottes Rouges, z.B. Léon Chardonnay; Weingut Pranzegg, z.B. Campill; Weingut Odinstal, z.B. Riesling 120 N.N.; Weingut Stefan Vetter, z.B. Müller-Thurgau Steinterrassen; Domaine Julien Meyer (aka Patrick Meyer), z.B. À-la-Vie; Christopher Barth, z.B. Zwei Zimmer Küche Barth; Kleines Gut, z.B. Trollinger; Weingut Atilla Homonna, z.B. Tokaji Furmint; Fattoria di Bacchereto, z.B. Terre a Mano; Gut Oggau, z.B. Theodora
ALKOHOLFREIER WEIN
Bei alkoholfreien Weinen handelt es sich um Weine, denen nachträglich der durch die Gärung entstandene Alkohol entzogen wird. Rein rechtlich darf sich alkoholfreier Wein nicht mehr »alkoholfrei« nennen, sondern läuft jetzt unter »entalkoholisierter« Wein – nur damit du es einmal gehört hast! Alkoholfreier Wein wird i.d.R. mittels thermischer Verfahren hergestellt. In der Praxis ist die schonende Entalkoholisierung durch Vakuumdestillation ein sehr gängiges Verfahren. Dabei wird der Wein unter Druck schonend erwärmt. Der Alkohol verabschiedet sich dabei bereits bei einer Temperatur von ca. 30°C. Ein weiteres Verfahren ist z.B. die Umkehrosmose. Ein alkoholfreier bzw. entalkoholisierter Wein darf den Grenzwert von 0,5 Vol.-% nicht überschreiten. Gesundheitlich ist das völlig unbedenklich – da enthalten selbst reife schwarzbraune Bananen mehr Alkohol. Durch die Entalkoholisierung geht nicht nur der Alkohol, der als Geschmacksträger wie Butter im Mürbeteig funktioniert, verloren, sondern viele weitere Aromen und auch strukturgebendes Tannin. Um das geschmackliche Gleichgewicht wiederherzustellen, arbeiten viele Produzent:innen alkoholfreier Weine mit zugesetzten Aromen, z.B. auf Basis von Teeauszügen oder Gewürzen, oder mit der Zugabe von Zucker. Ob alkoholfreier Wein schmeckt oder nicht, hängt sehr stark von unserer Erwartungshaltung und von unseren Bedürfnissen ab. Du solltest dir darüber im Klaren sein, dass alkoholfreier Wein kein Ersatz, sondern eine Alternative ist und nicht mit alkoholfreiem Bier, dessen Geschmack oft an das »Original« herankommt, mithalten kann.
LousPROBIERTIPPS: Alkoholfreie Alternativen, die ich wirklich gut finde, sind z.B. die Sachen von Muri, die Champagner Bratbirne von Jörg Geiger oder die Geschosse von Wachstum König und Obsthof Retter.
GUT ZU WISSEN: Steht auf dem Etikett »Ohne Alkohol«, muss der Alkoholgehalt tatsächlich bei null liegen. Bei »alkoholfreien« bzw. »entalkoholisierten« Produkten hingegen darf der Alkoholgehalt von 0,5 Vol.-% nicht überschritten werden.
»DER HAT ABER SCHÖNE TANNINE!«
Neben dem »Unwort« Mineralität (siehe »Mineralität«) gibt es meines Erachtens keinen Begriff in der Weinwelt, der so inflationär gebraucht wird wie Tannin. Dabei wissen viele gar nicht, was es mit diesem entzückenden Stöffchen auf sich hat. Lass uns mal einen Blick hinter die Kulissen werfen:
Tannin ist im Grunde genommen nichts anderes als Gerbstoff. Gerbstoff löst in unserem Mund ein austrocknendes, adstringierendes Gefühl aus. Wenn wir uns einmal so eine Traube angucken, dann sehen wir zum einen die Rappen, also das Stielgerüst, und zum anderen die Beeren – hier sitzen die wichtigsten Inhaltsstoffe! Im Fruchtfleisch befinden sich neben anderen Inhaltsstoffen Zucker, Apfelsäure und Weinsäure. Innerhalb der Beerenhaut finden wir Mineralien, Aromastoffe und Polyphenole. Polyphenole kannst du dir als DIE Mutter aller Pflanzenstoffe vorstellen, die maßgeblich für den Geschmack, die Farbe (aka Anthocyane) sowie für die Tannine verantwortlich ist. Im Fachjargon heißen die Tannine dann aber eigentlich nicht mehr Tannine, sondern gehören zur Gruppe der Flavonoide (aka flavonoide Tannine). Die höchste Konzentration an Flavonoiden finden wir in den Rappen und Kernen sowie in der Beerenschale. Durch die adstringierende Eigenschaft der Flavonoide wird die Haut der Beere nämlich verdichtet. Diese Verdichtung schützt vor Fressfeinden und macht die Schale insbesondere für Vögel schwer verdaulich. Kuriose Überlebenshacks von Mutter Natur.
In erster Linie ist es im Übrigen völlig egal, ob wir von Weißwein oder Rotwein sprechen. Jede Rebsorte besitzt Tannine. Die eine mehr, die andere weniger. Tendenziell weisen Rotweinsorten aber eine höhere Konzentration an Gerbstoffen auf. Aufgrund dessen meinen eigentlich alle Rotwein, wenn von Tanninen die Rede ist. Rote Rebsorten, die eine besonders hohe Gerbstoffkonzentration aufweisen, sind z.B. Nebbiolo, Petit Verdot, Tannat, Cabernet Sauvignon oder Touriga Nacional. Rebsorten, die hingegen wenig Gerbstoff mit sich bringen, sind z.B. Spätburgunder, Trollinger, Cinsault oder Frappato.
Tannine verleihen dem Wein im besten Fall mehr Struktur, Textur, Komplexität und Ausdrucksstärke. Sie beeinflussen





























