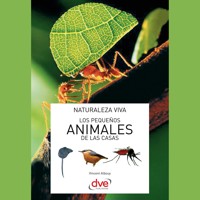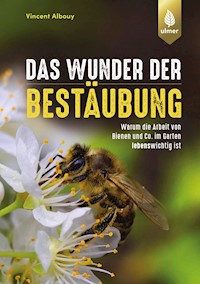
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Bienen und anderen Bestäubern geht es nicht gut. Einige Experten gehen sogar davon aus, dass die Pflanzenbestäubung mittelfristig in eine Krise gerät. Erfahren Sie in diesem Buch, warum Pflanzenbefruchtung so wichtig ist und welchen Einfluss sie auf die Gemüse- und Obstproduktion hat. Folgende Fragen stehen im Fokus: Wie vermehren sich Pflanzen? Was ist Bestäubung? Wer transportiert den Pollen? Wie läuft die Bestäubung bei verschiedenem Obst und Gemüse genau ab? Und: Wie kann die Bestäubung gefördert werden? Lesen Sie hier alles Wichtige zu diesem brandaktuellen Thema und erhalten Sie wertvolle Tipps, wie Sie die Bestäubung im eigenen Nutzgarten fördern und den Ernteertrag steigern können!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 56
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Vincent Albouy
DAS WUNDER DER
BESTÄUBUNG
Warum die Arbeit von Bienen und Co. im Garten lebenswichtig ist
Aus dem Französischen von Sabine Hesemann
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Wie funktioniert die Bestäubung?
Wie Pflanzen sich vermehren
Was ist Bestäubung?
Wer transportiert den Pollen?
Primitive Bestäuber
Fliegen
Schmetterlinge
Wildbienen
Honigbienen
Ein Bestäuber-freundlicher Garten
Die Bestäubung im Garten
Bestäubung von Obstblüten
Steinobst
Kernobst
Nüsse und Mandeln
Beerenobst
Melonen
Erdbeeren
Exotische Früchte
Feigen und Trauben
Ein Bienenvolk im Garten?
Bestäubung bei Gemüsepflanzen
Erbse, Gartenbohne und Saubohne
Tomate
Aubergine
Paprika
Zucchini und Kürbis
Salatgurke und Einmachgurke
Saatgutproduktion
Manuelle Bestäubung – rückständig oder modern?
Wie funktioniert die Bestäubung?
Bienen und anderen Bestäubern geht es schlecht. Einige Experten erwarten, dass die Pflanzenbestäubung kurz- bis mittelfristig in eine Krise gerät. In diesem Zusammenhang ist es von zentraler Bedeutung, dass man versteht, wie die Pflanzenbefruchtung funktioniert und wie wichtig sie für die Obst- und Gemüseproduktion im Garten ist.
Wie Pflanzen sich vermehren
Die Blütenpflanzen gelten als die höchstentwickelten Pflanzen. Die Blüte ist ihr Werkzeug für die Vermehrung und damit für den Fortbestand der Art.
Der Aufbau einer Blüte
Eine typische Bedecktsamer-Blüte ist aus verschiedenen Teilen aufgebaut. Betrachten wir sie von außen nach innen:
• Die Sepalen (Kelchblätter), üblicherweise grün, bei manchen Arten jedoch bunt, schützen den Inhalt der Knospe.
• Die Petalen (Kronblätter), gewöhnlich farbig, nur sehr selten gelblich-grün, schützen die Fortpflanzungsorgane der Pflanze. In vielen Fällen sind sie gemustert: Das Muster lockt die bestäubenden Tiere an; daher spricht man von „Saftmalen“.
• Die Staubblätter, die männlichen Fortpflanzungsorgane, tragen die Staubbeutel mit dem Pollen. Dieser wird bei günstiger Witterung abgegeben. Pollen besteht aus mikroskopisch kleinen Körnchen, die einen unterschiedlich langen Pollenschlauch ausbilden müssen, um die Samenanlagen zu befruchten.
• Die Karpellen (Fruchtblätter) bergen bei bedecktsamigen Pflanzen die Samenanlagen, die künftigen Samen. Aus den Fruchtblättern entwickeln sich die Früchte.
Unglaubliche Vielfalt
Das Schema zeigt eine einfache Blüte, wie sie auch bei einem Apfelbaum aussieht. Bei vielen Pflanzen jedoch ist der Aufbau ein anderer: Einzelne Teile fehlen oder sind mit anderen verwachsen wie etwa bei zusammengesetzten Fruchtknoten, die als Pistill oder Stempel bezeichnet werden – ihr säulenförmiger Griffel hat am Ende unterschiedlich geformte Narben; das Pollenkorn muss die Narbe erreichen, damit es zur Befruchtung kommt. Es gibt auch Pseudanthien (Scheinblüten), zum Beispiel bei der Endivie mit ihrer Infloreszenz bzw. einem aus mehreren einfachen Blüten zusammengesetzten Blütenstand: Er sieht aus wie eine einzelne Blüte.
Schema einer Hahnenfußblüte
Die meisten Blüten sind zwittrig: Sie enthalten männliche wie auch weibliche Organe. Ein paar wenige Arten haben eingeschlechtige Blüten, entweder nur mit weiblichen Organen ohne Staubblätter oder nur mit männlichen Blüten ohne Karpellum. Auf ein und derselben Pflanze können auch männliche und weibliche Blüten wachsen (wie bei Haselnuss oder Zucchini); oder eine Pflanze trägt ausschließlich weibliche oder männliche Blüten (wie zumeist bei Spinat).
Nektarien
Bei von Tieren bestäubten Blüten sitzen gewöhnlich unten an den Geschlechtsorganen Drüsen, sogenannte Nektarien. Sie sondern den Nektar, eine zuckerhaltige Flüssigkeit, ab. Er dient dazu, die Bestäuber anzulocken – sie ernähren sich von ihm, ja für fliegende Blütenbesucher ist er sogar eine sehr wertvolle Nahrungsquelle, denn der Zucker ist ein unersetzlicher Treibstoff für ihre Flugmuskulatur.
1 Bei dieser Auberginenblüte besteht das Pistill aus einem weißen Griffel mit grüner Narbe an seinem Ende; ringsherum gelbe Staubblätter und hellviolette Blütenblätter.
2 Die Korbblüte der Endivie ist aus einfachen, verschiedenartigen Einzelblüten zusammengesetzt.
3 Hahnenfußblüte voller Glanzkäfer der Gattung Meligethes.
Was ist Bestäubung?
Wir unterscheiden zwischen Bestäubung – also dem Platzieren von Pollen auf der Narbe der gleichen Art – und Befruchtung; bei Letzterer vermischen sich männliches und weibliches genetisches Material, sodass ein Individuum mit anderen Erbanlagen entsteht.
Mischung der Gene
Die Evolution allen Lebens basiert auf der Auswahl der bestangepassten Individuen. Damit eine natürliche Selektion stattfinden kann, sollten sich die Gene zwischen den Individuen einer Generation möglichst partiell unterscheiden. Diese Unterschiede entstehen insbesondere durch Kreuzung: Dabei mischt sich die Hälfte der Gene eines Individuums mit der Hälfte der Gene eines anderen Individuums. Im Laufe der Evolution haben sich zahlreiche Mechanismen entwickelt, die dazu dienen, die weit verbreitete Rekombination von Genen durch Kreuzungen zu fördern, darunter die Bestäubung. Doch bei Pflanzen gibt es auch Alternativen, die einen Ausfall des gewöhnlichen Ablaufs bei der Neukombination ausgleichen: Befruchtung durch den eigenen Pollen (wie bei der Bohne) oder vegetative Vermehrung durch Klone wie die Sprossknollen der Kartoffel oder die Ausläufer der Erdbeere.
Etwas Fachvokabular
Man bezeichnet eine Pflanze als autogam oder selbstkompatibel, wenn die Blüte vom eigenen Pollen befruchtet werden kann (wie etwa bei Tomaten). Man bezeichnet sie als selbstfruchtend, wenn die Blüte einer Einzelpflanze durch den Pollen einer anderen Blüte derselben Pflanze befruchtet werden kann (wie bei den einhäusigen Melonen, die männliche und weibliche Blüten tragen). Selbstkompatible, nicht selbststerile Pflanzen können sich also selbst bestäuben, sofern der Pollen irgendwie auf die Narbe der Blüte kommt. Eine Pflanze wird als allogam und selbstinkompatibel bezeichnet, wenn ihre Blüte nur vom Pollen eine anderen Einzelpflanze befruchtet werden kann (Fremdbestäubung).
Die junge Frucht dieser befruchteten Auberginenblüte wächst zwischen den Kelchblättern hervor.
In der Praxis
Eine Art oder eine Sorte gilt als selbstinkompatibel, wenn ohne das Zutun von Bestäubern keine Früchte oder Samen entstehen oder wenn die durch Selbstbestäubung entstehenden Früchte und Samen minderwertig ausfallen oder in zu geringer Zahl auftreten.
Eine Art gilt als selbstkompatibel, wenn Früchte und Samen normalerweise nach Selbstbestäubung entstehen bzw. wenn Qualität und Quantität nicht in ungewöhnlichem Ausmaß nachlassen.
Früchte ohne Bestäubung
Manchmal entsteht eine Frucht auch ohne Befruchtung, also auch ohne dass die Blüte bestäubt wurde. So bei einigen Feigen- und Birnensorten. Man spricht in diesem Fall von Parthenokarpie, Jungfernfrüchtigkeit. Die Pflanze vermehrt sich allerdings nicht, denn die Frucht trägt keine Samen. Durch Parthenokarpie entstandene Einzelpflanzen würden in der Natur aussterben. Der Mensch vermehrt sie jedoch vegetativ durch Ableger und Pfropfung.
1 und 2 Aus dieser Rettichblüte entwickelt sich … eine hübsch geformte Schote voller Samenkörner.
3 Die unbefruchteten Blüten des Apfelbaumes verwelken ohne Fruchtansatz.
Wer transportiert den Pollen?
Die Anzahl an Bestäubern, die für den Transport der Pollen zur Narbe der Blüte infrage kommen, ist zwar begrenzt. Doch Bienen und andere Insekten sind nicht die einzigen, die diese Arbeit verrichten.
Physikalische Faktoren
Dazu zählen:
• die Schwerkraft (wenn der Pollen auf die Narbe fällt)
• Wasser (bei 2 % der Wasserpflanzen)
• Wind (bei einer Minderheit der Landpflanzen)
• Tiere (bei den meisten Pflanzen)
• die Pflanze selbst (wenn die Staubblätter sich krümmen und die Narbe der Blüte berühren)
Unter den bestäubenden Tieren sind die Insekten die mit Abstand größte Gruppe; dazu kommen Vögel oder Fledermäuse sowie ausnahmsweise auch Kleinnager, Beuteltiere, Echsen und Schnecken. In Europa arbeiten nur Insekten als tierische Bestäuber im Garten.