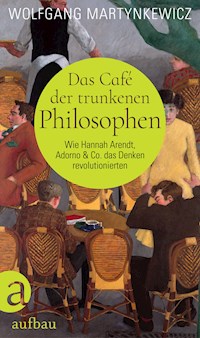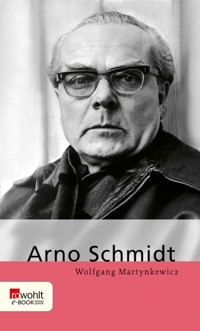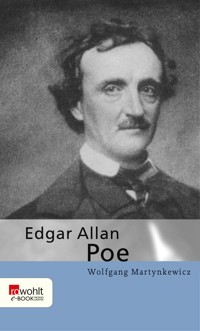12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Schattenseite der Moderne. Um 1900 entsteht ein neues Leitbild: die vitale Persönlichkeit. Es ist der Anfang einer radikalen Mobilmachung, welche die ganze Gesellschaft erfasst. Rilke unterzieht sich einer Kräftigungstherapie: gymnastische Übungen, kalte Bäder, Waldlauf; sogar Holzhacken steht auf dem Programm. Auch Kafka sieht sich unter Zugzwang. In der Naturheilanstalt „Jungborn“ klettert er auf Bäume, pflückt Kirschen und nimmt – zu seinem Entsetzen – nackt auf einer Wiese Luftbäder. Thomas Mann bekämpft derweil seine Trägheit im Züricher Sanatorium Bircher-Benner. Und selbst Bismarck, der ein „großartiger Fresser und Säufer“ (Kafka) war, versucht es zur Abwechslung mal mit Obst und frischer Luft. Doch sosehr man die Gifte und Reize der Zivilisation abzuwehren sucht, der Mensch ist dem neuen Leben nicht gewachsen. Das Gespenst der Erschöpfung geht um, Untergangsbilder kursieren, Europa scheint am Ende. Unter den Neurotikern, Nervösen, Magenkranken und Depressiven wächst die Sehnsucht nach Erlösung und neuer Kraft, nach Seelenführern, Gesundheitsaposteln, Trainern und Ernährungsberatern. Auch für sie schlägt um 1900 die Stunde. Auf der Grundlage zahlreicher, teilweise bislang unbekannter Dokumente entwirft Wolfgang Martynkewicz ein provokantes Epochenbild, das Einblick in die Innenwelt einer von Überforderung und Erschöpfung geprägten Moderne gibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Wolfgang Martynkewicz
Das Zeitalterder Erschöpfung
Die Überforderung des Menschendurch die Moderne
Impressum
Mit 24 Abbildungen
ISBN 978-3-8412-0666-4
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, September 2013
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die Originalausgabe erschien 2013 bei Aufbau, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung hißmann, heilmann, Hamburg
unter Verwendung eines Motivs von © adoc-photos/Corbis
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Inhaltsübersicht
Cover
Impressum
Die unheimliche Erschöpfung oder Das Seelenleben des modernen Menschen. Vorwort
Am Limit
»Arbeiten muß ich lernen«
Eine rätselhafte Schwäche
Das Menetekel der Ermüdung
Der reizsame Mensch
Die Erhabenen oder Vom Glanz der Erschöpfung
Eine geheimnisvolle Zeitkrankheit
Die Willenskultur in der Krise
Umkehr und Erneuerung: Bismarcks Exerzitien
»Nein! an Ihren Nerven liegt’s nicht«: Nietzsches Minimum
»Eine wirkliche Transfusion von Lebenskraft«: Cosima Wagners Regeneration
Zwischen Mönch und Übermensch: Max Webers Depressionen
Die große Gesundheit
Schöne neue Welt
Die Erzeugung der Besten
Das kommende Geschlecht
Purifizierung und Wiedergeburt
Die Optimierung des Menschen
Ausblick
Gefährlich gesund
Der Traum vom langen Leben
Die richtige Dosis
Von wunderbaren Kräften: Sigmund Freud und das Kokain
Frankensteins Erben
Ernähre ich mich richtig?
Heilmittel und Heilslehren
Rennpferde und neue Menschen
Eine neue Philosophie des Leibes
Bericht aus dem innersten Deutschland
Im falschen Körper
Der Aufbau eines neuen Ichs
Zivilisation als Spannung
»Wenn wir jetzt nicht Europäer werden«
»Keine Wurzeln im Leben«
Der neue Nomade
Innen ist immer schon außen!
Weltlosigkeit. Nachwort
Anhang
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Dank
Personenregister
Bildnachweis
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne ...
Die unheimliche Erschöpfung oder Das Seelenleben des modernen Menschen
Vorwort
Nicht das Erschlaffen der Menschheit im Wohlleben ist zu fürchten, sondern die wüste Erweiterung des in Allnatur vermummten Gesellschaftlichen, Kollektivität als blinde Wut des Machens.
Theodor W. Adorno, Minima Moralia
Erschöpfung hat Konjunktur. Wer ist nicht alles erschöpft – und was ist nicht alles von Erschöpfung bedroht: die menschliche Leistungsfähigkeit, das Ich in der digitalen Datenflut, die Ressourcen und Energien, der Fußballtrainer Ralf Rangnick, das männliche Selbstbild, die christlichen Religionen, die Zeugungskraft und die Sexualität im Allgemeinen, die Lehrer, Professoren und Manager, die Zweierbeziehung und die Geschlechterdifferenz, der Kreidefelsen auf Rügen und – natürlich – die Politik, das neoliberale Wirtschaftsmodell und – last but not least – die europäische Idee. Die Rede von der Erschöpfung ist ubiquitär geworden und generiert immer neue Varianten. Man spricht vom »erschöpften Selbst«, vom »überforderten Menschen«, von der »Müdigkeitsgesellschaft«, vom »Burnout der Kultur«, von der »ausgebrannten Republik«.1
Das in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Mode gekommene Schlagwort von der Posthistoire, vom Ende der Geschichte und vom Ende der Moderne2, hat eine neue Evidenz der Bedrohung gefunden: Angesichts einer beschleunigten Welt, die immer mehr an Kraft und Energien fordert, scheint nichts sinnfälliger zu sein als die Behauptung, die Erschöpfung habe Züge einer kollektiven Pathologie angenommen. Der »Stressreport Deutschland 2012« kommt zu dem Ergebnis, dass sich die arbeitsbedingte psychische Belastung »auf hohem Niveau«3 befindet. Stressauslösende Faktoren nehmen unvermindert zu (Multitasking, Termin- und Leistungsdruck, Störung und Unterbrechung bei der Arbeit) und führen zu zahlreichen psychischen Störungen und anderen Erkrankungen.4
Wer »Erschöpfung« sagt, erhält sogleich ein Echo, es bedarf keiner weiteren Erklärung, jeder weiß offenbar sofort, was gemeint ist, jeder kann eigene Erfahrungen und Erlebnisse einbringen. Die Betroffenheit ist allgemein, denn erschöpft ist irgendwie jeder oder doch zumindest ermüdet und in der Krise. Nach Schätzungen von Experten fühlen sich über neun Millionen Deutsche erschöpft, überfordert, ausgebrannt.
Doch gibt es nicht auch eine positive Seite der Erschöpfung? Man denke an die Lust, an den Orgasmus. Der Analytiker Wilhelm Reich sprach von der aufbauenden Erschöpfung, die allerdings an die »orgastische Potenz« gebunden sei, die nur »beim genuß- und leistungsfähigen Menschen«5 anzutreffen ist – eine Spezies, die in der Moderne jedoch kaum vorkommt. In der Regel haben wir es mit neurotischen Menschen zu tun, die, wie Reich eingestehen muss, die Erschöpfung als »Unbefriedigtsein«, als »schwere Müdigkeit«6 erfahren. Auch in der Sexualität ist also das Glück der Erschöpfung zumeist nicht zu finden – jedenfalls nicht für den, der mit neurotischen Konflikten belastet ist. Und wer ist das nicht?
Nach den positiven Seiten von Müdigkeit und Erschöpfung hat jüngst auch Byung-Chul Han gesucht. Die »Erschöpfungsmüdigkeit«, so meint er, »macht unfähig, etwas zu tun«.7 In Anlehnung an Handkes »Versuch über die Müdigkeit« plädiert er für eine Müdigkeit, »die zum Nicht-Tun inspiriert«8 und die der Leistungsund Aktivgesellschaft entgegengesetzt ist. Dass »tiefe Müdigkeit« einen anderen Blick ermöglicht und die »Klammer der Identität«9 lockert, ist eine Überlegung, der man in Experimenten schon früh nachgegangen ist. So wurde gezeigt, dass es dem Ruhebedürftigen trotz großer Anstrengung nicht gelingt, die »Wach-Vernunft« aufrechtzuerhalten.10 Müdigkeit setzt die Energien herab und schränkt das Denken ein – der Mensch wird gleichgültiger gegenüber der Realität. Han schreibt: »Die Dinge flimmern, schimmern und zittern an ihren Rändern. Sie werden unbestimmter, durchlässiger und verlieren etwas von ihrer Entschlossenheit.«11 Dass sich im Zustand der Schläfrigkeit solche Empfindungen einstellen – niemand wird es bezweifeln. Müdigkeit hat eine Aura, aber die Erschöpfung? Sie ist eine fundamentale Kränkung der Leistungsgesellschaft und ihres energie- und kraftstrotzenden Selbstanspruchs, denn sie ist – jenseits aller Gesundbeterei – Schwäche, Lähmung, Passivität, auch Unruhe, Übererregung, Übermüdung.
Die Medizin hat in den letzten Jahren den Versuch unternommen, das Burn-out-Syndrom vom chronischen Erschöpfungssyndrom abzugrenzen.12 Es handelt sich demnach um eine Erschöpfung, die durch Stress ausgelöst und als Befindlichkeitsstörung eingestuft wird. Im Unterschied dazu resultiert der Zustand der chronischen Erschöpfung nicht aus einer Überlastung, er kann daher auch durch Ruhe und Entspannung nicht wesentlich beeinflusst werden. Anhand eines Diagnoseschlüssels hat man das Krankheitsbild und seine Leitsymptome beschrieben und klassifiziert.
Das Burn-out besitzt heute einen gewissen Adel, es ist ein zurechenbares Leiden, das aus einer Anstrengung resultiert, die in der Arbeits- und Aktivgesellschaft mit Anerkennung verbunden ist. Der Ausgebrannte hat mit hohem Einsatz gespielt, er hat alle seine Kräfte und Energien aufgeboten und sich nicht geschont. Anders ist es mit dem chronisch Erschöpften, der – folgt man der medizinischen Klassifikation – gerade nicht an einer Überlastung leidet. Er ist der beunruhigende Fall einer Erschöpfung, die offenbar nicht der Logik von Verausgabung und Überschreitung folgt und nur mehr einen schwer definierbaren gesellschaftlichen Empfindungskomplex darstellt.
Der gegenwärtige kulturwissenschaftliche und sozialpsychologische Diskurs hat den Begriff weitgehend entgrenzt. Man spricht von einer Zeitkrankheit, einer Pathologie der Kultur. Der Erschöpfte ist von den beiden zentralen Ressourcen der digitalen Welt abgeschnitten: Aktivität und Aufmerksamkeit. In Anlehnung an Freuds Begriff von der »Flucht in die Krankheit« könnte man diesbezüglich auch von einer regelrechten Flucht in die Erschöpfung sprechen. Wobei in der momentan geführten Debatte der interessante, von Freud betonte Aspekt des »Krankheitsgewinns«, also der Befriedigung im Symptom, eher unterbelichtet bleibt.13
Erschöpfung wird als Abwehr gedeutet – Abwehr einer überkomplexen Welt, die das Ich gefährdet. Angesichts des technologischen und sozialen Wandels rückt das Bild vom überforderten Menschen in den Mittelpunkt: Dieser ist mit Ansprüchen konfrontiert, die er nicht mehr bewältigen kann, er ist einer Flut von Reizen ausgesetzt und immer weniger in der Lage, diese Informationsmengen adäquat zu verarbeiten – ein Mensch also, der von Natur aus über keine hinreichende eigene Komplexität verfügt und der Außenwelt mehr oder weniger hilflos gegenübersteht: ein Mensch, der nach Halt sucht, nach Integrität und Konstanz.
Das ist freilich keine ganz neue Zustandsbeschreibung: Das Phänomen Erschöpfung – das wird in der gegenwärtigen Diskussion oft unterschlagen – hat eine lange Geschichte. Es ist – das wird dieses Buch zeigen – ein Wiedergänger, der die Moderne begleitet, der zeitweise im Verborgenen geblieben ist und – wie wir jetzt sehen – plötzlich wieder hervortritt und das Ich mit dem Untergang bedroht.14
Nichts hat die Moderne so herausgefordert, so fasziniert und gleichzeitig auch so beunruhigt wie das Gefühl, an einer Grenze zu stehen, sich am Ende einer Entwicklung zu befinden, an einem Punkt, an dem es so wie bisher nicht weitergehen kann. Die Moderne will über sich selbst hinaus, sie akzeptiert keine Grenze und keine Vollendung und produziert systematisch Gefühle der Überforderung und der »Erschöpfungsunruhe«15. Das Individuum wird in eine Position der permanenten Herausforderung gedrängt, wenn es sich erhalten will, muss es sich anpassen.
Bei aller Freude über die neue Freiheit, die mit dem Aufbruch für den Einzelnen sichtbar und spürbar wurde, war die Moderne ein ungeliebtes Projekt. Selbst die tragende Schicht, das Bildungsbürgertum, empfand sie ziemlich schnell als Zumutung und wandte sich ab. Man denke nur an die künstlerischen Avantgarden, die Unverständnis, Angst und Abwehr erregten. Die Moderne erschien als Verunsicherung, als etwas Fremdes, gegen das man sich mit allen Kräften wappnen und schützen musste. So sah man es bereits um 1900.
Der Soziologe Georg Simmel hat vor nunmehr hundertzehn Jahren in seinem berühmten Aufsatz über »Die Großstädte und das Geistesleben« den Seelenzustand des modernen Menschen beschrieben und die typischen Konflikte auf den Punkt gebracht: »Die tiefsten Probleme des modernen Lebens quellen aus dem Anspruch des Individuums, die Selbständigkeit und Eigenart seines Daseins gegen die Übermächte der Gesellschaft, des geschichtlich Ererbten, der äußerlichen Kultur und Technik des Lebens zu bewahren.«16 Die Komplexität der modernen Welt ist Bedrohung und Überforderung, das Subjekt muss, um nicht »nivelliert und verbraucht« zu werden, »Widerstand«17 ausbilden.
Das Seelenleben des modernen Großstädters, so Simmel, sei durch eine »Steigerung des Nervenlebens« bestimmt, die »aus dem raschen und unterbrochenen Wechsel äußerer und innerer Eindrücke hervorgeht«.18 Durch diese »rasche Zusammendrängung wechselnder Bilder«19 und die Plötzlichkeit von Impressionen absorbiert das großstädtische Leben die gesamte Aufmerksamkeit. Simmels These besagt, dass die Differenzen zwischen den Eindrücken intellektuell zwar erfasst, aber nicht mehr in der Tiefe der Persönlichkeit gespiegelt und verarbeitet werden. Um auf die Überkomplexität des modernen Lebens, die »Vergewaltigungen der Großstadt«20 zu reagieren, benötigt das Subjekt einen Schutz: Statt mit Gemüt und Gefühlen reagiere der Großstädter mit Reserviertheit und Verstand – und dem verstandesmäßigen Menschen sei das »eigentlich Individuelle gleichgültig«21. Diese Gleichgültigkeit kommt in einer zentralen Charaktereigenschaft zum Ausdruck, der Blasiertheit: »Das Wesen der Blasiertheit ist die Abstumpfung gegen die Unterschiede der Dinge, nicht in dem Sinne, daß sie nicht wahrgenommen würden, wie von den Stumpfsinnigen, sondern so, daß die Bedeutung und der Wert der Unterschiede der Dinge und damit der Dinge selbst als nichtig empfunden wird.«22 Wir bemerken die Differenzen, aber lassen sie nicht mehr an uns heran, sie bleiben an der Oberfläche. Blasiertheit ist die »letzte Möglichkeit, sich mit Inhalten und Form des Großstadtlebens abzufinden«23 – sie reduziert die Eindrücke, wehrt durch Passivität ab und verhindert affektive Vereinnahmung und wirkliche Teilhabe. Sobald der Mensch seine Reserviertheit aufgibt und Gefühle zeigt, wird es anstrengend. Wenn alle »äußeren Berührungen« zu »inneren Reaktionen« führten, würde der moderne Mensch »innerlich völlig atomisieren und in eine ganz unausdenkbare Verfassung geraten«.24
Simmel ging in seiner Analyse noch von einem »Schutzorgan« aus, das der entfesselten Moderne den Weg in die »Tiefen der Persönlichkeit«25 versperrt und so die Stabilität des bürgerlichen Subjekts in einer Welt voller Reize ermöglicht. Daran vermochte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts niemand mehr so recht zu glauben. Theodor W. Adorno sieht denn auch die letzten Bastionen fallen und spricht von der »totalen Erfassung des Menschen«.26 Das Individuum bleibe keineswegs hinter der technologischen Entwicklung zurück: »Es wächst die organische Zusammensetzung des Menschen an. Das, wodurch die Subjekte in sich selber als Produktionsmittel und nicht als lebende Zwecke bestimmt sind, steigt wie der Anteil der Maschinen gegenüber dem variablen Kapital. Die geläufige Rede von der ›Mechanisierung‹ des Menschen ist trügend, weil sie diesen als ein Statisches denkt, das durch ›Beeinflussung‹ von außen, Anpassung an ihm äußerliche Produktionsbedingungen gewissen Deformationen unterliege. Aber es gibt kein Substrat solcher ›Deformationen‹, kein ontisch Innerliches, auf welches gesellschaftliche Mechanismen von außen bloß einwirkten.«27 Der Mensch wird mehr und mehr zur Maschine, und das Mechanisierte passt sich ein, selbst die Flucht in die Krankheit28 sei dem modernen Menschen versperrt: »Daß das Individuum mit Haut und Haaren liquidiert werde, ist noch zu optimistisch gedacht«29, so Adorno.
Wird aber nicht gerade an der Erschöpfung sichtbar, dass der Prozess der Subsumierung und Vereinnahmung doch auf Grenzen stößt? Ist die Erschöpfung nicht Beweis dafür, dass eine »Selbsterhaltung ganz ohne Selbst« nicht funktioniert?
Der Aufschrei der Erschöpften ist jedenfalls unüberhörbar: Vereinnahmt von Twitter und Facebook, ferngesteuert von Google, verliert das Subjekt seine Balance und gerät aus der Fassung. Frank Schirrmacher spricht von der »Ich-Erschöpfung«30 und einer sich schleichend durchsetzenden Deformation durch die taktgebende Technologie. Sascha Lobo schreibt vom »digital verstärkten Kapitalismus«, der alle ermüdet.31 Thomas Strässle rät angesichts des Zeitgeistphänomens Burn-out und einer steigenden Reizüberflutung zu mehr Gelassenheit und empfiehlt »eine andere Haltung« zur Welt.32 Nach der Diagnose von Hartmut Rosa stehen wir nicht nur »am Rande der Erschöpfung«, sondern sogar am »Rande des Sinnvollen«. Der Soziologe entwickelt angesichts eines totalen »Beschleunigungsregimes« die Vision von »Entschleunigungsoasen«. Er selbst treibt »Entschleunigungspraktiken« wie Morgengymnastik und Abendmeditation.33
Hatte nicht schon Nietzsche am erschöpften Europäer gezweifelt und uns den Chinesen als Vorbild empfohlen? – »Der Kultur-Zärtling ist eine Mißgeburt im Vergleich zum Araber und Korsen; der Chinese ist ein wohlgeratener Typus, nämlich dauerfähiger, als der Europäer.«34
In diesem Buch sollen nicht noch einmal die allseits bekannten Krisenphänomene der »vernetzten Epoche« zitiert werden, es soll vielmehr der Zusammenhang hergestellt werden zwischen der um 1900 einsetzenden Mobilmachung des Menschen und der schon sehr früh diagnostizierten Erschöpfung. Beides gehört zusammen.
In dieser Zeit entstanden die Träume von einem vitalen Menschen, der mit stimulierenden Mitteln seine Kräfte ins Unermessliche steigern kann, der nicht ermüdet, der seine Jugend erhält und gegen Krankheiten immun ist. Dieser Übermensch sollte, wie es Marinetti im »Futuristischen Manifest« erklärte, von den Wurzeln abgetrennt werden, sich mit Eisen vermischen und von Elektrizität nähren: »Bereiten wir«, tönte der Schlachtruf, »die bevorstehende und unvermeidliche Verschmelzung des Menschen mit dem Motor vor.«35 Marinetti gilt seither als Prophet eines neuen Menschen. Erst heute, so meint man, seien seine ästhetischen Visionen in der Realität angekommen. Doch die utopisch anmutende Synthese von Mensch und Maschine, die mechanische Individualität, war schon damals nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt. Was Paul Virilio in den neunziger Jahren als »Eroberung des Körpers« und als Prothesen-Existenz beschrieb, begann um 1900 und erlebte im Ersten Weltkrieg mit der Verkoppelung von Kriegsmaschinen und Soldatenkörpern einen ersten Höhepunkt.
Es geht in diesem Buch um die vielfach verdrängten Pathologien, die uns heute wieder begegnen. Bekanntlich hat Freud die »Wiederholung des Gleichartigen […] als Quelle des unheimlichen Gefühls«36 bezeichnet. Nicht das Fremde erschreckt uns, sondern das Vertraute und Bekannte, das wir im Verborgenen halten wollen und das plötzlich hervortritt: »Das Heimliche wird dann zum Unheimlichen.«37 Die Erschöpfung ist ein solches Schreckbild, sie ist gewissermaßen ein Doppelgänger der Moderne. Ursprünglich – darauf macht Freud in seiner Untersuchung über das »Unheimliche« aufmerksam – sei der Doppelgänger »eine Versicherung gegen den Untergang des Ichs«38 gewesen. Der Mensch habe positive Energien aus dem anderen Ich gezogen, seinen Narzissmus gestärkt. Doch war dies nur in einer Phase der Fall, in der der Mensch noch nicht mit seinem Ich zerfallen war, nach der Überwindung dieser Phase »ändert sich das Vorzeichen des Doppelgängers, aus einer Versicherung des Fortlebens wird er zum unheimlichen Vorboten des Todes«39.
Können wir das nicht auch von der Erschöpfung sagen? War sie nicht zunächst die Bestätigung eines Ichs, das seine Kräfte in einer großen Anstrengung erschöpfte – einer Anstrengung, in der es sich mit der Verausgabung identifizierte? Das »Vorzeichen« von Erschöpfung wandelt sich da, wo menschliche Tätigkeit den Charakter exzessiver Arbeit annimmt. Um noch einmal – nicht das letzte Mal in diesem Buch – Nietzsche zu zitieren: Die Erschöpfung ist immer »dort am größten […], wo am unsinnigsten gearbeitet«40 wird.
Als unheimlich wurde die Erschöpfung um 1900 aber auch empfunden, weil selbst die Repräsentanten der Willenskultur von ihr heimgesucht wurden: Ob Bismarck, der »eiserne Kanzler«, ob Nietzsche, der Apologet der Kraft, ob Cosima Wagner, die asketische Herrin des Hügels, oder Max Weber, der kraftstrotzende Gelehrte und Verteidiger der protestantischen Ethik – sie alle kämpften mit nervösen Symptomen und Erschöpfungszuständen. Hinter der Maske des »faustischen Menschen« (Oswald Spengler) zeigte sich eine vielfach gebrochene, tief verunsicherte Kultur.
In Zeiten der Kraftlosigkeit und Krankheit wächst bekanntlich die Sehnsucht nach Heil und Erlösung, nach Rettern, Seelenführern, Propheten, Trainern und Ernährungsberatern. Auch für sie schlägt um 1900 die große Stunde. Ob sie nun Liebig, Baltzer, Lahmann, Bircher-Benner, Kellogg, Steinach oder Schweninger heißen, sie alle wollten den Menschen umbauen und in ein neues Reich führen. Sie propagierten die Ideen einer umfassenden Lebensreform, die ihr Heil in Ganzheiten suchte und mit Absolutheitsansprüchen auftrat, in denen sich die Faszination des Zeitalters für das Totalitäre spiegelte. Die Lebensreform wollte die Rhythmen und verborgenen Kräfte der menschlichen Natur aufspüren, um sie für eine kulturelle Erneuerung zu nutzen. In einer Epoche, die sich am Ende wähnte, signalisierte sie den Aufbruch.
Der Begriff »Fin de Siècle« brachte ein prekäres Zeitgefühl zum Ausdruck, das vor allem die gebildeten Schichten beherrschte und hier wiederum insbesondere die literarisch-künstlerischen Kreise. Man fühlte sich angekränkelt von der Zeit, von Willensschwäche, von Dekadenz- und Niedergangsdiagnostik und sehnte sich nach Erfrischung und neuer Kraft. Erschöpfung wurde zur ästhetischen Empfindung, über die man sich definierte und von der man sich zugleich abzustoßen versuchte. Anders als man es vielleicht heute vermutet, nahmen die Literaten und Künstler nicht in erster Linie eine geistige, sondern eine körperliche Erschöpfung an sich wahr. Auch den vermeintlichen Niedergang der Kultur sah man als einen physischen Verfall und blickte nicht zuletzt mit Sorge auf die eigene körperliche Fitness.
Für die Ästheten um 1900 stand nicht die Seele, sondern der Körper im Mittelpunkt, der schöne, trainierte und vor allem gesunde Körper. Thomas Mann sprach 1909 in seinen Notizen zu »Geist und Kunst« von der »Gesundheits- und Durchsonnungstendenz«,41 die sich in der gesamten Literatur zeigen würde. Soeben hatte er Gerhart Hauptmanns Reisetagebuch »Griechischer Frühling« gelesen, das ein Griechentum beschwört, das im Ursprünglichen und Naturhaften wurzelt. Hier waren noch die alten Götter lebendig, hier war unverfälschte Tiefe und Reinheit, Kraft und Schönheit zu finden. Von dem mystifizierenden Blick auf das Hellenentum irritiert, notierte Thomas Mann: »Jemand sollte zählen, wie oft im Griechischen Frühling ›gesund‹ vorkommt.«42
So treffend die sarkastische Bemerkung war, so sehr war Thomas Mann doch auch selbst ein Anhänger der von ihm persiflierten »Gesundheits- und Durchsonnungstendenz«. Um sich körperlich fit zu halten, ging er in das Sanatorium Lebendige Kraft von Max Bircher-Benner, stärkte sich mit Rohkost und Bewegungstherapien, er fuhr nach Dresden in das berühmte Lahmann’sche Sanatorium und in die Kuranstalt von Christoph von Hartungen in Riva am Gardasee. Er war kein Einzelfall. Die Sorge um die Gesundheit und die Angst vor der Erschöpfung hatte die Literaten fest im Griff: Heinrich Mann, Rilke, Kafka, Hesse, Meyrink – sie alle wollten sich durch Askese befreien. Sie sollen hier als Seismographen herangezogen werden, deren Aufzeichnungen einen Empfindungskomplex sichtbar werden lassen, der normalerweise sprachlos macht. Welche Rolle Körper und Gesundheit für den Dichter spielen, hat Gottfried Benn klargestellt, der bekanntlich in diesen Dingen Fachmann war. Und er hat dazu Goethe zitiert, der von seiner italienischen Reise schreibt: »Ich lebe sehr diät und halte mich ruhig, damit die Gegenstände keine erhöhte Seele finden, sondern die Seele erhöhn.« – »Welche«, so Benn, »eigentümliche Nähe von Ernährung und Erlebnis! […] Aus all dem klingt doch wohl mehr als ein Ahnen, daß der Körper der letzte Zwang und die Tiefe der Notwendigkeit ist, der Monolog der Schöpfung und, wenn er in bestimmter Weise entartet, manchmal die Prämisse des Genies.«43
Dieses Buch will keine Wege aus der Erschöpfung aufzeigen, sondern in thematisch abgegrenzten Diskursen den Weg einer Kultur der Erschöpfung nachzeichnen. Dies scheint auch deshalb geboten, weil die heutigen Analysen der Komplexität des Themas häufig nicht gerecht werden. So ist etwa die Behauptung nicht zu halten, es hätte sich früher in erster Linie um eine körperliche Erschöpfung gehandelt, bei welcher der »Motor Mensch« (Anson Rabinbach) im Mittelpunkt gestanden hätte, während der Mensch im Zeitalter der digitalen Revolution mit einer geistigen, einer »Ich-Erschöpfung« konfrontiert sei, die das Gehirn angreife.44 Erschöpfung – das zeigen die folgenden Fallstudien – hat immer mit den »nervösen Apparaten« (Karl Jaspers) zu tun. So hat der große italienische Ermüdungsforscher Angelo Mosso in zahlreichen Untersuchungen die Erschöpfung auf die Nerven und das Zentralorgan des Menschen bezogen. Er kam bereits um 1900 zu dem Schluss, dass, verkürzt gesagt, Erschöpfung und Arbeit nicht im direkten Zusammenhang stehen: Bevor die muskuläre Ermattung spürbar ist, ermüdet das Gehirn. Im Fin de Siècle zeigte sich die Erschöpfung als ein geistiges, ein nervöses Phänomen, das macht diese Epoche als Reflexionsfolie für unsere Gegenwart so interessant, denn – wer wird es leugnen – Erschöpfung in der digitalen Welt spielt sich vor allem im Kopf ab und hat mit der repetitiven Arbeit, der Alternativlosigkeit des Lebens, dem Ende der Utopien und der Theoriemüdigkeit zu tun.
In einer Situation, in der die Rede vom Burn-out zum Jargon geworden ist, der »signalhaft«45 auf unspezifische Empfindungen hindeutet und in der der Begriff in immer neuen Varianten erscheint, ist es Zeit, sich wieder den Inhalten zuzuwenden.
Am Limit
»Arbeiten muß ich lernen«
Man muß arbeiten, wenn nicht aus Geschmack, so mindestens aus Verzweiflung, da, Alles wohl erwogen, arbeiten weniger langweilig ist als sich amüsiren.
Friedrich Nietzsche, Nachgelassene Fragmente, 1887–1889
»Fehlt mir die Kraft? Ist mein Wille krank? Ist es der Traum in mir, der alles Handeln hemmt? Tage gehen hin und manchmal höre ich das Leben gehen. Und noch ist nichts geschehn, noch ist nichts Wirkliches um mich«,1 schreibt Rilke an Lou Andreas-Salomé im August 1903. Der junge Dichter übermittelt der Freundin in dieser Zeit ausführliche Bulletins über sein gesundheitliches Befinden. Nicht von Krankheiten berichtet er, sondern von schwer einzuordnenden Befindlichkeiten: »Ich habe immerfort so viel Schmerzen und lebe in lauter Ungemach. Was mir wehe thut hat vielleicht dieselbe Ursache wie die Angst. Hinter beidem sind wohl Unregelmäßigkeiten im Blutumlauf, die entweder ungewöhnliche Geisteszustände erzeugen oder die und jene Stelle des Körpers schmerzhaft betonen. Jetzt quälte es wieder im Kopfe, war tagelang heftigster Zahnschmerz, wurde Augenweh und setzte schließlich als Rachenkatarrh mit trübem Fiebergefühl […] ein.«2 Um sich zu kräftigen, rückt Rilke den Symptomen mit einer ganzen Reihe von therapeutischen Maßnahmen zu Leibe: Luftbäder stehen auf dem Programm, barfuß gehen im kühlen Gras, Dampfbäder – er kauft sich zu diesem Zweck einen Apparat, der sogar auf Reisen mitgeht (das Ehepaar Rilke transportiert das Gerät bis nach Rom) –, und natürlich ernährt er sich vegetarisch, er versagt sich den Genuss von Alkohol, trinkt duftende Tees und allenfalls einmal einen selbstbereiteten Kaffee. Doch der nervöse Leib lässt sich nicht beruhigen.
Rettung verspricht in dieser ausweglosen Situation nur die ruhige, tägliche Arbeit, die etwas »Sicherheit und Halt«3 gewährt. Sie ist das Mittel einer Selbsterziehung, die ihn »wirklichwerden« lässt, ein »Wirklicher unter Wirklichem«.4
Sobald Rilke jedoch zu arbeiten beginnt, fühlt er sich energielos, müde und voller »Bangigkeit«5. Bereits 1902, als er Rodin trifft und sich ihm wenig später als Privatsekretär andient, will er nur eins: von ihm arbeiten lernen.6 Er möchte sich dem Meister anschließen, um seine verbrauchten Energien aufzuladen und seine Mattigkeit zu überwinden. In Rodin sieht er – fälschlicherweise – den Menschen, der rastlos tätig und deshalb »tief« geworden ist.7 Tatsächlich war Rodins künstlerische Produktivität weniger auf Arbeit als vielmehr auf Arbeitsteilung und geschicktes Management gegründet8 – Realitäten, die Rilke geflissentlich übersah, um das Bild des einsamen, stets schöpferischen Künstlers zeichnen zu können. Diesem Vorbild wollte er mit mönchischen Tugenden nacheifern. Rilke vertraute sich eines Tages dem Meister an, gestand seine »bangen Abgründe« und Idiosynkrasien – und erntete offenbar nur Unverständnis. Zur Ermunterung bekam er die Maxime mit auf dem Weg: »Man muß immer arbeiten – immer.«9 Lou Andreas-Salomé schreibt er daraufhin: »Und dann habe ich still und strenge versucht, immer in Arbeit zu sein, und meine Bestürzung ist groß, wenn ich fühle, daß es mir nicht gelungen ist.«10 Rilke schiebt es auf Paris, die »große Stadt«, die »wider« ihn ist, ihn zerstreut, aus dem Rhythmus bringt und krank macht: »drei Influenza-Anfälle mit endlosen Fiebernächten und großer Bangigkeit; und meine Kraft und mein Muth war klein geworden, und ich fuhr mit dem letzten Rest fort«.11
Für Rilke ist die Arbeit »sakral konnotiert«,12 er leitet aus ihr seine Mission als Künstler ab. Will man dieser Rettungsphantasie gerecht werden, muss man sie vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund betrachten. Das 19. Jahrhundert hatte den Leistungskörper entdeckt. Die Muskeln, ihre Energie und Kraft, waren das bevorzugte Erkenntnisinteresse der Humanwissenschaften. Was Ende des 18. Jahrhunderts als Projekt der Aufklärung begonnen hatte, entwickelte sich im 19. Jahrhundert über die psycho-physischen Forschungen von Ernst Heinrich Weber und Gustav Theodor Fechner zur modernen Arbeitswissenschaft. Das tätige, an sich arbeitende Individuum galt nun als Ideal. Der Leipziger Arzt Daniel Gottlob Moritz Schreber – Vater des durch Freuds Studie über die »Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken« berühmt gewordenen Senatspräsidenten Daniel Paul Schreber – schreibt in seiner »Aerztlichen Zimmer-Gymnastik« von 1855: Der Mensch »ist bestimmt zur Thätigkeit […], zum vollen Gebrauche seiner geistigen und körperlichen Kräfte. Sein ganzes Wesen ist darauf berechnet. Der geistig Träge und der körperlich Faule schmachten vergeblich nach dem Vollgenusse geistiger und leiblicher Freude. Die süsse Würze des Lebens ist nur ein Lohn des Thätigseins. Der Mangel desselben erzeugt Stumpfheit der Organe, Störung ihrer Verrichtungen, Krankheit, vorzeitigen Tod.«13 Der Mensch hat sein Schicksal selbst in der Hand, lässt er in seinen Anstrengungen nach, ist Verfall und Degeneration die Folge. »Wie alle Kräfte«, so Schreber, »durch angemessenen Gebrauch sich steigern und auf einem gewissen Höhepunkt erhalten, so verkümmern und verschwinden sie im entgegengesetzten Falle bei Mangel der Uebung vor der Zeit gänzlich.«14 Carl Wilhelm Ideler, Psychiater an der Berliner Charité, stellt in seiner 1846 erschienenen »Allgemeinen Diätetik für Gebildete« den Grundsatz auf, dass »nur das andauernd gespannte Leben« sich zu einer »vielfachen Summe seiner Energie«15 steigert. Er empfiehlt dem geistig Arbeitenden, »sich täglich eine etwas größere Aufgabe« vorzunehmen, um so »zuletzt das Maximum von Denkkraft« zu erreichen.16 Zu vermeiden sind »Absätze, Sprünge im Denken«, welche die »Schwungkraft« rauben und die Energie zersplittern. Sollen die individuellen Anlagen entwickelt werden, sind »etwa 8–10 Stunden« ununterbrochene Arbeit notwendig, dabei soll die »vollkräftige Tageszeit von den frühen Vormittagsstunden bis tief in den Nachmittag« hinein genutzt werden. Diese »diätetische Grundregel« verlangt, dass die Hauptmahlzeit erst am späten Nachmittag eingenommen wird, da ansonsten »der Genuß desselben um die Mittagszeit eine schädliche Unterbrechung zuwege bringt«.17 Für John Brown, der mit seinem »System der Heilkunde« großen Zuspruch beim gelehrten Publikum fand, hängt alles Leben an Reiz und Erregbarkeit. Reize ermuntern uns zur Tätigkeit.18 Ein Mangel an Erregbarkeit lässt den Menschen altern, stumpft die Lebenssinne ab, macht ihn gebrechlich und entzieht dem Körper Energie.
Das 19. Jahrhundert propagierte die Vita activa. Mehr und mehr rückte dabei ein neuer Aspekt in den Vordergrund: die Berufsarbeit. Zum Ende des Jahrhunderts setzte eine regelrechte Heiligung der Arbeit ein, der Begriff wurde universalisiert und zum Humanum schlechthin erhoben. Ferdinand Lassalle feierte ihn als übergreifendes »Prinzip des Zeitalters«, die »Idee der Arbeit« solle zur Herrschaft kommen und zum gemeinsamen Band der Gesellschaft werden: »Arbeiter sind wir alle, insofern wir nur eben den Willen haben, uns in irgend einer Weise der menschlichen Gesellschaft nützlich zu machen.«19 Es ging um eine »neue Haltung«, ein neues »Gepräge« der menschlichen Existenz. Lassalle spricht von Würde, Sittlichkeit, Selbstbewusstsein und Stärke. Alle Welt redete nun einer Selbstbegründung durch Arbeit das Wort, selbst der Kaiser stimmte in das Lob ein, und natürlich stand der deutsche Mensch in besonderer Weise diesem Ideal nah.
Jeder wollte und musste sich jetzt durch Berufsarbeit definieren. Auch Künstler und Literaten gerieten unter Zugzwang, sie wollten wie Rilke »Arbeiter werden« und blickten fasziniert auf die Möglichkeit eines regelmäßigen Pensums. Rilke erkannte darin ein mönchisches Ritual, von dem er sich körperliche und geistige Kraft, vor allem aber Halt versprach. An van Gogh bewunderte er die Fähigkeit des »Immer-Arbeiten-Könnens«, die diesen vor dem Wahnsinn bewahrt habe. »Van Gogh konnte vielleicht die Fassung verlieren, aber die Arbeit war noch hinter der Fassung, aus ihr konnte er nicht mehr herausfallen.«20
Die Hoffnung, auf diese Weise die unsichere geistige Existenz zu stabilisieren und das eigene Ich zu stärken, teilten viele Intellektuelle Anfang des 20. Jahrhunderts. Ludwig Wittgenstein, der im August 1914 als Freiwilliger in den Krieg zog, eröffnet sein »Geheimes Tagebuch« mit der bangen Frage: »Werde ich jetzt arbeiten können??«21 Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte an der Auffassung der Arbeit als Heilsversprechen wenig geändert. Nahezu täglich hält Wittgenstein fest, ob und wann er zum Schreiben und Lesen gekommen ist. Wie Rilke folgt auch er einem zugleich asketischen und heiligen Programm, das gegen die eigene Triebnatur ankämpft und sich zum besseren Menschen machen kann: »Arbeite nur fort, damit du gut wirst«,22 lautet eine Notiz. Wittgenstein berichtet auch von der Ohnmacht des »Fleisches«,23 der Schwäche und Untätigkeit. Natürlich spielt der Krieg in diesem Fall eine besondere Rolle, seiner fragmentierenden Wirkung sollte etwas entgegengesetzt werden. Zeitlebens blieb Wittgenstein diesem Arbeitsethos verpflichtet. Zahlreiche Anekdoten bezeugen seine Anstrengung, ein möglichst einfaches Leben zu führen. Immer suchte der exzentrische Philosoph nach Orten, die abseits lagen und ein eremitisches Dasein ermöglichten. Unter äußert kargen Bedingungen lebte er in Norwegen, in einem kleinen Ort nördlich von Bergen, ebenso frugal und einsam wohnte er später in dem Dorf Trattenbach im niederösterreichischen Otterthal, danach in Hütteldorf, nahe Wien.24
Das war bei Rilke nicht anders, auch er liebte die Einsamkeit und flüchtete in ferne Domizile, freilich bevorzugte er ein etwas exquisiteres Ambiente. So entstanden die »Duineser Elegien« auf Schloss Duino an der Adria, wo er als Gast der Fürstin Marie von Thurn und Taxis residierte; zuletzt lebte er in dem Schlösschen Muzot im Kanton Wallis, das der Mäzen Werner Reinhart für ihn erwarb.
Die Reize des Lebens – das gilt für Rilke wie für Wittgenstein – stellten eine Gefährdung des eigenen Arbeitsethos dar, sie mussten abgewehrt oder doch zumindest reduziert werden. Doch beide hatten damit ihre Schwierigkeiten, wobei Wittgenstein rigoroser und – insgesamt – auch erfolgreicher im Kampf gegen die widerständige Natur war.
Rilke bekundete in vielen Briefen seine Absicht, endlich Kontinuität in sein Leben zu bringen, und entwarf in Stunden der Einkehr Arbeitsprojekte. An Lou Andreas-Salomé schickte er eine lange Liste mit »Lernabsichten«25: Naturwissenschaftliche Vorlesungen wollte er hören, das Wörterbuch der Gebrüder Grimm lesen, aus dem Russischen und Französischen übersetzen, Dänisch lernen usw. – ein Selbsterziehungsprogramm, dessen einzelne Punkte stets mit dem Refrain »Ich will …« beginnen.
Allen guten Vorsätzen zum Trotz stellte sich stets ein, was Rilke sein »Erschöpftsein, Vertrocknetsein« nennt – »eine Unfähigkeit, die […] vom körperlichen ausging«, verringerte ihn zu einem »Mindestmaaße von Dasein«.26 Die Rede ist von Apathie und Ermattung: »Ich könnte über vieles klagen und klage vor allem über diese unbegreifliche Müdigkeit; der Schlaf ist immer das nächste, und er nimmt mich, wie ein ihm Gehöriges, mitten am Tage. Und alles was quälte, quält weiter […].«27 Zuweilen glaubte er, den Grund für die rasche Ermüdbarkeit und die Schmerzempfindungen, die er zusammenfassend als »Symptome«28 seines Lebens bezeichnet, endlich gefunden zu haben: »Heute morgen ist mir in einer großen Helligkeit dieses klar geworden: ich lebe seit Jahren mit schlechtem Gewissen und mit seichter Kraft […]. Soll mein Leben besser werden, so muß ich vor Allem an diese beiden Dinge denken: Kraft und Gewissen.«29
Es war ein Circulus vitiosus, den Rilke in immer neuen Anläufen zu durchbrechen versuchte. Im Frühjahr 1901 begab sich der frisch Verheiratete mit seiner Frau in das Sanatorium von Heinrich Lahmann. In der damals berühmten Naturheilanstalt im Kurort Weißer Hirsch bei Dresden ließ er seinen Körper vitalisieren. Der behandelnde Arzt stellte sogleich fest, dass der Patient organisch »vollkommen« gesund, aber körperlich »stark geschwächt und angegriffen und von geringer Widerstandskraft«30 sei. Eine »ernste Kur« sei nötig. Die Therapie begann noch vor 7 Uhr morgens mit kalten und warmen Wechselgüssen auf den Rücken. »Dann Frühstück (Obst, Cacao (Dr. Lahmanns Nährsalz Cacao) Butter Brot, dann Leib, Unterleibs Rücken und Kreuzmassage und Gymnastik, um 10 Uhr eine Orange und zwei Schnitten Dr. Lahmanns Schrotbrot mit Butter, hernach entweder ein leichtes Vollbad 31° oder ein Sonnenbad oder ein heißes Fuß oder Handbad von 7 Minuten Dauer, vor Tisch 10 Minuten Luftbad, dann Essen: vorzügliche milde Kost, meist Gemüse […]. Hernach liege ich 2 Stunden, in Decken eingepackt im Freien, in der Sonne in einem Liegestuhl […]. Dann kriege ich Kakao mit Nährsalzbiscuits […]. Nach 8 geht man meist zu Bett und schläft natürlich bei offenem Fenster.«31 Zur Kräftigung der Muskulatur standen Holzsägen und Waldlauf auf dem Programm. Rilke trug nun auch die von Heinrich Lahmann entwickelte Unterwäsche aus Baumwolle – biologisch produziert, ohne künstliche Farbstoffe. Und natürlich durfte auch die Tochter nichts anderes tragen. An seine Mutter schreibt Rilke: »Leinenwäsche ist für unser kleines Kind nicht verwendbar: die ganze Ausstattung ist aus Lahmannzeug und es soll sich gleich von vornherein daran gewöhnen, nichts anderes zu tragen.«32 In zahlreichen Briefen aus Dresden lobte er die kräftigende Wirkung der Kur, er fühle sich ruhiger und widerstandsfähiger. Doch bereits Ende Mai 1901, als er sich in Prag aufhielt, gestand er der Mutter, die Stadt gehe ihm »auf die Nerven«33. Die alten Symptome waren wieder da, er fühlte sich unruhig und ermattet.
Abb. 1: Dr. Lahmanns Sanatorium, Ansicht der 1888 eröffneten Naturheilanstalt in Dresden, Weißer Hirsch
Müdigkeit und Erschöpfung waren Anfang des 20. Jahrhunderts weit verbreitet und gerade auch unter Literaten ein Thema. Viele fühlten sich von der Zeit angekränkelt, von der Dekadenz und dem »süßen Gift« der Zivilisation. Thomas Mann nahm an sich eine allgemeine »Ermüdung« und »reduzierte Vitalität«34 wahr. 1901 kurte er zusammen mit seinem Bruder Heinrich in Mitterbach bei Christoph von Hartungen, später suchte er das von dem Arzt geleitete mondäne Sanatorium in Riva am Gardasee auf. Auch in der Heilanstalt Lahmann war er Gast. Gleichwohl nahmen seine neurasthenischen Beschwerden und seine Mattigkeit weiter zu. Im Sommer 1909 unterwarf er sich einer ungleich strengeren Kur im Züricher Sanatorium Bircher-Benner. Hier durfte er nur Rohkost essen, musste täglich einige Stunden im Garten arbeiten und Luftbäder nehmen, zur Vitalisierung wurde er mit Kalt- und Warmwasseranwendungen behandelt. Er sah sich als »Gras fressender Nebukadnezar« und sprach von einem »hygienischem Zuchthaus«35, fühlte sich aber nach der Vitalisierungskur gekräftigt und voller Energien.
Sein Kollege Franz Kafka klagte in seinem Tagebuch: »So wenig Körperkraft! Sogar diese paar Worte sind unter der Beeinflussung der Schwäche geschrieben.«36 Von »Verfall« und der »körperlichen Unmöglichkeit zu schreiben«37 ist immer wieder die Rede. In zahlreichen Notaten berichtet er von »Müdigkeit« und »Mattigkeit«38, gleichwohl ist an Ruhe nicht zu denken: »Nur Träume kein Schlaf.«39 Zur körperlichen Ertüchtigung begab sich Kafka in die von Adolf Just geleitete Naturheilanstalt Jungborn, auch bei Christoph von Hartungen in Riva am Gardasee unterzog er sich einer Kur.
Die Sorge um die eigene Fitness ging in den kultivierten Schichten um. Man konstatierte angesichts beschleunigter Lebensverhältnisse und zunehmender Reize ein wachsendes Gefühl der Ermüdung und Energielosigkeit. Doch nicht allein die feinsinnigen Literaten klagten um 1900 über Schwäche und Kraftlosigkeit. Der Nervenarzt Paul Julius Möbius beobachtete schon 1894, dass mehr und mehr »normale«, auf den ersten Blick völlig gesunde Menschen seine Praxis aufsuchten: Kellner, Dienstboten, Pferdebahnschaffner.40 Sie fühlten sich überfordert und seien oft zu kontinuierlicher Tätigkeit nicht mehr in der Lage, weil ihre Lebensführung in Unordnung geraten sei.41 Der Arzt müsse »wie ein guter Verwalter«42 in das Leben dieser Patienten eingreifen und sie zur »Thätigkeit« anleiten43. Für den an Schwäche und Müdigkeit leidenden Menschen sei »die rechte Arbeit das Hauptheilmittel«.44
Was Möbius in seinem Aufsatz zu Krankheitsbild und Therapie schreibt, erinnert an die Problematik von Rilke, Wittgenstein, Thomas Mann und Kafka. Ermüdung und Erschöpfung wurden als Symptome der Neurasthenie zugeordnet, die zur Modekrankheit avancierte. Im Fin de Siècle war das Krankheitsbild jedoch so unscharf geworden, dass man alles und jedes darunter verstand. Gleichzeitig hatte sich aber der Befund eher verschärft. Er ließ sich nicht länger auf bestimmte Individuen und Schichten begrenzen, sondern weitete sich zur Pathologie der modernen Kultur aus.45
Emil Kraepelin sprach von einer »grossen Ermüdbarkeit«,46 die sich in allen Bereichen des kulturellen Lebens zeige, es sei »die Krankheit unserer Zeit«47. So einig man sich in der allgemeinen Diagnose war, so vielfältig waren die Ansichten über die Ursachen. Die »Krankheitskeime« wurden nicht mehr nur in der beschleunigten Moderne verortet, man bohrte tiefer und glaubte an eine »Vergiftung« der biologischen Wurzeln. Die Begriffe »Degeneration« und »Entartung« nahmen im medizinischen Diskurs einen immer größeren Stellenwert ein.48
Gleichwohl blieb das Phänomen der nervösen Ermüdung komplex und rätselhaft. Überlastung und, wie man heute sagen würde, Stress entkräften den Menschen und setzen seine Leistungsfähigkeit herab. Bei der nervösen Müdigkeit allerdings spielen diese Faktoren keine große Rolle. Sie ist immer da und kann auch durch Schlaf nicht beseitigt werden, die Menschen kommen nicht zur Ruhe, sie fühlen sich überreizt und kraftlos. Viele glaubten damals wie Rilke an eine Krankheit des Willens, die durch asketische Übungen geheilt werden könne. Das Fin de Siècle sah sich zwischen zwei Polen: Schwäche und Reizbarkeit.
Eine rätselhafte Schwäche
Seit den Arbeiten von G. Beard ist eine neue Krankheit aus Amerika importiert worden, die sich epidemieartig verbreitet zu haben scheint. Der Name Neurasthenie ist in Aller Munde, sie ist die Modekrankheit geworden.
Paul Dubois, Die Psychoneurosen und ihre psychische Behandlung, 1905
Die Zeitschrift »Science« berichtete vor einiger Zeit, Forscher hätten den Auslöser für das Syndrom der chronischen Erschöpfung gefunden. Bei einem großen Teil der Patienten, die am Chronic fatigue syndrome (CFS) litten, sei ein bestimmter Virus nachweisbar, das Xenotropic murine leukemia virus-related virus (XMRV).1 Der Erreger blockiere das Immunsystem und führe auf bisher ungeklärte Weise den Erschöpfungszustand herbei. Diese rätselhafte Schwäche, die weder durch Überanstrengung hervorgerufen noch durch Ruhe und Erholung behoben werden könne, sei auf eine Vergiftung des Körpers zurückzuführen, auf einen Erreger, der die Menschen leistungsunfähig mache.
Wie immer bei Krankheiten, die vermehrt oder massenhaft auftreten, taucht irgendwann die These von der viralen Infektion auf. Es ist der Versuch, für etwas, das sich der rationalen Erklärung entzieht, Gründe zu finden. Auch bei Krebserkrankungen vermutete man in der Vergangenheit immer mal wieder einen viralen Zusammenhang. In jüngster Zeit gibt es die These, dass Alzheimer durch eine virale Infektion entsteht, die entweder im Körper selbst angelegt ist oder sogar durch äußere Ansteckung übertragen werden kann. Im Fall des Erschöpfungssyndroms wurden schon wenig später die Ergebnisse der Untersuchung in Zweifel gezogen, denn bei zahlreichen Patienten konnte der Erreger nicht nachgewiesen werden.
Die Ätiologie der chronischen Erschöpfung bleibt so rätselhaft wie ihr epidemisches Auftreten. Das Syndrom entzieht sich der Erklärung und ist im Moment auch nicht heilbar. Aus medizinischer Sicht ist das alles höchst unbefriedigend. Ganz anders sieht es aus, wenn man sich dem Phänomen aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive nähert, denn dann steht nicht so sehr die Krankheit als solche im Mittelpunkt, sondern ihr Bild, also alles, was sich mit ihr an Deutungen und Phantasien, an Ängsten, Zwängen und Dämonisierungen verbindet.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!