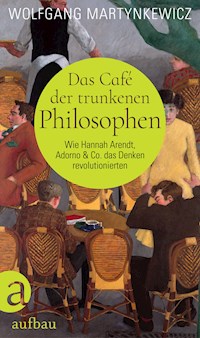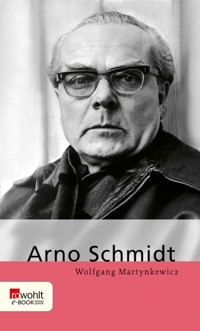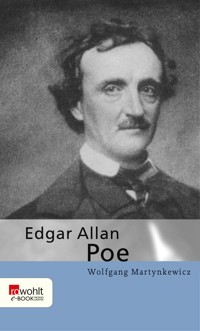18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im Februar 1917 besuchte der junge Militärarzt und Dichter Gottfried Benn die Familie Sternheim in La Hulpe bei Brüssel. »Stark. Bedeutend. Aber schrecklich zugleich«, schreibt Thea Sternheim in ihr Tagebuch. Diese Mischung aus Bewunderung und Abscheu ist typisch für die Art und Weise, wie Frauen Gottfried Benn sahen. Benn stellte infrage, was der bürgerlichen Welt heilig war: das ästhetische Empfinden, den guten Geschmack und die Moral. Aus der Begegnung mit Thea Sternheim und ihrer Tochter Mopsa entwickelt sich eine Ménage-à-trois, die bis in die fünfziger Jahre anhalten wird. Else Lasker-Schüler, Tilly Wedekind, und eben Mopsa und Thea Sternheim – Gottfried Benns amouröse Abenteuer sind legendär, obschon er auf den ersten Blick wenig anziehend wirkte. Wolfgang Martynkewicz schildert Benn als Dichter und Liebenden in einer Zeit, in der die festen Bezugspunkte schwankten. Eine meisterhaft erzählte Lebens- und Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der heraufziehenden Konflikte des 20. Jahrhunderts. »Rasender Mensch ist er und sehr stark.« Else Lasker-Schüler.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Wolfgang Martynkewicz
Wolfgang Martynkewicz ist freier Autor und Dozent für Literaturwissenschaft an den Universitäten Bamberg und Bayreuth; zahlreiche Veröffentlichungen zur Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts und zur Geschichte der Psychoanalyse; u.a. über Jane Austen, Edgar Allan Poe, Arno Schmidt, Sabina Spielrein, C. G. Jung und Georg Groddeck. 2009 gelang ihm mit »Salon Deutschland. Kunst und Macht 1900–1945« ein Erfolg bei Presse und Publikum.
Informationen zum Buch
»Rasender Mensch ist er und sehr stark.« Else Lasker-Schüler
Else Lasker-Schüler, Tilly Wedekind, Mopsa und Thea Sternheim – Gottfried Benns amouröse Abenteuer sind legendär, obschon er auf den ersten Blick wenig anziehend wirkte. Wolfgang Martynkewicz schildert Benn als Dichter und Liebenden in einer Zeit, in der die festen Bezugspunkte schwankten. Eine meisterhaft erzählte Lebens- und Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der heraufziehenden Konflikte des 20. Jahrhunderts.
Im Februar 1917 besuchte der junge Militärarzt und Dichter Gottfried Benn die Familie Sternheim in La Hulpe bei Brüssel. »Stark. Bedeutend. Aber schrecklich zugleich«, schreibt Thea Sternheim in ihr Tagebuch. Diese Mischung aus Bewunderung und Abscheu ist typisch für die Art und Weise, wie Frauen Gottfried Benn sahen. Benn stellte infrage, was der bürgerlichen Welt heilig war: das ästhetische Empfinden, den guten Geschmack und die Moral. Aus der Begegnung mit Thea Sternheim und ihrer Tochter Mopsa entwickelt sich eine Ménage-à-trois, die bis in die fünfziger Jahre anhalten wird.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Wolfgang Martynkewicz
Tanz auf dem Pulverfass
Gottfried Benn, die Frauen und die Macht
Inhaltsübersicht
Über Wolfgang Martynkewicz
Informationen zum Buch
Newsletter
Einleitung
Spielen ist alles
Eine Frau!
Der Bürgerschreck
Flucht aus dem falschen Leben
Mythos Brüssel
Das Leben »geschah« ihm
»O! schon bin ich wieder melankolisch!!!!!!!«
Ein einsamer Wolf
»… entgleist zwischen allen Extremen«
Tage der Verwirrung
Die große Gereiztheit
Der Denker auf der Bühne
Berlin – Paris
Des Mannes dunkle Wege
Die glücklichste Zeit meines Lebens
Ich habe sie kommen sehen
Hoppla, wir leben! – leben wir?
Anhang
Verzeichnis der Siglen und Abkürzungen
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Dank
Personenregister
Bildnachweis
Impressum
Einleitung
Der Mann, der die Frauen liebte
Er liebt sie alle: blonde oder brünette, junge oder ältere, schlanke oder vollschlanke Frauen – und sie alle lieben ihn. Er ist fasziniert von den Frauen, ein Sammler und Jäger, der nach dem Geheimnis des Weiblichen sucht. Nie findet er Ruhe, rastlos hält er Ausschau nach der Neuen, der Einen und Einzigen, die das Glück verspricht, das er dann aber doch nicht findet.
In »Der Mann, der die Frauen liebte« hat François Truffaut diesem Typus ein Gesicht gegeben. Bertrand Morane, der Held der Geschichte, ist kein Draufgänger, kein Schürzenjäger im eigentlichen Sinn. Äußerlich wirkt er alles andere als attraktiv – kein schöner Mann, kein Mann, der mit seiner körperlichen Präsenz ins Auge fallen würde, eher ein spröder, in sich gekehrter Typus, der aber gleichwohl über eine besondere Ausstrahlung verfügt. Truffaut hat die Rolle mit dem aus Polen stammenden Schauspieler Charles Denner besetzt. Mit seinen düsteren Augen und seinem traurigen Gesicht, auf dem sich kaum einmal ein Lächeln zeigt, wirkt er einsam, verloren, melancholisch. Er ist jedoch alles andere als passiv. Sobald ihn eine Frau interessiert, weiß Morane, was er will und verfolgt beharrlich und mit großer Energie sein Ziel. Er riskiert alles, sogar sein Leben. Angezogen von den schönen Beinen einer Frau überquert er am Ende des Films die Straße und wird von einem Auto erfasst.
»Der Mann, der die Frauen liebte« – das war auch Gottfried Benn. Seine amourösen Abenteuer sind legendär und in vielen Briefbänden nachzulesen. Glaubt man den zahlreichen Verehrerinnen, dann war er von anziehender Melancholie – ein Mann, der nicht nur die Frauen liebte, sondern von den Frauen geliebt wurde, obgleich auch er nicht gerade unwiderstehlich wirkte: »mittelgroß, untersetzt, mit einem interessanten Kopf. Er hatte einen Schmiß über die linke Backe, Erinnerungen an seine Studentenzeit. Er hatte überhaupt etwas vom Korpsstudenten, so komisch das klingt«1. So erinnert sich die Schauspielerin Tilly Wedekind an ihre erste Begegnung mit Benn im Frühjahr 1930. Mitte April stand er mit einem Strauß Veilchen vor ihrer Tür. Kurz darauf besuchte sie ihn in seiner Wohnung, in der Berliner Belle-Alliance-Straße, in der er auch seine Praxis hatte: »Er hatte einen seltsamen Blick. So weit weg, so tief, so traurig. […] Er führte mich durch sein Ordinationszimmer und fragte, ob er seinen weißen Kittel anziehen dürfe, er sei das zu Hause gewohnt und fühle sich am wohlsten darin. Ich dachte mir, so, nun wird er mich schlachten. Er war mir immer ein bißchen unheimlich mit seinem abseitigen Blick.«2 Else Lasker-Schüler, die sich 1913 leidenschaftlich in den jungen Dichter verliebte, sie war 43, er 27 Jahre alt, spricht von »Augen, die von fern kommen«3. Dazu passten die dunklen, tragischen Verse: »Grauenvolle Kunstwunder, Todesträumerei«4, schwärmte sie.
Schwere, Einsamkeit und Trauer sind die immer wiederkehrenden Umschreibungen, wenn es um Benns Ausstrahlung auf Frauen geht. Von einer »tiefe[n] Melancholie« spricht 1933 auch die Journalistin Käthe von Porada, »aber beherrscht, in sich abgeschlossen, ohne das geringste Leck, jede ›Ansteckung‹ eines anderen vermeidend: die Meisterschaft eines Siegenden, nicht die hilflose Ausstrahlung einer geopferten Selbstzersetzung«.5
Benn kannte seine Wirkung auf Frauen, er wusste um den Reiz der Melancholie, die ihm konstitutionell anhaftete, mit der er aber auch spielte und hinter der er sich verschanzte, wenn die Frauen ihm zu nahekamen. In einem Brief an Tilly Wedekind spricht er von seinen »Abnormitäten«, seinem »Einsamkeitsdrang«6, der in ihm stecke und der sich, beim besten Willen, nicht negieren lasse. »Ich kann aus meinem Leben nicht heraus u. will es auch gar nicht. […] Ich schreibe das wirklich aus Freundschaft an Sie u. sage Ihnen, daß ich Sie reizend u. charmant u. süß u. begehrenswert finde, aber um mich steht eine Mauer aus Kühle u. Abgeschlossenheit, über die niemand hinüberkann.«7
Bertrand Morane, um noch einmal auf Truffauts Held zurückzukommen, verkörpert auch »Kühle u. Abgeschlossenheit«. Die Beziehungen, die er eingeht, sind körperlicher Natur. Gefühle sind ihm hinderlich, sie führen zum Rückzug, zum Abbruch der Beziehung. Morane will sich die Liebe der Frauen nur gefallen lassen, wenn sie sein Ich, seinen Lebensentwurf nicht antasten. Auch Benn nähert sich den Frauen, die er liebt, mit großer Reserve und zieht sich zurück, sobald er sich bedrängt oder vereinnahmt fühlt. Von Herta Wedemeyer, seiner zweiten Ehefrau, weiß Benn im Januar 1937 zu berichten, sie »wird nie im entferntesten in mein Leben einzugreifen versuchen, rührt an keine Bezirke, in die ich sie nicht haben will«.8
Zum Opfer seiner Leidenschaft wurde Benn nie, dazu führte er viel zu gut »Regie« – »Regie ist besser als Treue«9. Von der hielt Benn nämlich wenig. Die Ehe war für ihn »eine Institution zur Lähmung des Geschlechtstriebes also eine christliche Einrichtung«.10 Für einen Mann sei »alles, was nach Bindung aussieht, […] gegen seine Natur«. Um seine Bedürfnisse zu befriedigen, bliebe ihm nur die »Illegalität«, das Abenteuer, die »gestohlene Liebe«, die die einzig wahre Liebe sei, denn nur außerhalb der Ehe würde der Mann den »echten Koitus« erleben. In der Ehe ginge es um andere Themen: »Wirtschaftsfragen, Essensfragen, Geselliges, ›gemeinschaftliche Interessen‹« – alles Dinge, die, Benn zufolge, notwendig sind, aber dem »Sexus« entgegenstehen, ihn regelrecht ›torpedieren‹.11
So hat er sich in Briefen geäußert, so wollte er sein. Seine drei Ehen ist er, nach eigenem Bekunden, aus lebenspraktischen Gründen eingegangen. Für Liebe und Zärtlichkeit waren im Wesentlichen die wechselnden Freundinnen zuständig. Die Bereiche waren getrennt, die Rollen verteilt. Benn gab sich abgeklärt, von romantischer Liebe, Seeleninnigkeit und trauter Zweisamkeit wollte er nichts wissen. Um so mehr aber suchte er körperliche Liebe und Erotik, Rausch und Entgrenzung. Benn war stolz auf seine zahlreichen Eroberungen: »Ich habe mit sehr vielen Frauen ›was gehabt‹, über ganz Europa sind sie verstreut, auch USA! Wunderbare Frauen.«12 Frauen waren seine Leidenschaft; Triebe, so schreibt er im »Phänotyp«, sollten nicht bekämpft werden, das schafft nur Neurosen und brächte Spannungen hervor, »die sich nicht lohnen, Krisen, die voraussichtlich unproduktiv enden –, man soll erleben und etwas Artifizielles daraus machen«13. Mit anderen Worten, es geht nicht nur um das Ausleben der Triebe, das mag bei einem ›normalen‹ Mann der Fall sein, bei einem Mann wie Benn geht es darum, die amourösen Abenteuer auch in Kunst umzuwandeln. »So ist das Leben, wenn man es ernst nimmt«, gibt er 1952 seinem Freund Friedrich Wilhelm Oelze zu verstehen: »Das sind die Zahlungen für Kunst u Ruhm.«14
Das war halb scherzhaft, halb ernst gemeint. Richtig ist, Benns Liebschaften sind vom Werk nicht zu trennen. Seine Haltung zu Frauen ist von Anfang an in seiner Literatur präsent und Ausdruck seines antibürgerlichen Habitus, seines Images als zupackender, subversiver Dichter. 1912 veröffentlicht der sechsundzwanzigjährige Mediziner in der Zeitschrift »Pan« das Gedicht »D-Zug« mit den vielzitierten Zeilen: »Eine Frau ist etwas für eine Nacht./Und wenn es schön war, noch für die nächste!«15 Spricht hier ein fiktionales Ich oder der Dichter? Autobiographie und Fiktion waren bei Benn kaum zu trennen. Schon in seinen frühen Gedichten gibt es eine permanente Bewegung, ein Oszillieren zwischen Text und Leben. Paul de Man hat von der Autobiographie als einem Maskenspiel gesprochen und die Frage gestellt: Ob nicht auch die entworfene Figur das Leben hervorbringen und bestimmen kann?16 Bezogen auf Benn: War es nicht die figurative Rede, die den Ton vorgab und auf das Leben des protestantischen Pfarrerssohns zurückwirkte, ihm zuallererst Ausdruck verlieh?
Ein »wahrhaft Aufständischer«
Es ist bekannt, dass der Dichter und Erzähler Benn aus einer Lebenskrise hervorgegangen ist. 1911 wandte er sich enttäuscht von der Psychiatrie ab, auf die er sich eigentlich hatte spezialisieren wollen. Die Literatur zum Medium psychiatrischer Diskurse zu machen, erschien ihm weitaus bedeutender und reizvoller als die Begrenzung auf das rein wissenschaftliche Wissen. Im Ästhetischen suchte er nach Gewissheit und Ausdruck. Doch seine Gedichte stießen zunächst auf wenig Resonanz. In Briefen hat Benn die stark affektive Situation betont, in der er sich befand. Im Mai 1912 schreibt er: »Die Naturwissenschaften u die Medizin« hätten ihn »innerlich total ruiniert«. Er lebe schon »jahrelang […] hart an den verschiedensten Abgründen«17. Zwei Monate zuvor, im März 1912, war die Sammlung »Morgue und andere Gedichte« erschienen – ein Zyklus, der Epoche machen sollte und der bei den einen Verehrung, bei anderen Abscheu auslöste. Im Fokus standen nicht die künstlerisch gestalteten Themen, sondern die Stoffauswahl: Makabere Szenen aus dem Leichenschauhaus und dem Sektionssaal, Bilder von Siechtum, Verfall und Tod. »Der das geschrieben hatte«, so sein Verleger Alfred Richard Meyer, »kam nicht von der Theorie, sondern aus den Erlebnissen des ärztlichen Berufes.«18 Hinter den Gedichten standen die Erfahrungen eines Pathologen – so wurden sie eine ganze Weile gelesen und verstanden.19 Ein Pathologe, der den schönen Schein der bürgerlichen Welt durchstieß und den Menschen so zeigte, wie er ist – nicht als Krone der Schöpfung, sondern als ein »Klumpen Fett und faule Säfte«. Die Lektüre – da war sich die Kritik einig – war nur etwas für starke Nerven. Gelobt wurde unisono die genaue, sachliche Schilderung der Realität. So sah es also im Sektionssaal aus – grauenerregend, ekelhaft. Der Dichter fiktionalisierte, spitzte zu und profitierte vom Unwissen der Literaten, die die Pathologie nur vom Hörensagen kannten und vor der abstoßenden klinischen Praxis schaudernd zurückwichen.
Benn galt nun als jemand, der sich mutig und mit Härte der Wirklichkeit stellte. Ein Dichter, der sich frei machte von aller ästhetischen Verklärung und Mystifizierung, ein »wahrhaft Aufständischer«20, der keine Rücksicht nahm und die Dinge beim Namen nannte. Das passte zu seiner militärärztlichen Ausbildung, ebenso wie zum männlichen Ethos, das man in den Eliten des wilhelminischen Bürgertums zur Schau zu tragen hatte.21 Norbert Elias spricht vom »Kriegerethos« in einer »verbürgerlichten Fassung«22. Benn stammte aus dieser »Verhaltens- und Empfindungstradition«23, seinen ›Mann stehen‹, Zähne zusammenbeißen, hart sein – war das Credo, mit dieser Haltung war er aufgewachsen, und so wurde er, vor allem von den Frauen, wahrgenommen: »Er steht unentwegt, wankt nie, trägt das Dach einer Welt auf den Rücken«, so Else Lasker-Schüler.24
Mit den Rönne-Novellen gelang Benn dann der große Wurf. Er schrieb den Zyklus mitten im Ersten Weltkrieg, in Brüssel, wohin man ihn als Militärarzt abkommandiert hatte. Rönne war aus der Welt gefallen und hatte sich, wie sein Autor, von den Gewissheiten des naturwissenschaftlichen Denkens, das sich um 1900 von der Gehirnforschung faszinieren ließ, weit entfernt. Die Sprachskepsis der Jahrhundertwende wie auch die These vom »unrettbaren Ich« (Ernst Mach) nahmen in der Figur Gestalt an. Rönne stand auf »den Trümmern einer kranken Zeit«25, er fand in der Wirklichkeit keinen Halt mehr, alles schien sich aufzulösen, zu zerfallen – nicht zuletzt die Einheit der Person. »Keinem Ding mehr gegenüber« zu sein, »keine Macht mehr über den Raum«26 zu haben, damit formulierte Benn das Grundgefühl der Epoche. Freilich nicht nur er, so dachten auch andere in seiner Generation: »Wir haben keine Wahrheit mehr«, verkündete Benns Freund und Kollege Carl Einstein.27
»Die Geschichte spricht«
Anfang der dreißiger Jahre änderte sich Benns Auffassung. Das Leben ist nur so lange halt- und ergebnislos, so lange es kein »großes Gesetz«28 gibt, das über dem Leben steht. Dieses ›große Gesetz‹ war nun da, und damit würde die Geschichte des Menschen erst beginnen. Benn begeisterte sich für das ›Dritte Reich‹, für den ›neuen Staat‹ – schrieb über Zucht und Züchtung, über Kunst und Macht. Viele, die ihn verehrten, waren überrascht, ja, abgestoßen von den Ansichten, die er jetzt vertrat, Ansichten, die zu Werk und Person nicht zu passen schienen. Sie hatten ihn anders gelesen, anders verstanden, und waren enttäuscht.
Klaus Mann sprach von der »diabolische[n] Sympathie«29 Benns für den Nationalsozialismus und artikulierte in einem Brief an den bewunderten Dichter sein Unverständnis, sein Entsetzen: »In welcher Gesellschaft befinden Sie sich dort? Was konnte Sie dahin bringen, Ihren Namen, der uns der Inbegriff des höchsten Niveaus und einer geradezu fanatischen Reinheit gewesen ist, denen zur Verfügung zu stellen, deren Niveaulosigkeit absolut beispiellos in der europäischen Geschichte ist und von deren moralischer Unreinheit sich die Welt mit Abscheu abwendet?«30 Bildung und Barbarei, das waren für Klaus Mann getrennte Welten, da gab es keine Verbindungen, keine Übergänge, da waren Entscheidungen gefragt. Und Manns Brief enthält in dieser Hinsicht eine unverhohlene Drohung: »Wer sich […] in dieser Stunde zweideutig verhält, wird für heute und immer nicht mehr zu uns gehören.«31 Benns Antwort an Klaus Mann und »die literarischen Emigranten« am »lateinischen Meer«32 ist voll Hohn und Spott: »Da sitzen sie also in ihren Badeorten und stellen uns zur Rede, weil wir mitarbeiten am Neubau eines Staates […].«33 Naivität und eine »novellistische Auffassung der Geschichte« wirft er seinen Kritikern vor. Alle großen Kulturleistungen seien nun mal »aus furchtbaren und gewaltsamen Anfängen emporgewachsen«. Die »liberale und individualistische Ära«34 hätte das »vergessen«, ja, sie sei viel zu hedonistisch und genusssüchtig eingestellt und habe keinen Sinn für Werte, die dem Leben übergeordnet sind, für Tragik und Heroismus.
Benn glaubte an die nationalsozialistische Revolution, die die alte Welt umkrempeln, den Individualismus überwinden und ein neues Geschlecht hervorbringen würde. Die Aufbruchsstimmung, die 1933 herrschte, hatte Benn elektrisiert, er verspürte die Lust am Untergang und sah eine neue Zeit heraufziehen. In einem Brief an seine ehemalige Freundin Gertrud Zenzes schreibt er am 23. September 1933: »Das alles ist ja auch nur ein Anfang, die übrigen Länder werden folgen, es beginnt eine neue Welt, die Welt, in der Sie und ich jung waren und gross wurden, hat ausgespielt und ist zu Ende.« Man stehe, so Benn weiter, »vor einer Wendung der abendländischen Geschichte […], die vielleicht nur dem elften Jahrhundert verglichen werden kann oder dem Ausgang der Antike«35. Mit dem Nationalsozialismus kündigt sich für Benn eine Zeitenwende an, das Ende des bürgerlichen Zeitalters, von dem er und seine Generation lange geträumt hatten, schien besiegelt. In den Texten, die er Anfang der dreißiger Jahre schreibt, verweist er immer wieder auf die Erfahrungen ›seiner‹ Generation, der expressionistischen Generation, die sich in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg formierte und die für Benn so etwas wie der Fundus und Fixpunkt war, aus dem er lebte. Eine Generation, die nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten suchte. Denn eine Wirklichkeit, auf die man sich beziehen könnte, gäbe es nicht mehr, so Benn, »es gab nur noch Fratzen. Wirklichkeit, das war ein kapitalistischer Begriff. Wirklichkeit, das waren Parzellen, Industrieprodukte, Hypothekeneintragung, alles, was mit Preisen ausgezeichnet werden konnte bei Zwischenverdienst«36. Die Expressionisten lehnten sich mit ihrer Existenz dagegen auf: »Ein Aufstand mit Eruptionen, Ekstasen, Haß, neuer Menschheitssehnsucht, mit Zerschleuderung der Sprache zur Zerschleuderung der Welt.«37
Zwischen Faszination und Mysterium
Zu dieser Generation gehörte auch Thea Sternheim, sie war viele Jahre mit Benn befreundet, sie schätzte und liebte ihn, verehrte ihn als genialen Dichter. Es war, wir werden das noch sehen, eine etwas andere Beziehung, als Benn sie normalerweise zu Frauen hatte. Kein amouröses Abenteuer – dazu hätte sich Thea Sternheim nicht hergegeben. Zweifellos, sie liebte Benn, aber auf eine etwas andere Art und Weise als die anderen Frauen, die ihn liebten – sie liebte ihn nicht körperlich, sondern, so merkwürdig es sich zunächst anhört, durch die Sprache. Keine andere seiner Frauen und Freundinnen kannte sein Werk so genau wie Thea Sternheim. Keine andere hat sich aber auch von diesem Werk so gefangen nehmen lassen. Nicht die Inhalte zählten für sie, sondern der Rhythmus, der Tonfall, das geheimnisvolle Raunen und die Melodie – das alles versetzte sie in einen Rausch. Die Sprache war das Medium ihrer Verliebtheit, über die Sprache vollzog sich eine Idealisierung des geliebten Objekts, eine Wunschprojektion. Liebe, so meint Sigmund Freud, setzt das Erkennen der Realität außer Kraft, sie verkennt das geliebte Objekt, überschätzt es und will sich mit dem Verkannten identifizieren. Im Grunde handelt es sich um eine Schädigung der Wahrnehmung, eine Abweichung von der Norm, eine, im wörtlichen Sinn, Ver-rücktheit. Nur so ist es vielleicht zu erklären, dass Thea Sternheim Benns politische Radikalisierung in den zwanziger Jahren aus dem Blick verlor und ihr der Freund erst 1933 zum Rätsel wurde: »Unfassbar wie dieser umfassende Geist sich so zu verlieren vermochte!«38 Das schreibt sie im Juli 1957 in ihr Tagebuch – da war Benn schon ein Jahr tot. Thea Sternheim las erneut die Essays »Der neue Staat und die Intellektuellen« und »Züchtung« von 1933, sie las sie zum wiederholten Mal und konnte immer noch nicht begreifen, wie ein gebildeter, aufgeklärter Geist sich so irren und auf diese Bahn geraten konnte. Wer die Physiognomien der führenden Nazi-Größen betrachtet und dann vom »Sieg der Griechen« redet, muss blind und völlig wirklichkeitsfremd sein: »Hat er in den illustrierten Zeitungen nicht feststellen können wie die Brüder aussahen die die Losung zu dieser von Benn mitbesungenen Züchtung abgaben, diese aus Hitler, Göring, Streicher, Göbbels, Himmler zusammengewürfelten Helden?«39
Nicht viel anders ging es ihrer Tochter Mopsa, die 1926 eine leidenschaftliche Affäre mit Benn hatte und nicht mehr von ihm loskam. Als sie ihn 1952 in Berlin wiedersah, schrieb sie in einem Brief an ihre Freundin: »Er ist für mich das, was er immer war, der einzige Mann, welcher einen Einfluß auf mich hatte. Es ist eine Art Gehirnvergiftung.«40
Mutter und Tochter führten Tagebuch: Thea Sternheims Aufzeichnungen beginnen 1905 und enden kurz vor ihrem Tod am 5. Juli 1971. In dieser Zeit schrieb sie über 30000 kleinformatige Seiten, die Chronik ihres Lebens, die zugleich ein Bild der Epoche, des 20. Jahrhunderts, mit ihren Ideologien, Ängsten, Zukunftshoffnungen und Katastrophen war. Im Unterschied zu ihrer Mutter führte Mopsa Sternheim ihr Tagebuch nur sporadisch, aber schon früh übte sie sich im Tagebuchschreiben. Im Februar 1918 nahm sie sich vor, nun ›ernsthaft‹ ihre Erlebnisse und Empfindungen aufzuschreiben – da war sie gerade dreizehn Jahre alt. Sie schrieb vor allem in Lebensphasen, in denen es ihr »schlecht«41 ging. Das Tagebuch war für sie ein Rettungsanker, eine Möglichkeit, Ordnung in ihr Leben zu bringen. Sie sei, so schreibt sie ironisch und durchaus selbstbewusst, »Mitglied einer haltlosen Generation, obendrein noch weiblichen Geschlechts, immerhin LEBEND in der sog. Kunstsphäre und ausschliesslich für und durch sie.«42 Daran litt sie und daran zerbrach sie. In beiden Tagebüchern spielte Benn eine bedeutende Rolle, er bezauberte Mutter und Tochter, blieb aber für beide letztlich ein Mysterium, unnahbar und anziehend zugleich.
Als Thea Sternheim Benn persönlich kennenlernte, war sie noch mit dem Dramatiker Carl Sternheim verheiratet – dem Enfant terrible der damaligen Theaterszene. Mit seinen Komödien »Die Hose«, »Der Snob« und »1913« brachte er den lange Zeit niedergehaltenen und nun »entfesselten Kleinbürger«43 auf die Bühne, der in der spätwilhelminischen Gesellschaft nach Macht und Anerkennung strebte. Carl Sternheim führte Benn in die Familie ein, die beiden Männer hatten nicht nur gemeinsame literarische Interessen, auch ihre Ansichten über Frauen waren nahezu identisch. Wie Benn war auch Sternheim ein Don Juan und Erotomane, der immer auf der Suche nach Abenteuern war und aus seiner Promiskuität keinen Hehl machte.
Am 3. Februar 1917 besuchte Benn die Sternheims zum ersten Mal, diese wohnten zusammen mit ihren beiden Kindern, der 1905 geborenen Dorothea (Moiby, später Mopsa) und dem 1908 geborenen Klaus, in ihrem komfortablen Herrenhaus im Brüsseler Vorort La Hulpe. Die damals dreiunddreißigjährige Thea Sternheim kam aus einem großbürgerlichen Milieu und hatte 1906 von ihrem Vater ein Millionenvermögen geerbt. Durch den Krieg hatten sie einiges von ihrem Vermögen verloren. Nichtsdestotrotz konnten die Sternheims immer noch auf großem Fuß leben, und Benn war von ihrem Lebensstil, von dem eleganten Haus, fasziniert.
Eine »neue Aera«
1949, als Benn wieder Kontakt zu seiner alten Freundin aufnahm, schrieb er Thea Sternheim von der Bedeutung, die die Generation in seinem Leben spielt und gespielt hatte: die »Gemeinschaft der Generation, die die gleichen Erlebnisse und Menschen und Bücher kennt«44 – das wäre doch das eigentlich entscheidende Band im Leben. Und er erinnerte sie an seinen Besuch: »Wissen Sie noch wie ich eines Winterabends mit St.[ernheim] in La Hulpe ankam, ein kleiner Pony hatte uns von der Bahn gezogen, Mops brachte ihrem Vater die Hausschuhe, sie war rot und struppig, noch nichts von der späteren Schönheit und Sensitivität war zu sehn. Einige Unterhaltungen aus den beiden Tagen haben mich durch das ganze Leben begleitet […].«45
Auf die Unterhaltungen kommen wir unten noch zurück. Obwohl sich Benn über die Inhalte der Gespräche ausschweigt, wissen wir einiges durch Thea Sternheims Tagebucheinträge. Thea Sternheim hat das Lebensgefühl dieser Epoche geteilt, sie hoffte auf eine Erneuerung und Umgestaltung der verkrusteten wilhelminischen Gesellschaft. Man lebte in Möglichkeiten und verachtete die Wirklichkeit. Anders als heute war man damals vom Eros des Aufbruchs erfüllt, man glaubte und hoffte auf eine neue Zeit, auf einen neuen Menschen, man ließ sich von Leidenschaften und Visionen bewegen.
Im Vorfeld des Benn-Besuchs diskutierte Thea Sternheim mit ihrem Mann über die »junge literarische Richtung in Deutschland«46, den Expressionismus. Beide waren davon überzeugt, dass diese Bewegung »die neue Aera schaffen« wird, und die »neue Aera«, das hieß, »die Überwindung des bourgeois, die Überwindung aller bourgeoisen Ambitionen«.47 Die bürgerliche Welt war das Feindbild der expressionistischen Generation. Man hasste das Bürgerliche in jeder Form und pflegte den seit Baudelaire gängig gewordenen ›épater le bourgeois‹. Konstitutiv für diese Generation war der Gestus der antibürgerlichen Revolte, die symbolische Aggression, der Schock. Unter ›Bürger‹ oder ›Bürgerlichkeit‹ verstand man jedoch nicht unbedingt die soziale Klasse, sondern eine bestimmte Haltung und Mentalität. Die damit gemeinte Geistesverfassung des Bürgers hat 1919 Walther Rilla auf den Punkt gebracht: »Bürgerlich« ist die »obstinate Verbohrtheit ins Gegebene«, sind »Dummheit, Aufgeblasenheit, Strebertum, Kriechertum, Ungeist, Stagnation«.48 Gegen diese bürgerliche Welt galt es, sich zu profilieren. Der Künstler war der Antipode des Bürgers49, er repräsentierte das Versprechen auf Erneuerung, auf ein anderes Leben, fernab aller bürgerlichen Ordnungsvorstellungen, befreit von der gehassten Spießermoral. Wie diese Welt und Wirklichkeit aussehen sollte, wurde nicht weiter konkretisiert.
›Neu‹, ›jung‹, ›rein‹, ›unverfälscht‹, ›ursprünglich‹ – das sind auch die von Thea Sternheim immer wieder benutzten Begriffe, wenn es um die Beschreibung des ästhetischen Aufbruchs geht.
Der Expressionismus war eine Jugendbewegung, die gegen die Zwänge der Tradition und der Form revoltierte, eine Bewegung, die sich nach einem vitaleren, intensiveren Leben sehnte, nach einem Leben, das einen übergreifenden Sinn hatte, authentisch war und den elementaren Gefühlen wieder Raum gab.
Die expressionistischen Ideen standen bemerkenswerterweise mit religiösem Denken in engem Zusammenhang. Erneuerung, Umkehr, Wandlung waren leitende Begriffe des Expressionismus, die in religiösen Vorstellungen wurzelten. Ebenso wie das vom Expressionismus propagierte Heilsversprechen vom neuen Menschen. Ludwig Rubiner schreibt 1919 in seinem Essay über »Die Erneuerung« im pathetisch-messianischen Ton: »Vor der Erneuerung wird eine große Bekehrung kommen müssen. Aber Bekehrung, das kann man nicht mit Jammern machen, nicht passiv, nicht mit Abwarten, Zusehen und Abwälzen der drohenden Dinge auf die anderen. Bekehrung ist bewußtes und willentliches Hindurchgehen durch ein Leben, das wir für niedriger halten als jenes, das vermeintlich unserer würdig wäre. […] Bekehrung ist der Weg des Handelns mit allen, mit allen unseren endlichen Mitteln zum ewigen Ziel.«50
Thea Sternheim hatte ein besonderes Verhältnis zur Religion, in der sie so etwas wie ihr geheimes Leben sah. Aus vielen unterschiedlichen Elementen hatte sie sich eine Privatreligion zusammengebastelt: Katholizismus, Mystik, Urchristentum, Tolstoianismus, christlicher Anarchismus und Pazifismus. Bevor sie ihr Tagebuch dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach übergab, hat sie viele Passagen mit religiösem und mystischem Inhalt geschwärzt, sie wollte diese Dinge nicht preisgeben, sie waren ihr zu intim.51
Als sie im August 1954 ihre alten Tagebücher wieder liest, spricht sie von ihrer »Liebe zu Jesus«, vom »Glauben an seine Göttlichkeit«, an »sein Menschentum«. Das »religiöse Ereignis«, so schreibt sie, sei der »Brennpunkt« ihres Lebens. »Heute wie eh kann ich von ihm nicht wegdenken, heute wie eh ist der Menschensohn, der dem unvorstellbaren Wesen, was Gott ist, den erschütternden Namen ›Vater‹ gegeben hat, der König meines Herzens.«52 In der Tagebuch-Eintragung vom 3. Februar 1917, in der es ganz wesentlich um den Benn-Besuch geht, spielt auch Thea Sternheims »Auflehnung gegen die Dinge dieser Welt« und ihr Glaube an Christus eine Rolle. »Ein neuer Christus muss kommen auf dem Berge zu predigen.«53 In Tolstoi – wir werden noch auf ihn zurückkommen – glaubte sie einen »Vorläufer« des neuen Christus zu erkennen, sie sah Ähnlichkeiten mit Johannes dem Täufer.
Ein paar Zeilen später ist dann von der Ankunft Benns im Hause der Sternheims die Rede: Kein neuer Christus – sicher. Aber gleichwohl einer, auf den Thea Sternheim ihre Hoffnungen setzte. Und Benn bot sich als Hoffnungsträger der neuen Ideen durchaus an. In seinen Aufsätzen zum Expressionismus54 hat er deutlich gemacht, dass der Expressionismus für ihn nicht lediglich eine neue Kunst war, sondern eine veränderte Haltung zur Welt und Wirklichkeit, die in einer radikalen Infragestellung der tradierten Ordnung zum Ausdruck kommt. Expressionismus beschreibt Benn »als Wirklichkeitszertrümmerung, als rücksichtsloses An-die-Wurzel-der-Dinge-Gehen«55.
Radikal und destruktiv wollte man sein, und man liebäugelte mit der Vorstellung einer Tabula rasa, einer reinigenden Apokalypse. Das ›Ende‹ der Welt sah man als die notwendige Bedingung für einen neuen Anfang, für ein ›neues Jerusalem‹ an. Der Erste Weltkrieg wurde daher von vielen Expressionisten begrüßt. Dabei dachte man nicht so sehr nationalistisch, sondern zivilisationskritisch. Man hoffte auf den Untergang der erstarrten Wilhelminischen Gesellschaft und auf eine spektakuläre Wiedergeburt. Bevor aber das Neue entstehen könnte, müsste die alte Welt, so schrieb Franz Marc, durch das »Fegefeuer des Krieges« gereinigt werden.56
Nicht von ungefähr ist auch Benns Rede, wenn er vom Expressionismus spricht, religiös konnotiert. So nennt er die Expressionisten die »Gläubigen einer neuen Wirklichkeit und eines alten Absoluten« […], die »mit der Askese von Heiligen«57 ihre Existenz riskierten. Die Expressionisten fragten »nach dem Menschen«, die Wissenschaft dagegen hatte nur »unanschauliche Begriffe, künstlich abstrahierte Formeln«58. Die Expressionisten waren es auch, die nach der Wirklichkeit fragten, die in einer ökonomisierten Welt zunehmend ungreifbar geworden war, die sich vom Einzelnen, vom Ich, entfremdet hatte. Für Benn bezeichnete der Expressionismus das »Autochthone« und »Elementare«. Er ist nicht »Auflehnung gegen vorhergehende Stilarten: Naturalismus oder Impressionismus, es ist einfach ein neues geschichtliches Sein«.59
Die Forschung hat mit dem »expressionistischen Jahrzehnt«, das von 1910 bis 1920 währte, die Bewegung zeitlich eingegrenzt. An sich aber, so Benn, sei der Expressionismus eine Geisteshaltung, die sich nicht auf diesen Zeitraum beschränken lasse, die in verschiedenen Ausdrucksformen immer existiert habe, nur sei sie in manchen Zeiten nahezu völlig erloschen, dann wiederum können »innere Lagen«60 eintreten, in denen sie, mächtiger als je zuvor, hervortritt und zum geschichtlichen Ereignis wird.
Diesen Zeitpunkt sah Benn 1933 gekommen, der Expressionismus, der in den zwanziger Jahren gescheitert war, sollte nun zum Geist der Epoche werden. Benns Vorbild war Marinettis Futurismus. Mit dem 1909 publizierten Manifest sei eine geistige Bewegung entstanden, die den Aufstieg Mussolinis erst möglich gemacht hätte. Benn versteigt sich zu der Behauptung, der Futurismus habe »den Faschismus mitgeschaffen«61. Eine ähnliche Rolle soll der Expressionismus nun für den Nationalsozialismus spielen. Die Leitbegriffe der expressionistischen Bewegung sind in Benns Reden und Aufsätzen aus dem Jahr 1933 alle wieder da, geradezu inflationär findet sich die Vokabel »neu« – »eine neue Welt«, ein »neues Weltgefühl«, eine »neue Art von Intelligenz«, eine »echte neue geschichtliche Bewegung«. Es fehlt auch nicht die Berufung auf das Leben, die Jugend und die Wandlung. Thea Sternheim »kann es nicht glauben«, aber sie erinnert sich 1933 auch an den »jungen Benn«, an sein »zweideutiges Verhalten während der deutschen Besetzung in Belgien«62, eben zu der Zeit, als sie ihn 1917, mitten im Krieg, kennenlernte. Dass Benns Faszination für das Totalitäre nicht erst 1933 entstand, sondern gewissermaßen bis zum Anfang ihrer Beziehung zurückreichte, wurde ihr jetzt bewusst.
»Verlorene Generation«
Mopsa Sternheim, Klaus und Erika Mann und Pamela Wedekind waren alle ungefähr im selben Alter, alle stammten aus wohlhabenden Verhältnissen, ihre Eltern gehörten zum Bildungsbürgertum, zur geistigen Elite. Und das Elternhaus hatte sie geprägt, sie empfänglich gemacht für Literatur und Kunst – in den zwanziger Jahren wollten sie auf eigenen Füßen stehen. Klaus Mann schrieb Theaterstücke, die man gemeinsam aufführte, auch der später berühmte Gustaf Gründgens war mit von der Partie. Mopsa Sternheim entwarf die Kostüme und war für das Bühnenbild verantwortlich. Bei der Kritik kamen die Aufführungen nicht gut an, man sprach den »Dichterkindern«, wie man die Truppe kurzerhand nannte, alle Originalität ab, von Epigonentum war die Rede. Sie standen von Anfang an im Schatten der überaus erfolgreichen Eltern bzw. Väter. Keine leichte Ausgangsposition, besonders wenn man auf dem Gebiet reüssieren will, das die Altvorderen schon besetzt haben.
Wie Klaus Mann ein schwieriges Verhältnis zum Vater hatte, so hatte Mopsa Sternheim ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter. Anfangs schrieb sie noch wie die Mutter Tagebuch, verfasste Gedichte, begeisterte sich für jene Literatur, die auch ihre Mutter las, die beiden tauschten sich aus, teilten Vorlieben und Abneigungen. Was die schwierige Ehe von Thea und Carl Sternheim betraf, so stand die Tochter zunächst auf der Seite der Mutter. Das sollte sich in den zwanziger Jahren ändern. Mopsa Sternheim – davon zeugt ihr Tagebuch – sieht die Mutter nun kritischer, sie fühlt sich vereinnahmt, baut sich einen eigenen Freundeskreis auf und will vor allem eins, ein selbstständiges Leben führen, unabhängig sein, einen eigenen Weg finden. Aber genau das ist ihr nicht wirklich gelungen, sie fiel immer wieder zurück in die Abhängigkeit.
Klaus Mann schreibt in seiner Autobiographie von der »Unrast«, der »Angst vor Wiederholung, Monotonie und Überdruß«, die sein ganzes Leben beherrsche. »Es trieb mich fort. Immer trieb es mich zum Aufbruch, zum neuen Abenteuer. Ich gefährdete (oder rettete) menschliche Beziehungen, riskierte berufliche Chancen, unterbrach Studien und Amüsements – nur aus dem nervös-irrationalen Bedürfnis nach Wechsel und Bewegung.«63
Mopsa Sternheim war von ähnlicher Unruhe, Rastlosigkeit und Fremdheitsgefühlen erfüllt. 1932 hat sie in einem Aufsatz die gesellschaftliche Situation in den zwanziger Jahren beschrieben: Mit dem Ersten Weltkrieg und dem Ende des Kaiserreichs, kam in Deutschland »die Zeit des Umsturzes, dem nichts standhielt. Vorher feststehende Begriffe hatten zur Katastrophe geführt, alle Autorität eingebüsst. […] Nichts Absolutes gab es mehr, alles war Relation, keine feststehende Skala der Werte. Man war ›enthemmt‹, war im Rollen, sich selbst und alle Ware setzte man in gesteigerten Maass um.«64 Nach dem Untergang der alten Welt hatten die alten Werte, der alte Glaube, an Gültigkeit verloren. Man suchte, nicht nur in Deutschland, nach Halt und Orientierung, nach einem neuen Selbstverständnis. Aus Amerika kam um diese Zeit ein Begriff, in dem sich viele der Jüngeren wiedererkannten: lost generation. Ein Begriff, der eine umgreifende Weltentfremdung ausdrückte, ein Verlust an Wirklichkeit und Erfahrung. Gertrude Stein, F. Scott Fitzgerald, John Dos Passos und Ernest Hemingway machten daraus ein literarisches Programm, einen Stil.
Mopsa Sternheim und Klaus Mann hatten wenig mit dieser Literatur zu tun, aber sie fühlten instinktiv, dass auch sie zu einer »verlorenen Generation« gehörten. Das Gefühl, verloren und haltlos, dem eigenen Leben entfremdet zu sein, ließ sie in ›künstliche Paradiese‹, in Drogenexzesse und sexuelle Libertinage flüchten.
Zeitlebens glaubte Mopsa Sternheim, ihr Leben zu vergeuden, ihre Zeit zu verbummeln, nichts, was wirklich Bestand hat, fertigzubringen. Immer wieder fasste sie Entschlüsse, steckte sie sich Ziele, die sie dann aber aus den Augen verlor, die sie nicht weiter verfolgte und schließlich aufgab. Es belastete sie, nichts aus ihren Talenten und Möglichkeiten gemacht zu haben, sie sah sich gescheitert. Dennoch: Mopsa Sternheim hat vieles gewagt und ausprobiert, sie hat sich als Zeichnerin versucht, als Bühnen- und Kostümbildnerin, als Autorin – zum ›Ausprobieren‹ gehörten freilich auch die Drogen, mit denen sie schon früh experimentierte und von denen sie nicht mehr loskam – zum ›Ausprobieren‹ gehörten auch die Männer. Sie ging zahlreiche Beziehungen ein, war oft leidenschaftlich verliebt, doch zumeist war sie schon nach kurzer Zeit der Sache überdrüssig, langweilte sich in der Beziehung und fühlte sich ausgenutzt. Nur bei einem Mann, der am Anfang stand, war offenbar alles anders: Gottfried Benn.
Benns Geliebte
Für Klaus Theweleit ist Benns Kunstproduktion ganz wesentlich mit dem Frauenopfer verbunden. Im »Buch der Könige« hat er gezeigt, dass der Tod von Benns Ehefrau Herta im Juli 1945 und seine eigene Wiedergeburt als Künstler und Dichter eng zusammenhängen, ja sich bedingen.65 Es ist die alte Geschichte von Orpheus und Eurydike, von Künstler und Künstlerfrau – Eurydike muss sterben, um die Kunstproduktion des Mannes, sein Schöpfertum, zu stimulieren und neu zu begründen. Benn, so die These Theweleits, ästhetisiert das Schicksal der Frau, macht daraus Kunst – und die Frau weiß um ihre Aufgabe, ihre Bestimmung, sie akzeptiert, mehr oder weniger bewusst, das Opfer, um große Kunst entstehen zu lassen. Der Künstler macht die Frau zum Mittel seiner Produktion, er unterwirft seine Liebesbeziehungen den übergeordneten Zwecken seines Schöpfertums, er braucht die Schicksale und Dramen, die in privaten Lebens- und Liebesgeschichten stecken, er eignet sie sich an, verleibt sie sich ein, um Werke entstehen zu lassen. Die Frauen sind eingebunden, instrumentalisiert. An Herta Benns Tod zeigt Theweleit durchaus plausibel die Mechanismen ästhetischer Produktion auf. Aber ein ganz wichtiger Punkt gerät dabei doch etwas aus dem Blick: Liebe war nicht das tragende Motiv für Benn, diese Verbindung einzugehen. Bei allem, was wir wissen, war Herta Benn eine treusorgende Ehefrau und Sekretärin, aber nicht eine Geliebte. Und sie spielte offenbar widerspruchslos die Rolle, die ihr von Benn zugedacht war, sie ließ sich instrumentalisieren. Betrachtet man die Beziehungen, die Benn zu Frauen hatte, so war sie, wir werden es sehen, eher ein Sonderfall.
Die ernsthafte Benn-Forschung befasst sich nur ungern mit dem Dichter und seinen zahlreichen Liebschaften. Eigentlich überlässt man dieses Thema lieber »Benns Biographen«, die sich von »solchen Fragen« nur zu gern faszinieren lassen. Für die Forschung – die ernsthafte Forschung – ist die Geschichte schon deshalb nicht relevant, weil Benn in seinen Texten, wie zum Beispiel im »Doppelleben«, »kaum ein Wort über Frauen« verlieren würde. Zeitlebens sei der Dichter der Überzeugung gewesen, das zum echten Künstlertum »Einsamkeit« und »persönliche Isolation«66 gehört. Kunst sei »ein vulkanischer Akt unter Ausschluss der Öffentlichkeit«67 – Frauen haben da natürlich keinen Zutritt.
In jüngster Zeit hat man sich in die Niederungen begeben und Benns Liebesleben in ein aufklärerisches Licht gerückt und sich an Erklärungen versucht68: Gottfried Benn kam als »junger Arzt« nach Berlin. »Es war eine gute Zeit für wechselnde Verbindungen.« Und Benn ergriff die Gelegenheit, wo immer er sie ergreifen konnte, er hatte »zahlreiche Liebesbeziehungen«.69 Daran sei nichts Verwerfliches. Zumal es sich um Frauen handelte, die nicht naiv gewesen wären und eine gewisse Bildung vorzuweisen hätten, es gäbe unter seinen Geliebten Dichterinnen, Journalistinnen, Schauspielerinnen, Sängerinnen und sogar Intellektuelle. Allesamt Damen, die wussten oder hätten wissen müssen, auf was sie sich einließen, wenn sie sich mit einem Mann wie Benn verbanden. Die »Biographen«, die den Dichter als »Frauen verschleißenden Egomanen«70 abstempeln, wären auf dem Holzweg, denn Benns Geliebte wären im klassischen Sinn keine Geliebten gewesen, sie waren »Partnerinnen«71 – ein Begriff, der heute einen guten Klang hat und schon damals, so die Behauptung, von Bedeutung gewesen sei, denn die gesellschaftliche Situation hätte sich in den Jahren, als Benn ein »junger Arzt« war, entscheidend gewandelt: »Nach dem Ersten Weltkrieg betrachtete man erotische Affären in den großen Städten außerordentlich liberal, erstmals konnte in dieser Hinsicht von einer Gleichberechtigung der Frau überhaupt die Rede sein.«72 Die zwanziger Jahre werden bemüht, angespielt wird auf das »sündige Berlin«, auf Sex und Rausch, auf Frauen, die burschikos und emanzipiert auftraten. Erotische Affären, so die Behauptung, wären damals quasi an der Tagesordnung gewesen. Mit anderen Worten, Benn war keine Ausnahme – so waren die Zeiten! Aber waren die Zeiten so, ging es in Berlin wirklich so zu? Oder sind das nicht eher Klischees und Phantasien? Benn war, um das klarzustellen, in den Dreißigern, als er nach Berlin zurückkam, vierzig Jahre, als er die Liebesbeziehung mit der gerade einundzwanzigjährigen Mopsa Sternheim einging, also nicht mehr der Allerjüngste. Die zwanziger Jahre werden heute von der Forschung in puncto Sexualität und »Gleichberechtigung der Frau« (siehe Berufstätigkeit der Frauen, die nach dem Krieg eher zurückging, restriktive Ehe- und Scheidungsgesetze etc.) eher ambivalent gesehen – eine erotische Befreiung gab es, wenn überhaupt, dann für den Mann. Und dafür ist Benn das beste Beispiel.
In den Liebschaften des Dichters sieht die Forschung so etwas wie die ›dunkle Seite‹ Benns, die aber bekanntlich zum Genie dazugehört, also kann man sie nicht ganz negieren, nicht wegdisputieren, sie gehört offenbar ›irgendwie‹ zum kreativen Prozess. Zumal Benn selbst alles dafür getan hat, um seine Frauen-Geschichten publik zu machen, es gibt wohl kaum einen anderen Schriftsteller, der sich so mit seinen Affären gebrüstet hat und schon die bloße Anzahl seiner Liebschaften zum Renommee erhob. In sein Notizbuch schreibt er: »Ich habe mit sehr vielen Frauen ›was gehabt‹, über ganz Europa sind sie verstreut, auch USA!«
Das klingt ein wenig nach ›Don Juan‹ – und soll wohl auch so klingen. Don Juan rühmte sich bekanntlich damit, 1003 Geliebte allein in Spanien gehabt zu haben, sein Buchhalter (bei Benn hieß er F. W. Oelze) kam mit der Statistik kaum nach. Und wie wir wissen, ging es dem Frauenheld keineswegs um die umworbene Frau, sondern um deren Besitz, um die Brechung des Willens. Die Frau war eine Herausforderung seiner Machtgelüste, er wollte sie haben, um sie zu erniedrigen. Lieben unterstellt eine Wechselseitigkeit, und die war mit seiner Natur nicht zu vereinbaren. Don Juan setzte seine Bedürfnisse ohne jede Rücksicht auf gesellschaftliche und religiöse Normen durch. Sein Begehren nach der Frau, seine Herrschsucht, hatte etwas Antisoziales. Gerade die strengen Tugenden und Moralvorschriften forderten ihn heraus, steigerten den Reiz des Verlangens. So konnte er seine Eroberungen als einen Kampf gegen eine Gesellschaft umdeklarieren, in der die Lust als Sünde galt.
War es bei Benn nicht ähnlich? Er sah in seiner Promiskuität etwas Antibürgerliches. In vielen Gedichten feiert er den Tabubruch, das unkonventionelle Ausleben der Triebe. »Die Ehe«, es wurde oben zitiert, galt ihm als »Institution zur Lähmung des Geschlechtstriebes«. Monogamie, das war ihm ein Synonym für ›bürgerlich‹. Dahinter steckte freilich noch etwas anderes. Benn litt zeitlebens an depressiven Stimmungen. Man weiß heute, dass Depressionen und sexuelle Funktionsstörungen eng zusammenhängen. Bei einem großen Teil der Menschen, die an Depressionen leiden, kommt es zum Erschlaffen der Sexualität, ein kleiner Teil dagegen, man spricht von einer Untergruppe von etwa 10 Prozent, wird in der Depression sexuell aktiver.73 Diesen Menschen gelingt es, die Sexualität als therapeutisches Mittel einzusetzen, um aus der Stimmung herauszukommen, sich abzulenken und zu beleben. Menschen mit vielen und häufig wechselnden sexuellen Kontakten sind dabei, wie Untersuchungen zeigen, am erfolgreichsten. Ihre Promiskuität wirkt wie ein Antidepressivum. Benn gehörte vermutlich zu dieser Gruppe. Sex war für ihn, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Lebenselixier. Nur durch Sex konnte er aus einem Stimmungstief herauskommen, zu neuer Energie und Schöpferkraft zurückfinden. In gewisser Weise war Benn also zur Promiskuität ›verurteilt‹, machte daraus aber auch eine Haltung. Mit der propagierten und gelebten Promiskuität fühlte er sich außerhalb bzw. am Rand der Gesellschaft, sie stand für das von ihm so geliebte Anderssein, für das Abenteuer, die Herausforderung.
Und diese Herausforderung – kommen wir noch einmal auf Don Juan zurück – war dann am größten, wenn es sich um eine ›hochstehende‹ und ›gebildete‹ Frau handelte. Je tugendhafter und ehrsamer sie war, desto größer war für Don Juan die Verlockung. Mit anderen Worten, eine Prostituierte oder eine ›naive‹ Frau aus dem Volke war für ihn kein Objekt der Begierde. Was sollte er in diesem Fall überwinden? Wogegen sollte er kämpfen und seinen Machtwillen durchsetzen? Lust zog er allein aus der Unterwerfung einer hochgestellten, sittsamen Person, einer Person, die eigentlich ›so etwas‹ nicht macht. Der Reiz des Tabus spielte eine wesentliche Rolle, dazu aber bedurfte es der moralischen Fallhöhe. Es waren die religiösen und keuschen Damen von hoher Geburt, die Don Juan vor allem interessierten.
Dass Benn sich von den ›gebildeten‹ und ›hochstehenden‹ Damen, wie zum Beispiel Thea Sternheim, angezogen fühlte, war also so zufällig nicht, er folgte nur seiner Konstitution und seinen Gelüsten. Sobald die Damen oder »Partnerinnen« eigenständig wurden, beendete der Dichter das Verhältnis. Auf Geist hatte immer nur einer Anspruch: Gottfried Benn.
Die Frauen und die Macht spielten im Leben und Werk Gottfried Benns eine ganz entscheidende Rolle. Von den Frauen und der Macht fühlte er sich gleichermaßen herausgefordert, sie übten auf den Dichter eine höchst verführerische Wirkung aus, eine Wirkung, die so groß war, dass er sich immer wieder entziehen und zurückziehen musste. Benn sprach dann von seinem »Einsamkeitsdrang«, von seinem Hang zur Melancholie, seinen, wie er augenzwinkernd sagt, »Abnormitäten« – und davon, dass mit ihm, dem Solitär, eben ›kein Staat‹ zu machen sei.
Die Frauen und die Macht, ein großes, ein, in der Benn-Forschung, immer wieder angesprochenes Thema. Wenn es hier noch einmal aufgegriffen wird, dann hat das auch mit den beiden Frauen zu tun, die in diesem Buch im Mittelpunkt stehen sollen: Thea Sternheim und ihre Tochter Mopsa. Sie standen mit dem Dichter über viele Jahrzehnte in Kontakt, sie bewunderten und liebten ihn nicht nur, sondern setzten sich mit ihm auseinander, sie waren intime Kenner von Werk und Person, das unterscheidet sie von den vielen anderen Frauen Benns. Ihre Beziehung zu dem Dichter und ihr Leben sind der Fokus, aus dem die Geschichte erzählt werden soll. Eine Geschichte, die nicht losgelöst werden kann von dem Drama der Zeit – dem 20. Jahrhundert, einem »Zeitalter der Extreme«, so der britische Historiker Eric Hobsbawn. Eine bewegte und bewegende Zeit, eine Zeit des Aufbruchs, aber auch der großen Katastrophen und Menschheitstragödien.
Zwischen Aufbruch und Katastrophe spielt sich auch das Leben der drei hier im Vordergrund stehenden Protagonisten ab, es sind die beiden Pole, die in diesem Buch die Folie und den Resonanzraum bilden, um die Personen und ihre Lebensgeschichten sichtbar und begreifbar zu machen.
Spielen ist alles
Ach, man würfelt immer mal wieder und hofft auf drei Sechsen.
Benn im Gespräch mit Ursula Ziebarth, 1954
»Sie war klein, damals knabenhaft schlank, hatte pechschwarze Haare, kurzgeschnitten, was zu der Zeit noch selten war, große rabenschwarze bewegliche Augen mit einem ausweichenden unerklärlichen Blick.«1 So erinnert sich Gottfried Benn 1952 an Else Lasker-Schüler, die verehrte Dichterin, die er 1912, vielleicht auch erst 1913 (man weiß es nicht ganz genau), kennen- und – auch davon weiß man eigentlich wenig – lieben gelernt hatte. So ziemlich alles, was wir von dieser Liebe wissen, ist in Form von Gedichten und fiktionalen Texten überliefert. Da ist Vorsicht geboten – und Vorsicht ist selbst da geboten, wo es um ›Erinnerungen‹ geht. Benn kann sich an einiges erinnern, nicht nur an Figur, Haare, Augen und Blick, sondern auch an die bemerkenswerte Kostümierung der Dichterin, sie trug »extravagante weite Röcke oder Hosen, unmögliche Obergewänder, Hals und Arme behängt mit auffallendem, unechtem Schmuck, Ketten, Ohrringen, Talmiringen an den Fingern, und da sie sich unaufhörlich die Haarsträhnen aus der Stirn strich, waren diese, man muß schon sagen: Dienstmädchenringe, immer in aller Blickpunkt«2. Hat sie sich so gekleidet, so verkleidet? Mit Sicherheit kann man es nicht sagen. Sigrid Bauschinger, die Biographin Else Lasker-Schülers, schreibt, dass es von einer solchen Kostümierung »kein Bild« gäbe, es könne jedoch sein, dass sich Lasker-Schüler zuweilen so angezogen habe.3
Was das Aussehen und Auftreten der Dichterin angeht, so stand Benn mit seiner abschätzigen Beschreibung nicht allein. So sehr man in literarischen Kreisen ihre Gedichte lobte, ihr schrilles Erscheinungsbild war nicht jedermanns Sache, so mancher aus dem bürgerlichen Publikum entrüstete sich – eine Frau, die sich derart in Szene setzte, das war degoutant – freilich, so wollte sie auch wahrgenommen werden.
Im März 1916 besuchte Thea Sternheim eine Veranstaltung mit Else Lasker-Schüler in München: »Man stelle sich vor: Eine in den Dreissigern stehende Frau mit kurzen Haaren und auffallend stumpfen Fingern, zerzaust, wie durch Betten gerollt, liest in verdunkeltem Raum beim Schein zweier Kerzen vor einer Kalas einigen zwanzig Leuten, die erschüttert scheinen ihre jüdischen Balladen vor. Ich hörte da ich erst zum Schlusse der Vorlesung kam nur noch zwei. Sie beeindruckten mich ebenfalls, aber die Aufmachung der Frau ist nicht geeignet mich anzuziehen.«4
Die Dichterin, es ist bekannt, liebte das Maskenspiel, sie erfand Kunstfiguren, Doubles: Tino von Bagdad oder Prinz von Theben – ein Spiel mit Namen, aber nicht nur mit Namen, sie stattete die von ihr erfundenen Figuren mit Legenden aus, in denen sie zu leben versuchte, und kostümierte sich im Stil ihrer orientalisierten Phantasiegestalten. Um 1910 zeigte sie sich als Performance-Künstlerin in knabenhaft-männlichen Gewändern – Frauenkleider, die sie nach eigenem Bekunden nicht mochte, hätten zu ihrer Rolle als Prinz von Theben freilich auch nicht gepasst.
In Benns Rede »Erinnerungen an Else Lasker-Schüler«, die er im Februar 1952 im Berliner »British Centre« auf einer Gedenkveranstaltung zu Ehren der Dichterin hält, beansprucht er, einen anderen, unverstellten Blick auf die Künstlerin zu haben und sie besser zu kennen als alle anderen. Im »heutigen Berlin«, so sagt er gleich am Anfang seines Textes, gehöre er zu den »wenigen«, die sie »persönlich kannten« und sicher sei er »der einzige, dem sie eine Zeitlang sehr nahestand«.5 Nicht nur das, er sei »vermutlich auch der einzige, der am Grab ihres Sohnes Paul neben ihr stand«6. Ein intimer Freund und Vertrauter der Künstlerin also, darüber hinaus aber auch ein Zeitgenosse und literarischer Weggefährte, einer, der, wie Else Lasker-Schüler selbst, aus der Generation des expressionistischen Aufbruchs stammt.
Benn blickt zunächst zurück auf die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, die Belle Époque: »Es war 1912, als ich sie kennenlernte. Es waren die Jahre des ›Sturms‹ und der ›Aktion‹, deren Erscheinen wir jeden Monat oder jede Woche mit Ungeduld erwarteten. Es waren die Jahre der letzten literarischen Bewegung in Europa und ihres letzten geschlossenen Ausdruckswillens.«7 Benns große Zeit, eine, wie er sie auch in anderen Zusammenhängen schildert, heroische Zeit, der Anfang seiner Laufbahn als Dichter und zugleich die Geburtsstunde jener ›großen Generation‹, von der er immer wieder schwärmt. Benn erwähnt den ersten Gedichtband Else Lasker-Schülers, »Styx«, der 1902 erschien, und die von ihm besonders geschätzten »Hebräischen Balladen« – »vollendet im großen Stil«.
»Gottfried Benn ist der dichtende Kokoschka. Jeder seiner Verse ein Leopardenbiß, ein Wildtiersprung.« – Else Lasker-Schüler, 1912
Nach diesem Präludium geht er zur Nahaufnahme über. Er zeichnet das Bild einer Frau, die nicht in die bürgerliche Welt passte bzw. nicht zu ihr gehören wollte, einer Vagabundin.8 Sie lebte in Halensee in einem möblierten Zimmer, und habe, bis zu ihrem Tod im Januar 1945 in Jerusalem, nie eine eigene Wohnung besessen. Sie führte ein unstetes Leben am Rande der Gesellschaft, in der sogenannten Boheme. Nie konnte sie irgendwo wirklich Fuß fassen, nie sesshaft werden, eine umherschweifende, wurzellose, nomadische Existenz. Ihr Leben fristete sie in engen Kammern, »vollgestopft mit Spielzeug, Puppen, Tieren, lauter Krimskrams«.9 Eine Frau, die zwanghaft hortet und Dinge zusammenträgt, die für Außenstehende keine Bedeutung haben – »lauter Krimskrams« eben. Dazu passt dann auch der merkwürdige Kleidungsstil, den Benn unter dem Vorzeichen des Unechten, Übersteigerten, Überkandidelten und Skurrilen beschreibt. Was Benn aber besonders herausstellt, was ihn scheinbar frappiert, aber auch brüskiert, das war die uncharmante und geradezu herausfordernde Haltung, mit der sich die Künstlerin coram publico in Szene setzte. Spätestens, wenn er ihre »Dienstmädchenringe« erwähnt, spürt man Verachtung und Aggressivität. So, wie Benn die Dichterin beschreibt, legte sie es darauf an, nicht als Dame, sondern als Vagabundin erkannt zu werden. Er zeigt sie als eine Frau, die ihr Äußeres provokant darbot, die auffällt und auffallen wollte. Gleichwohl konnte man ihr nicht in die Augen sehen, sie hatte einen »ausweichenden und unerklärlichen Blick«.10 Mit anderen Worten, bei aller Zurschaustellung, die ihr eigen war, sie gab sich nie ganz den Blicken der Anderen preis.
War nicht ihr bizarres Äußeres nur Maskerade, ein Versuch, sich zu verhüllen, ihr Ich zu schützen? Auf Benn jedenfalls wirkt der ganze Aufzug ordinär – eine Dame, die etwas auf sich hält, zeigt sich nicht so in der Öffentlichkeit, das ist schlicht geschmacklos und bringt einen Mann in Schwierigkeiten: »Man konnte weder damals noch später mit ihr über die Straße gehen, ohne daß alle Welt stillstand und ihr nachsah.«11 Für Benn, der 1912 noch damit liebäugelte, eine Karriere als Arzt zu machen und eine bürgerliche Existenz zu begründen, konnte diese Frau nicht präsentabel gewesen sein. Noch 1952 schreckt er förmlich vor ihr zurück und nimmt Lasker-Schüler aus einer Mischung von Bewunderung und Abscheu wahr. Einerseits feiert er sie als »die größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte«12; in dieser Hinsicht kann er sich gar nicht genugtun, ihre Sprache zu loben, »ein üppiges, prunkvolles, zartes Deutsch, eine Sprache reif und süß, in jeder Wendung dem Kern des Schöpferischen entsprossen«13. Andererseits lösen ihre Themen, die, wie Benn bemerkt, »vielfach jüdisch« waren, eine gewisse Irritation bei ihm aus. Das Jüdische erscheint ihm wie ein Appendix. Und er wundert sich darüber, dass die Dichterin zeitlebens an diesem Thema festhielt, obwohl die Juden ihr nie den Rang zusprachen, der ihr eigentlich gebührte. Benn führt das darauf zurück, dass Person und Werk durch einen »exhibitionistischen Zug« gekennzeichnet seien. Lasker-Schüler »exponierte ihre schrankenlose Leidenschaftlichkeit, bürgerlich gesehen, ohne Moral und ohne Scham«.14 Mit diesem Exhibitionismus, behauptet Benn, hätte sich niemand identifizieren wollen.
Und Benn? Wie reagierte er 1912 auf die »schrankenlose Leidenschaftlichkeit« einer Frau, die immerhin siebzehn Jahre älter war als er? Die 43-jährige Else Lasker-Schüler, Tochter eines Wuppertaler Bankiers, gerade das zweite Mal geschieden, alleinerziehende Mutter, und der 26-jährige Benn, Sohn eines protestantischen Pfarrers aus Brandenburg, ein angehender Arzt, der sich zum Dichter berufen fühlte und soeben mit dem Zyklus »Morgue« in spektakulärer Art und Weise die literarische Bühne betreten hatte – »ein blonder schlanker, typisch preussisch aussehender Mensch«15. Sie waren – bei Licht besehen – ein ziemlich ungleiches Paar. Nicht nur, was den Altersunterschied und ihre Herkunft betraf, auch in ihrer Einstellung zur Kunst lagen sie weit auseinander. Für Else Lasker-Schüler waren Gedichte immer auch Botschaften, sie sollten sich an jemanden richten und waren dazu da, neue Räume zu schaffen, mit den Mitteln der Fiktion sollte die Wirklichkeit erweitert und vertieft werden. Im Gegensatz dazu hat Benn darauf beharrt, dass Gedichte sich an niemand richten sollen, sie entstehen nicht, sondern werden »gemacht«16, gemacht aus Worten, nicht aus Gefühlen und Phantasien: »Gedichte müssen nackt u. geschichtslos dastehn.«17
Mussten sie nicht aneinander vorbeireden? Sie taten es und verstanden sich trotzdem, jedenfalls eine Weile. Es war ein Spiel mit verteilten Rollen. Lasker-Schüler war für Benn eine Frau, die anders war als die Frauen, die er bisher kennengelernt hatte, denn sie nahm sich ihre Freiheit und beanspruchte, wie er feststellen musste, »über sich allein zu verfügen«18. Sie war Teil, ja Mittelpunkt einer antibürgerlichen Boheme, eines künstlerischen Vagabundentums, das sich damals im Berliner Café des Westens, dem sogenannten ›Café Größenwahn‹ am Kurfürstendamm, Ecke Joachimsthaler Straße, versammelte. Hier trafen sich vor dem Krieg die Akteure und Propagandisten der expressionistischen Bewegung. Neben Else Lasker-Schüler und ihrem Mann Herwarth Walden, mit dem sie bis 1912 in zweiter Ehe verheiratet war, gehörten zum Kreis der Caféhaus-Boheme: René Schickele, Roda Roda, Jakob van Hoddis, Erich Mühsam, Carl Sternheim, John Höxter und der Dichter der »Katerpoesie« Paul Scheerbart, der sich hier zu seinen bezaubernden, immer wieder rezitierten Versen inspirieren ließ: »Charakter ist nur Eigensinn. Es lebe die Zigeunerin!« Im ›Café Größenwahn‹ debattierte man über Ideen und Projekte, und manche wurden sogar in die Tat umgesetzt und im Café aus der Taufe gehoben: 1910 gründete Herwarth Walden die Zeitschrift »Der Sturm«, 1911 rief Franz Pfemfert »Die Aktion« ins Leben.
Das war das Umfeld, in dem sich Benn um 1912 bewegte. Er selbst, so erinnert sich ein Mitstreiter, sah nicht gerade aus wie ein deutscher Baudelaire, sondern eher wie ein deutscher Offizier in Zivil: »Benn trug einen hellen, sehr kurzen Sommermantel, einen ›Covercoat‹, der oberhalb der Knie in modischer Weise mit mehreren Nähten abgesteppt war und dazu einen schwarzen, steifen Hut, eine ›Melone‹, wie sie heute nur noch bei Beerdigungen üblich ist. […] Es war ein Anblick für Götter, wenn dieser korrekt gekleidete junge Mann das ›Café des Westens‹ betrat und sich an den Tisch der Else-Lasker-Schüler setzte. An den Armen dieser zigeunernden Bohemienne klingelten Metallreifen aus sämtlichen Ländern, von Island bis Indien, und Benn saß dieser Frau gegenüber wie ein Manager, der den Versuch macht, sie für einen Wanderzirkus zu gewinnen.«19
Unter den städtischen Nomaden war er ein Exot, jemand, der, vom Äußeren her gesehen, eigentlich nicht dazugehörte, der wie ein Fremdkörper wirkte. Das machte ihn aber offenbar nicht verdächtig, es machte ihn interessant – ein Mann aus einer anderen Welt, aus einer anderen Zeit, der sich in die Boheme verirrt hatte – dazu noch jung, als Liebhaber noch relativ unerfahren, eine stattliche, athletische Erscheinung.
So musste ihn Else Lasker-Schüler gesehen haben. »Sie nannte mich Giselher oder den Nibelungen oder den Barbar«20, wie Benn nicht ohne Stolz anmerkt. Else Lasker-Schülers Phantasie kannte keine Grenze, hatte sie erst einmal Namen gefunden, ging es hemmungslos weiter. Unter der Chiffre ›Giselheer‹ entfaltete sie in ihrer Dichtung eine intrikate Beziehung auf Leben und Tod:
Giselheer dem Tiger
Über dein Gesicht schleichen die Dschungeln.
O, wie du bist!
Deine Tigeraugen sind süß geworden
In der Sonne
Ich trage dich immer herum
Zwischen meinen Zähnen.
Du mein Indianerbuch,
Wild West,
Siouxhäuptling!
Im Zwielicht schmachte ich
Gebunden am Buxbaumstamm –
Ich kann nicht mehr sein
Ohne das Skalpspiel
Rote Küsse malen deine Messer
Auf meine Brust –
Bis mein Haar an deinem Gürtel flattert.21
›Giselheer‹, so hieß der jüngste der drei burgundischen Könige aus dem »Nibelungenlied« – ein Germane also.
In insgesamt siebzehn Gedichten inszeniert Else Lasker-Schüler eine Art Liebesdrama, darunter die vier Gedichte »Giselheer dem Heiden«, »Giselheer dem Knaben«, »Giselheer dem König« und das oben zitierte »Giselheer dem Tiger«. Das Motto des Zyklus gibt die Richtung des Dramas an:
Der hehre König Giselheer
Stieß mit seinem Lanzenspeer
Mitten in mein Herz.22
Else Lasker-Schüler, so viel scheint sicher, hat Benn Giselheer genannt, aber ob und wie weit er mit jenem besungenen Giselheer identisch ist, darüber ist viel spekuliert worden. Verbirgt sich dahinter eine Realität, ein wirkliches Liebesdrama? Hat Benn der Dichterin das Herz gebrochen? Oder ist das Ganze nur ein Spiel? – ein Spiel, das auf einer gewissen Realität basiert und dann abhebt. An ihren Freund und Förderer Karl Kraus schreibt Else Lasker-Schüler 1911: »Jedenfalls liebe ich nach meiner Sehnsucht die Leute alle zu kleiden, damit ein Spiel zu Stande kommt […]. Spielen ist alles. […] Ich bin von Natur Räuberhauptmann, jedes Geschöpf muß mir freiwillig oder gewalttätig Tribut zahlen.«23
Sigmund Freud hat in seinem Vortrag »Der Dichter und das Phantasieren« darauf aufmerksam gemacht, dass Spiel nicht der Gegensatz zum Ernst ist. Spiel und Ernst gehören zusammen, sind aufeinander bezogen. Derjenige, der spielt, nimmt die Dinge ernst, er verwendet »große Affektbeträge« darauf, die »Welt in eine neue, ihm gefällige Ordnung«24 zu bringen. Er erzeugt eine »Phantasiewelt«25, die zwar von der Wirklichkeit gesondert ist, nichtsdestotrotz aber Wirkungen entfaltet. Man leidet unter Phantasien, sie verschaffen aber auch Genuss, denn sie halluzinieren eine Realität, die man in Wirklichkeit nicht haben, nicht leben kann. »Unbewußte Wünsche«, so Freud, »sind die Triebkräfte der Phantasien, und jede einzelne Phantasie ist eine Wunscherfüllung, eine Korrektur der unbefriedigenden Wirklichkeit.«26
Else Lasker-Schüler betrieb mit ihren Phantasien solche Korrekturen, mit ihren Schöpfungen setzte sie sich ab von einer Wirklichkeit, in der sie mit ihren Wünschen und ihrer Sinneslust keinen Platz fand. Denn eins ist offensichtlich, es geht hier, die Indizien im Text sind unübersehbar, um erotische Wünsche, um ein Spiel mit einer sadomasochistischen Wunschphantasie.
Im »letzten Lied an Giselheer«, in dem berühmten Gedicht mit dem Titel »Höre«, findet sich die häufig zitierte Zeile »Ich bin dein Wegrand (…)«. War das wirklich, wie man vermutet, eine Antwort auf Benns Gedicht »Hier ist kein Trost«?, das mit dem Vers beginnt:
Keiner wird mein Wegrand sein.
Laß deine Blüten nur verblühen.
Mein Weg flutet und geht allein27
Benn selbst zitiert 1952 Else Lasker-Schülers Gedicht »Höre« und feiert es als ästhetisches Ereignis, die Verse würden »zu den schönsten und leidenschaftlichsten« gehören, »die sie je geschrieben hat«28. Es waren nicht irgendwelche Verse, sie richteten sich, auch das verschweigt er nicht, an »Dr. Benn«. Zuvor aber habe er selbst der verehrten Dichterin seine Sammlung »Söhne« mit einer Widmung übereignet. Benn erweckt den Eindruck, jeder habe auf seine Art an den Anderen gedacht, ihn in sein kreatives Schaffen einbezogen. Nun sind die »Söhne« im engeren Sinn keine Liebesgedichte, sie thematisieren das Thema der expressionistischen Generation, den damals vielfach aufgegriffenen Vater-Sohn-Konflikt. Der Zusammenhang war ein anderer, den Benn nicht erwähnt. Er suchte damals einen arrivierten Verleger, und Else Lasker-Schüler setzte sich bei Kurt Wolff intensiv, aber schließlich erfolglos für ihn ein.
Die ablehnende Haltung des Verlegers gegenüber Benn ist bemerkenswert, denn Wolff, der bis 1912 gemeinsam mit Ernst Rowohlt einen Verlag führte und sich dann selbstständig machte, war besonders interessiert an Autoren, die sich der jungen expressionistischen Bewegung zugehörig fühlten. Im Kurt Wolff Verlag erschienen die wichtigsten Autoren des Expressionismus: Walter Hasenclever, Franz Werfel, Carl Ehrenstein, Kasimir Edschmid, Johannes R. Becher und auch, 1916, Gottfried Benn, aber mit seinem Prosazyklus »Gehirne«. Für Benns Lyrik konnte sich der Verleger nicht erwärmen, er mochte den Provokateur und den ›rotzigen‹ Ton seiner Gedichte nicht. Was die expressionistische Lyrik anging, so war Franz Werfel für ihn das Maß aller Dinge. Mit seiner pathetischen Bejahung des Lebens, der menschlichen Gemeinschaft und der Liebe stand Werfel der »Morgue«-Lyrik diametral entgegen. 1912 stellte Wolff den jungen und überaus erfolgreichen Prager Dichter als Lektor ein, und dieser formulierte dann die Ankündigung der legendären Reihe »Der jüngste Tag«. Das darin entworfene Bild vom Dichter als Missionar und »Prediger« einer neuen Menschlichkeit, der sich nicht am Tonfall und an der Sprache berauscht, sondern an den Gefühlen und Stimmungen, die er auslöst, dieses Bild hob sich deutlich von den Stilisierungen Benns ab.
Else Lasker-Schüler waren diese Unterschiede bewusst, sie sah in Benn jedoch ein Original und machte für ihn regelrecht Propaganda. Werk und Person vermochte sie dabei kaum zu trennen. Sie sah den Dichter als Verkörperung und Bürge seiner Kunst, als Mann, der sich mit seiner ganzen Physiognomie in seiner Lyrik ausdrückt. Bei Kurt Wolff, dem Adressaten ihrer Vermittlungsversuche, entstand der Eindruck, Else Lasker-Schüler und Benn seien ein Paar, was sie nachdrücklich bestritt: »Ehrenwort […] Ich stehe Dr. Benn nicht was Liebe betrifft nah.«29 Es gehe ihr allein um die Gedichte, die nämlich habe »ein wirklicher Tiger gedichtet.« Und dieser Tiger sei obendrein noch »Arzt-Operateur und direkt mächtig.«30