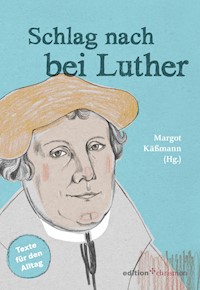Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: adeo
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Unsere Zeit ist begrenzt. Das macht sie so kostbar. Wer das wahrnimmt, lebt anders. Dankbarer. Margot Käßmann schreibt offen über eigene Verlusterfahrungen und was sie dann getragen hat. Wie man in schweren Zeiten Trost findet, weil man weiß, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Ihr Buch macht Mut, sich bezeiten den großen Fragen des Lebens und Sterbens zu stellen - damit das Leben gelingt. "Ich bin überzeugt: Es tut gut, ans Sterben zu denken - für das Leben! Gerade wer die eigene Endlichkeit und die anderer nicht ignoriert, lebt intensiver. 'Wie will ich leben, damit ich am Ende in Frieden sterben kann?', darum geht es. Ich verstehe das Leben als geschenkte Zeit, die ich nutzen, verantworten und auch auskosten will." Margot Käßmann
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dankbarer und liebevoller Erinnerung an meine Mutter und meinen Vater
Voller Hoffnung leben.In Frieden sterben.
Das
Zeitliche
segnen
Margot Käßmann
Inhalt
Vorwort
1 – Auf dass wir klug werdenSterben in Deutschland heute
2 – Noch bist du daAbschiedsschmerz
3 – Verlorene LiebeErinnerung und Trauer
4 – Erde zu ErdeBestärkende Rituale
5 – Kinder und TodAngst und Endlichkeit
6 – Wie kann Gott das zulassen?Vom Ringen mit Zweifeln
7 – Auferstanden von den TotenZuversicht des Glaubens
8 – Wenn meine Zeit zu Ende gehtPersönliche Vorbereitung
9 – In Frieden sterbenEthische Herausforderungen
10 – Von der LebenslustDas Leben in Fülle leben – gerade weil es Grenzen gibt
Nachsatz
Quellenhinweise
Vorwort
Es tut gut, ans Sterben zu denken – für das Leben! Wer die eigene Endlichkeit und die anderer nicht ignoriert, hat einen anderen Blick auf die Zeit. Damit du dein Leben bewusst lebst, muss es doch nicht erst zu einer Krebsdiagnose kommen – auch wenn das manches Mal so vermittelt wird!
Wie will ich schon jetzt leben, damit ich am Ende in Frieden sterben kann? Darum geht es. Ich verstehe das Leben als geschenkte Zeit, die ich nutzen, verantworten und auch auskosten will. Gerade, dass unsere Zeit begrenzt ist, macht sie doch so kostbar. Gewiss, der Tod ist schmerzhaft, die Angst vor dem Sterben ist groß. Aber die ewige Fortsetzung unseres Lebens ist doch auch nicht unbedingt ein beglückender Gedanke. Oder, wie der Theologe Heinz Zahrnt einmal schrieb: „Für immer leben, das wäre nicht das ewige Leben – es wäre die ewige Hölle.“1 Mit Blick auf eine Zukunft bei Gott kann ich mir ewiges Leben durchaus vorstellen. Eines steht für mich fest: Wer über das Sterben nachdenkt, lebt intensiver.
Und wer vorbereitet stirbt, entlastet die Angehörigen. In manchem Beerdigungsgespräch habe ich die Hilflosigkeit von Angehörigen erlebt. Sie hatten meist nie zuvor mit den Verstorbenen oder auch untereinander über das Sterben gesprochen. Wollte die Mutter eine Sarg- oder eine Urnenbestattung? War es richtig, am Ende einer Organspende zuzustimmen? Wen eigentlich müssen wir informieren, hatte der Bruder eine Adressliste? Wollen wir um Spenden bitten, Blumenkränze bestellen? Muss es überhaupt eine Todesanzeige geben? Hätte der Großvater sich ein bestimmtes Lied gewünscht zur Trauerfeier? Wenn die meisten der bei einem Todesfall anstehenden Fragen im Vorfeld geklärt sind, wird der Abschied nicht von so vielen notwendigen Entscheidungen belastet, die innerhalb sehr kurzer Zeit zu treffen sind. Und auch im Nachhinein gibt es nicht diese Frage: Hätten wir es vielleicht ganz anders machen sollen?
Wenn wir über das Sterben anderer und auch den eigenen Tod sprechen, bringt das in der Regel eine existenzielle Vertiefung des Gesprächs mit sich. Der Blick weitet sich, von den Banalitäten kommen wir zu den Grundfragen des Lebens. Das tut gut, weil es dem Leben Tiefgang bringt.
Schließlich: Wer Sterbende begleitet, Abschied nehmen muss, Trauernde tröstet, scheint ein wenig „aus der Zeit“ herauszutreten. Du bist mit den Gedanken woanders. Gewiss, das Leben geht weiter. Aber Sterben, Abschied und Trauer brauchen Raum und Zeit. Es ist wichtig, dass wir diesen Raum und diese Zeit schaffen. Für die Lebenden! Die irgendwann selbst sterben werden …
Ich würde mich freuen, wenn dieses Buch zum eigenen Nachdenken und zum Miteinander reden anregt. Es geht um ein Thema, das in der Tat uns alle angeht. Und um ein Thema, zu dem der christliche Glaube viel zu sagen hat. Wer über Sterben und Tod nachdenkt, thematisiert letztendlich das Leben.
Berlin, im Juli 2014
Margot Käßmann
1 Heinz Zahrnt, Glauben unter leerem Himmel, München 2000, S. 250.
Anfang des Jahres 2014 sind alle Medien voll davon: Michael Schumacher ist am 29. Dezember 2013 schwer gestürzt. STERN und SPIEGEL titeln mit der Geschichte. Wie kann einem Rennfahrer der Formel 1 so etwas passieren? Einer der erfolgreichsten Autorennfahrer der Welt stürzt beim Skifahren auf einen Felsen, trägt zwar einen Helm, ist aber dennoch schwerstverletzt? Das kann doch nicht wahr sein! Er wird doch gerade erst 45 Jahre alt. Unfassbar.
Die Erkenntnis von Verletzbarsein und Sterblichkeit schockiert in einer Welt des „höher, größer, schneller und weiter“. Wer denkt schon an Endlichkeit! Da muss doch etwas gemacht werden können. Ehefrau und Kinder, Angehörige und Fans von Michael Schumacher erleben das, was viele immer wieder erfahren müssen: ein Unfall als Schock. Die Bedrohung durch lebenslange Behinderung als Angstvorstellung. Andere trifft eine Krebsdiagnose. Unvermutet wird sie zur totalen Irritation des Alltags. Der Tod als nie bedachte Möglichkeit schockiert, versetzt in einen Ausnahmezustand – wobei ein Autorennfahrer dieses Thema gewiss weniger ausgeblendet hat als viele andere.
Es zeigt sich immer wieder: Das Thema Sterben und Tod kommt für viele Menschen erstaunlicherweise absolut überraschend. Eine ARD-Themenwoche hat das vor ein paar Jahren sehr schön mit ihrem Titel auf den Punkt gebracht: „Sie werden sterben. Lassen Sie uns darüber reden.“ Ich war dabei, als Dagmar Reim, die Intendantin des RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg), versuchte, das Thema der Konferenz der Senderbeauftragten schmackhaft zu machen. Da gab es viel Widerstand und Skepsis: Ist so ein thematischer Schwerpunkt nicht ein Quotenkiller? So etwas wirkt doch total negativ auf die Stimmung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Und dann auch noch im November! Das zieht doch total runter …
Am Ende stand eine der erfolgreichsten ARD-Themenwochen überhaupt. Es gab Kindersendungen, Hörspiele, Expertendiskussionen und Filme zum Thema. Die Resonanz war enorm und es zeigte sich: Viele wollen reden, wir brauchen solche Anlässe zum Reden.
Den Auftakt zur Themenwoche bildete ein Tatort, dann folgte eine Talkrunde bei Günther Jauch. Gäste an diesem Abend waren der Trauerbegleiter Fritz Roth, der in Bergisch-Gladbach ein Bestattungshaus gegründet hat, der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach und Bastian Brauns, ein junger Medizinstudent, begleitet von seiner Freundin Katharina Reingen. Alle drei Männer kämpften gegen den Krebs. Es war bewundernswert, wie offen sie über ihre Krankheit sprachen. Roth und Bosbach waren befreundet und scherzten geradezu über den eigenen bevorstehenden Tod, sodass ich mich als weiterer Gast in der Runde an ein Wort des Apostels Paulus erinnert fühlte: Tod, wo ist dein Sieg? (1 Kor 15,55).
Aber schon während der Sendung, in der auch ich Gast war, und stärker noch danach hatte ich ein gewisses Unbehagen. Zunächst wusste ich noch nicht warum. Später wurde mir klar: Die Stimmung war fast zu optimistisch-positiv. Zum einen war das gewiss gut und hat zu viel positiver Resonanz auf die Sendung sowie großem Respekt gegenüber den Betroffenen geführt. Für den Schmerz aber, den es auch bedeutet, das Leben und die eigenen Lieben loslassen zu müssen, blieb nicht wirklich Raum. Und auch die Angst und die Trauer der Angehörigen kamen nicht zur Sprache. Dabei waren durchaus Angehörige im Publikum und in der Runde selbst anwesend. Im Nachhinein habe ich mir den Vorwurf gemacht, nicht auch ihre Gefühle angesprochen zu haben.
Es ist wichtig, offen über den Tod zu sprechen, o ja! Und ich hoffe, dass viele, die zugeschaut haben, auch selbst ins Nachdenken und Reden kamen. Aber schönreden können wir den Tod auch nicht. Er tut weh, ganz gleich wie alt wir sind. Eine Freundin macht es bis heute zornig, dass beim Tod ihrer Mutter viele meinten, sie müsse doch eigentlich froh sein, die Dame war schon sehr alt und saß zudem im Rollstuhl – als täte der Tod nicht dennoch weh, wenn die eigene Mutter stirbt. Es geht darum, wie wir eine Balance finden zwischen dem offenen Umgang mit Tod und Sterben einerseits und der Realität von Schmerz und Trauer andererseits.
Simone de Beauvoir hat in einem Buch mit dem Titel „Ein sanfter Tod“, in dem sie über den Tod ihrer Mutter nachdenkt, ihre Überraschung geschildert, wie sehr sie das Geschehen erschüttert hat. Bevor ihre eigene Mutter starb, konnte sie die tiefe Trauer anderer nicht nachvollziehen. Sie schreibt: „Ich verstand nicht, dass man allen Ernstes um einen Angehörigen, einen alten Verwandten weinen kann, der über siebzig Jahre alt ist. Wenn ich einer fünfzigjährigen Frau begegnete, die verzweifelt war, weil sie eben ihre Mutter verloren hatte, hielt ich sie für neurotisch: Wir sind alle sterblich; mit achtzig Jahren ist man wohl alt genug, einen Toten abzugeben …“
So schrieb sie mit Distanz. Als sie am Sterbebett ihrer eigenen Mutter saß, dachte sie anders darüber, wollte aufbegehren gegen diesen Tod, erlebte das Sterben als endgültigen Abschied, der sie tief berührte.
Wenn Vertrautheit die Angst nimmt
Ähnliches erleben viele Menschen. Sendungen wie die von Günther Jauch leisten einen Beitrag dazu, uns für die Nöte anderer zu sensibilisieren.
Aber erst nach einer eigenen Verlusterfahrung kannst du wirklich nachvollziehen, wie es anderen in einer ähnlichen Situation ergeht.
Fritz Roth starb wenige Wochen nach jener Sendung am 14. Dezember 2012. Er hat in seinem Leben unermüdlich für eine würdige Kultur von Sterben, Trauer und Bestattung in Deutschland gekämpft. Sein Haus bietet nicht nur ganz individuelle Bestattungen, sondern er hat auch eine Trauer-Akademie gegründet, ein Haus der menschlichen Begleitung. Wir sind uns öfter begegnet und seine Projekte haben mich beeindruckt: etwa der „Koffer für die letzte Reise“. Fritz Roth hatte 100 Menschen eingeladen, einen Koffer zu packen, mit dem, was sie gern mitnehmen würden auf ihre „letzte Reise“, wenn sie denn könnten. Als Ausstellung waren diese Koffer an vielen Orten zu sehen. Sehr verschiedene Gegenstände hatten Menschen eingepackt: Die einen nahmen eine Puppe mit. Andere Fotos von Angehörigen oder auch Briefe und Karten. Mancher eine Flasche Wein, einer Musiknoten, eine andere die Bibel. Einer legte einen Zettel hinein mit dem Satz: „Ich kann ohne Gepäck gehen und gehe ohne.“ Symbolisch zeigen die Koffer, was Menschen wichtig ist, ihnen am Herzen liegt. Ich finde es anregend, selbst darüber nachzudenken: Was käme in meinen Koffer?
In seinem Buch „Das letzte Hemd ist bunt“ schreibt Fritz Roth, es gehe „… um die Frage, wie wir die Handlungsspielräume füllen und die Vertrautheit mit Tod, Abschied und Trauer zurückgewinnen.“2 Diese „Vertrautheit“ scheint mir ein zentraler Punkt zu sein. Das Wegschließen des Todes hinter die Mauern von Angst, Sprachlosigkeit und Unkenntnis und auch das Abschieben der Sterbenden in Heime und Krankenhäuser lässt die Unsicherheit und die Angst immer größer werden. Stattdessen bräuchte es so dringend das gemeinsame Gespräch, um all das Bevorstehende benennen und bewältigen zu können.
Für mich als Pfarrerin ist das Sterben immer wieder sehr konkret geworden: am Sterbebett, beim Trauergespräch mit den Angehörigen, am offenen Sarg, bei der Beerdigung, in der Begleitung von trauernden Menschen. Auch in meinem eigenen Leben haben Sterben und Tod mich oft unmittelbar berührt. Mich treibt nicht die Angst vor dem Tod um, da hält und trägt mich mein Gottvertrauen. Das Ignorieren der eigenen Sterblichkeit empfinde ich als traurig. Mich bedrückt auch die Sprachlosigkeit zwischen Menschen, die sich sehr nahe sind, wenn es um das Thema Abschied geht. Dabei ist doch die Erfahrung: Wo zwei miteinander über „letzte Dinge“ sprechen, lernen sie viel übereinander, wird die Beziehung persönlicher, tiefer.
Wer sich den anstehenden letzten Fragen stellt, die Begrenztheit des eigenen Lebens wahrnimmt, kann bewusster das Geschenk des Lebens, die geschenkte Zeit annehmen. Das wusste schon der Psalmbeter, wenn er sagt: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden (Psalm 90,12). Ein Buch über das Sterben wird daher immer ein Buch über das Leben sein, über die Lebensklugheit, die es zu lernen gilt.
Der ganz normale Tod
Doch wer hat heute Gelegenheit, einem Sterbenden die Hand zu halten, wenn er oder sie nicht beruflich oder ehrenamtlich damit befasst ist? Wer erlebt noch eine Aussegnung zu Hause oder den Abschied am offenen Sarg? Beginnt jemand, über das eigene Sterben zu sprechen, wird sehr schnell abgewiegelt und das Thema gewechselt. Die meisten Menschen setzen sich erst dann mit solchen Fragen auseinander, wenn sie die Augen davor nicht mehr verschließen können, weil ein enger Angehöriger schwer erkrankt ist, eine Freundin im Sterben liegt oder sie selbst eine entsprechende Diagnose bekommen haben. Im Alltag kommt der Tod kaum vor, hat das Sterben keinen Raum. In Fernsehkrimireihen, Computerspielen und in den Nachrichten spielt der Tod dagegen sehr wohl eine wichtige Rolle. Hier wird jeden Sonntag ein „Tatort“ gesichert, werden virtuelle Menschen abgeschossen, Prominente betrauert und von den vielen Toten durch Krieg und Terror in aller Welt berichtet. Aber das tägliche Ringen mit dem Tod in Wohnungen, Altenheimen und Krankenhäusern, das „ganz normale Sterben“ also, kommt selten vor, weder in den Medien noch im Erleben der Menschen.
Dabei sterben jedes Jahr rund 860000 Menschen in unserem Land. Das heißt 860000 Frauen, Männer und Kinder stehen vor den letzten Fragen. Und ihre Angehörigen auch! Die meisten (66 Prozent3) wünschen sich, zu Hause zu sterben. Aber das ist nur bei 25 Prozent Realität, die Mehrheit beendet ihr Leben im Krankenhaus (40 Prozent) oder einer stationären Pflegeeinrichtung (30 Prozent). Gerade in Krankenhäusern gibt es aber wenig Raum und Zeit für Sterbende oder Trauerangebote für Angehörige. Vieles hat sich in den letzten Jahren zwar verbessert – dass Menschen alleingelassen und abgeschoben auf dem Flur sterben, ist nicht mehr der Fall. Aber im Klinikalltag ist es schwer, Abschied zu gestalten, und dem Pflegepersonal wird meist keine Zeit zugestanden, um Sterbende zu begleiten oder gar Angehörige zu trösten. Oft gibt es auch noch immer keinen würdigen Abschiedsraum.
Jede Krankheitsgeschichte und jedes Sterben ist individuell verschieden. Ob Prominenter oder Erika Mustermann – es lässt sich nicht in Fallpauschalen ausdrücken und als Situation vorhersehen. Natürlich gibt es ähnliche Krankheitsverläufe, können anhand bestimmter Symptome Vorhersagen getroffen werden. Aber die 860000 Menschen, die pro Jahr in Deutschland sterben, können nicht „über einen Kamm geschoren“ werden. Das Leben ist unvorhersehbar. So wenig wie wir Geburten im Detail planen und regeln können, so wenig absoluten Einfluss haben wir letztlich auch auf Krankheit und Sterben. Natürlich bietet die moderne Medizin viele Möglichkeiten einzugreifen. Aber am Ende werden wir alle sterben.
Es geht darum, die persönliche Geschichte der Menschen, die uns nahestehen, mitzuerleben, sie zum Teil unseres Lebens und unserer Gespräche zu machen. Erfahrungen zu sammeln, mitten im Leben.
Von Herausforderungen bei der Pflege
Angesichts von Pflegebedürftigkeit nahestehender Menschen kommen viele an ihre Grenzen. Was ist der richtige Schritt? Kann ich zusagen, die Pflege zu übernehmen? Oder kann ich auch sagen, dass ich das nicht schaffe, dass wir andere Lösungen als eine häusliche Pflege brauchen? Dabei ist niemandem ein Vorwurf zu machen. Vorwürfe anderer und Selbstvorwürfe, das schlechte Gewissen, die mangelnde Akzeptanz – all das trägt zur Tabuisierung der realen Probleme bei. Für Angehörige ist es schwer, jemanden bis zum Ende zu pflegen. Einerseits ist es ein körperlicher Kraftakt, andererseits zeitlich kaum zu leisten, wenn die Angehörigen berufstätig sind. Und wenn sie es dennoch tun und den Kranken nach Hause holen, wird misstrauisch nachgefragt. Das haben Freunde kürzlich erlebt, die ihre Mutter zu Hause pflegen. Die Einstufung in Pflegestufe 3 wurde infrage gestellt, weil beide, Tochter und Schwiegersohn, in Vollzeit berufstätig sind. Das könne nicht funktionieren. Beide haben jedoch Berufe, mit denen das vereinbar ist. Nach neuen gesetzlichen Regelungen können Angehörige eine berufliche Auszeit von bis zu zehn Tagen, bei Betrieben mit mehr als 15 Mitarbeitenden sogar bis zu sechs Monaten nehmen. Anders als in der Elternzeit gibt es jedoch keine finanzielle Unterstützung. Wie also soll das gehen?
Pflegekräfte werden daher aus Polen und anderen osteuropäischen Ländern angeworben, um 24 Stunden präsent zu sein. Im Internet gibt es zahlreiche Angebote. Eine 24-stündige Pflege ist schon ab 1400 € im Monat möglich. Die zu Pflegenden oder ihre Angehörigen sind in solchen Fällen in der Regel nicht Arbeitgeber, sondern die Anstellung erfolgt per „Entsendung“ durch eine Firma mit Sitz in Polen. So wird die Pflegekraft in der Regel nach polnischen Stundenlöhnen bezahlt und ein großer Teil des Geldes geht an die entsprechende Firma. Nur selten ist dies eine für alle Seiten wirklich zufriedenstellende Lösung. Aber wie soll die Pflege bewältigt werden? 24 Stunden zu Hause präsent sein – das ist für Angehörige wie für Pflegekräfte eine völlige Überforderung.
So hat kürzlich ein Buch starke Resonanz erhalten, in dem eine Frau den Kraftakt der Pflege beschreibt: Martina Rosenberg, „Wann stirbst du endlich, Mutter?“. Sie schildert, wie schwer es ist zu pflegen, wie zermürbend, da ja auch die Gepflegten nicht ständig dankbar und zufrieden sind. Sie beschreibt die Distanz, die notwendig ist, um sich nicht völlig zu erschöpfen, das schlechte Gewissen, nicht allen gerecht zu werden. Viel zu wenig wird darüber berichtet, geschrieben, gesprochen, welche Belastung Pflege bedeutet. Das Thema braucht viel mehr Öffentlichkeit! Und Angehörige brauchen Unterstützung. Es geht auch um Nachbarschaft. Weiß ich in einer anonymer werdenden Gesellschaft überhaupt noch, wer im Haus oder in der Wohnung nebenan wohnt? Wie können neue Kontakte geknüpft werden, damit jemand sagt: Ich komme vorbei. Oder anbietet, die pflegende Tochter mal für ein paar Stunden zu entlasten? Wie kann die Isolation in Pflegeheimen aufgebrochen werden?
Auch mit Blick auf die professionelle ambulante Pflege stellen sich diese Fragen. Ich habe einmal eine ambulante Pflegerin begleitet. Was da geleistet wird, verdient höchsten Respekt. Mit dem Auto geht es von einer Person zur anderen. Allein die Parkplatzsuche ist schon ein Problem. Und dann bleiben für die „große Morgenwäsche mit Toilettengang“ exakt 23 Minuten, die abgerechnet werden können. Das ist für die Pflegenden wie die Gepflegten kaum zu ertragen. Da ist kein Platz für Persönliches, sondern es herrscht enormer Leistungsdruck. Deshalb ist es notwendig, dass die sogenannte Zivilgesellschaft sich einbringt, wir alle also, indem Nachbarn mit hinschauen, sich Zeit nehmen, zu Besuch kommen und so möglichst viele einen Beitrag leisten. Das mag unrealistisch oder gar naiv klingen in einer Zeit, in der alle sehr mit sich selbst beschäftigt sind, viele großen Leistungsdruck verspüren. Aber ich bin überzeugt, ein Mehr an Miteinander würde auch insgesamt das Lebensgefühl verbessern.
Bei familiärer Pflege haben viele ganz zuletzt auch Angst, etwas zu versäumen. Selbst auf dem Dorf habe ich erlebt, dass die Großmutter noch für die letzten 24 Stunden in ein Krankenhaus gebracht wurde, weil alle befürchteten, etwas falsch zu machen. Die alte Dame wäre gewiss lieber zu Hause geblieben. Die Angst aber rührt aus Ungewohntheit, Unkenntnis. Würden wir das Sterben öfter erleben, wäre das sicher anders.
In Heimen und in Krankenhäusern hat das Personal nicht die Zeit, das Sterben intensiv zu begleiten. Auch hier ist kein Vorwurf zu machen. Die Mitarbeitenden haben hohe Anerkennung verdient für ihren Einsatz, an sie werden enorme Anforderungen gestellt. Aber so sehr sich viele bemühen: Niemals wird es möglich sein, intensive Pflege und Begleitung voll zu finanzieren. Unterstützung ist notwendig. Ich denke beispielsweise an die „Grünen Damen“, die ehrenamtlich Menschen in Krankenhäusern und Alteneinrichtungen begleiten, betreuen und helfen, sie zu versorgen.
Die Hospizbewegung – Sterbende begleiten
Besondere Hoffnung macht diesbezüglich die Hospizbewegung. Sie ist in England entstanden, wo Cicely Saunders 1967 die erste Einrichtung dieser Art gründete. Es geht darum, die Sterbenden wieder stärker in den Blick zu nehmen und ihnen und ihren Angehörigen beizustehen, damit ein würdevolles Lebensende ermöglicht wird. Grundprinzip der Hospizbewegung ist, den Menschen ganzheitlich zu begleiten, also nicht nur die körperliche Pflege im Blick zu haben, sondern auch die psychischen Fragen, die seelischen Bedürfnisse der Sterbenden und die der Angehörigen. Dies geschieht in einem Zusammenwirken von Ärztinnen und Ärzten, Pflegepersonal, Seelsorgerinnen und Seelsorgern und Ehrenamtlichen. Auch die spirituellen und religiösen Fragen haben Raum in dieser Begleitung auf dem letzten Weg.
Nachdem ich einige Hospize kennengelernt habe, kann ich mir gut vorstellen, dort meine letzten Tage zu verbringen und zu sterben. Manche sagen: Wie kannst du nur! Das widerspricht doch der Liebe und Fürsorge, dem Füreinander in der Familie! Das sehe ich aber nicht als Widerspruch. Mich beeindruckt, wie ein Mensch dort im Hospiz sterben kann. In einer ruhigen, einfühlsam gestalteten Umgebung, ärztlich und pflegerisch versorgt von Menschen, die nicht erschrecken über das, was vor sich geht. Menschen, die wissen, wie Schmerzen zu lindern sind. Du kannst individuelle Wünsche aussprechen ohne Angst, andere zu belasten. Und es gibt Rituale. Etwa das Fenster zu öffnen nach dem Tod, um der Seele Freiheit zu geben. Oder eine Kerze aufzustellen, damit die anderen wissen: Dieser Mensch ist von uns gegangen. Es herrscht eine eigene, sehr liebevolle Atmosphäre in Hospizen.
Mein Wunsch, im Hospiz zu sterben, sagt nichts aus über meine Töchter, meine Freundinnen und Freunde. Sie würden mich sicher begleiten wollen. Aber zum einen würde ich ihnen gern die Freiheit lassen, ihr Leben zu leben, mich zu besuchen, aber auch wieder gehen zu können. Zum anderen würde ich mir selbst gern die Freiheit nehmen, auch für mich zu sein, Ruhe mit mir selbst zu finden. Viele Sterbende suchen offenbar diese Zeit, nur für sich. In manchem Beerdigungsgespräch wurde mir erzählt, dass Angehörige stets da waren, die sterbende Ehefrau, den sterbenden Vater intensiv begleitet haben. Aber gerade als sie einkaufen, duschen, telefonieren gingen, nur kurz weg waren, da starb der Mensch, dem sie in den letzten Minuten gern die Hand gehalten hätten. Als habe er darauf gewartet, allein die letzten Atemzüge zu tun. Bei manchen führt das zu Enttäuschung, weil sie viel Kraft investiert haben und nun in dem entscheidenden Moment nicht da waren. Ihnen kann ich nur tröstend sagen: Vielleicht wollte der Sterbende genau diese Freiheit, vielleicht hat sie sich unbewusst genau diesen Augenblick gesucht …
Die Hospizbewegung ist entstanden durch ehrenamtliches Engagement und das Ehrenamt trägt sie bis heute, unterstützt durch Spenden. Dass diese Orte des Friedens und der Sterbebegleitung auf sanfte Art entstehen konnten, dafür ist vielen Menschen zu danken, deren Namen nie genannt werden.
Neben den stationären Hospizen gibt es auch die ambulante Hospizbewegung, von der Menschen, die auf das Sterben zugehen, begleitet werden. Die Zahl der ambulanten Hospizdienste hat sich seit 1996 mehr als verdreifacht. Derzeit haben wir in Deutschland mehr als 1500 ambulante Einrichtungen einschließlich der Dienste für Kinder. Und auch die Zahl der stationären Einrichtungen in der Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen ist in Deutschland in den letzten 15 Jahren deutlich gestiegen. Während es 1996 nur 30 stationäre Hospize und 28 Palliativstationen gab, waren es 2011 bereits 195 stationäre Hospize und 231 Palliativstationen.4 Eine wunderbare Entwicklung, die nur durch ehrenamtliches Engagement möglich geworden ist. Zwar gibt es noch lange nicht für alle, die es wünschen, ambulante oder stationäre Hospizbegleitung. Aber wir sind auf einem guten Weg und die Hospizbewegung hat das Thema Sterben vielerorts auf die Tagesordnung gebracht.
Sterben ohne Schmerzen – Palliativmedizin
Hand in Hand mit der Entwicklung von Hospizen geht die Palliativmedizin. Menschen mit einer Erkrankung, bei der das Sterben absehbar ist, sollen so begleitet werden, dass deren Schmerzen erträglich bleiben. Neben der „Beherrschung“ von Schmerzen sind ebenso wie bei der Hospizbewegung die psychischen und sozialen, aber eben auch die spirituellen Fragen im Blick. Es geht nicht um Lebensverlängerung, sondern um bestmögliche Lebensqualität bis zuletzt.
Ich erinnere mich gut an den Zeitpunkt, als endlich die erste Krankenkasse palliative Versorgung in ihren Leistungskatalog aufnahm. Die Frau, die dies initiiert hatte, war aktiv geworden, nachdem sie miterleben musste, wie ihr Mann unter entsetzlichen Schmerzen starb. Noch während meiner Zeit als Hannoversche Landesbischöfin wurden die ersten drei „Palliativbetten“ im Friederikenstift mit Spendenmitteln finanziert. Heute sind sie vielerorts selbstverständlicher Teil der Pflege, auch wenn weiterhin zu fordern ist, das Palliativmedizin in der Vorbereitung auf den Beruf von Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegekräften zum Standard wird. Denn erst seit 2010 ist Palliativmedizin Teil der Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern, das war dringend notwendig. Aber auch Pflegende müssten viel besser unterwiesen werden, was palliativ möglich ist. Deutschland ist in dieser Hinsicht leider noch immer „Entwicklungsland“, wie es in einem Beitrag der ZEIT 2013 hieß5. Viele zögern beispielsweise, Morphin zu geben, weil offenbar die Suchtproblematik so hoch eingeschätzt wird. In der Schweiz habe ich schon vor vielen Jahren erlebt, dass ein Freund die Morphindosis sogar selbst bestimmen durfte. Die „Pauschalisierung“ unseres Gesundheitssystems verhindert zudem leider oftmals individuelle, skalierbare Lösungen. Der genannte Artikel in der ZEIT zeigt auf, in welchem Kontrast die Vorgaben zu den Wünschen der Sterbenden stehen: Sieben Mal am Tag etwas zu trinken geben, das wird den Pflegenden von der Krankenkasse erstattet. Ob jemand nur fünf Mal etwas trinken möchte oder neun Mal nach Wasser ruft – irrelevant für die Abrechnung.
Seit 2010 gibt es die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen“ in Deutschland. Darin heißt es: „Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Sterben unter würdigen Bedingungen. Er muss darauf vertrauen können, dass er in seiner letzten Lebensphase mit seinen Vorstellungen, Wünschen und Werten respektiert wird und dass Entscheidungen unter Achtung seines Willens getroffen werden. Familiäre und professionelle Hilfe sowie die ehrenamtliche Tätigkeit unterstützen dieses Anliegen.“ Das wünschen sich Menschen, wenn sie an ihr eigenes Sterben und das naher Angehöriger denken. Und die Charta weist auch auf das Miteinander von Angehörigen, ausgebildeten Pflegekräften und Ehrenamtlichen hin, das im Idealfall ein sich jeweils gegenseitig entlastendes Zusammenspiel ist.
Es gibt also positive Entwicklungen. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wird mit dem Sterben behutsamer umgegangen als früher. Palliativmedizin und Hospizbewegung haben das Bewusstsein für die Wünsche von Sterbenden erweitert. Initiativen wie die von Fritz Roth haben die Bedürfnisse der Trauernden besser in den Blick genommen.
Verdrängung in unserer Gesellschaft
Dennoch: Es gibt auch eine große Verdrängung, als würde das Thema nicht alle betreffen. Schweigen über das Sterben, Tabuisierung von Tod – das macht gerade diejenigen einsam, die davon betroffen sind. Aber in einer „karnevalisierten Gesellschaft“ist kein Ort für solche Fragen. Da sagte mir eine Frau, als meine Mutter starb: „Meine Mutter ist auch schon 90, aber wenn ich über das Sterben sprechen will, winken sie und meine Schwester ab: bloß nicht!“ Ein 60-Jähriger sagt: „Was, du hast eine Patientenverfügung? Das ist doch viel zu früh, an so was will ich gar nicht denken!“ Ob es daran liegt, dass bei uns nicht nur diese Karnevalisierung Einzug hält, sondern auch ein Machbarkeitswahn herrscht? Es kann doch nicht sein, dass es ein Ende gibt, und das liegt noch nicht einmal in meiner Hand? Etwas, was einfach so, aber unaufhaltsam kommt – das muss doch zu kontrollieren, lenken, steuern sein …
Ein Grund für diese Verdrängung ist gewiss auch die steigende Anonymisierung und Vereinsamung. Einerseits nimmt zwar die Individualisierung bei der Bestattung und der Trauer zu. Gleichzeitig steigt aber auch die Zahl der anonymen Bestattungen stetig. Sie wird im Internet als „günstigste Bestattungsvariante“ gehandelt. Aber sie ist auch unendlich traurig, finde ich. Da wird die Asche eines Verstorbenen verstreut, auf einem Friedhofsfeld, in einem Wald oder auch auf See. Und es bleibt kein Name, kein Ort. Mir ist durchaus klar: Das Ascheverstreuen im Wald oder auf See ist für viele Menschen ein Sinnbild von Freiheit, das respektiere ich. Traurig ist aber, wenn eine solche Anonymität angstgetrieben ist. Einige Menschen wollen anscheinend alles tun, um nur nicht irgendjemandem zur Last zu fallen, irgendeine Grabpflege zu verursachen. Von Gemeinschaft, Vertrauen, selbstverständlichem Geben und Nehmen ist keine Rede mehr.
Altersgelassenheit statt Jugendwahn
Oder liegt die Verdrängung von Sterben und Tod auch an dem Jugendwahn, weil niemand mehr alt sein möchte? Ich bin jetzt 56. Keine Frage, ich fühle mich sehr gut. Aber mein Alter kann ich auch nicht leugnen. Kürzlich fragte mich eine junge Frau, ob sie mir den Koffer die Bahnhofstreppen hinuntertragen soll – nicht die Höflichkeit eines Mannes gegenüber einer Frau, sondern die der Jüngeren gegenüber der Älteren! Okay, dachte ich, es ist dir also langsam anzusehen, das Alter. Das hat aber doch auch enorme Vorteile! Ich finde, diese ewige Angst vor dem Alter, bei der eine eigentlich 40-jährige, aber scheinbar ewig jung bleibende Heidi Klum von Plakaten lächelt und sich in Pose wirft, bedenklich. Nicht nur die Jugend, auch das Alter hat doch immense Vorteile. Du kannst dich entspannen angesichts der ewigen Rennerei und der Konkurrenz um die vorderen Plätze. Du kannst Zeit ganz anders ausschöpfen.
Als ich junge Mutter war, habe ich die Zeit mit meinen Kindern zwar genossen, aber im Hinterkopf hatte ich immer die Anforderungen, die noch auf Erledigung warteten: einkaufen, Predigt schreiben, Wäsche waschen, Taufgespräch. Mit meiner Enkeltochter kann ich heute stundenlang einfach nur dasitzen, Hühner beobachten, einen Stein an Laternenmasten als Klanginstrument ausprobieren oder in einem Bilderbuch nach dem Papagei suchen – und es drängt mich nichts, ich habe nicht mal eine Armbanduhr um. Das ist Lebensglück, stressfrei, so wie es Menschen wohl erst ab einem gewissen Alter genießen können. Da wächst eine Gelassenheit, die Jüngere schlicht nicht haben, weil sie auf Erfahrung fußt. Und der Sinn des Lebens bekommt eine neue Dimension, die du früher nicht mal geahnt hast. Wer alt werden darf, erlebt viel Neues, es bleibt spannend!
Gerade erst hat eine Studie gezeigt, dass die Quote der Menschen, die nach dem Sinn des Lebens fragen, stetig sinkt. Nur etwa 37 Prozent der Menschen in Deutschland stellen sich diese Frage, ein dramatischer Rückgang um fast acht Prozent in nur vier Jahren. Drei Viertel der 14- bis 19-Jährigen haben sich die Frage noch nie gestellt, bei den über 70-Jährigen spielt sie zumindest fast für die Hälfte eine Rolle.6 Wer keinen Sinn im Leben sucht, denkt wohl auch nicht an Endlichkeit. Und wenn es keinen Sinn gibt, ist auch Trauer nicht angesagt. Trauer ist für viele anscheinend eine Phase, die schnell überwunden werden soll. In einer ökonomisierten Gesellschaft gibt es dafür keinen Raum und keine Zeit. Älterwerden hilft auch, diese Räume zu suchen und sich Zeit zu nehmen.
„Memento mori“ als Lebensklugheit
Auf einer seiner neuen CDs singt Reinhard Mey ein eindrückliches Lied über die letzte Begegnung mit seinem Sohn, bevor dieser durch eine schwere Erkrankung ins Wachkoma fiel. Das Chanson beschreibt, wie er ihn zum letzten Mal vom Bahnhof abholte. Vater und Sohn klopfen sich zur Begrüßung gegenseitig auf den Rücken, wie Vater und Sohn das eben tun. Und als er ihn nach dem Treffen wieder zum Bahnhof brachte, wurde nicht viel geredet, wie das manchmal ist zwischen Männern. Er singt: „Wir begreifen unser Glück erst, wenn wir es von draußen sehn! Wenn ich ihn vom Bahnhof abhol’n könnte noch einmal … Ich wollte für immer warten vor der lausigen Bahnstation.“7 Im Mai 2014 ist Maximilian Mey gestorben. Ja, ein Lied nur. Aber eines, das wunderbar ausdrückt, was viele fühlen: Hätte ich gewusst, dass es die letzte Begegnung ist, ganz anders hätte ich in dieser Situation reagiert und meine Gefühle gezeigt! Wir können nicht jedes Treffen unter dieses Vorzeichen stellen. Aber das zu bedenken, lässt uns gewiss bewusster Abschied nehmen dann und wann.
Für ein Buch habe ich als Herausgeberin Sätze gesammelt, die für Menschen in ihrem Leben große Bedeutung hatten.8