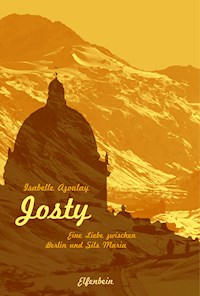Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elfenbein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marokko in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts: Marcel erinnert sich an seine Kindheit in Casablanca. Er erzählt aber nicht nur die Geschichte eines Jungen, der dabei ist, sich von seiner Familie zu lösen, und mit den Tücken des Erwachsenwerdens zurechtkommen muss. Er erzählt auch die Geschichte einer jüdischen Familie in permanenter Aufbruchstimmung: Während die Großeltern noch ganz im Mellah, dem alten jüdischen Viertel der Stadt, verwurzelt sind, leben die Eltern im Geiste bereits im ersehnten Frankreich, und die ältere Schwester bricht schon auf ins Gelobte Land. Und schließlich erzählt er von den letzten Minuten des marokkanischen Judentums vor dessen Exodus: Die überwältigende Mehrheit der zweihunderttausend Juden Marokkos wanderte nach dem Zweiten Weltkrieg nach Israel aus; diejenigen jedoch, die ein bürgerliches Leben anstrebten, gingen – wenn nicht nach Amerika – nach Frankreich, zu "ihrem" Charles de Gaulle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isabelle Azoulay
De Gaulle und ich
Eine Geschichte aus Casablanca
Elfenbein
© 2008 Elfenbein Verlag, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-941184-96-1 (E-Book)
ISBN 978-3-932245-90-9 (Druckausgabe)
Die Spur
Rue du Jura, eine kleine Straße im dreizehnten Arrondissement von Paris, hier gehe ich. Rechts vor mir geht ein Mann. Ich sehe sein Profil. Ich kenne ihn. Ich glaube, ich kenne ihn. Ich kenne ihn sogar gut, und erst einmal weiß ich nichts mehr. Ich gehe regelmäßigen Schrittes weiter, schaue ihn an … Könnte es André sein? André, der, als ich klein war, in Casablanca am Lido saß – oder war es die Plage Benaïm? – und mit allen Kindern redete? André, der mich beeindruckte? André, den ich mich kaum direkt anzusprechen traute? Er, der so klar sprach, dass ich mich geblendet fühlte? André, der jedem, der es wollte, Eis und Krapfen spendierte? Mechanisch gehe ich ihm nach. Kann er das überhaupt sein, ich war dreizehn oder vierzehn Jahre alt, und er, wie alt mag er damals gewesen sein? Als Kind unterscheidet man so schlecht. Alle Erwachsenen sind fünfzig, und gleich danach kommen die Greise. Nein, André war noch jung und so offen, wie man später kaum mehr sein kann. Ich laufe ihm nach. Wie kann ich ihn ansprechen? Waren Sie am Lido von Casablanca? Eine Lawine kommt, eine Lawine von Bildern. Die Hitze. Auch heute ist es warm. Während ich weiter diesem Mann nachlaufe, öffne ich den obersten Knopf meines Hemdes. Wie war die Frage? Haben Sie am Lido gesessen und mit den Kindern gesprochen? Ich bin Marcel, ich stand mit den anderen da, bei Ihnen am Strand. Und dann? Was soll ich bloß sagen, wenn er ja sagt? Er wird schon nicht ja sagen. Das wäre absurd, er wird irgendetwas sagen. Er geht schneller, er rennt fast, ich gehe nun auch schneller, er entfernt sich, sein Bus ist plötzlich da, er erwischt ihn gerade noch. Place des Gobelins, ich winke dem Fahrer zu. Zu spät. Er ist in diesem Bus. Der Bus ist voll. Ich bleibe stehen. Ich habe ihn verloren. Wie angenagelt schaue ich diesem gewöhnlichen Bus hinterher. Er verkleinert sich peu à peu, biegt ab. Vorbei. André ist verschwunden.
Ich wurde 1940 in Casablanca geboren. Meine Mutter stillte mich zwei Jahre lang. Ich glaube mich daran zu erinnern, wie furchtbar es war, abgestillt zu werden. Ich meine, mein Vater hat es meiner Mutter befohlen. Ich bilde mir ein, dass sie noch um zwei Tage Verlängerung verhandelte. Erst danach kam ich richtig auf der Welt an. Prompt wurde es kompliziert. Meine Geschwister waren bis dahin sanft mit mir gewesen. Von dem Tag an, als ich abgestillt wurde, musste ich mich verteidigen. Ich hätte lieber mit meiner Mutter allein im Hotel gewohnt.
Meine frühe Jugend muss ein einziges Gerangel gewesen sein, ich konnte nicht schnell genug wachsen, um mich zu isolieren. Und André, der junge Mann am Strand, der sich mit den Jugendlichen unterhielt, der war ein Lichtblick gewesen. Wenige Menschen hatte es gegeben, die glaubwürdig machten, es gäbe irgendwann einen Ausweg aus der Familie.
Das Kino »Le Triomphe«
Wir bekamen Taschengeld, jede Woche. Mein Kinogeld. Man kann alles über den Alten sagen, aber das Kinogeld, daran hielt er sich. In seiner Abwesenheit nannten wir unseren Vater immer »den Alten«. Er wusste: Kino war heilig. Mir bei weitem heiliger als Schabbat. So gesehen war Schabbat kaum noch wichtig. Das Kino führte geradeaus zu irren Freuden. Es ging um das Kino »Le Triomphe«, genau genommen um die Samstagsfilme. Ich glaube, es gab nur am Wochenende Filme. Wir kannten auch kein anderes Kino. Und dass derart Wundersames noch anderswo stattfand, war kaum anzunehmen. Man ließ sich auf ein merkwürdiges Spiel ein, und das funktionierte immer. Am Eingang Geld abgeben, in einen dunklen Raum treten, sich dort der Reihe nach hinsetzen und alles andere vergessen. Dass die Sitze aus rotem Samt von allein hochklappten, wenn man aufstand, zeigte schon, dass es sich hier um ein Spiel handelte. In der Dunkelheit war man nach ein paar Minuten nur mit sich allein. Der Flut der Bilder ausgeliefert, glitt ich so dahin, bis ich mich selbst vergaß. Ich war in dem, was geschah. Nur das. Nichts anderes konnte passieren. Es hauchte mich aus allem hinaus, erlöste mich. Ich hatte den Verdacht, dass hinter dieser Kinosache noch viel größere Dinge steckten, dass die Filme gewissermaßen erst die Spitze ganz anderer wundersamer Sachen seien. Eventuell verbarg sich in den Kellerräumen des »Triomphe« auch eine Zentrale für das Geschehen außerhalb von Casablanca. Vielleicht hing der Name »Triomphe« mit darin und meinte eigentlich: Kommt alle her, hier könnt ihr einen Triumph über alles bisher Angenommene erleben, einen Sieg über die Langeweile, eine Überwindung der Tatsachen und vor allem: eine ungeahnte Befreiung vom Ernst. Wahrscheinlich wurden dort noch ganz andere Geschichten gesammelt. Das Geschehen im Kinosaal war so deliziös, dass es schon von selbst verriet, man könnte ganz andere Dinge vor Augen bekommen. Das Erstaunliche war: Das hier Erlebte hinterließ keine sichtbaren Spuren. Nur unsichtbare. Man ging wieder hinaus, scheinbar war alles wie vorher, und in Wirklichkeit war nichts wie vorher. Der Zauber, der von den verblüffenden Bilderfolgen ausging, ließ mich als Held in Person herausgehen. Ob »Simbad le marin«, »Le dernier des Mohikans«, »Le voleur de Tanger« in Technicolor mit Tony Curtis oder »La môme vert de gris« mit Dominique Wilms und Eddie Constantine – es ging immer auf. Es war die größte Freude der ganzen Woche.
Ich weiß nicht mehr wie, aber ich schaffte es immer, ins Kino zu gehen. Ich wollte keinen Film verpassen. Die Woche über nährten mich die Bilder, zehrte ich von den Geschichten. Ich versetzte mich immer wieder in die Szenen, ohne dass es irgendjemandem auffiel, und meine Erinnerung rang um jedes Detail. Das Glück wiederholen. Wie ich heute mein Gedächtnis strapaziere, um mich an alle Details dieser Jahre in Casablanca zu erinnern. Fünfzig Jahre hat mich diese Kiste der Erinnerungen so gut wie kaum interessiert. Nun überfällt es mich, ich will alles wieder wissen, alles dreimal umdrehen, Straßennamen und Gerüche, Blicke und Gesten. Je genauer, desto komischer, je lebendiger, desto intensiver – wie damals das Kino. Die Augen geschlossen, in Casablanca.
Manchmal schaffte ich es, Geld zu organisieren, um an einem Wochenende sogar zweimal ins Kino zu gehen. Die Aussicht mobilisierte enorm viele Kräfte. Mit meinem Freund Maurice Adjiman sammelte ich alte Zeitungen. Wir klingelten systematisch eine Straße ab und fragten ganz höflich. Dann brachten wir so viele Zeitungen, wie wir tragen konnten, zur Markthalle Mère Sultan. Dort verkauften wir sie für ein paar Münzen. Die Fischhändler wickelten darin die einzeln verkauften Fische ein. Wir machten uns zu Lieferanten für Verpackungsmaterial. Wir mussten ganz schön viel schleppen, bis es für das Kino reichte. Ein paar Mal habe ich meine Schwester Alia den ganzen Schulweg auf meinen Schultern getragen. Dafür gab sie mir ihr Taschengeld.
Mit Armand in den Platanen
Ich habe sechs Geschwister. Aber wenn ich damals überhaupt mit jemandem zusammen war, dann mit meinem jüngeren Bruder Armand, der direkt nach mir kam, ich glaube, wir waren sogar kaum ein Jahr auseinander. Ich war das zweite Kind. Mein älterer Bruder Dan nahm eine ganz besondere Stellung ein: Er war der heimliche Liebling meiner Mutter. Hinzu kam, dass er ein Einzelgänger war, womit er als Spielgefährte für seine Brüder nicht zur Verfügung stand. Dan war für alle unnahbar. Er fühlte sich ein bisschen wichtig. Dabei lag es hauptsächlich daran, dass er wenig sprach. Nach der Devise »Je weniger ich spreche, desto weniger Falsches kann ich sagen« hatte er sich eine Sonderposition geschaffen. Er ahnte, dass so sein Einzelgängerstolz weitgehend durch Einbrüche von Dummheit und Pein verschont bleiben konnte. Und während er dieser Strategie folgend viel schwieg, schuf er sich von ganz allein jene besondere Position. Aus seinem kargen Sprechen hatte er etwas Erhabenes gestrickt.
Armand und ich kamen nach Dan, und nach uns gab es in der Reihenfolge die drei Mädchen, Alia, Fréha und Sylvia, die uns gar nicht interessierten. Jacob, der Letzte, der Allerkleinste, kam für mich schon überhaupt nicht in Betracht, weil er eben zu jung war. Wenn ich überhaupt mit einem Bruder etwas unternahm und durch die Gegend zog, war es mit Armand.
Armand war faul wie ein Esel. Meine Mutter sagte, es liege daran, dass die Hebamme bei seiner Geburt so spät kam. Der Alte hatte ungeheure Angst gehabt, die Geburt mit meiner Mutter allein durchstehen zu müssen. Er wollte unbedingt, dass das Kind erst kam, wenn die Hebamme da war. So hatte die Nachbarin, Madame Federman, die selber keine Kinder und Angst vor Geburten hatte, meiner Mutter den schon fast herausrutschenden Armand wieder ein Stück zurückgeschoben, weil man warten sollte. Damit, sagte meine Mutter, hätte man ihm jeden Funken von Ehrgeiz an der Basis verdorben. Darum sei er nun unschlagbar faul.
Bei so vielen Geschwistern musste jeder zusehen, wie er an relevante Informationen kam. Und da hatte ich mich eben mit Armand zusammengetan.
Wir wohnten in der Rue de Brié, einer schmalen, zart abschüssigen Straße. Die Palmenallee, die am unteren Ende unserer Straße zum Zentrum führte, mündete am Gericht. Dessen Innenhöfe rissen so viel Licht an sich, dass es durch die Arkaden wieder auf die Straße strahlte. Dieser Platz war von Riesengewächsen mit großen roten Blüten geschmückt, und ganz dicht nebeneinander standen kurzstämmige Platanen. Sie waren sehr alt, und auch die Steinbänke schienen schon seit der Antike hier angewurzelt zu sein.
Armand und ich kletterten auf diese Bäume, deren dichtes Laub sich horizontal streckte, kauerten uns zusammen und warteten ganz still auf verliebte Paare. Es kamen immer welche. Sie machten sich auf den Bänken breit. Es war ein Platz, der durch die großen blühenden Gewächse relativ geschützt schien. Für Spanner bot er einen äußerst günstigen Aussichtsposten. Wie Koalabären hingen wir im Laub versteckt. Wir warteten nie lange.
Da sind schon welche. Sie kommen Hand in Hand, setzen sich. Wir gucken uns die Augen aus dem Leib und versuchen zu verstehen, was das Paar da tut. Sie ist ziemlich hübsch. Er nicht. Es ist sehr warm, die Luft sehr trocken. Armand und ich atmen leise. Stieren hinunter. Sie reden erst ein bisschen. Sie heißt Marise, und er wiederholt ihren Namen mehrmals. Im Grunde sind sie verlegen. Sie lacht, wenn er »Marise« sagt. Sie sprechen, wie man Versteck spielt. Hin und her. Sie sind jeder für sich mutig, und zusammen sind sie hilflos. Sie setzen sich ganz dicht nebeneinander. Er sagt: »Viens«, und zieht sie so an sich, dass sie im Nu quer auf seinem Schoß sitzt. Sie sagt: »Non«, und lässt alles geschehen. Jetzt hat er ihre Brüste auf Augenhöhe. Wenn er sich vorbeugt, berührt er sie sogar. Sie zappelt. Und schon reiben sie sich aneinander, sie hören nicht auf, sich zu betasten. Wie Blinde. Sie sagt noch: »Doucement.« Und dann stecken sie sich die Zungen gegenseitig in den Hals. Sie holen Luft. Und küssen sich wieder, minutenlang. Während der Küsse, nach einigen Sekunden, werden ihre Körper weicher, sie entspannen sich, und ihre Münder lassen nicht voneinander los. Die Hand des Jungen schleicht sich vorsichtig unter das Kleid und dann an ihrem Schenkel hoch. Automatisch zieht ihre Hand die seine wieder in Richtung Knie. Und wieder seine Hand langsam hoch, und noch mal ihre Hand hinunter. Ganz oft.
Mit Armand kam ich häufig her. Eines war uns klar: So ein Logenplatz, das war schon genial. Manche Mädchen kicherten, andere waren ganz ernst. Manche Jungen waren ganz angespannt, schwitzten sogar, einige waren lässig. Was uns schon sehr witzig vorkam, war, dass diese Paare immer das Gleiche taten. Fast alle. Die wenigsten saßen nur da und redeten. Wussten sie denn, dass alle hier das Gleiche taten? Und woher wussten Sie, dass es nur das eine zu tun gab? Taten es alle, wenn keiner schaute? Auch meine Eltern? Niemals. Der Graf von Monte Christo? Ausgeschlossen. Die Nachbarn, Monsieur und Madame Federman? Unmöglich! Nur hier. Unter die Platanen dieses Platzes kamen diejenigen, die so etwas tun mussten. Irgendwie ahnte ich, dass es nicht nur eine neue heimliche Mode sein konnte. Hatte man in grauer Vorzeit auch hier im Laub gehockt und geguckt, was Paare machten? Wahrscheinlich. Von diesen Bäumen aus, herabschauend auf diese Bänke der Antike, um zu sehen, was andere so tun? War gut möglich. Dadurch war im Lauf der Zeit klar geworden, dass es das zu tun gab. Und doch, bei aller Evidenz, blieb es nebulös.
Arons Kindheit
Die zukunftweisende Bedeutung, die vom Klang »Alexandredumas« ausging, hatte der Alte eingeführt. Aron. Er war der letzte Sprössling einer wohlhabenden, weitverzweigten Familie und hatte dadurch eine Sonderstellung. Er wurde als Kind besonders geherzt und später auch besonders gefeiert. Sein Vater war Rabbiner. Neben dem Studium heiliger Schriften spielte er eine wichtige Rolle im Gemeinderat des Mellahs, des jüdischen Viertels. Er organisierte die Besteuerung des koscheren Fleisches und beriet bei der Wiederverteilung der Gemeindegelder. Aber ganz nebenbei importierte Arons Vater Nähmaschinen aus Deutschland. Dadurch wusste er, wie man an ungewöhnliche Dinge kam. Für den kleinen Aron wurden immer ganz besondere französische Spielsachen aus einem Katalog bestellt. In der Verwandtschaft wurde damals getratscht – es muss um 1918 gewesen sein –, er sei das einzige Kind in Marokko, das Rollschuhe und einen Roller besaß. Es mag nichts bedeuten, aber er war eben der Einzige. Später hat er sich immer europäisch gekleidet, und da er schmal und groß war, war es ein glaubwürdiges Auftreten, er wirkte fein.
In den dreißiger Jahren besaß Aron in seiner Art, sich zu bewegen, etwas von einem Dandy, und als solcher wurde er auch innerhalb der eigenen Familie wahrgenommen. Das beeindruckte sehr, er galt als Intellektueller. Man sah ihm an, dass er stolz darauf war, elegant zu sein. Sein Auge blitzte vor List und Provokation. Er sprach lupenreines Französisch. Wenn er redete, hörten alle zu. Besuchte er Verwandte, versammelte sich alles um ihn. Sprach er, waren auch die Kinder still, als ob er Moses persönlich wäre und oben auf dem Sinai stünde. Und er berichtete von der modernen Welt, von der Moderne überhaupt, von dem, was in der Zeitung stand. Amerika war bis dahin eine ferne, vage Gegend, wo man reich wurde und aus der man nie zurückkehrte. Aron aber sprach nicht nur davon, als wäre er dort gewesen, sondern so, als könnte jeder mal eben hinfahren und sich die elegante und reiche Welt anschauen. Und nach Frankreich sowieso, ein Katzensprung. Da würde man nicht unbedingt sofort reich werden, dafür aber gebildet und souverän. Sollte man glauben. Halb auf Arabisch, halb auf Französisch stellten Verwandte ihm Fragen. Wenn er antwortete, schwiegen sie. Und immer kam er irgendwann auf sein Lieblingsthema: Frommheit als Falle. In einem feurigen Credo liebte er es, mit seinem kühnen Atheismus die Zuhörer zu tyrannisieren. Ab einem bestimmten Zeitpunkt sahen sie es schon kommen, schauderten davor, aber es war unabwendbar. In einer Mischung aus Bewunderung und Furcht hörten sie das, was man ihn nicht hindern konnte auszusprechen: »Dieu n’existe pas.« Gott sei eine geniale Erfindung, um die Armen zu lenken, eine kluge Legende, um die Ungebildeten zu besänftigen – er sagte: »Für die Profanen.« Gott sei eine ganz wichtige Stütze für die Nichtwissenden, aber in Wirklichkeit gebe es ihn nicht. Er sprach von den höheren Sphären und meinte damit die nicht in Erscheinung tretenden Entscheider und Bestimmer. Nie haben wir damals Näheres über die höheren Sphären erfahren.
In den Augen der Frauen wirkte Aron wie ein armer Teufel, ein aus dem Paradies Vertriebener. Sie schauten mit Demut und Unsicherheit, lächelten schließlich sanft mit ablehnender Miene. Die wirklich Gläubigen unter ihnen rüsteten sich im Innern mit schweren Schilden gegen ihn, als wollte man mit bloßer Leibeskraft einen berstenden Staudamm aufhalten. Zum Teil verzerrten sich ihre Gesichter, als müssten sie ein schreckliches Geräusch ertragen. Andere schlossen die Augen oder schauten mit angezogenen Schultern auf den Boden. Schon das Wort »Gott« auszusprechen, war verboten. So kann man sich leicht vorstellen, wie verwirrend die häretische Formel hallte. Eine mutige Tante traute sich endlich zu sagen: »Hör auf, dein Gerede zieht das böse Auge an! Hör auf zu spotten und ihm«, sie meinte Gott, »die Stirn zu zeigen!« Während sie sprach, nickten fast alle. Sie redeten auf ihn ein, sie beschwichtigten ihn, versuchten ihn abzulenken und zu beschwören – es half gar nichts. Er holte noch einmal aus, und dozierte glänzend über das Verhängnis des Aberglaubens, der uns in Schach halten und an Willkür fesseln würde. Bravo. Aron mimte dabei den triumphierenden Löwen. Manche Tanten flossen in ihrer Ohnmacht so dahin. Merkwürdigerweise verlor der Alte dadurch nie an Respekt, er kam trotzdem majestätisch davon. Sie legten es ihm als Allüre aus, die eben zur Modernität dazugehöre, und spielten es herunter.
Ein noch schrecklicheres Enfant terrible als Sohn eines Rabbiners dürfte es nicht gegeben haben. Kurz und gut: Der Alte mochte viel mehr als andere wissen, aber er galt in der Verwandtschaft als ungemein anstrengende Person. Das hat uns später immer etwas isoliert. Denn seine strapazierenden Auftritte strahlten auf uns aus, und die Religiösen haben mit uns Kindern garantiert Mitleid gehabt. Aus irgendeinem Grunde müssen meine Großeltern prompt verarmt sein und Aron ohne Reichtum zurückgelassen haben. Da er als Kind aber nachdrücklich bevorzugt wurde, hat er sich auch später immer verhalten, als sei es normal, privilegiert zu sein.
Alice, meine Mutter, und Aron gingen in Casablanca manchmal Tango tanzen. Man erzählte, Aron sei ein begnadeter Tänzer gewesen. Sie war eine Schönheit, die den Neid eines Pharaos hätte erwecken können. Zusammen müssen sie tangotanzenderweise ein hinreißendes Bild abgeben haben. Alice hatte ganz feine Gesichtszüge. Sie war eine eher zurückhaltende und keusche Person, aber dabei war sie zugleich gelassen und bei sich, so dass sie als einfache Frau, die sie war, eine starke Ausstrahlung besaß. Insofern eignete sie sich besonders gut sowohl für die geistige Haltung als auch für die äußerliche Szenerie des Tangos. Sie ließ sich führen, aber erhobenen Hauptes. Zu Hause war meine Mutter zwar dem Alten ganz klar untergeordnet, aber sie hatte eine eigene Art, sich ohne viel Worte zu behaupten. Wenn sie etwas durchsetzen wollte, waren Argumente gar nicht ihre Sache. Sie tat das, was sie für richtig hielt, und drückte sich leise durch die Dinge und die Menschen. Aber sie suchte nicht nach einem zustimmenden Blick. So unterlief sie stur und lautlos die Strenge des Alten. Wie ein U-Boot bewegte sie sich mit sicherer Atmung fort. Abends ging sie schlafen, und so schob sie sich lautlos durchs Leben.
Meine Mutter hatte den Alten nicht aus Liebe geheiratet. Man hatte sie verheiratet, und folgsam hatte sie eingewilligt. Keine Täuschung hatte sie abgelenkt, keine Illusion aufgehalten, sie hatte nicht rebelliert – der Lauf der Dinge hatte sie zum Alten geführt, und dafür war sie dankbar. Aron war alles andere als gewöhnlich, und obendrein hatte er noch diesen besonderen Ruf, weil er sich in religiösen Dingen querstellte. Meine Mutter wusste, dass sie als Paar eine gute Figur machten. Seitdem sie uns Kinder um sich hatte, war sie zu einer häuslichen Priesterin geworden. Eine stets Unordnung wegschaffende Kraft, die im Sinne des Guten, des Warmen, des Sauberen und Sättigenden agierte. Von morgens bis abends, ohne Zwiespalt, ohne Zögern. »Une femme capable« – eine fähige Frau – nannte man das in der Verwandtschaft. Sinnbringend, makellos. An Schabbat, wenn sie sich zurechtgemacht hatte, sagte der Alte: »Du bist wirklich die Schönste«, und sie strahlte mit einer gespielten Bescheidenheit. Sie gab die Schüchterne, weil seine Bemerkung ihr das vorgab. Ich fand sie nicht wirklich schüchtern. Still war sie, mehr nicht. Mich genierte die zur Schau gestellte Anständigkeit des Alten zutiefst. Dadurch glaubte ich ihm auch nicht wirklich.
Monsieur Gawlik wird sich totsaufen
Unsere direkten Nachbarn hießen Gawlik – Polen, die recht gut Französisch sprachen, auch wenn sie diesen unverwechselbaren lieblichen Akzent hatten. Egal, was sie sagten, die Melodie ihres Akzents ließ immer mitschwingen: »Komm ich heut nicht, komm ich morgen.« Dabei waren sie ernst und pünktlich. Monsieur Gawlik war ein bescheidener polnischer Schneider, Katholik, und kaum jemand mochte wirklich wissen, warum er in Marokko gestrandet war, die Vorgeschichte könnte gut finster aussehen. Denn wenn man ihn fragte, sagte er in einem phlegmatischen Ton: »Sagen wir: wegen der Sonne.« Dabei sah er aus, als würde er sich gerade aus der Sonne gar nichts machen. Marokko war in diesen Jahren für nicht wenige ein guter Schlupfwinkel. Für Gebeutelte, die sich sonst wo bedroht fühlten, für Mutige, die zielstrebig ihr Glück suchten, sowie für Schurken, die sich in ihrer Heimat rar machen wollten. Gawliks Grund war ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das er wie einen Buckel mit ins Grab nehmen würde.
Er hatte eine stämmige Statur, die trotzdem in der Welt kaum Platz einnahm. In seiner Art, diskret sein zu wollen, zeigte er Demut. Die Stirn, von Gram gezeichnet, ließ vermuten, dass ihn eine diffuse Ungewissheit plagte. Er war leise und trank gern. Viel sogar, manchmal bis zur Bewusstlosigkeit. Nicht selten schickte er mich eine Flasche Pastis besorgen, den er trank, ohne ihn mit Wasser zu verdünnen. Dabei dachte ich an den Alten, den so viel Pastis ohne Wasser umgebracht hätte. Und meine Mutter hätte wahrscheinlich schon bei einem halben Glas erbrechen müssen. Durch den Hang zum Rausch entzog sich Monsieur Gawlik dem allgemeinen Unbehagen, das ihm seine extreme Schüchternheit auflud, wenn er anderen Menschen begegnete. Genau genommen bestand das Leben aus einem immer wiederkehrenden Durchkauen von Erinnerungen und einer lauernden Angst vor fremden Menschen. Wer weiß, was ihm für Menschen in Polen begegnet waren. Das kann tief sitzen. Das Ganze war umso betrüblicher, da er alles immer wieder in reichlich Alkohol tränkte. In der ersten Phase der Trunkenheit war er liebevoll bis hin zu maßlos sentimental, redete und redete, und dann kamen ihm die Tränen, und er redete weiter wie jemand, der langsam die Nerven verliert und allmählich lauter wahre Dinge sagt, bis er sich in seinen Worten verlor. Dann trat schleichend, aber sicher ein Stadium ein, in dem man eigentlich sagen konnte, dass er schon ein bisschen tot war. Hatte Madame Gawlik sonntags mit den Kindern das Haus verlassen, um in die Kirche zu gehen, passte er mich im Treppenflur ab und schickte mich Pastis holen.
Michel Gawlik und seine Mutter auf dem Markt
Die Gawliks hatten einen Sohn, Michel, und eine Tochter, Wanda. Madame Gawlik hatte bäuerliche slawische Vorfahren, entsprechend stämmig war auch ihre Statur. Sie war eine dunkelblonde, mollige Person, hilfsbereit und fromm. Das grundlegende Bestreben der Eltern Gawlik war es, als respektabel zu gelten, sprich: nicht aufzufallen. So sehr, dass es für beide Kinder ein leichtes Spiel war, ihre Alten auf die Palme zu bringen. Wanda brauchte nur auf der Straße zu pfeifen, schon kochte ihre Mutter vor Scham und lief rot an.