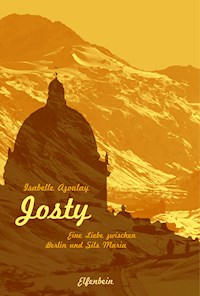
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elfenbein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berlin, Anfang des 19. Jahrhunderts: Johann hat es durch »Fleiss und Thätigkeit« zu einem wohlhabenden Patissier gebracht: Kunden aus »Hof, Kunst und Geist« lieben seine süßen Kunstwerke. Das Leben in der höheren Gesellschaft ist für ihn nur ein Spiel mit Umgangsformen – um preußische Konventionen schert er sich nicht. In Lina findet Johann eine perfekte Verbündete: Sie ist eine unabhängige Frau und ihrer Zeit weit voraus. Und da Lina Jüdin ist und nicht konvertieren will, leben beide in wilder Ehe glücklich zusammen. Doch Johann wird immer mehr von Schuldgefühlen geplagt: Als zwölfjähriger Junge war er – ohne sich zu verabschieden – vor der Armut und Enge seines Elternhauses im Engadin geflüchtet. Ein Lottogewinn ist nun der Auslöser für eine Reise an den Ort seiner Kindheit: Sils Maria. Es ist Johanns zweite Flucht – diesmal vor dem Verlust der Erinnerung. – Isabelle Azoulay erzählt nicht nur die Geschichte einer unkonventionellen Liebe in einer politischen und gesellschaftlichen Umbruchzeit. Es ist auch ein Buch über den Wunsch nach Individualität und über die Angst, aus der Welt zu fallen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isabelle Azoulay
JOSTY
Eine Liebe zwischen Berlin und Sils Maria
Elfenbein
Von Isabelle Azoulay erschien außerdem:
»De Gaulle und ich. Eine Geschichte aus Casablanca«
© 2009 Elfenbein Verlag, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-941184-95-4 (E-Book)
ISBN 978-3-932245-99-2 (Druckausgabe, Leinen)
ISBN 978-3-941184-27-5 (Druckausgabe, kartoniert)
IJohann
Er dachte selten an Gott. Er achtete ihn zwar, in der Regel verließ er sich aber lieber auf sich selbst.
Johann Josty geht über den Schlossplatz. Carolina hüpft ihm voraus, dunkle Locken, fünf Jahre. Er ruft ihr zu, sie solle in den Laden gehen. An der Stechbahn, schräg gegenüber dem Schloss, ist seine Konditorei. Er schaut seiner Tochter hinterher, ruft noch einmal, winkt. Er will ins Bankhaus. Er komme gleich, ruft er. Zwei Häuser weiter: das Bankhaus Jacquier & Securius. Allein die schwere Tür lässt nur Eigenwillige hinein.
Vor zwei Wochen hat er aus Witz und Zerstreuung ein Lotterielos gekauft. Die Verkäuferin hat ihn charmant in ein Gespräch verwickelt, und Johann hat das Los gekauft, weil er gerne höflich parliert, er hat ja gesagt, um nicht nein sagen zu müssen. Johann ist reelle Werte gewohnt, und dass aus dem Nichts heraus große Summen kommen mögen, hält er für Spinnerei. Zu lange hat er auf seinen eigenen Fleiß setzen müssen, zu sehr ist er viele Jahre beharrlich gewesen, zu genau ist diese Rechnung aufgegangen. Und was geschah jetzt? Die Beiläufigkeit erlaubte sich, allen Fleiß der Welt zu überholen: Am 26. März 1810 zieht Johann das Los mit dem größtmöglichen Gewinn: hundertfünfzigtausend Taler, direkt, ohne Bedingungen, sofort abholbar, nebenan. Er hat gelacht und wieder gelacht, doch in die Flanke dieses Lachens hat sich ein unheimliches Gefühl geschlichen. Dieses Lachen ist ihm, kaum zu Hause mit sich allein, im Halse steckengeblieben. Er erzählt nur wenigen davon. Trotzdem weiß es jeder. Er fürchtet Neid. Glück hatte er schon vor dem Gewinn, also konnte dieses Zusatzglück nur zum Übermut verhelfen. Dass Gott im Spiel war und ihm die Anständigkeit und den unermüdlichen Fleiß reich belohnte, war ohne Zweifel, aber Johann fühlte sich zweifach belohnt, es machte ihn nachdenklich. Der Verkäuferin des unheimlichen Loses gab er ein üppiges Trinkgeld, beschenkte großzügig seine geliebte Lina und beschloss, eine Reise zu wagen. Die Reise.
Eine große Summe möchte er mitnehmen. Nach Hause. Morgen früh will Johann diese Reise antreten. Er ist durch seine Geschäfte viel unterwegs, aber jetzt kommt es ihm so vor, als stünde seine erste große Reise an. Eine Reise, die ihm ein Rückweg ist.
Vor fünfundzwanzig Jahren war er hierhergekommen. Zu Fuß – mit einer kurzen Ausnahme: In Landeck hatte er einer Postkutsche aus dem Graben geholfen und durfte dafür bis nach Marienbad mitfahren. 1785. Frei, hungrig, neugierig, schwerelos.
Seit langem ruhte der Wunsch in ihm, Sils, den Ort der Kindheit, wiederzusehen. Das ist ihm eine Gewissheit geworden. Wenn ihm in den letzten Jahren diese Reise als fernes, vages Vorhaben vorschwebte, so war das eine glückliche Vorstellung – aber nun? Wie lange will er bleiben? Einen Monat? Zwei? Den ganzen Sommer?
Früher dachte er, irgendwann werde sich ein Grund, ein Anlass bieten, irgendwann werde das Leben reif genug sein. Mit zwölf Jahren war er davongelaufen, seitdem gab es keine Gelegenheit, die ihn zurückführte. Keine. Die ersten Kilometer war er wie ein Dieb gelaufen. Kaum über die Berge in Richtung Norden, hatte sich schon die Kindheit losgelöst. Endlich den Querriegel der Alpen überwunden, das Strenge, das Düstere, die Armut hinter sich gelassen. Er hatte sich nicht mehr umgedreht. Wie ein Fohlen davongaloppiert, ein paar Tage nach der Geburt, vorwärts, ohne Angst.
Heute, am Vortag dieser Reise, schreckt er zurück. Hoch in die Alpen, noch höher, als das Auge reicht? Vor Ort war man dem Himmel ausgeliefert, und Johann erinnert sich, wie bedrohlich ihm dieser als Kind erschienen war. Das Leben war von der Natur so kurz gehalten, unendliche Winter hielten die Leute gefangen. Das hatte sich in sein Gedächtnis tief eingegraben. Sils: trostloser Krümel öden Wiesengrunds im tiefen Ende des Tals. Viele Jahre hatte sich seine Seele nicht darum gekümmert. Aber irgendwann begann sich in ihr etwas zu regen, scheu, vergessenes Findelkind der eigenen Jahre. Die Dichter kaprizierten sich darauf, gerade die rauen Alpentäler zu bemühen, um die aus der Welt verschwundene Unschuld zu bedenken. Narren! Johann wusste, dass diese Neigung nur Fremde ergreifen konnte, die es niemals vier Jahreszeiten dort ausgehalten hätten. An der Unberührtheit der Natur hatten bereits einige die Fehlentwicklungen der Zeit zu messen vermocht. Johann hasste dieses kokette Bemühen der kargen Landstriche, um das Erhabene herbeizuzitieren. Es war doch nur der hilflose Versuch, mit der Fremdheit von Bergen zu hantieren, auf Kosten der Gebeugten, Durchgefrorenen, Faltigen. Seiner Leute.
Johann hatte versucht seinen Geist daran zu gewöhnen, die Dinge von der guten Seite zu nehmen, und wollte das Wertvolle in ihnen finden. Aber im Schöndichten der rauen Natur raubte man seinen Leuten den Respekt. Das ging zu weit. Diejenigen, die im Besitz eines besseren Lebens waren, gar die im Besitz der Macht Befindlichen, sollten besser auf der Hut sein: Ihre Schwärmerei von der klirrenden Klarheit der Berge stand im Dienste der Ablenkung von ihrem wankenden Sockel.
So war sein Blick auf die Dinge. Eine tiefe Traurigkeit hatte sich ihm zwischen Lunge und Herz gelegt. Gefühlskeusch hatte er viele Jahre über sein Weh zu Sils geschwiegen, viele Jahre lang.
In Berlin lebt sich’s prächtig, eine sublim schöne Stadt. War er glücklicher, als er noch nicht wusste, ob ein Louisdor rund oder eckig ist? Keineswegs. Mit leeren Händen zurückkehren wie sein Vater, das war ausgeschlossen. Die Mutter war zwar von adligem Geschlecht: Sie entstammte der Familie Castelmur, so dass Bildung, Umsicht, Haltung an die Herkunft erinnerten. Aber Vermögen und Privilegien hingen nicht mehr daran.
Johann ist nun siebenunddreißig Jahre alt. Nichts und niemand wird ihn jemals hinführen, nach Hause. Fast mit Starrsinn hat er bislang die Erinnerung an die frühen Jahre verscheucht, erfolgreich. Nichts und niemand wird ihn zufällig hinschubsen, er muss selbst entscheiden, zurückzuwollen, dort über die Alpen, an die letzte Kante vor Italien, ins Engadin, kurz vor dem Malojapass, nach Hause, nach Sils Maria.
Zögerlichen Schrittes betritt er die Eingangshalle der Bank, dreht sich noch einmal um – noch kann er zurück, alles vergessen, die Idee dieser Reise tief vergraben, am besten für immer. Johann bleibt stehen. Nein, das passt nicht zu ihm. Er ist nicht mehr in der Lage, so viel Versäumnis geduldig weiterzuschleppen. Er weiß zu gut um die jahrelange Sehnsucht, einmal zurückzukehren. Niemand sucht ihn, schließlich ist er doch kein Refugié, kein Mörder, der zum Tatort zurückschleicht. Nichts hat er verbrochen.
Morgen früh wird er sich auf den Weg machen. Der Extrawagen wird auf ihn warten, es ist so weit. So viele Leben stehen zwischen Sils und Berlin, dass er sich trauen kann, der Kindheit ins Angesicht zu blicken. Alle hat er damals im Stich gelassen, Mutter und Großmutter, den kleinen Michel, allen Kummer beschert, das konnte nach so viel Leben dazwischen verziehen werden, so hofft er. Hat die Zeit den Stachel der Aufregungen stumpf werden lassen?
Zuvorkommend wird er von einem servilen Bankbediensteten begrüßt. Dieser Moment nimmt ihm die Zeit, seinen Zweifeln nachzuhängen. Man bedient ihn mit freundlichen Gesten, er ist ein gern gesehener Kunde. Viel Geld trägt er hierhin, denn seine Konditorei zwei Häuser weiter ist gut besucht, eine weitere am Potsdamer Tor ebenfalls, und an anderen Läden der süßen Branche ist er beteiligt. Geschäftlich vif und sicher, hat er mit seinen merkantilen Mutproben gut gezielt. Die Lage der süßen Branche ist zu seinen Gunsten.
Und noch eine Portion List dazu: Als Friederike von Berg, die adelige Hofdame der Königin Luise, zum ersten Mal die Konditorei betrat, streckte er alle seine Fühler aus. Die sehr gebildete Hofdame redete ununterbrochen, zitierte Goethe, lachte, probierte Johanns neuste Marzipankreation, und eine Pastete auch, und noch eine, und redete dabei wie ein Wasserfall, schließlich verschluckte sie sich, prustete und hustete heftig. Johann stand vor ihr. Klopft man einer Hofdame auf den Rücken? Johann hob sie knapp vom Boden hoch, ließ einen Stuhl bringen, Wasser, tröstete sie, hielt ihr die Hand, während sie wieder zu sich kam. Erschöpft lehnte sie sich zurück. Langsam fand sie Worte, um ihr Entzücken über diese neuen Gaumenfreuden kundzutun. Johann nahm das Lob stolz an und stand angespannt, aber ruhig auf.
»Was Ihrem Gaumen auf diese Weise schmeichelt, könnte auch Königin Luise erfreuen.«
Flink packte er seine besten Stücke ein, hoffte, dass die geschwätzige Hofdame nicht selber die Pasteten verdrückte, ohne die Königin davon kosten zu lassen. Glück hatte er: Sie soll die Pröbchen hoch gelobt haben, wurde Johanns Kundin. Der Hof liebt es, wenn einer die Vorlieben des preußischen Königshauses, und noch mehr die der Königin Luise, kennt. Sie ist eine junge anziehende Schönheit, deren Charme man sich kaum entziehen kann. Welche Delikatessen sie schätzt, merkt sich die weitere Hofgesellschaft genau. Und die Hauptstadt liebt es, die süßen Extravaganzen des Hofes ebenfalls zu goutieren, und die Provinz eifert mit Vergnügen den Usancen der Hauptstadt nach. Voilà. Alle Gunst der Stunde für Johann. Die Umstände stärkten sein freudiges Temperament und auch seinen Durchsetzungswillen. Was er anfasst, floriert. Dabei ist er nicht wirklich ein Abenteurer, er ist – viel subtiler – ein Fuchs, eine Nase, ein hochsensibler Experimentierer, der, wenn es passt, schnell disponiert, dann ist er in seinem Element.
Um wieder Land zu gewinnen, musste er in den ersten Jahren in Berlin mühsam den Gehorsam abschütteln, den ihm die lange Lehrzeit in Magdeburg aufgebürdet hatte. Der Engadiner Meister der Patisseriekunst und Wasserbrenner Fanconi, in Magdeburg niedergelassen, hatte ihn in die Lehre genommen. Johann wunderte sich: Die eigenen Leute waren überall. Er verlor keine Zeit, fing sofort an, und hatte dabei schlicht vergessen, dass auch sein Vater Zuckerbäcker gewesen war, in Triest. Nach kurzer Zeit wunderte er sich noch mehr: Bündner Konditoren waren überall. Noch in der Lehre schwebte ihm vor, diese Tatsache zu nutzen, Netze zu knüpfen.
Johann machte einen guten Eindruck, man konnte auf ihn setzen, er wirkte zuverlässig. Als einer der wenigen begann er seine Lehre schuldenfrei. Viele hatten sich den geplanten Weg zum Meister finanzieren lassen und mussten ihre Reise mit dem mageren Lehrgeldlohn jahrelang abarbeiten. Johann begriff rasch, »Fleiss und Thätigkeit« konnten sein Glück und sein ferneres Fortkommen schneller begründen. Er bekam sofort Kleidung und Wäsche, fühlte sich adrett, der Weg machte Sinn.
Fanconi lebt nicht mehr, eine Lungenentzündung riss ihn in den Tod. Vielleicht fällt deshalb Johanns Blick auf die zähen Magdeburger Jahre milde aus. Warum diese Nachsicht? Härter hätte es kaum sein können. Fanconi war ein stiller Herrscher. Sein finsterer Blick reichte aus, um die Lehrlinge zurechtzuweisen.
Wie konnte ich es so lange aushalten? Woher nahm ich so viel Geduld? Versunken wartet Johann, dass der Bankbedienstete ihm die Scheine bringt. Und die Goldstücke. Ein Louisdor ist rund, heute weiß er es. Er sitzt und wartet. Woher nahm ich damals diese Geduld, um Fanconi auszuhalten?
Mehr als elf Stunden am Tag mühte er sich in der heißen Backstube ab, Nachtarbeit, wenig Schlaf, ungesunde Feuchtigkeit. Die Lehre: Jahre saurer Arbeit. Erst dachte er, er könnte sich daran gewöhnen. Falsch. Er begann Löwenkräfte zu mobilisieren, alles daran zu setzen, damit die Zeit der Härte und der Demut schnell vorüberging. Von da an lebte er schneller, etwas in ihm brannte, vielleicht entstand so der unbändige Drang voranzukommen. Aber in allem Eifer gab es eine wunderbare Komponente, die die Wachheit der Sinne hervorrief.
Dem Konditorhandwerk muss etwas Generöses innewohnen, der Zuckerbäcker, der an Zutaten geizt, ist verloren. Wie teuer die Zutaten auch sind, zimperlich darf er nicht sein. Der Verstand muss den Sinnen Vorrang einräumen, das führt zum Genuss, verlangt eine sensible Ader beim Goutieren und kann zur Verschwendung verführen.
Johann wusste das früh, es reizte ihn. Er beobachtete Gesellen, die heimlich nachts in den Arznei-, Koch- und Bäckerbüchern des Meisters nach Rezepten gierten und in Bange abschrieben. Frankreich war für die Branche die Hochburg der Zunft – und der Verschwendung. Nur wenige Rezeptbücher wurden übersetzt. Sie wurden wie Schätze verwahrt. Eines Nachts musste Johann für andere Schmiere stehen. Das stachelte seinen Mut an. Es gab etwas zu erobern, feine, kostbare Delikatessen, von Geheimnissen umwoben, kurzum: Im Lauf der Lehre begeisterte er sich für sein Fach. Sensible Zungen mit Trouvaillen entzücken, das spornte ihn an.
Als er in Berlin eintraf, wurde gerade das Brandenburger Tor mit Schadows Quadriga gekrönt. Er orientierte sich blitzschnell, half in den ersten Monaten einer Brezelverkäuferin – Zeit, die Lage zu sondieren, Kontakte zu knüpfen, Orte zu suchen. Schließlich mietete er einen Keller mit Backofen an, verkaufte sein erstes Gebäck auf der Straße, suchte bald schon Räume, plante das eigene Geschäft.
Als er am 1.Mai 1796 seine eigene Konditorei eröffnete, war er gerade mal dreiundzwanzig Jahre alt. Stechbahn 1, beste Adresse. Die geputzte Menge stolzierte auf und ab und schaute neugierig auf seine Auslagen. Die Gebäude der Stechbahn waren im französischen Stil als erste dreistöckige Kauf- und Wohnhäuser Berlins einheitlich erbaut. Im Erdgeschoss offene Bogenlauben mit Kaufläden, vor der Tür hatten fünfzehn Mietskutschen ihren Standplatz – eine Idee des Königs, zur Bequemlichkeit des Publikums. Und nun zog Johann mit seiner süßen Zauberkunst ein. Pasteten, Schokolade und Marzipan waren seine Spezialität. Er war sich seiner sicher.
Der verschmitzte Buchhändler Ernst Mittler, der ihn auf den freien Laden aufmerksam gemacht hatte, als ein Tabakhändler ausgezogen war, kam nicht selten vorbei, um Johanns courfähige Kundschaft zu beäugen. Deren höfliche Überheblichkeit zog ihn regelrecht an. Der Lotterieladen der Familie Matzdorff, das Bankhaus Jacquier & Securius und die Konkurrenz: die Volpische Konditorei. Wie sollte Johann es mit Volpi aufnehmen? Eine Konditorei, drei Häuser weiter, da konnte man die Freundlichkeit drehen und wenden, wie man wollte, das war ein Problem.
Johann wusste: Der Konkurrent war auch ein Engadiner. Volpi, nicht weniger eifrig als er, verkaufte sehr exquisite kandierte Früchte und Bonbons. Johann versprach ihm, weder das eine noch das andere anzubieten.
Rasch sprach es sich herum: Jostys Pasteten sind ein Erlebnis. Teure Capricen, die Johann vermögend machen werden. Auf der Bank zählte man sein Geld kaum noch, man wog es. Prächtige Equipagen fuhren vor. Damen mit ihren Zofen stiegen aus, schauten sich die Auslagen an, fragten Josty nach neuen Kreationen. Ihre Besuche bei ihm nannten sie »Passionsstationen«. Sie verwickelten ihn in Gespräche, zelebrierten den Einkauf raffinierter Gebäcke. Er belieferte Henriette Herz, Rachel Varnhagen und Charlotte von Kalb. Iffland ließ ihn in sein Lusthaus Villa Tranquilitas im Tiergarten süße Stücke bringen. Die Schauspielerin Henriette Meyer sagte es weiter. »Die Unzelmann«, die Heroine des Schauspielhauses am Gendarmenmarkt und Konkurrentin der Meyer, kam jede Woche. Kabinettsrat Karl Friedrich Beyme könnte sogar ein bisschen süchtig geworden sein, manchmal ließ er seinen Lakai zweimal am Tag seine Lieblingspralinen holen. Johann scharrte rasant Geld zusammen. Und bei allem Erfolg in der Prominenz von Hof, Kunst und Geist bestand an der Stechbahn die Kundschaft überwiegend aus höheren Beamten und pensionierten Offizieren.
An der Wand seiner Konditorei ließ Johann ein lebensgroßes Wandgemälde des Königs in Prachtuniform anfertigen. Es sollte dem ehemaligen Soldaten zeigen, dass er sich an einem Ort befinde, wo die preußische Militärhierarchie geschätzt wurde. An Wochentagen sah man viele Zivilpersonen, deren ramassierter Schnurrbart den pensionierten Militär verriet. Sonntags, nach der Parade, blitzten und blinkten die Uniformen. Jostys Publikum wurde in den Journalen als reif beschrieben, manche Besucher waren »malkontent, wenn auch nur im Stillen, was ja nicht gegen die Subordination ist«. Ganz anders als an der Stechbahn wurde ein paar Jahre später das Café am Potsdamer Tor sofort zum Ort, wo man auch Zeitung las und politisch disputierte. Keineswegs eine canaillöse Wirtschaft, im Gegenteil: Es herrschte angeregte Diskussion, gehobene, fast feierliche Stimmung, ein raffiniertes Flair, das Johann sehr geschickt zu lenken wusste. Männer zeigten sich mit Frauen, schönen Frauen, nicht immer den eigenen. Die delikat gekleideten Damen hatten regen Anteil an der Ausstrahlung des Cafés. Wenn sie ihre Capricen kauften, konnte man sie ansprechen, hofieren, beobachten. Hier wurde Tournüre und Geschmack gepflegt.
Auch das Café Josty sollte zum Magneten werden. Johann ruhte sich keineswegs aus, er vermehrte die Verkaufsstätten der Patisserie, eröffnete an der Börsenhalle eine weitere Niederlassung. Er träumte von einer Konditorei mit Getränkeausschank. Die Ära der Kaffeeriecher und Spitzel war zwar vorbei, aber die Lizenz für Kaffeeausschank noch gesperrt. Giovanoli, ein anderer Engadiner, der in der Charlottenstraße im gleichen Genre erfolgreich war, eröffnete die erste Gaststätte, in der neben dem Verkauf von Patisserien auch der Kaffeeausschank erlaubt war. Endlich war die Lizenz dafür vergeben worden. Die Angst der Obrigkeit, durch Kaffeehandel Devisen an Ausländer zu verlieren, war passé. Prompt imitierte Josty den Kollegen Giovanoli am Potsdamer Platz.
»Hier riecht’s doch wahrhaftig nach Kaffee!«, rief Ernst Mittler.
»Es soll so sein, stell dir vor, es darf so sein!«
Mittler beneidete Johann sofort, ahnte, dass man damit schnell Geld machen könnte. Die Ära der Riecher hatte tief gesessen, so dass manche Kunden über die »bestgehassten Franzosen Berlins« noch einmal böse schimpften und irrwitzige Geschichten über die Steuerpächter von früher erzählten. Wie verzweifelt muss der König einst gewesen sein! Über die Geschichten hinweg bestellte jeder, der den Laden betrat, Kaffee mit Pasteten. Das galt als chic, die Kasse rasselte. Josty war in aller Munde. Das philiströse Publikum war begeistert.
Gar mancher Dichter widmete Jostys ambrosischem Kaffee pathetische Zeilen.
Die Geschäfte liefen über alle Hoffnungen hinaus gut. Mit seinem Freund Andrea Puonz, der auch aus Sils stammte, entwickelte Johann immer neue Ideen. Jachem Zamboni aus Bever, der im schlesischen Hirschberg schon eine Konditorei besaß, schloss sich ihnen an. Bald kam noch Christofel Pedotti aus Ftan hinzu. Der Erfolg gab Johann Rückenwind, beflügelte die Visionen, die »Johann Josty & Co.« wurde gegründet und dem Gesellschaftsvertrag die Klausel beigefügt, dass bei Uneinigkeit jeder Teilhaber einen Bündner, »ün hom Grischun«, wählen und dass alles, was die Vertrauensmänner beschließen oder entscheiden würden, rechtskräftig sein solle wie ein obrigkeitliches Urteil. Man träumte von Potsdam, Danzig, Stettin, Breslau – und träumte nicht nur. Gespräche wurden geführt, Verbindungen geknüpft, Räume besichtigt, Lagepläne studiert.
Seine begehrten Pasteten ließ Johann in einer Backstube unweit der Stechbahn herstellen, denn vor Ort wurde der Platz knapp. In der ausgelagerten Küche leitete und überwachte Andrea Puonz die Produktion. Johann und seine Leute überprüften mit Luchsaugen und feiner Zunge stets die süßen Trouvaillen. Johann selbst experimentierte, suchte fiebrig nach neuen Kombinationen von Zutaten, hielt sich über importierte Gewürze auf dem Laufenden, war à jour, was modische Rezepte betraf. Er wusste: Seine Klientel war alles andere als verschwenderisch, verlangte Nahrhaftes für ihr Geld. Die Vermahlung des Kakaos war noch nicht erfunden, so probierte er, durch Verkleinerung der Menge den starken Geschmack durch Gewürze aufzuwiegen, die Geheimnisse des Zusammenspiels von Geschmack und Parfüm auszufeilen. Gar mit Fleischextrakten versuchte er, Schokolade nahrhafter zu machen, erfand viele Marzipanvarianten, übte am Einsatz von Tragant, das Maß vom Genuss des Auges und des Gaumens auszubalancieren. Er wusste um sein künstlerisches Können, erarbeitete neue Schablonen für Verzierungen: Muscheln, Rosetten, Bärentatzen, Madeleineformen.
In vielem wirkten die Engadiner Leute preußischer als die wahren Preußen selbst. Zu stolz, um unredlich zu sein. Johann wusste das. Nicht nur in ihrer peniblen Sauberkeit bei der Warenbehandlung waren sie vergleichbar. Die Alpenleute, die in der Fremde beinahe ein Volk von Zuckerbäckern wurden, wussten ihre Kunst den Usancen anderer Länder beflissen anzupassen. Aber hier in Preußen schienen die Bündner sich an die Passform der Sitten besonders gut anzuschmiegen, sie verstanden es, sich in einer anspruchslosen Artigkeit gut anzubequemen, und ihre freundliche Gefälligkeit kam dem Berlinertum besonders entgegen. Im Kern waren sie ähnlich. Häufig witzelte Johann darüber, wobei seine Landsleute zu ihrer Rettung hervorbrachten, dass sie auch ganz anders könnten, und dass die Bündner einfach ein Gespür dafür hatten, nicht anzuecken. Wenn sie unter sich waren, wollten sie in ihren Herzen keine Preußen sein.





























