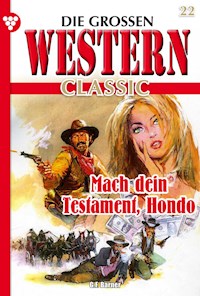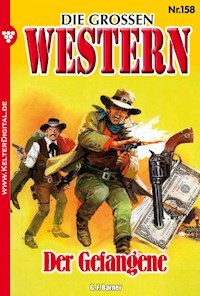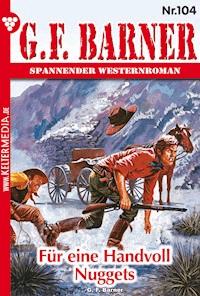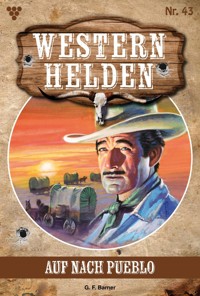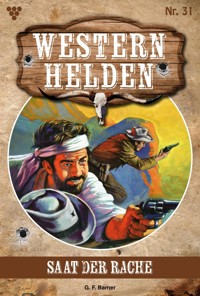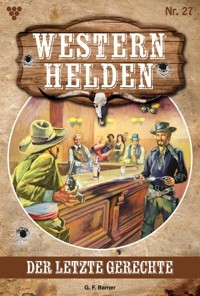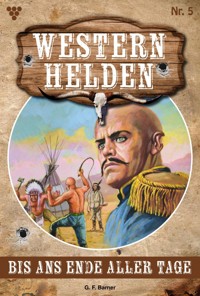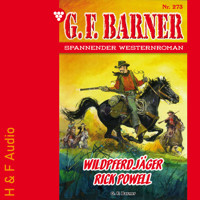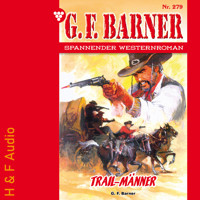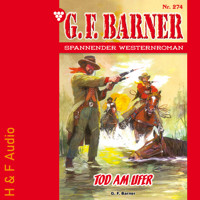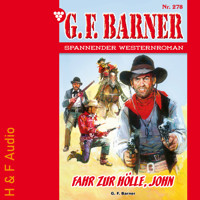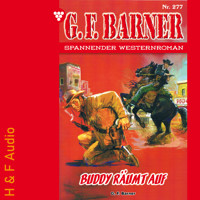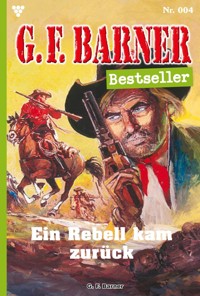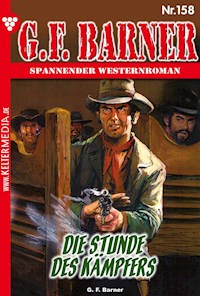
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: G.F. Barner
- Sprache: Deutsch
Begleiten Sie die Helden bei ihrem rauen Kampf gegen Outlaws und Revolverhelden oder auf staubigen Rindertrails. G. F. Barner ist legendär wie kaum ein anderer. Seine Vita zeichnet einen imposanten Erfolgsweg, wie er nur selten beschritten wurde. Als Western-Autor wurde er eine Institution. G. F. Barner wurde als Naturtalent entdeckt und dann als Schriftsteller berühmt. Seine Leser schwärmen von Romanen wie "Torlans letzter Ritt", "Sturm über Montana" und ganz besonders "Revolver-Jane". Der Western war für ihn ein Lebenselixier, und doch besitzt er auch in anderen Genres bemerkenswerte Popularität. Die Tür knarrt, der Mann hüstelt neben ihm. »Ich wußte nicht, daß er einen Bruder hatte«, sagte Sheriff Meales gepreßt. »Morgen hätten wir ihn beerdigt.« »Ja.« Der Mann neben Meales sagt nur das eine Wort und zieht die Tür ganz auf. Meales beobachtet ihn von der Seite. Der Mann kam am Nachmittag kurz vor der Dämmerung in die Stadt und war in Mrs. Swayers Store gegangen, um ein paar Zigarren zu kaufen. Im Store herrschte Zwielicht. Und Mrs. Swayer ist eine abergläubische Frau. Sie hat geschrien, als sähe sie eine Horde Apachen in voller Kriegsbemalung oder Larry Dorans Geist durch die Straße reiten. Ja, denkt Meales, er gleicht ihm. Er ist nur ein wenig größer, und die Augen sind grau. Larry hatte braune Augen und etwas volleres Haar, aber sonst fast dasselbe Gesicht. Im Lampenschein merkt man den Unterschied, er ist älter und schweigsamer. »Kane hat ihm den Sarg gekauft, er ist ein seltsamer Mann.« »Kane, für den er einmal gearbeitet hat?« »Ja, Doran, das ist schon lange her.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G.F. Barner – 158 –De Stunde des Kämpfers
Viehdiebstahl im Grenzgebiet
G.F. Barner
Die Tür knarrt, der Mann hüstelt neben ihm.
»Ich wußte nicht, daß er einen Bruder hatte«, sagte Sheriff Meales gepreßt. »Morgen hätten wir ihn beerdigt.«
»Ja.«
Der Mann neben Meales sagt nur das eine Wort und zieht die Tür ganz auf. Meales beobachtet ihn von der Seite. Der Mann kam am Nachmittag kurz vor der Dämmerung in die Stadt und war in Mrs. Swayers Store gegangen, um ein paar Zigarren zu kaufen. Im Store herrschte Zwielicht. Und Mrs. Swayer ist eine abergläubische Frau. Sie hat geschrien, als sähe sie eine Horde Apachen in voller Kriegsbemalung oder Larry Dorans Geist durch die Straße reiten.
Ja, denkt Meales, er gleicht ihm. Er ist nur ein wenig größer, und die Augen sind grau. Larry hatte braune Augen und etwas volleres Haar, aber sonst fast dasselbe Gesicht. Im Lampenschein merkt man den Unterschied, er ist älter und schweigsamer.
»Kane hat ihm den Sarg gekauft, er ist ein seltsamer Mann.«
»Kane, für den er einmal gearbeitet hat?«
»Ja, Doran, das ist schon lange her. Ich laß dich besser allein, wie?«
»Ich komme nachher zum Office, Sheriff.«
Mehr sagt Hondo Doran nicht. Die Tür knallt hinter ihm zu, die Lampe hält er in seiner Hand. Der Schein schwankt, das Licht fällt auf den braunen Sarg.
Sie haben ihn hoch aufgebahrt, denkt Doran, und die Fenster oben geöffnet.
Der Stoff schabt am Holz, als er zieht. Das Gesicht unter ihm trägt einen trotzigen, verbissenen Zug, es ist nicht ruhig. Als wenn er noch immer kämpft, denkt Hondo Doran düster, aber gegen wen? Wer hat ihn erschossen?
Er hat nicht viel gefragt, nachdem die Frau losschrie und voller Furcht bis an das Regal ihres Store zurückwich. Der Sheriff kam schnell und hat selber erschrocken ausgesehen. Die Ähnlichkeit zwischen ihm und Larry hat die Leute erschreckt.
In der Tür steht ein Mädchen.
Nicht irgendeines, er weiß es in dem Augenblick, in dem er es sieht, dieses Mädchen beschäftigt ihn einige Sekunden lang. Sie sehen sich an, das Mädchen mit Schreck in den Augen und leicht geöffnetem Mund.
»Ich bin Hondo Doran«, sagt er langsam und ruhig. »Ich bin der Bruder, Miß…«
»Kane«, antwortet sie leise. »Ich bin Suzanne Kane, einen Moment dachte ich wirklich… Die Leute kamen in Mammy Hillers Hotel gerannt und sagten, Larry wäre wieder…«
Er blickt sich um und schüttelt den Kopf. Larry wird nie mehr aufstehen. Dann nimmt er die Lampe und hängt sie wieder an den Haken. Ein ewiges Licht für Larry.
»Sie sind größer als Larry, Mr. Doran.«
»Ja, ich glaube, Miß Kane. Ist der Sheriff nicht mehr draußen?«
»Nein, ich habe ihn nicht gesehen.«
»Er wird sich freuen und alles tun, um Ihnen zu helfen, Doran. Was – entschuldigen Sie die Frage – was wollten Sie hier?«
»Vielleicht bleiben«, antwortet er leise. »Ich habe etwas Geld sparen können und dachte, mit Larry gemeinsam eine Ranch aufzubauen.«
»Wollen Sie zum Sheriff, dann gehe ich voraus ins Hotel und sage meinem Vater, daß Sie kommen.«
»Ich gebe nur den Schlüssel ab. Ein Mann der Kane-Ranch hat meinen Bruder gefunden, also weiß der Sheriff sicher nicht mehr als dieser Mann. Ist er in der Stadt?«
»Sie meinen Clay? Ja, er ist im Hotel.«
»Gut, dann komme ich mit.«
Er geht neben ihr. Sie hat Mühe, an seiner Seite zu bleiben, und sie hat den Eindruck, daß er ein Mann ist, der auf sein Ziel zumarschiert und alles hinter sich läßt, was nicht schnell genug ist, neben ihm zu bleiben.
»Ich gehe zu schnell«, sagt er plötzlich entschuldigend. »Ich habe gerade an Larry denken müssen.«
Er lächelt nicht, er ist ernst und geht die wenigen Schritte zu Meales, der unter dem Vorbaudach steht, allein.
»Doran, wenn du Hilfe brauchst, ich bin jederzeit für dich da. Diese Viehdiebereien haben wir schon seit zwei Jahren – nicht nur bei den
Kanes.«
»So, das wußte ich nicht«, antwortet Doran knapp. »Werden alle Rancher bestohlen?«
»Die nur, die etwa bis zu sechzig, siebzig Meilen von der Grenze entfernt wohnen, Doran.«
»Wir reden noch darüber, Sheriff. Vielen Dank für den Schlüssel.«
Er nickt ihm zu, dann tritt er wieder neben Suzanne.
»Sie wußten nicht, daß andere Rancher auch bestohlen worden sind?«
»Nein, woher sollte ich das wissen?« fragt er achselzuckend. »Eine Bande? Wieviel Rinder verschwinden hier im Monat?«
»An der ganzen Grenzlänge werden es etwa hundert Rinder sein.«
Er blickt auf sie herab und zieht die Augenbrauen hoch.
»Und man hat noch niemals einen Viehdieb erwischt, Miß Kane?«
»Noch nie – oder doch! In Parsons Saloon redete vor gut einem Dreivierteljahr ein Mann, der wie ein Cowboy der tausend Hügel aussah, im betrunkenen Zustand einige seltsame Dinge. Er begann zu lachen, als sich Genroy, ein Rancher, mit Parson über seine verschwundenen Rinder unterhielt. Und dann sagte er, er solle sie nur schön suchen.«
»Kannte jemand den Mann?«
»Er war oft in der Stadt und nannte sich Webbster. Ob das sein richtiger Name war, weiß ich nicht. Er trank immer eine ganze Menge. An diesem Abend war er nicht mehr fähig, ohne Hilfe zu gehen. Als Genroy und zwei seiner Leute den Burschen packten und ihm drohten, schwieg er verstockt. Er schien nüchtern zu werden und sagte keinen Ton mehr. Daraufhin sperrten sie ihn ein. Er schien sich plötzlich zu fürchten. Das bestärkte Genroy und die anderen noch in der Meinung, den richtigen Mann erwischt zu haben. Sie schafften ihn ins Jail, aber dort saß er keine zwei Stunden.«
Suzanne Kane bleibt stehen, als sie den Gehsteig auf der anderen Straßenseite erreicht haben.
»Da drüben in der Gasse war es«, sagt sie gepreßt. »Das Fenster des Jails war damals tiefer. Der Sheriff hörte den Mann im Jail schreien, aber ehe er an der Zellentür sein konnte, krachte ein Schuf. Jemand, der durch die Gasse davonjagte, hatte den Mann kaltblütig durch das Fenster erschossen.«
»Also war er ein Viehdieb«, stellt Doran trocken fest. »Sicher ein kleiner. Wer konnte der Mann hinter ihm gewesen sein?«
Einen Moment blickte sie zu Boden.
»Man redet viel«, sagt sie dann flüsternd. »Ich kann dazu wenig sagen. Wenn Vater etwas sagen will – und ich denke, er wird das tun, dann fragen Sie ihn nur alles, was Sie wissen wollen. Es hat einmal Viehdiebe hier gegeben – vor neun, zehn Jahren. Kommen Sie herein, Vater sitzt mit Genroy und Clay unten im Hotel.«
Zwei, drei Männer, die auf dem Vorbau des Hotels stehen, sehen Doran groß an. Er geht an ihnen vorbei, folgt dem Mädchen und denkt an Larrys Briefe aus der ersten Zeit, die Larry auf der Kane-Ranch verbrachte. Er schrieb von Suzanne Kane, daß sie das prächtigste Mädel sei, das er jemals gesehen habe.
*
Sie geht nun vor ihm, das Haar von einer Schleife zusammengehalten, den Kopf leicht gesenkt. Im Flur brennt Licht. Linker Hand führt eine Tür zum Saloon. Stimmengewirr ertönt von dort.
Rechts geht es zum Eßsaal und Klubzimmer des Hotels, eine Treppe führt vor ihnen steil nach oben.
»Wir müssen hier hinein, Mr. Doran.«
Kaum öffnet sie die Tür, da kommt die polternde, knurrige Stimme eines Mannes hinter ihr auf.
»Tochter, da bist du ja. Hallo, der verdammte Rumtreiber! Wo, zum Teufel, kommst du her, Junge? Ich werde dir…«
»Es ist nicht Dan«, sagt vor Doran Suzanne eilig. »Vater, das ist Hondo Doran – Larrys Bruder.«
Er sitzt hinter dem Tisch wie ein Löwe, ein großer Mann, breitschultrig, das Haar lang und schon weißgrau. Zwischen seinen starken Brauen ist eine Falte. Sie verrät seine Kurzsichtigkeit.
Nun blinzelt er Doran an.
»Ja – hallo!« sagt er brummig und kämpft seinen Zorn nieder. »Das also ist der große Bruder von Larry. Armer Junge, tut mir leid um ihn, Mann. Er konnte was, mehr als die anderen, vielleicht auch mehr als ich. Rinderverstand ist selten – und eine glückliche Hand noch mehr.«
Er stemmt sich hoch – ein Turm von Mann, dessen Stimme tief und polternd klingt. Sein Händedruck ist eisern, seine Augen hinter den dicken Brillengläsern messen Doran von Kopf bis Fuß.
»Das ist Hillary Genroy – mein Nachbar. Und das hier ist Clay.«
»Hallo!« sagt Doran ruhig. »Ich habe ein paar Fragen, Mr. Kane.«
»Natürlich. Frage, mein Freund. Was willst du wissen?«
»Hat ihn jemand gehaßt?« fragt Doran und setzt sich, als der Alte auf den einen Stuhl deutet und die anderen beiden Männer ihm die Hand gereicht haben. »Gab es jemanden, der ihn aus Haß umbringen konnte?«
»Er hatte nur Freunde – er hatte nie mit jemandem ernsthaften Streit, Doran. Nein, gehaßt hat ihn keiner hier. Es sind die verdammten Viehdiebe gewesen, der Teufel soll das Gesindel holen. Einmal möchte ich sie packen, ich würde die Hälfte aufhängen und den Rest erschießen lassen!«
»William«, murmelt Genroy, ein hagerer, knochiger Mann, grimmig. »Wenn mir damals der verdammte Sheriff nicht einen Strich durch meine Rechnung gemacht hätte, dann würde dieser Webbster in allen Tönen geheult haben. Fange einen Viehdieb und brate ihn, er wird alles sagen und froh sein, wenn er reden kann.«
»Wir brauchen einen Sheriff, ich bin für das Gesetz!« knurrt William Kane. »Na gut, hinter diesem Webbster haben andere gesteckt, aber wer?«
»Keinen Verdacht, Kane?« erkundigt sich Doran bedächtig.
Kane dreht den Kopf und blinzelt heftig.
»Schon«, antwortet er ruhig. »Es hat hier vor einem Dutzend Jahren Viehdiebe genug gegeben. Dann konnte ich einige erwischen.
Weißt du noch, Genroy?«
»Ja«, antwortet Genroy bissig. »Ich war dabei. Der Anführer damals hieß Klyburn, Sam Klyburn. Er hatte zwei Jungs, die reinsten diebischen Elstern. Was die Halunken sahen, das nahmen sie mit.
Eines Tages erwischten wir sie. Der Alte hatte wenigstens Mut genug, den Rückzug mit ein paar Mann zu decken, und schickte seine Söhne weg. Klyburn starb, zwei andere mit ihm – Dallard und Matteo.«
»Und die Söhne?« fragt Doran.
»Die entwischten. Wir konnten nicht genau feststellen, wer alles dabeigewesen war. Wir bekamen nur die drei Burschen in die Finger«, brummt William Kane gereizt. »Matteo lebte noch, aber er konnte nichts mehr verraten. Klyburns Haus steckten wir an, seine Weide nahm sich Genroy. Ich ritt mit meinen Leuten zu Dallard und besetzte seine Weide. Wenn die Tochter nicht gewesen wäre, dann hätte ich Dallards Haus auch dem Feuer übergeben.«
»Die Dallards leben also noch hier?« fragt Doran.
»Seine Frau war eine brave Seele«, mischt sich Clay ein und wiegt bedauernd den Kopf. »Sie war zwei Jahre vor der Sache gestorben. Nein, es sind nur noch Ed Dallard und seine Schwester auf dem Stück Land, das wir ihnen gelassen haben.«
»Und ist Dallard ein Viehdieb?«
»Wir haben in den vergangenen Jahren oft genug nachgesehen, immer früh genug, so daß sie weder die Pferde noch die Rinder, die verschwunden waren, wegschaffen und wieder auf ihrem Land sein konnten. Auch dein Bruder Larry ist zweimal dort gewesen«, gibt der alte Kane zu verstehen. »Doran, Ed Dallard ist gerissen, aber einen Mord – traust du ihm einen Mord zu, Clay?«
Clay schüttelt stumm den Kopf.
»Also nicht«, stellt Doran fest. »Und Klyburns Söhne, wo sind die geblieben?«
»Weiß der Teufel, denen hat die Furcht wohl so in den Adern gesteckt, daß sie bis nach Feuerland gelaufen sind«, knurrt Genroy. »Niemand hat sie seitdem zu Gesicht bekommen, aber wir denken seit Monaten, daß sie doch in der Gegend stecken müssen. Matteos Bruder, der mit Sicherheit damals erkannt wurde, ist in der letzten Zeit zweimal hier gesehen worden.«
»Ich wette meinen Hut, daß der Lump vielleicht sogar mit den Klyburn-Jungs zusammensteckt und von drüben kommt, um hier Vieh zu stehlen«, erklärt Kane. »Hier kann nur jemand stehlen, der das Land wie seine Taschen kennt. Wenn wir wissen, wo wir Matteo finden können, dann haben wir sie alle, aber der Kerl sitzt drüben in Mexiko und ist nicht greifbar.«
»Moment«, sagt Doran kühl. »Könnte man das nicht herausbekommen, Kane? Ich bin einige Zeit in New Mexico gewesen und auch manchmal in Mexiko. Damals machte ich die Erfahrung, daß man in Mexiko fast jeden bestechen kann.«
»Nicht hier«, antwortet Kane verbissen. »Doran, die Kerle halten zusammen, sobald es darum geht, einem Gringo – so nennen sie uns in Mexiko – Vieh zu stehlen.«
»Was hat man versucht, um die Burschen zu erwischen?«
»Wir haben Posten reiten lassen«, brummt Kane. »Alle Rancher haben Leute abgestellt. Sind unsere Wachen im Osten gewesen, dann haben die verdammten Schurken im Süden oder Westen gestohlen. Ich sage doch – es kann nur jemand stehlen, der dieses Land wie seine Taschen kennt, Doran. Mir sind in den letzten zwei Jahren rund dreihundert Rinder davongeflogen.«
»Meist im Frühjahr, ehe die noch ungebrannten Rinder aufgetrieben werden konnten«, meldet sich Clay. »Wir haben alle gesucht, aber nie etwas gefunden.«
Der alte Kane flucht leise. Dann sieht er Clay an und sagt knapp:
»Geh raus und sieh nach, frage ein wenig herum, aber nicht zu auffällig, ob jemand Dan gesehen hat. Ich möchte wissen, wo mein prächtiger Dan sich wieder herumtreibt. Vielleicht ist er irgendwo in der Stadt oder drüben im mexikanischen Nogales. Siehst du ihn, dann schleife ihn an den Ohren her, verstanden, Clay?«
»Ja, Boß.«
Clay steht auf und geht schweigend hinaus. Als die Tür hinter ihm zugefallen ist, fragt Doran:
»Kane, ist Dan dein Sohn?«
»Nun ja«, knurrt Kane mit gefurchten Brauen. »Er ist jetzt eine Woche nicht zu Hause gewesen und hat mir auch nicht geschrieben, wann er sein Gesicht wieder zu zeigen gedenkt. Der Junge macht mich noch krank. Er bekommt es fertig und geht drei Wochen auf die Jagd, aber ich fürchte, erjagt nur zweibeini… Der verdammte Junge!«
Sein Gesicht ist zerfurcht und müde. Er blickt kurz zu seiner Tochter, die reglos an der Wand lehnt, und seufzt schwer.
»Warum sagst du nichts, Tochter?«
»Was soll ich sagen, Vater? Er ist alt genug, um zu wissen, was er macht, denke ich!«
»Denkst du!« sagt er bissig. »Du denkst dir deinen Teil, ich weiß es. Schon gut, ich hätte ihn härter anpacken müssen, aber warum sieht er aus wie deine Mutter? Erledigt, das gehört nicht hier her. Doran, du willst sicher wissen, wie man Larry gefunden hat?«
»Ja, das wollte ich«, murmelt Doran. »In einem Talkessel, das weiß ich, aber wo liegt das Tal?«
»Etwa achtzehn Meilen von der Grenze entfernt im Sardina Canyon«, gibt der Alte zurück. »Clay wollte am Nachmittag mit ein paar Leuten nachsehen, ob er Larry vielleicht helfen mußte. Dein Bruder wollte immer alles allein machen. Nun ja, kurz vor der Dämmerung fand er das Tal. Vier Mann müssen die Rinder aus dem Tal geholt haben, ihre Spuren waren dort. Oben auf den Felsen über dem Tal hat jemand geblutet, also hat Larry einen der Burschen angeschossen. Danach hat Clay zwei meiner Jungs mit Larry auf die Ranch geschickt, während Clay versucht hat, die Fährten zu verfolgen – umsonst, zu viele Steine dort oben.«
»Einer ist verwundet«, murmelt Doran. »Achtzehn Meilen bis zur Grenze? Ob er drüben einen Doc braucht?«
»Kann schon sein, aber du erfährst nichts, Doran, ich sage es dir«, antwortet Genroy grimmig. »Versuchen könntest du es, doch versprich dir nichts davon.«
»Ich werde es mir überlegen«, gibt Doran zurück. »Kann ich in diesem Hotel ein Zimmer für die eine Nacht bekommen? Morgen wird Larry begraben, ich werde danach zu einer kleinen Ranch reiten. Ist dort jemand, der für das Vieh sorgt, Kane?«
»Einer meiner Jungs, Doran. Mann, sei nicht leichtsinnig, denke an Larry, ehe du es dir in den Kopf setzt, nach drüben zu gehen.«
»Ich werde daran denken«, sagt Doran ruhig und steht auf. »Wir sehen uns ja noch morgen, wenn mir einige Fragen einfallen sollten.«
Er nimmt seinen Hut, nickt Suzy kurz zu und geht dann nach draußen.
*
Doran zaudert im Flur einen Moment, dann dreht er sich um und tritt in die Nacht hinaus. Hinten links sieht er den alten Clay aus einem Saloon kommen. Er geht los, bleibt auf diesem Gehsteig und wartet vor dem nächsten Saloon, in dem Clay verschwindet.
Es dauert keine zwei Minuten, bis Clay wieder auf den Vorbau tritt. Doran taucht hinter der Ecke des Hauses auf. Clay bleibt stehen, erkennt ihn und zuckt die Achseln:
»Es ist schlimm mit dem Jungen«, sagt er bitter. »Als er noch klein war, glich er William Kanes Frau sehr, aber nur im Aussehen, sein Charakter ist ein wenig anders. Doran, keine zweihundert Yards weiter ist die Grenze, ich werde mein Pferd holen und drüben nachsehen. Vielleicht muß ich ihn aus einem Bett holen, das ihm nicht gehört.«
»So ist das?« fragt Doran. »Nun ja, der eine macht dies, der andere das. Clay, wer hat meinen Bruder gehaßt?«
Clay, der schon weitergehen will, bleibt mit einem Ruck stehen.
»Niemand hat Larry gehaßt, wirklich keiner, Doran.«
»So? Also, das war es, sonst nichts.«
Clay brummt. »Ich wette, der verdammte Junge hat sich wieder in ein Mädchen vergafft. Er ist einfach nicht hart genug erzogen worden. Dann will ich meinen Gaul holen.«
Er geht davon. Doran aber lehnt sich an den Bretterzaun.
Der Gedanke an Dan Kane ist nur kurz, der an jenen Burschen, der verwundet über die Grenze entwischt sein muß, bedeutend länger.
»Ich finde dich«, sagt Doran zwischen den Zähnen. »Mein Freund, eines Tages habe ich dich. Das ist ein Versprechen!« Eines Tages hat er ihn, er weiß es. Und er soll sich nicht irren. Eines Tages hat er ihn!
*
Der Schmerz hockt in seiner Seite wie ein kleiner Teufel. Und der Teufel hat eine Forke. Er erinnert sich, daß er zuerst nur an eine Gabel dachte, mit der der Teufel ihn peinigte. Nun muß es schon eine Forke sein.
Die Lider halb geschlossen, den Schmerz spürend, blickt er auf die Decke. Er sieht den abgeplatzten Lehm, die großen, schmutzig-grauen Flecken und die Spinnweben. Seine Erinnerung reicht genau bis zum Anblick des Raumes, in dem er noch immer liegt. Er hat – seltsam verschwimmend und schwankend – das Haus gesehen und gemerkt, daß sie ihn von der Decke hochgenommen haben, die zwischen zwei Pferden als Tragbahre gespannt gewesen ist. Dann hat er die Decke angestarrt und Eds Gesicht über sich gesehen.
Du wirst schon wieder, keine Angst. Hast nur ein bißchen viel Blut verloren, Junge. In zwei Wochen bist du wieder auf dem Damm!
Wenn er hin und wieder aufgewacht ist, dann hat er nur Fratzen gesehen, bärtige, ungepflegte Gesichter.
Ed, denkt er, habe ich nicht zu Gesicht bekommen. Wie lange liege ich schon?
Jetzt ist er klar bei Verstand und kann alles deutlich sehen. Und hören.
Die Stimmen sind da – weit entfernt, aber sie werden langsam lauter. Er hat das Gefühl, daß sich die beiden Männer, die reden, ihm nähern. Mühsam wendet er den Kopf, blickt zur Tür und sieht sie nicht. Sie müssen draußen sein.
Dann erkennt er, daß sie im Anbau stecken. Etwas klappert, es hört sich an, als wenn einer Steine gegeneinander wirft.