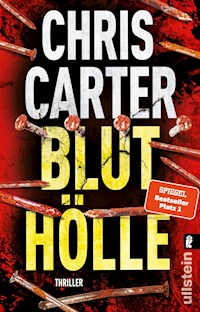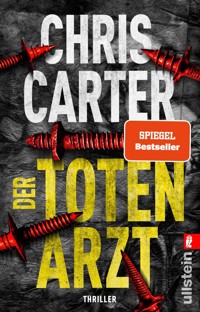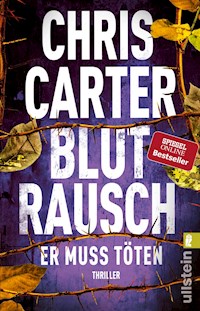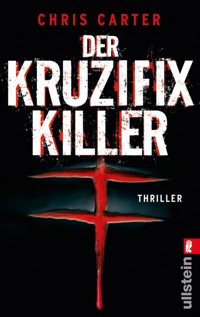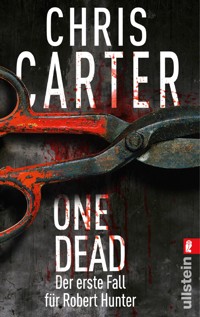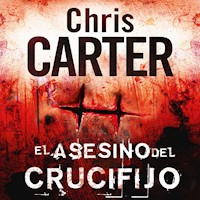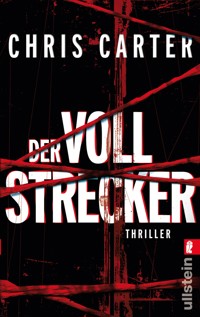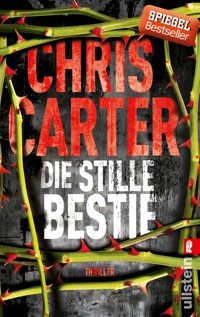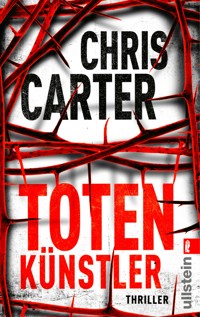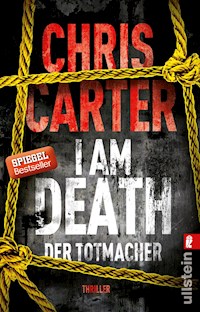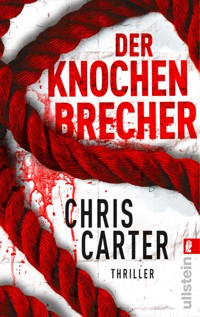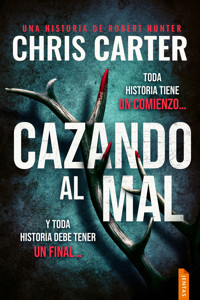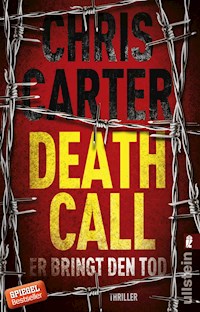
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
SPIEGEL-Bestseller der Psychothriller-Legende Chris Carter: grausame Mordmethoden, ein sadistischer Serienkiller und unerwartete Plot Twists! Chris Carter hat jahrelang als Kriminalpsychologe für die Polizei in Los Angeles gearbeitet, das macht seine Bücher so einzigartig. Sei vorsichtig, wenn das Telefon klingelt. Es könnte der Beginn eines Albtraums sein … Tanya Kaitlin freut sich auf einen entspannten Abend. Plötzlich klingelt ihr Handy, ein Videoanruf von ihrer besten Freundin. Tanya nimmt den Anruf an, und der Albtraum beginnt: Ihre Freundin ist gefesselt und geknebelt. Tanya hat nur eine Chance, die Freundin zu retten, das sagt ihr eine tiefe, unheimliche Stimme. Sie muss zwei Fragen richtig beantworten. Tanya scheitert - und ihre Freundin wird vor ihren Augen brutal ermordet. Profiler Robert Hunter und sein Partner Garcia haben einen neuen Fall: ein Serienmörder, der seinen Opfern in den sozialen Medien auflauert. Er studiert ihre Fehler und nutzt sie für sein perfides Spiel. Und das hat gerade erst begonnen ... »Danke für eine schlaflose Nacht, denn einen Carter unterbricht man nicht. Man MUSS in einem Stück lesen. Brillant, grandios, spannend - wer das nicht liest, hat ehrlich was verpasst.« Amazon-Kundin »Die Hörbücher sind - auch dank Uve Teschner als Sprecher - einfach fesselt, mitreißend und nichts für schwache Nerven. Uve Teschner hat es geschafft, dass mein Hund nachts zur Sicherheit bei mir schlafen durfte.« Amazon-Kundin *** Ein Megathriller für alle, die es blutig mögen! Kommen Sie dem Täter auf die Schliche? ***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Detective Robert Hunter und sein Partner Carlos Garcia werden an den Tatort eines bestialischen Mordes gerufen: Eine junge Frau ist nackt an einen Stuhl gefesselt, das Gesicht von Scherben zerschnitten und zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Aber es gibt eine Zeugin: Der Killer hatte Tanya, die beste Freundin der Toten, vor der Tat angerufen und sie gezwungen, alles mitanzusehen. Jetzt wird Tanya von Selbstvorwürfen zerfressen. Hätte sie den Mord verhindern können, wenn sie auf die Fragen des Täters hätte antworten können, so wie er es ihr versprochen hatte? Hunter aber weiß: Der Mörder hat ihr absichtlich eine Frage gestellt, die sie nicht beantworten konnte. Es ist ein Spiel, bei dem man nur verlieren kann. Und es hat gerade erst begonnen.
Der Autor
Chris Carter wurde 1965 in Brasilien als Sohn italienischer Einwanderer geboren. Er studierte in Michigan forensische Psychologie und arbeitete sechs Jahre lang als Kriminalpsychologe für die Staatsanwaltschaft. Dann zog er nach Los Angeles, wo er als Musiker Karriere machte. Gegenwärtig lebt Chris Carter in London. Seine Thriller um Profiler Robert Hunter sind allesamt Bestseller.
www.chriscarterbooks.com
In der Robert-Hunter-Serie sind in unserem Hause bereits erschienen:
One Dead (E-Book)
Der Kruzifix-Killer
Der Vollstrecker
Der Knochenbrecher
Totenkünstler
Der Totschläger
Die stille Bestie
I Am Death – Der Totmacher
Death Call – Er bringt den Tod
Chris Carter
Death Call
Er bringt den Tod
THRILLER
Aus dem EnglischenvonSybille Uplegger
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1523-2
Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage August 2017
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH,
Berlin 2017
© Chris Carter 2017
Published by Arrangement with Luiz Montoro
Titel der englischen Originalausgabe:
The Caller (Simon & Schuster Inc.)
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Titelabbildung: © FinePic®, München
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
1
Tanya Kaitlin drehte das Wasser ab, stieg aus der Dusche und trocknete sich gründlich ab, bevor sie in ihren schwarzweißen Lieblingsbademantel schlüpfte. Sobald das getan war, griff sie nach dem farblich passenden Handtuch, das an einem der kleinen Haken hinter ihrer Badezimmertür hing, und wickelte es sich wie einen Turban um das strohblonde nasse Haar. Obwohl das Wasser nur lauwarm gewesen war, hatte sich so viel Dampf entwickelt, dass der große Spiegel, der an der Wand über dem Waschtisch aus schwarzem Granit hing, vollständig beschlagen war. Tanya wischte mit der Hand eine kreisrunde Stelle frei. Sie ging ganz nah an den Spiegel heran und inspizierte gründlich ihr Gesicht. Schon nach wenigen Sekunden hatte sie etwas entdeckt.
»O nein«, sagte sie und drehte sich zur Seite, um besser ihr rechtes Profil betrachten zu können. Mit beiden Zeigefingern zog sie in der Nähe ihres Kinns die Haut straff. »Das hättest du wohl gern, du blöder Mistpickel. Aber vergiss es. Ich sehe dich.«
Tanya widerstand dem Drang, an dem kleinen Pickel herumzuquetschen. Stattdessen zog sie die linke Schublade des Waschbeckenunterschranks auf und begann, zielstrebig darin zu wühlen. Die Schublade war voll mit Tiegeln, Tuben und Ampullen, die verschiedene Öle, Cremes, Lotionen und andere »Wundermittel« für die Gesichtshaut enthielten. Tanya kaufte so ziemlich alles, was in einem der vielen Modemagazine angepriesen wurde, die sie regelmäßig las.
»Nein, du nicht … du nicht …«, murmelte sie, während sie einzelne Produkte beiseiteschob. »Wo zum Teufel ist das Teil? Ich hab es, ich weiß ganz genau, dass ich es hier irgendwo hab.« Ihre Suche wurde hektischer. »Ah, da bist du ja.« Erleichtert atmete sie auf.
Aus den Tiefen der Schublade förderte sie eine kleine weiße Tube mit kugelförmigem Applikator zutage. Sie hatte das Produkt bisher noch nie benutzt, aber in einem Artikel, den sie wenige Tage zuvor gelesen hatte, war es als eins der fünf wirksamsten derzeit auf dem Markt erhältlichen Aknemittel angepriesen worden. Nicht, dass Tanya ein Problem mit Akne gehabt hätte – im Gegenteil, für eine Dreiundzwanzigjährige hatte sie ein ungewöhnlich gutes Hautbild. Aber sie sorgte eben gerne für den Fall der Fälle vor. Die Anzahl der Kosmetikprodukte, die sie allein im Laufe der vergangenen zwei Jahre »für den Fall der Fälle« angeschafft hatte, spottete jeder Beschreibung.
Tanya schraubte den Deckel der Tube ab, sah ein weiteres Mal in den Spiegel und tupfte dann mit Hilfe des Roll-on-Applikators eine kleine Menge der Salbe auf das winzige Pickelchen, das kaum sichtbar an ihrem Kinn spross.
»Ganz genau, Mistding. Du bist erledigt«, sagte sie triumphierend. »Jetzt verzieh dich – und zwar noch vor dem Wochenende, sonst gibt’s Ärger.«
Tanya wollte gerade mit ihrem Pflegeritual für Gesicht und Körper beginnen, als sie aus dem Schlafzimmer ein Geräusch hörte – oder wenigstens glaubte sie, aus dem Schlafzimmer ein Geräusch gehört zu haben. Sie öffnete die Badezimmertür, schob ihren Handtuchturban so zurecht, dass ihr rechtes Ohr frei lag, steckte den Kopf durch den Türspalt und lauschte kurz. Die unverwechselbare Melodie verriet ihr, dass sie soeben eine Anfrage für einen Videochat von einer ihrer drei engsten Freundinnen erhalten hatte.
»Komme schon … komme schon!«, rief Tanya und eilte aus dem Bad ins Schlafzimmer. Dort sah sie ihr Smartphone auf dem Nachttisch liegen. Es vibrierte und ruckelte dabei hin und her, als wolle es zur Melodie tanzen. Hastig riss sie es an sich und warf einen Blick auf das Display – die Einladung zum Videochat kam von ihrer besten Freundin Karen Ward. Die Uhr des Smartphones zeigte zweiundzwanzig Uhr neununddreißig an.
Das Telefon vor ihr Gesicht haltend, nahm sie den Anruf an. Sie und Karen telefonierten oft per Video.
»Hey, Süße!«, rief sie und ließ sich auf die Bettkante plumpsen. »Ich hab einen Pickel an meinem Kinn gefunden, dem musste ich gerade erst mal den Garaus machen. Ist das zu fassen?«
Als das Bild auf ihrem Smartphone-Display sichtbar wurde, runzelte sie verwundert die Stirn. Statt des Gesichts ihrer Freundin waren nur deren tiefliegende blaue Augen zu sehen. Und die waren voller Tränen.
»Karen, alles in Ordnung mit dir?«
Karen antwortete nicht.
»Süße, was ist denn los?«, fragte Tanya in ernsthafter Sorge.
Als sich kurz darauf der Bildausschnitt ganz langsam zu vergrößern begann, wurde ihre Besorgnis zu Angst. Das Gefühl legte sich um sie wie ein zu enger Mantel.
Karens helle Haare waren nass, als hätte sie geschwitzt. Wie feuchtes Papier klebten die Strähnen an ihrer Stirn und an den Seiten ihres Gesichts. Sie musste geweint haben, denn ihr Augen-Make-up war verschmiert und ihr in einem bizarren Muster aus schwarzen Zickzacklinien die Wangen heruntergelaufen.
Tanya beugte sich dichter über ihr Smartphone. »Karen, was um alles in der Welt ist denn los? Geht es dir gut?«
Doch auch diesmal bekam sie keine Antwort, und als der Bildwinkel noch weiter aufging, erkannte Tanya endlich, woran das lag: Karen wurde von einem dicken Lederknebel am Sprechen gehindert. Er saß so fest, dass ihr Gesicht davon ganz verzogen wirkte. Der Knebel hatte ihr sogar die Mundwinkel aufgerissen. Aus den Wunden lief Blut über ihr Kinn.
»Was soll das?«, hauchte Tanya kaum hörbar. »Karen, ist das irgendein blöder Scherz?«
»Ich fürchte, Karen kann gerade nicht reden.«
Die Stimme, die Tanya durch die winzigen Lautsprecher ihres Smartphones vernahm, musste digital verzerrt worden sein, denn sie klang geradezu beängstigend tief. So tief sprach kein normaler Mensch. Außerdem stimmte etwas mit der Geschwindigkeit nicht; die Worte klangen eigenartig schleppend und gedehnt. Tanya hatte unwillkürlich das Gefühl, als spräche ein Dämon aus einem Hollywood-Film zu ihr. Sie konnte unmöglich sagen, ob es sich um eine männliche oder eine weibliche Stimme handelte.
»Was …?« Die Brauen angestrengt zusammengezogen, starrte sie auf den Handybildschirm. Doch außer Karen war dort niemand zu sehen. »Wer ist denn da?«
»Wer ich bin, tut nichts zur Sache«, entgegnete die Dämonenstimme monoton. »Wichtig ist allein, dass du mir jetzt gut zuhörst, Tanya, und dass du nicht auflegst. Du kannst mich nicht sehen, aber ich sehe dich. Wenn du den Anruf beendest, wird das schreckliche Konsequenzen haben … für Karen … und für dich.«
Tanya schüttelte den Kopf, als wolle sie einen bösen Traum abschütteln. »Was?« Ihre Verwirrung wuchs von Sekunde zu Sekunde.
Der Bildausschnitt vergrößerte sich noch ein wenig mehr, und jetzt sah Tanya, dass Karen mit einem dünnen Seil an einen Stuhl gefesselt war. Tanya kniff die Augen zusammen. Sie kannte diesen Stuhl – und auch das große Poster an der Wand dahinter. Der Anruf kam aus Karens Wohnzimmer.
Tanya zögerte. Sie wägte kurz ab, dann legte sie skeptisch den Kopf schief. Das kann doch nur irgendein geschmackloser Scherz sein, dachte sie bei sich. Und dann – endlich – ging ihr ein Licht auf.
»Pete, bist du wieder da? Bist du das mit der dämlichen Teufelsstimme?« Tanyas eigene Stimme klang jetzt wieder etwas fester. »Wollt ihr zwei mich veräppeln?« Sie zog sich das Handtuch vom Kopf, so dass ihr die feuchten Haare offen über die Schultern fielen.
Keine Reaktion.
»Wirklich zum Totlachen, Leute. Kommt schon, Pete, Karen – hört auf mit dem Mist. Das ist echt nicht lustig, okay? Ich hab mich total gegruselt. Ich hätte mir eben vor Angst fast in die Hose gemacht.«
Noch immer kam keine Antwort.
»Leute, jetzt mal im Ernst. Lasst das sein, sonst lege ich auf.«
»Das würde ich an deiner Stelle nicht tun«, meldete sich erneut die Dämonenstimme. »Ich weiß ja nicht, wer dieser Pete ist, aber das ließe sich bestimmt herausfinden. Dann könnte er der Nächste auf meiner Liste werden.«
Tanya sah nach wie vor niemanden außer Karen. Zu wem auch immer diese Dämonenstimme gehörte, er oder sie musste sich hinter der Kamera befinden – obwohl Tanya den Eindruck hatte, dass das Telefon auf ein Stativ montiert war, weil die Bilder kein bisschen wackelten.
Das ist doch vollkommen irre, dachte sie und sah ihrer besten Freundin in die Augen.
Daraufhin atmete Karen scharf durch die Nase ein, was ihr sehr schwerzufallen schien, denn ihr ganzer Kopf zitterte dabei vor Anstrengung. Frische Tränen rollten ihr über die Wangen und hinterließen dort weitere schwarze Linien.
Tanya kannte Karen gut. Sie wusste, dass diese Tränen echt waren. Was immer hier gerade vor sich ging, an einen Scherz glaubte sie jetzt nicht mehr.
»Ich würde mich ja zu gern weiter mit dir unterhalten«, fuhr der Dämon fort, »aber die Zeit drängt, Tanya. Wenigstens für deine Freundin Karen hier. Also erkläre ich dir jetzt, wie die Sache ablaufen wird.«
Tanya versteifte sich unwillkürlich.
»Ich habe nämlich eine Wette abgeschlossen.«
Tanya wusste nicht genau, ob sie richtig gehört hatte. »Was? Eine Wette?«
»Ganz genau«, bestätigte der Dämon. »Ich habe mit Karen gewettet. Wenn ich die Wette verliere, lasse ich sie frei, und keine von euch beiden wird je wieder von mir hören. Darauf gebe ich euch mein Wort.«
Es folgte eine lange Pause.
»Aber sollte ich die Wette gewinnen …« Die Person am anderen Ende ließ den Rest des Satzes ganz bewusst unausgesprochen.
Tanya schüttelte den Kopf und stieß den Atem aus. »Ich … ich verstehe das nicht.«
»Das Spiel ist kinderleicht, Tanya. Ich nenne es Zwei Fragen.«
»Hä?«
»Du musst nichts weiter tun, als mir zwei Fragen korrekt zu beantworten«, erklärte die Dämonenstimme. »Ich stelle sie dir nacheinander. Du hast pro Frage so viele Antwortversuche, wie du möchtest, aber wir können erst dann mit der zweiten Frage weitermachen, wenn du die erste richtig beantwortet hast. Solltest du dafür länger als fünf Sekunden benötigen, wird die Antwort als falsch gewertet. Ich brauche nur zwei korrekte Antworten, und deine Freundin Karen kann gehen.« Eine winzige Pause. »Ich weiß, ich weiß. Das Spiel hört sich nicht besonders spannend an, stimmt’s? Aber na ja … warten wir es ab.«
»Fragen? Was denn für Fragen?«
»Ach, keine Bange. Sie hängen alle unmittelbar mit dir zusammen. Du wirst schon sehen.«
Tanya musste erst einmal tief Luft holen, ehe sie sprechen konnte. »Und was passiert, wenn ich Ihnen eine falsche Antwort gebe?«
Diese Frage veranlasste Karen dazu, kaum merklich den Kopf zu schütteln. Ihre Augen wurden groß, und in ihnen spiegelte sich die nackte Angst.
»Das ist eine durchaus berechtigte Frage, Tanya«, antwortete die Stimme. »Ich habe den Eindruck, dass du eine kluge Frau bist. Das verheißt Gutes.«
Die Stille, die darauf folgte, klang, als wäre die Leitung urplötzlich tot. Das musste an dem Stimmenverzerrer liegen, den der Unbekannte benutzte.
»So viel kann ich dir immerhin schon jetzt verraten: Um Karens willen wollen wir hoffen, dass dieser Fall nicht eintritt.«
Auf einmal fiel Tanya das Atmen schwer. Sie wollte dieses Spiel nicht mitspielen. Und das musste sie auch nicht. Sie musste einfach nur auflegen.
»Wenn du auflegst«, sagte die Dämonenstimme am anderen Ende, als hätte sie Tanyas Gedanken gelesen, »stirbt Karen, und du bist als Nächste dran. Wenn du aus dem Bild verschwindest, stirbt Karen, und du bist als Nächste dran. Wenn du versuchst, die Polizei zu rufen, stirbt Karen, und du bist als Nächste dran. Aber ich kann dir versichern, dass das sowieso zwecklos wäre, Tanya. Bis der Streifenwagen hier ist, würden annähernd zehn Minuten vergehen, wohingegen ich nur eine einzige Minute brauchen würde, um deiner Freundin das Herz aus der Brust zu reißen und es als kleines Präsent für die Polizisten auf dem Tisch liegenzulassen. Das Blut in ihren Adern wäre noch warm, wenn sie hier ankommen.«
Diese Worte ließen sowohl Karen als auch Tanya vor Angst erschauern. Karen begann, trotz ihres Knebels zu schreien und sich verzweifelt hin- und herzuwerfen, um sich von den Fesseln zu befreien. Vergeblich.
»Wer sind Sie?«, stieß Tanya hervor. Um ein Haar hätte ihre Stimme dabei versagt. »Warum tun Sie Karen das an?«
»Ich würde dir raten, dich auf das vorliegende Problem zu konzentrieren, Tanya. Denk an Karen.«
Gleich darauf nahm Tanya eine Bewegung am Bildschirm wahr. Eine ganz in Schwarz gekleidete Gestalt bezog Aufstellung hinter dem Stuhl, auf dem ihre beste Freundin saß. Aufgrund des Bildausschnitts konnte Tanya lediglich den Oberkörper der Person sehen.
»Verdammte Scheiße, was für ein kranker Streich ist das hier?«, brüllte sie ins Telefon. Mittlerweile kämpfte sie mit den Tränen.
»Nein, Tanya«, gab der Dämon zurück. »Das hier ist kein Streich. Es ist alles echt. Sollen wir beginnen?«
»Nein, warten Sie …«, flehte Tanya. Ihr Herz schlug wie rasend.
Doch der Dämon hörte nicht auf sie. »Frage Nummer eins, Tanya: Wie viele Facebook-Freunde hast du?«
»Was?« Tanya traute ihren Ohren nicht.
»Wie viele Facebook-Freunde hast du?«, wiederholte der Dämon ein klein wenig langsamer.
Okay, das kann wirklich nur ein Scherz sein, dachte Tanya. Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Träume ich, oder was ist hier los?
»Fünf Sekunden, Tanya.«
Tanyas verdatterter Blick ging zu Karens Gesicht. Es war zu einer Maske der Angst erstarrt.
Im nächsten Moment begann die Dämonenstimme rückwärtszuzählen. »Vier … drei … zwei …«
Tanya hatte keine Zeit zum Nachdenken. Kurz bevor sie duschen gegangen war, hatte sie auf ihre Facebook-Seite geschaut. »Eintausendeinhundertdreiunddreißig«, antwortete sie wie aus der Pistole geschossen.
Schweigen.
Die Luft in Tanyas Schlafzimmer schien sich zu verdichten und schwer zu werden wie Rauch.
Dann begann die Person hinter Karens Stuhl zu applaudieren.
»Das ist zu hundert Prozent korrekt, Tanya. Du hast ein gutes Gedächtnis. Durch diese Antwort ist deine Freundin ihrer Freiheit schon einen Schritt näher. Jetzt gilt es: Nur noch eine richtige Antwort, und der Spuk hat ein Ende.«
Wieder eine absichtlich in die Länge gezogene Pause.
Tanya hielt den Atem an.
»Und da Karen deine beste Freundin ist, dürfte die nächste Frage für dich kein Problem sein.«
Tanya wartete.
»Wie lautet Karens Handynummer?«
Tanya runzelte die Stirn. »Ihre Handynummer?«
Diesmal wiederholte der Dämon die Frage nicht, sondern begann sofort mit dem Countdown. »Fünf … vier … drei …«
»Aber … die kenne ich nicht auswendig!«
»Zwei …«
Aus Tanyas Kehle drang ein ersticktes Röcheln.
»Eins …«
»Das ist doch total albern«, sagte Tanya mit einem zittrigen Lachen. »Warten Sie eine Sekunde, dann schaue ich nach.«
2
Detective Robert Hunter vom Raub- und Morddezernat des LAPD bemerkte die rothaarige Frau, kaum dass er den Vierundzwanzig-Stunden-Lesesaal im Erdgeschoss der historischen Powell Library betreten hatte, die zum Campus der University of California in Westwood gehörte. Die Frau saß, teilweise von einem Stapel ledergebundener Bücher verborgen, allein an einem Tisch, hatte einen Kaffeebecher neben sich stehen und tippte konzentriert etwas in ihren Laptop.
Als Hunter auf dem Weg zu seinem angestammten Platz ganz hinten in der Ecke des großen Saals an ihr vorbeikam, hob sie den Kopf und sah ihn an. Ihr Blick verriet nichts. Er war weder neugierig noch auffordernd oder kokett, lediglich ein beiläufiges Zur-Kenntnis-Nehmen. Bereits eine Sekunde später hatte sie sich wieder ihrem Computerbildschirm zugewandt.
Dies war jetzt schon das dritte Mal, dass Hunter die Frau in der Bibliothek sah. Immer saß sie hinter einem Bücherstapel verschanzt, immer hatte sie einen Kaffee dabei, immer war sie allein.
Hunter liebte das Lesen, und deshalb liebte er den Vierundzwanzig-Stunden-Lesesaal der Powell Library – besonders in den frühen Morgenstunden der Nächte, in denen seine Hyposomnie ihn wieder einmal nicht zur Ruhe kommen ließ.
Durchschnittlich einer von fünf Menschen in den Vereinigten Staaten leidet unter chronischer Schlaflosigkeit, die in den meisten Fällen durch eine Kombination aus beruflicher, finanzieller und familiärer Belastung hervorgerufen wird. Hunters Fall allerdings war ein wenig anders gelagert. Er hatte schon mit Schlafschwierigkeiten gekämpft, als er von einem stressigen Berufsalltag noch Jahrzehnte entfernt gewesen war.
Begonnen hatte es kurz nach dem Krebstod seiner Mutter. Damals war Hunter gerade sieben Jahre alt. Nachts saß er allein in seinem Zimmer und sehnte sich nach ihr. Er war so von Trauer überwältigt, dass er keinen Schlaf fand, hatte zu viel Angst, um die Augen zu schließen, und war gleichzeitig zu stolz zum Weinen. Die Alpträume, die ihn heimsuchten, wenn er doch einmal wegdämmerte, waren so verheerend, dass sein Gehirn mit der Zeit eine Art Schutzmechanismus entwickelte: Es hielt ihn mit aller Macht wach. Dadurch wurde der Schlaf für ihn gleichermaßen zu einem Luxus wie zu einem Schreckgespenst. Um sich in den endlosen Nächten die Zeit zu vertreiben, begann Hunter, sich dem Lesen zu widmen. Er verschlang die Bücher geradezu, denn sie gaben ihm Kraft. Sie waren seine Zuflucht. Seine Festung. Ein sicherer Ort, an dem die schrecklichen Träume ihm nichts anhaben konnten.
Im Laufe der Jahre besserte sich sein Zustand deutlich, und auch die Alpträume wurden seltener. Doch wenige Wochen nachdem er von der Stanford University seinen Doktortitel in Kriminal- und Biopsychologie erhalten hatte, wurde seine private Welt zum zweiten Mal erschüttert. Sein Vater, der nach dem Tod seiner Frau nie wieder geheiratet hatte und zu der Zeit als Wachmann in einer Zweigstelle der Bank of America in Downtown L. A. arbeitete, wurde während eines Raubüberfalls von einer Kugel getroffen und fiel ins Koma. Hunter saß wochenlang an seinem Krankenbett, las ihm vor, erzählte ihm Witze und hielt über Stunden hinweg seine Hand. Doch auch diesmal waren Liebe und Hoffnung nicht genug. Als sein Vater schließlich starb, nahmen Hunters Schlafprobleme und seine Alpträume wieder zu. Seitdem waren sie seine ständigen Begleiter. In einer guten Nacht brachte er es auf drei, maximal vier Stunden Schlaf.
Heute war keine gute Nacht.
Hunter erreichte den letzten Tisch am Ende des Saals und sah auf seine Armbanduhr. Es war zwölf Minuten vor eins, doch ungeachtet der späten Stunde war der Lesesaal noch gut besucht, und die ganze Nacht hindurch herrschte ein stetiges Kommen und Gehen.
Hunter setzte sich so, dass er den Raum überblicken konnte, und schlug sein mitgebrachtes Buch auf. Er hatte etwa eine Viertelstunde darin gelesen, als er Lust auf eine Tasse Kaffee bekam. Die nächstgelegenen Getränkeautomaten befanden sich vor den Türen des Lesesaals neben den Fahrstühlen. Auf dem Weg durch den Saal kam Hunter wieder an der rothaarigen Frau vorbei. Ihre Blicke trafen sich erneut, und auch diesmal wandte sie sich schnell wieder ihrer Arbeit zu, wenngleich nicht ganz so schnell wie beim Mal zuvor. Obwohl Hunter sie dabei ertappt hatte, wie sie ihn ansah, ließ ihre Körpersprache keinerlei Anzeichen von Verlegenheit erkennen. Im Gegenteil: Sie wirkte vollkommen gelassen und souverän.
Der nagelneue Automat draußen bot fünfzehn verschiedene Kaffeevariationen an, von denen neun aromatisiert waren. Die extravaganteste Kreation – inklusive Topping aus Sahnehaube, Karamellsauce und Schokostreuseln – wurde in einem Becher serviert, der sage und schreibe 0,85 Liter fasste. Er kostete stolze neun Dollar fünfundneunzig.
Hunter musste lachen. Die Preise und Portionsgrößen hatten sich seit seiner Studentenzeit wirklich sehr verändert.
»Sofern Sie Ihren Kaffee nicht pappsüß mögen, würde ich von dem lieber die Finger lassen«, kam plötzlich ein Ratschlag von hinten.
Hunter erschrak. Als er sich umdrehte, stand die Rothaarige vor ihm.
Sie war unleugbar schön, allerdings auf eine eher unkonventionelle Art, die Hunter faszinierte. Ihre schulterlangen kupferroten Haare waren naturgewellt, und sie hatte sich den Pony rechts über der Stirn zu einer hinreißenden Victory Roll gedreht, der klassischen Pin-up-Girl-Frisur. Sie trug eine altmodische schwarze Schmetterlingsbrille, die perfekt zu ihrem herzförmigen Gesicht passte und die Aufmerksamkeit des Betrachters geschickt auf ihre grünen Augen lenkte. In ihrer Unterlippe saß ein Stecker mit einem kleinen schwarzen Schmuckstein, und ihre Nasenscheidewand war mit einem zierlichen Silberring gepierct. Sie trug ein schwarzrotgemustertes Rockabilly-Kleid im Stil der fünfziger Jahre mit farblich darauf abgestimmten Mary Janes. Weil das Kleid ärmellos war, konnte man sehen, dass ihre Arme von den Schultern bis zu den Handgelenken mit bunten Tattoos bedeckt waren.
»Der Kaffee, den Sie sich angeschaut haben«, erklärte sie, als sie Hunters Verwirrung bemerkte, und wies mit ihrem leeren Becher in Richtung des Getränkeautomaten. »Der Caramel Frappuccino Deluxe. Der ist viel zu süß. Sofern Sie kein Zucker-Junkie sind, sollten Sie sich den lieber nicht antun.«
Hunter war gar nicht klar gewesen, dass er so aufmerksam die Kaffeeauswahl studiert hatte.
»Die Zuckermenge ist nicht das Einzige, was daran übertrieben ist«, gab er mit einem raschen Blick auf die Frau zurück. »Zehn Dollar für einen Kaffee?«
Ihre Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, das charmant, zugleich aber auch ein wenig scheu wirkte.
»Ich habe Sie schon öfter hier gesehen«, bemerkte sie und lenkte das Gespräch von süßen, überteuerten Heißgetränken auf ein anderes Thema. »Studieren Sie an der UCLA?«
Hunter sah die Frau lange an. Ihr Alter war schwer einzuschätzen. Sie bewegte sich mit dem Selbstbewusstsein und der Autorität einer Staatschefin, doch ihre zarten, jugendlichen Gesichtszüge hätten durchaus die einer Studentin sein können. Auch ihrer Stimme konnte man so recht keinen Hinweis auf ihr Alter entnehmen. Sie hatte einen hellen, fast mädchenhaften Klang, war aber zugleich fest und selbstsicher – eine Kombination, die Hunter ratlos zurückließ.
»Nein«, sagte er. Ihre Frage amüsierte ihn. Er wusste, dass er definitiv nicht wie ein Student aussah. »Meine Studienzeit liegt lange zurück. Ich …« Sein Blick ging an ihr vorbei in Richtung Lesesaal. »Ich komme einfach gerne nachts hierher. Ich mag die ruhige Atmosphäre.«
Diese Antwort entlockte ihr erneut ein Schmunzeln. »Ja, ich weiß, was Sie meinen«, sagte sie, als sie sich, Hunters Blick folgend, umwandte und den Lesesaal mit seinem Parkettboden im Schachbrettmuster, den dunklen Tischen aus Mahagoni und den hohen gotischen Fenstern betrachtete. »Außerdem«, fügte sie hinzu, »mag ich, wie es hier riecht.«
Hunter sah sie mit einem fragenden Stirnrunzeln an.
Sie legte den Kopf schief, bevor sie sich an einer Erklärung versuchte. »Ich finde, wenn Wissen einen Geruch hätte, dann würde es so riechen wie hier, finden Sie nicht? Altes und neues Papier. Leder. Holz …« Eine kurze Pause, in der sie mit den Achseln zuckte. »Überteuerter Kaffee und der schale Schweiß von Studenten.«
Diesmal erwiderte Hunter ihr Lächeln. Er mochte ihren Sinn für Humor.
»Ich bin Tracy«, sagte sie und streckte ihm die Hand hin. »Tracy Adams.«
»Robert Hunter. Freut mich sehr.«
Trotz ihrer schlanken Finger hatte sie einen festen Händedruck.
»Bitte«, sagte Hunter und trat einen Schritt zur Seite, während er mit einer Kopfbewegung zunächst auf Tracys leeren Kaffeebecher, dann auf den Automaten deutete. »Nach Ihnen.«
»Nein, Sie waren zuerst hier«, gab Tracy zurück. »Ich bin nicht in Eile.«
»Das ist kein Problem, wirklich. Ich habe mich sowieso noch nicht entschieden«, log Hunter. Er trank seinen Kaffee grundsätzlich schwarz und ohne Zucker.
»Oh. Na gut, wenn das so ist – vielen Dank.« Tracy trat vor den Automaten, stellte ihren Becher in das Fach unter die Düse, warf einige Münzen ein und traf ihre Auswahl – schwarz, ohne Zucker.
»Und, wie sind Ihre Lehrveranstaltungen so?«, erkundigte Hunter sich höflich.
»Nein, nein«, erwiderte Tracy, wobei sie ihren Becher nahm und sich zu ihm umdrehte. »Ich bin auch keine Studentin.«
Hunter nickte. »Ich weiß. Sie lehren hier, stimmt’s?«
Tracy sah ihn neugierig und mit einem intensiv forschenden Blick an, doch seine Miene gab nicht das Geringste preis.
Was sie nur noch neugieriger machte.
»Ja, das stimmt. Aber woher wissen Sie das?«
Hunter versuchte, die Sache mit einem Achselzucken abzutun. »Ach, das war nur geraten.«
Tracy glaubte ihm kein Wort. »Dass ich nicht lache.«
Sie überlegte, welche Bücher sie an ihrem Platz liegen hatte. Keins davon gab Aufschluss über ihre Tätigkeit, und selbst wenn, so hätte dieser Mann eine geradezu übermenschliche Sehkraft besitzen müssen, um von seinem Platz aus oder im Vorbeigehen die Titel lesen zu können.
»Dafür sind Sie sich Ihrer Sache viel zu sicher. Das war nie und nimmer geraten. Aus irgendeinem Grund wussten Sie es. Aber woher?« Jetzt war ihr Blick schon ein wenig argwöhnisch.
»Gute Beobachtungsgabe«, antwortete Hunter, doch ehe er dies weiter ausführen konnte, spürte er, wie sein Handy in seiner Jackentasche vibrierte. Er fischte es heraus und warf einen Blick auf das Display.
»Entschuldigen Sie mich ganz kurz«, bat er und hob das Telefon ans Ohr. »Detective Hunter, Morddezernat I.«
Tracy zog die Augenbrauen hoch. Damit hatte sie nun wirklich nicht gerechnet. Wenige Sekunden später sah sie, wie sich sein Gesichtsausdruck veränderte.
»Okay«, sagte er und spähte auf die Uhr. Inzwischen war es ein Uhr vierzehn. »Bin schon unterwegs.« Er beendete das Gespräch und sah Tracy an. »Es hat mich wirklich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Genießen Sie Ihren Kaffee.«
Tracy zögerte einen Moment.
»Sie haben Ihr Buch vergessen!«, rief sie ihm hinterher, doch Hunter eilte bereits mit großen Schritten die Treppe hinunter.
3
Das Morddezernat I des LAPD war eine Elite-Einheit innerhalb des Raub- und Morddezernats, die sich ausschließlich mit Serienmorden und Tötungsdelikten befasste, welche stark im Licht der Öffentlichkeit standen und zeitaufwendige Ermittlungen sowie spezielles Fachwissen erforderten. Und weil eine Stadt wie Los Angeles ihre ganz eigene Klasse gefährlicher Soziopathen hervorzubringen schien, kam Hunter als studiertem Kriminologen und Psychologen innerhalb des Dezernats I eine ganz besondere Aufgabe zu. Alle Morde, bei denen der Täter mit extremer Brutalität und/oder Sadismus vorgegangen war, wurden intern als ultra violent, kurz: »UV« eingestuft. Hunter und sein Partner Carlos Garcia bildeten zusammen die UV-Einheit des Dezernats.
Die Adresse, die man Hunter am Telefon genannt hatte, führte ihn nach Long Beach zu einem dreistöckigen terrakottafarbenen Mietshaus, das auf der einen Seite von einer Drogerie, auf der anderen von einem Eckhaus flankiert wurde. Selbst frühmorgens und auf der schnellstmöglichen Route hatte Hunter für die fünfunddreißig Meilen lange Fahrt vom UCLA-Campus in Westwood bis zum Hafen annähernd eine Stunde gebraucht.
Er sah schon die Streifenwagen, kaum dass er von der Redondo Avenue nach links in den East Broadway abgebogen war. Die Polizei von Long Beach hatte bereits einen Teil der Straße abgeriegelt. Garcias metallicblauer Honda Civic parkte gegenüber dem Mietshaus neben einem weißen Van der Spurensicherung.
Als er sich der abgesperrten Zone näherte, musste Hunter fast bis auf Schritttempo herunterbremsen. In einer Stadt, die so gut wie nie schlief, war es kein Wunder, dass sich jenseits des Flatterbands bereits eine kleine Schar von Gaffern eingefunden hatte. Die meisten von ihnen hatten die Arme über die Köpfe gestreckt und filmten das Geschehen mit ihren Handys oder Tablets, als wären sie auf einem Rockkonzert. Sie alle hofften, einen Blick auf etwas Interessantes zu erhaschen – je schauerlicher, desto besser.
Nachdem Hunter es an der Menge vorbeigeschafft hatte, zeigte er den beiden uniformierten Polizisten, die das schwarzgelbe Absperrband bewachten, seine Dienstmarke und stellte seinen zerbeulten Buick LeSabre neben dem Wagen seines Partners ab. Er stieg aus und streckte seinen eins achtzig großen Körper. Der Wind war kalt, dichte Wolken verbargen die Sicht auf die Sterne, was die Nacht noch dunkler wirken ließ. Hunter befestigte die Marke an seinem Gürtel und sah sich um. Der abgeriegelte Bereich der Straße war insgesamt etwa hundert Meter lang und reichte von der Kreuzung Newport Avenue bis dorthin, wo die Loma Avenue abzweigte.
Hunters allererster Gedanke war, dass es hier jede Menge Fluchtwege gab. Der Freeway war nicht mal anderthalb Meilen entfernt – obwohl es im Grunde gar keine Rolle spielte, ob der Täter motorisiert gewesen war oder nicht. Er hätte nur in eine der zahlreichen Seitenstraßen einbiegen müssen, schon wäre er auf Nimmerwiedersehen verschwunden gewesen.
Garcia, der neben einem Streifenwagen stand und sich gerade mit einem Officer des Long Beach Police Department unterhielt, hatte Hunters Wagen erspäht, gleich nachdem dieser die Absperrung passiert hatte.
»Robert!«, rief er und kam über die Straße auf ihn zu.
Hunter wandte sich um.
Garcias lange braune Haare waren zu einem glatten Pferdeschwanz zusammengebunden. Er trug eine dunkle Hose, ein gebügeltes hellblaues Oberhemd und darüber eine schwarze Jacke. Obwohl er einen hellwachen Eindruck machte und seine Kleider aussahen, als kämen sie frisch aus der Reinigung, waren seine Augen müde und blutunterlaufen. Im Gegensatz zu Hunter plagten Garcia nachts für gewöhnlich keine Schlafprobleme. In dieser Nacht allerdings hatte er gerade einmal zwei Stunden geschlafen, ehe der Anruf vom LAPD ihn aus dem Bett geholt hatte.
»Carlos.« Hunter begrüßte seinen Partner mit einem Nicken. »Tut mir leid wegen der Uhrzeit. Also, was gibt’s?«
»Weiß ich auch noch nicht genau«, antwortete Garcia mit einem leichten Kopfschütteln. »Ich bin nur wenige Minuten vor dir angekommen. Ich wollte mich gerade erkundigen, wer hier die Leitung hat, als ich dich gesehen habe.«
Hinter seinem Partner sah Hunter, wie jemand aus dem Haus trat und Kurs auf sie nahm.
»Ich glaube, er hat uns bereits gefunden«, stellte er fest.
Garcia vollführte eine halbe Drehung.
»Sind Sie die Kollegen von der UV-Einheit?«, fragte der Mann im Näherkommen. Seine belegte Stimme konnte nur das Ergebnis jahrelangen Zigarettenkonsums sein. Die gestickten Rangabzeichen oben an seinen Jackenärmeln wiesen ihn als Sergeant zweiten Grades bei der Polizei von Long Beach aus. Er war zwischen Ende vierzig und Anfang fünfzig und hatte sich die dichten graumelierten Haare aus der hohen Stirn nach hinten gekämmt – eine Frisur, die die Aufmerksamkeit des Betrachters auf eine kleine, gezackte Narbe oberhalb seiner linken Augenbraue lenkte. Er sprach mit leichtem mexikanischen Akzent.
»So ist es«, antwortete Hunter, während er und Garcia dem Mann entgegengingen. Sie begrüßten einander mit Handschlag. Der Sergeant stellte sich ihnen als Manuel Velasquez vor.
»Also, was ist passiert, Sergeant?«, wollte Garcia wissen.
Sergeant Velasquez lachte über diese Frage, aber es war ein nervöses, verhaltenes Lachen. »Ich weiß nicht genau, ob ich das, was da drinnen passiert ist, überhaupt mit Worten beschreiben kann«, sagte er und wandte sich dem Gebäude zu. »Keine Ahnung, ob irgendjemand das könnte. Sie müssen schon reingehen und es mit eigenen Augen sehen.«
4
Der Herbstwind, der in den letzten Minuten deutlich böiger geworden war, hatte die dicken Wolken am Himmel weiter zusammengetrieben. Gerade als Hunter, Garcia und Velasquez sich auf den Weg zum Eingang des Gebäudes machten, fielen die ersten Regentropfen auf ihre Köpfe und den trockenen Asphalt.
»Der Name des Opfers lautet Karen Ward«, begann Sergeant Velasquez und beschleunigte seine Schritte, um dem Regen zu entkommen. Er führte Hunter und Garcia die wenigen Betonstufen zum Eingang hinauf. Statt sich auf sein Erinnerungsvermögen zu verlassen, zückte er seinen Notizblock und klappte ihn auf. »Sie war vierundzwanzig Jahre alt, ledig und hat als Kosmetikerin in einem Spa in der East Second Street gearbeitet.« Reflexartig deutete er gen Osten. »Gar nicht weit von hier. Sie ist erst vor vier Monaten hier eingezogen.«
»Hat sie zur Miete gewohnt?«, fragte Garcia, als sie das Gebäude betraten.
»Genau. Die Besitzerin ist eine gewisse …« Velasquez blätterte eine Seite in seinem Notizblock um. »Nancy Rogers, wohnhaft in Torrance in South Bay.«
»Einbruch? Wurde was gestohlen?« Diese Frage kam von Hunter.
Ein beklommenes Kopfschütteln von Velasquez. »Nein, und der Täter hat auch gar nicht erst versucht, es danach aussehen zu lassen. Keine sichtbaren Anzeichen gewaltsamen Eindringens, keine Kampfspuren. Ihre Handtasche lag auf dem Sofa im Wohnzimmer, darin befand sich ihr Portemonnaie mit zwei Kreditkarten und siebenundachtzig Dollar in bar. Der Autoschlüssel war auch noch drin. Ihr Laptop stand im Schlafzimmer, wo wir außerdem noch ein bisschen Schmuck auf der Kommode gefunden haben. Schränke, Schubladen et cetera – bislang sieht es so aus, als wäre nichts angerührt worden.«
Die einzige Sicherheitsvorrichtung an der Eingangstür war ein altes Elektroschloss mit Gegensprechanlage. Überwachungskameras gab es nicht.
»Hat sie allein gelebt?«
»Ja«, antwortete der Sergeant mit einem Nicken.
Da es im Gebäude keinen Fahrstuhl gab, gingen sie zu Fuß ins oberste Stockwerk.
»Ich habe meine Leute in jede Etage geschickt, um die Nachbarn zu befragen. Nichts«, teilte Sergeant Velasquez ihnen in einem Tonfall mit, der nahelegte, dass ihn dieses Ergebnis mitnichten überraschte. »Keiner will was gesehen oder gehört haben.« Velasquez schüttelte den Kopf. »Direkt neben ihr wohnt ein Paar im mittleren Alter, Mr und Mrs Santiago. Die sind beide schwerhörig. Ich habe persönlich mit ihnen gesprochen, aber obwohl ich sehr laut geklopft habe, hat es eine gefühlte Stunde gedauert, bis Mr Santiago an die Tür gekommen ist – und das auch nur, weil er mitten in der Nacht zur Toilette musste und sowieso wach war.«
Das Treppenhaus mündete in einen langen, schmalen, von leistungsstarken Tatortleuchten erhellten Flur. Karen Wards Apartment hatte die Nummer 305 und war das letzte auf der rechten Seite.
Vor der Wohnung kniete Nicholas Holden, einer der Fingerabdruck-Experten von der Spurensicherung, und untersuchte gerade die Tür.
»Sie sagten eben, sie sei ledig gewesen?«, vergewisserte sich Garcia, als sie den Flur entlanggingen.
»Stimmt«, bejahte Velasquez.
»Wissen Sie, ob sie sich mit jemandem getroffen hat? Ob sie einen Freund hatte?«
Der Sergeant wusste genau, worauf Garcia mit der Frage hinauswollte. Wenn eine junge Frau in der eigenen Wohnung brutal ermordet wurde und es weder ein offensichtliches Motiv noch Einbruchsspuren gibt, rücken automatisch diejenigen Personen in den Hauptfokus der Ermittler, mit denen das Opfer vor seinem Tod eine wie auch immer geartete intime Beziehung geführt hat. Nicht nur in den Vereinigten Staaten machen Beziehungstaten mehr als die Hälfte aller Tötungsdelikte an Frauen aus.
»Sorry, Detective, aber wir hatten noch keine Zeit, das zu ermitteln«, sagte der Sergeant und schaute auf seine Uhr. »Ehrlich gesagt konnten wir überhaupt nur sehr wenig über das Opfer und den Tathergang rausfinden, ehe wir Bescheid bekamen, dass wir den Fall an die UV-Einheit abgeben sollen.« Er zögerte, ehe er die beiden Detectives ansah. »Normalerweise ärgere ich mich ja immer tierisch, wenn so was passiert. Unser Revier – unsere Ermittlung, comprendes? Schließlich sind wir keine Anfänger. Aber der Fall hier passt zur UV-Einheit wie die Faust aufs Auge, insofern haben wir von vorneherein damit gerechnet.« Er hob in einer kapitulierenden Geste die Hände. »Und ausnahmsweise werden Sie von mir oder meinen Leuten auch keine Klagen hören. Wenn Sie scharf auf das Grauen sind, das sich da drinnen abgespielt hat, brauchen Sie uns nicht zweimal zu fragen. Es gehört ganz Ihnen.«
Hunter und Garcia sahen Velasquez stirnrunzelnd an. »Moment mal«, sagte Garcia. »Was meinen Sie damit, der Fall passt zur UV-Einheit wie die Faust aufs Auge?«
Der Blick des Sergeant ging von Garcia zu Hunter, dann zurück zu Garcia. »Dann hat man Ihnen gar nichts von dem Anruf erzählt?«
Die einzige Antwort der beiden Detectives war verständnisloses Schweigen.
»O Mann.« Sergeant Velasquez blickte kopfschüttelnd zu Boden. »Also gut«, sagte er dann. »Gegen dreiundzwanzig Uhr zwanzig ging in unserer Zentrale ein Notruf ein. Eine Frau war am Apparat, sie war völlig hysterisch, man konnte sie kaum verstehen, aber sie hat immer wieder das Wort ›Mord‹ geschrien. Da ist unser Disponent natürlich hellhörig geworden. Der Anruf wurde zu unserem Revier und schließlich in mein Büro durchgestellt.«
»Dann haben Sie persönlich mit ihr gesprochen?«, hakte Garcia nach.
Der Sergeant nickte. »Sie war in Tränen aufgelöst und hat behauptet, jemand hätte ihre beste Freundin vor ihren Augen umgebracht.« Er hielt inne und hob den rechten Zeigefinger. »Na ja, nicht direkt vor ihren Augen, aber sie durfte … oder besser gesagt: Sie musste alles per Videochat mitansehen.«
»Wie bitte?« Garcias Miene zeigte unverhohlene Verwirrung.
»Sie haben ganz richtig gehört, Detective. Die Frau hat ins Telefon geschrien, irgendein Verrückter hätte sie von Miss Wards Smartphone aus angerufen und gezwungen, ein abartiges Spiel mit ihm zu spielen, bei dem das Leben ihrer Freundin der Einsatz war.«
»Ein Spiel?«, wiederholte Hunter.
»Das waren ihre Worte, ja. Hören Sie, mehr Einzelheiten kenne ich auch nicht; wie gesagt, die Frau war vollkommen außer sich, man konnte ihr kaum folgen. Aber ich habe natürlich die Dienstvorschrift eingehalten und sofort einen Streifenwagen zu der Adresse des angeblichen Mordopfers geschickt. Kurz vor Mitternacht sind zwei Uniformierte bei ihr eingetroffen – und wissen Sie, was? Ihre Wohnungstür war nicht verschlossen. Sie sind rein, um sich ein Bild von der Lage zu machen, und jetzt … sind Sie hier. Das sagt ja wohl alles.«
»Und diese aufgelöste Anruferin hat gesagt, sie sei die beste Freundin des Opfers?«, fragte Garcia nach.
Velasquez nickte. »Ihr Name lautet Tanya Kaitlin. Ich habe ihre Kontaktdaten im Wagen. Ich hole sie Ihnen, bevor Sie gehen.«
Als Hunter, Garcia und Velasquez endlich vor Wohnung Nummer 305 angekommen waren, begrüßte Hunter den Fingerabdruck-Experten der Spurensicherung. »Hey, Nick.«
»Hey, Jungs«, erwiderte der Mann mechanisch.
Nachdem sie sich in das Tatortprotokoll eingetragen hatten, bekamen Hunter, Garcia und Velasquez jeweils einen weißen Tyvek-Overall sowie ein paar Latexhandschuhe ausgehändigt. Während sie sich einkleideten, fiel Hunter die Brandschutztür am Ende des Korridors hinter Karen Wards Wohnung auf.
»Wo führt die hin, wissen Sie das?«
»Zu einer Metalltreppe und von da aus runter in die Gasse hinter dem Haus«, gab Velasquez Auskunft. »Wenn man nach links geht, kommt man an der Newport Avenue raus. Rechts führt die Gasse zur Loma Avenue.«
Bevor er den Reißverschluss seines Overalls hochzog, ging Hunter zu der Brandschutztür, um sie sich aus der Nähe anzusehen. Die Druckstange an der feuerabweisenden Tür wies darauf hin, dass sie nur von innen geöffnet werden konnte. Durch diese Tür ins Gebäude zu gelangen war unmöglich, allerdings bot sie, von Apartment 305 kommend, einen deutlich schnelleren Fluchtweg als das relativ weit entfernte Treppenhaus.
Hunter drückte gegen die Stange und stieß die Tür auf. Alles blieb still, die Tür war also nicht an ein Alarmsystem angeschlossen. Als er sich zum Apartment umdrehte, sah er, wie Nick Holden den Kopf erst zur einen, dann zur anderen Seite neigte und dabei aufmerksam die Wohnungstür anstarrte.
»Was gefunden, Nick?«
»Ich will sie mir nur mal bei besserem Licht ansehen«, gab Holden, ganz auf seine Arbeit konzentriert, zurück. Seine Atemmaske bewegte sich beim Sprechen. »Bis jetzt konnten wir Abdrücke von drei verschiedenen Personen sicherstellen, aber ich hab gerade erst angefangen.«
Hunter nickte. »Könnten Sie uns einen Gefallen tun und, wenn Sie fertig sind, auch noch die Brandschutztür untersuchen? Ich würde gern die Abdrücke der beiden Türen vergleichen.«
Holden warf einen Blick in Hunters Richtung. »Sicher, kein Thema.«
Die beiden Detectives waren fertig umgezogen und setzten nun noch die Kapuzen ihrer Overalls auf, um ihre Haare zu bedecken; einen Augenblick später betraten sie Apartment 305.
5
Von Karen Wards Wohnungstür aus gelangte man zunächst in einen kleinen Eingangsflur. Zwei großformatige Blumendrucke hingen an den weißen Wänden, auf dem Boden lag eine dunkelrote Antirutschmatte. Flur und Wohnung trennte ein an der Decke befestigter selbstgemachter Perlenvorhang mit unterschiedlich langen Schnüren.
Einen solchen Vorhang hatte Hunter zuletzt als Kind gesehen. Seine Großmutter hatte früher einen in ihrer Küche hängen gehabt.
An Karen Wards Vorhang hingen mehrere Glöckchen, die laut klimperten, als er die Schnüre teilte, damit er und Garcia ins Wohnzimmer weitergehen konnten. Sergeant Velasquez folgte ihnen, allerdings erst, nachdem er sich bekreuzigt und dazu einige Worte auf Spanisch gemurmelt hatte.
Das Wohnzimmer war relativ groß und mit wenigen, aber sorgsam ausgewählten modernen Möbeln eingerichtet. Die Hauptattraktion jedoch war ohne Zweifel die große gläserne Schiebetür, ebenfalls hinter einem Perlenvorhang verborgen, die auf einen Eckbalkon hinausführte. An der Nordseite des Zimmers befand sich eine kleine offene Küche.
Strategisch günstig zwischen Küchen- und Wohnbereich als Raumteiler platziert, stand ein Esstisch aus dunklem Kiefernholz, der Platz für vier Personen bot. Gegenüber vom Tisch, neben einer ebenfalls dunklen Vitrine, lehnte ein mannshoher Spiegel an der Wand.
Hunter und Garcia hatten kaum einen Fuß in den Raum gesetzt, als sie wie angewurzelt stehen blieben. Ihr Blick ging sofort zu dem Stuhl am Kopfende des Tisches – und zu der grausam zugerichteten Leiche, die darauf saß.
Hunter kniff die Augen zusammen, während sein Gehirn die grauenhaften Bilder zu verarbeiten versuchte.
Die Tote war nackt. Ihre Arme waren durch ein dünnes Nylonseil, das direkt unterhalb ihrer Brüste mehrmals um ihren Oberkörper und die Stuhllehne gewickelt worden war, seitlich am Körper fixiert. Weitere Seile fesselten ihre Füße an die vorderen Stuhlbeine. Sie saß aufrecht mit hängendem Kopf, so dass ihr Kinn fast die Brust berührte. Es sah aus, als schliefe sie. Doch dass Hunter bei ihrem Anblick im ersten Moment seinen Augen nicht traute, hatte noch einen ganz anderen Grund: In ihrem Gesicht, das wenig mehr war als eine undefinierbare Masse aus Fleisch und Hautfetzen, steckten unzählige Glasscherben. Das Blut war in Strömen aus den Wunden gelaufen. Es bedeckte ihren kompletten Torso sowie ihre Oberschenkel und war von dort aus auf den Holzboden getropft, wo es sich unterhalb des Stuhls in einer Lache gesammelt hatte. Der Teil der Tischplatte, vor dem das Opfer gesessen hatte, wies ebenfalls zahlreiche Blutspritzer auf.
Von dort, wo Hunter und Garcia standen, sah das, was früher einmal das Gesicht der Frau gewesen war, aus wie ein groteskes Nadelkissen, aus dem die scharfen, spitzen Splitter in alle Richtungen abstanden.
»Sie zwei sind wohl die UV-Männer.«
Diese Feststellung kam von einer Kriminaltechnikerin, die gerade damit beschäftigt war, behutsam Haare und Fasern von dem großen Teppich im Wohnbereich aufzusammeln. Im ersten Moment herrschte Schweigen, bevor es Hunter und Garcia endlich gelang, ihren Blick von der Leiche loszureißen.
»Ich bin Dr. Susan Slater«, stellte die Frau sich vor und erhob sich von den Knien. »Die leitende Kriminaltechnikerin für diesen Tatort.«
Weder Hunter noch Garcia hatte je zuvor mit Dr. Slater zusammengearbeitet. Sie war schätzungsweise Anfang dreißig und etwa einen Meter siebzig groß, schlank, mit hohen Wangenknochen und einer zierlichen Nase. Die Kapuze ihres Overalls verdeckte ihre Haare bis auf eine einzelne blonde Strähne, die ihr in die Stirn gerutscht war. Ihr Make-up war dezent und alltagstauglich, aber so gekonnt aufgetragen, dass sie trotz des weißen Overalls attraktiv und feminin wirkte. Ihre Stimme hatte einen ganz speziellen Klang – sie war sanft und freundlich, vermittelte aber zugleich den Eindruck großer Erfahrung und Kompetenz.
»Detective Robert Hunter von der UV-Abteilung des LAPD. Das hier ist Detective Carlos Garcia.« Sie begrüßten Slater mit einem kurzen Nicken, ehe sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Opfer richteten.
»Das übersteigt jedes Vorstellungsvermögen, oder?«, bemerkte Dr. Slater. »Wie kann jemand einem Menschen so etwas antun?«
»Der Täter hat mit Glasscherben auf ihr Gesicht eingestochen?«, fragte Garcia, dessen Miene deutlich zum Ausdruck brachte, dass er selbst kaum glauben konnte, was er da sagte.
»Könnte sein, Detective«, antwortete Dr. Slater. »Ohne eingehende Autopsie ist das unmöglich zu sagen. Aber falls es wirklich so passiert ist, ist das nur ein Teil der Geschichte.
»Und was ist der andere Teil?«, wollte Garcia wissen.
Sie trat ein paar Schritte auf das Opfer zu. »Ich zeige es Ihnen.«
Hunter und Garcia folgten ihr. Sergeant Velasquez blieb beim Perlenvorhang stehen.
Dr. Slater gab acht, die Blutlache am Boden nicht zu berühren, als sie neben dem Stuhl in die Hocke ging und Hunter und Garcia durch ein Handzeichen signalisierte, zu ihr zu kommen. Aus der Nähe boten die Verletzungen in Karen Wards Gesicht einen noch verstörenderen Anblick. Mehrere Glasstücke unterschiedlicher Größe hatten Haut und Muskelgewebe aufgeschlitzt und ihr fast das Gesicht von den Knochen geschält. Das Fleisch hing in Lappen von den stellenweise blanken Knochen herunter.
»Sehen Sie«, begann Dr. Slater, »wenn man sich nur die großen Glasstücke anschaut …« Sie wies auf eine Scherbe in der Wange der Toten, eine andere in der linken Augenhöhle und schließlich auf eine dritte, die durch das weiche Gewebe unterhalb des Kinns so tief in den Mund eingedrungen war, dass sie ihre Zunge aufgespießt und im unteren Teil der Mundhöhle fixiert hatte. »… könnte man den Eindruck gewinnen, der Täter hätte ihr diese Glassplitter einzeln ins Gesicht gerammt. Bei einigen geschah das mit derart brutaler Gewalt, dass es zu Frakturen kam oder das Glas im Knochen stecken geblieben ist.« Sie lenkte die Aufmerksamkeit der beiden Detectives auf zwei weitere Scherben – die eine steckte im Kieferknochen des Opfers, die andere in der Stirn. »Aber dabei würden wir eins übersehen, Detectives: nämlich, dass es noch eine viel größere Anzahl kleiner Splitter gibt.« Sie deutete auf einige Glasstücke, von denen manche kaum größer als eine Erbse waren. »Die sind so winzig, dass er sie unmöglich als Stichwaffen benutzt haben kann. Bei diesen Stücken handelt es sich wahrscheinlich um Absplitterungen, die durch die Krafteinwirkung entstanden sind.«
Hunter neigte den Kopf erst nach links, dann nach rechts, während er das Gesicht der Toten aufmerksam studierte. Trotz seiner langjährigen Erfahrung schauderte es ihn beim Anblick der entsetzlichen Wunden. Jede einzelne von ihnen musste der jungen Frau unvorstellbare Schmerzen verursacht haben. Er vermochte sich ihre schrecklichen Qualen kaum auszumalen. Der Großteil ihres Körpers war mit getrocknetem Blut bedeckt, daher konnte Hunter nur schwer erkennen, ob sie noch weitere Wunden aufwies, doch auf den ersten Blick schien es so, als hätte sich die Zerstörungswut des Mörders ausschließlich auf ihr Gesicht beschränkt.
Nach einer Weile stand Hunter auf und stellte sich hinter den Stuhl, um auch den Hinterkopf des Opfers in Augenschein nehmen zu können.
»Und was genau wollen Sie jetzt damit sagen, Doc?«, fragte Garcia. »Dass der Täter sie an den Stuhl gefesselt und ihr dann Glasscherben ins Gesicht gerammt hat?«
»Nein.« Die Antwort kam nicht von Dr. Slater, sondern von Hunter, der gerade hochkonzentriert den Boden hinter dem Stuhl des Opfers absuchte – dort lag kein einziger Splitter. »Umgekehrt, Carlos«, erklärte er. »Der Täter hat sie mit dem Gesicht in die Glasscherben gestoßen.«
6
Einige Stunden zuvor
»Das ist doch total albern«, sagte Tanya mit einem zittrigen Lachen. »Warten Sie eine Sekunde, dann schaue ich nach.«
»Ich habe sogar fünf Sekunden gewartet«, entgegnete die Dämonenstimme. »Und diese fünf Sekunden sind jetzt um. Du wolltest doch wissen, was geschieht, wenn du falsch antwortest … Dann pass jetzt gut auf.«
Völlig unvermittelt packte die Person, die hinter Karens Stuhl stand, ihren Lederknebel und zog ihn ihr mit einem derart heftigen Ruck herunter, dass an einer Stelle ihre Unterlippe aufriss und Blutstropfen aus der Wunde flogen.
Tanyas Augen waren groß vor Entsetzen. Sie konnte nicht begreifen, was dort gerade geschah.
Bevor Karen den Schrei ausstoßen konnte, der bestimmt seit Ewigkeiten in ihrer Kehle festgesessen hatte, sah Tanya, wie die Person eine behandschuhte Hand an Karens Hinterkopf legte. Einen Sekundenbruchteil später hörte sie ein lautes Knirschen, als Karens Kopf brutal nach vorn gedrückt und in einen Behälter gestoßen wurde, der vor ihr auf dem Tisch stand.
Was darin war, konnte Tanya nicht genau erkennen.
»O mein Gott!«, entfuhr es ihr. Sie zuckte vor dem Bildschirm zurück, ließ ihr Handy jedoch trotz ihres Entsetzens nicht einen Moment lang aus den Augen. »Was tun Sie da? Was in Gottes Namen tun Sie denn da?«, schrie sie mit vor Furcht überschnappender Stimme.
Dieselbe Hand packte Karen nun bei den Haaren und riss ihren Kopf wieder in die Höhe. Als Tanya das Gesicht ihrer Freundin sah, drehte sich ihr der Magen um, und sie spürte das saure Brennen der Galle in ihrer Kehle.
Aus Karens Gesicht ragten drei große Glasscherben. Die erste war bestimmt fast zehn Zentimeter lang und hatte ihre linke Wange durchstochen. Ihre Spitze, die in Karens Mund eingedrungen war, hatte ein kleines Stück ihrer Zunge abgeschnitten. Die zweite, deutlich kleinere Scherbe hatte Karens rechtes Nasenloch durchbohrt und ein Loch in ihre Nase gerissen. Das dritte, etwa vier Zentimeter lange Glasstück steckte in ihrer blutigen Stirn. Tanya war keine Expertin, aber es sah aus, als wäre das Glas in Karens Schädelknochen eingedrungen. »O mein Gott, nein … was machen Sie nur?«, stieß Tanya tränenerstickt hervor. »Karen … nein …«
»Sieh hin …«, sagte die Dämonenstimme drohend und drehte Karens Kopf leicht von einer Seite zur anderen, damit Tanya das Ausmaß ihrer Verletzungen auch ja nicht entging. »Sieh hin …«
Tanya starrte wie gelähmt auf das Display ihres Smartphones.
»Sieh hin …«, sagte die Dämonenstimme ein drittes Mal.
»Ich sehe ja hin …« Tanyas Stimme klang schrill und gequält, als würde sie die Schmerzen ihrer Freundin am eigenen Leib mitfühlen. »Mein Gott, Karen …« Mit der linken Hand wischte sie sich hektisch die Tränen weg.
»Sie ist deine beste Freundin, Tanya«, kam die Dämonenstimme aus dem Telefon. »Schon seit vielen Jahren. Da solltest du wirklich ihre Handynummer auswendig kennen. Was für eine Freundin bist du eigentlich?«
»Ich weiß … ich weiß …« Tanya schluchzte hemmungslos. »Es tut mir leid.«
»Du musst dich nicht entschuldigen. Du musst nur meine Frage richtig beantworten. Dafür hast du fünf Sekunden Zeit.«
»Nein … bi… bitte, tun Sie das nicht.«
»Fünf … vier … drei …«
Tanya schluchzte, während ihre Finger in fieberhafter Eile über ihren Touchscreen flogen. »Ich suche sie ja schon. Einen kleinen Moment, ich suche sie.« Tränen nahmen ihr die Sicht. Ihre Hände zitterten vor Angst.
»Zwei …«
»Bitte … nicht.«
»Eins …«
In ihrer Panik glitt Tanya das Handy aus der Hand. Es fiel mit dem Display nach unten auf ihr Bett.
»O nein, nein, nein!«
»Die Zeit ist um.«
KRACH.
Noch während sie nach dem Handy griff, hörte Tanya dasselbe Splittern und Knirschen wie zuvor, nur war es diesmal noch lauter. Sie drehte das Handy herum und sah gerade noch, wie die Hand Karens Kopf zum zweiten Mal in die Höhe riss.
Tanya erstarrte.
Karens Gesicht war bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Unzählige weitere Scherben, große wie kleine, hatten sich in ihr Gesicht gegraben und es in eine Maske des Grauens verwandelt. Doch das Allerschlimmste – das, wovon Tanya schwindlig wurde, bis sie das Gefühl hatte, jeden Moment ohnmächtig zu werden – war die eine Scherbe, die tief in Karens linkem Augapfel steckte. Eine viskose Substanz rann aus der Wunde, allerdings konnte die Scherbe nicht bis ins Gehirn vorgedrungen sein, denn Tanya erkannte, dass Karen nach wie vor bei Bewusstsein war.
»Ihre Nummer«, befahl der Dämon abermals, aber jetzt ließen Tanyas Nerven sie endgültig im Stich. Ihre Finger zitterten unkontrolliert, vor lauter Tränen konnte sie fast nichts mehr sehen, und ihr Atem ging schwer und unregelmäßig. Sie versuchte zu sprechen, doch die Laute verendeten irgendwo zwischen Kehle und Lippen.
Der Countdown begann von neuem. Diesmal hörte Tanya die Zahlen gar nicht mehr. Alles, was sie mitbekam, war der Satz »Die Zeit ist um« und dann …
KRACH.
KRACH.
KRACH.
Dreimal in rascher Folge, jedes Mal heftiger und brutaler als zuvor. Das letzte Knirschen war von einem erstickten Röcheln aus Karens Kehle begleitet.
Die Hand riss Karens Kopf in die Höhe, und eine Zeitlang war alles still. Karens Lippen waren so schlimm zerfetzt, dass sie an einer Seite herunterhingen. Ihre Nase war von unten nach oben aufgeschlitzt, und der Großteil des Knorpels war zerstört. Die Nasenspitze wurde nur noch von einem winzigen Hautlappen gehalten. In ihrem rechten Auge steckte nun ebenfalls eine Scherbe, und Blut floss aus der Wunde. Die Scherbe in ihrem linken Augapfel war durch den wiederholten Aufprall noch tiefer in ihren Kopf getrieben worden.
Obwohl Tanya kaum noch stehen konnte, vermochte sie nicht, den Blick abzuwenden. Sie war wie hypnotisiert von dem grauenhaften Anblick.
Eine Zuckung ging durch Karens Körper. Dann noch eine. Dann erschlaffte sie. Die Hand hielt sie noch etwa zwanzig Sekunden lang an den Haaren fest, ehe er sie losließ.
Ihr Kopf sackte nach vorn.
»Tja, das Spiel war wohl doch aufregender als gedacht«, sagte der Dämon. »Sieh nur, was du angerichtet hast, Tanya. Du hast deine Freundin umgebracht. Herzlichen Glückwunsch.«
»Nein!«, schrie Tanya wie von Sinnen.
»Jetzt entlasse ich dich wieder in dein jämmerliches kleines Leben.«
Der Dämon trat hinter dem Stuhl hervor und griff nach Karens Smartphone, um den Anruf zu beenden. Dabei verrutschte der Bildausschnitt ein kleines Stück nach oben.
Tanya erstarrte.
Einen winzigen Moment lang war das Gesicht des Dämons zu sehen. Es war ein Anblick, bei dem sie endgültig nicht mehr an sich halten konnte und sich in einem heftigen Schwall erbrach.
7
Garcias Blick ging zuerst zu der Blutlache unter dem Stuhl, dann zu den Spritzern auf der Tischplatte. Er war so geschockt von den entsetzlichen Wunden der Toten, dass ihm bislang gar nicht aufgefallen war, dass mit Ausnahme der Scherben in ihrem Gesicht nirgendwo Glas zu sehen war.
»Genau zu demselben Schluss bin ich auch gelangt«, stimmte Dr. Slater ihm zu, als sie neben Hunter hinter den Stuhl trat. »So, wie sie gefesselt wurde, hätte der Täter sie ohne große Schwierigkeiten packen und ihr Gesicht nach vorne drücken können.« Sie deutete an, wie sie das Opfer am Hinterkopf bei den Haaren nahm und ihren Kopf nach vorn bewegte. »Die Bewegung muss schnell und mit großer Kraft ausgeführt worden sein.«
Garcia ging um den Tisch herum, während er weiterhin mit Blicken den Fußboden absuchte. »Sie gehen also davon aus, dass der Täter ein Behältnis mit Glasscherben vor sie hingestellt hat, vielleicht auf den Tisch, vielleicht in ihren Schoß, sie dann bei den Haaren genommen und ihr Gesicht in die Scherben gedrückt hat?«
Sergeant Velasquez, der noch immer beim Perlenvorhang stand, knirschte vor lauter Unbehagen mit den Zähnen und verlagerte das Gewicht von einem Fuß auf den anderen.
»So absurd und sadistisch es auch klingt, Detective«, sagte Dr. Slater. »Aber ja, diese Theorie steht momentan ganz oben auf meiner Liste.«
»Hat man dieses … Behältnis denn gefunden?«, wollte Garcia wissen.
»Nein, bislang noch nicht«, musste Slater einräumen. »Aber ich kann Ihnen sagen, wo das Glas herkam.«
8
Hunter, Garcia und Sergeant Velasquez folgten Dr. Slater in einen kurzen Flur, von dem drei weitere Türen abgingen – eine links, eine rechts und eine am hinteren Ende. Dr. Slater führte die Männer in das Zimmer hinter der linken Tür.
Das einzige Bad der Wohnung war geräumig und komplett weiß gekachelt. Eine beigefarbene Keramikbadewanne befand sich an der südlichen Wand. Darüber war ein Duschkopf montiert, und ein durchsichtiger, zur Seite geschobener Duschvorhang hing von einer Metallstange. Eine Erklärung war nicht nötig. Sobald sie das Bad betreten hatten, sahen sie, was Dr. Slater mit ihrer Behauptung, sie wisse, woher das Glas gekommen sei, gemeint hatte. Die gesamte Südwand, von der Decke bis zum oberen Rand der Badewanne, war verspiegelt gewesen. Jemand hatte den Spiegel zerschlagen, und das meiste Glas fehlte. Nur noch in den Ecken saßen einzelne Stücke.
»Der Vorrat war groß«, sagte Dr. Slater. »Der Täter musste nicht lange suchen.«
Von der Badezimmertür aus betrachteten Hunter und Garcia die Überreste des Spiegels, ehe sie den Raum betraten, um einen Blick in die Badewanne zu werfen. Nichts. Sie war blitzsauber. Nicht einmal winzige Splitter des Spiegelglases lagen darin. Entweder der Täter war beim Einsammeln sehr gründlich gewesen, oder er hatte die Badewanne vorher mit einer Plane ausgelegt.
Garcia trat einen Schritt zurück und sah sich im Badezimmer um. Das Waschbecken befand sich auf der rechten Seite der Tür, die Toilette auf der linken. Zwischen Badewanne und Toilettenschüssel stand ein Regal mit sechs Ablageflächen, das eine Vielzahl von Kosmetika und Parfümflaschen enthielt. Am Regal lehnte eine digitale Personenwaage. An einem Haken an der Tür hing ein rosafarbener Bademantel.
»Schon eine Vermutung, was den Todeszeitpunkt angeht?«
»Die Totenstarre setzt gerade ein«, antwortete Dr. Slater. »Ich würde also sagen, vor mindestens zweieinhalb und höchstens vier Stunden.«
Hunter schaute auf seine Armbanduhr – zwei Uhr zweiundvierzig. »Hat man ihr Handy gefunden?«
»Ja«, antwortete Dr. Slater. »In der Mikrowelle. Er hat es gegrillt.«
»Was ist mit einem Computer oder Laptop?«
»Ihr Laptop lag im Schlafzimmer. Wir nehmen ihn zur Analyse mit, wenn wir hier fertig sind.«
Hunter nickte. Er ging nicht davon aus, dass die EDV-Abteilung etwas Verwertbares finden würde. Warum hätte der Täter sonst das Handy zerstören, aber den Computer heil lassen sollen? Er trat zum Waschbecken und öffnete den darüberhängenden Spiegelschrank. Darin befanden sich die üblichen Utensilien: Zahnbürste, Mundspülung, Heftpflaster, Augentropfen sowie mehrere Schachteln mit starken Kopfschmerztabletten. Auch ein Fläschchen mit Schlaftabletten entdeckte er. Der Mülleimer links neben der Toilette war leer. Bis auf den zerbrochenen Spiegel schien der Täter im Bad nichts angerührt zu haben.
Hunter kehrte in den Flur zurück und öffnete die Tür auf der rechten Seite. Sie gehörte zu einer kleinen Kammer, in der Karen Ward unter anderem ihr Putzzeug aufbewahrt hatte. Er schloss die Tür wieder und ging zur dritten und letzten Tür am Ende des Flurs – Karen Wards Schlafzimmer.
Das Zimmer war recht geräumig. Es enthielt ein niedriges Doppelbett, einen mit schwarzem Stoff bezogenen Sessel, eine Kommode mit vier Schubladen und ein hölzernes Schuhregal mit acht Regalböden. Ihre Kleider hatte Karen Ward nicht in einen Schrank, sondern auf eine extrabreite Kleiderstange aus Chrom gehängt. Obwohl eins der zwei nach Westen gehenden Fenster teilweise von selbiger Kleiderstange verdeckt wurde, vermutete Hunter, dass tagsüber noch genügend Licht ins Zimmer fiel.
Während er den Blick aufmerksam durch den Raum schweifen ließ, fiel ihm etwas ins Auge. Er trat zum Bett, das an der östlichen Wand stand, blieb davor stehen und drehte sich zu der Kleiderstange auf der anderen Seite des Zimmers um.
Irgendwas stimmt hier nicht, dachte er.
Die Kleiderstange war flankiert vom Sessel auf der einen und der Kommode auf der anderen Seite. Das Schuhregal stand rechts neben der Tür und war so groß wie die ganze Wand. Es gab nur einen Nachttisch, und zwar auf der Bettseite, wo Hunter gerade stand. Darauf befanden sich eine Leselampe, ein Digitalwecker und ein zerfleddertes Taschenbuch. Er zog die Schublade des Nachttischs auf und stutzte.
»Carlos, komm mal her, und sieh dir das an.«
Garcia gesellte sich zu seinem Partner.
Hunter holte einen Colt 1911 Special Combat, Kaliber .38 aus der Schublade.
»Wow«, sagte Garcia und hob überrascht die Hände. »Ein ziemlich großes Eisen für die Nachttischschublade.«
»Sie hat einen Waffenschein dafür«, verkündete Hunter und deutete auf das offiziell aussehende Dokument in der Schublade. Mit dem Daumen löste er die Magazinsperre der Pistole und nahm das Magazin heraus. Die Existenz der Waffe an sich war schon überraschend genug, doch die Munition darin versetzte ihnen regelrecht einen Schock: Das Magazin war mit neun Special-Flex-Tip-Patronen gefüllt.
Hunter und Garcia tauschten einen verwunderten Blick.
Die Flex Tip war ein patentiertes Design der Firma Hornady Ammunition und gehörte zu ihrer sogenannten »Critical Defense«-Reihe. Beide Detectives waren mit dem Patronentypus wohlvertraut. Er besaß eine extrem hohe Zerstörungskraft, denn beim Eindringen in das Gewebe dehnte sich die flexible Spitze aus, wodurch es zur vollständigen Energieabgabe kam. Das Ergebnis war ein Steckschuss mit verheerender Wirkung. Flex-Tip-Patronen waren bestimmt nicht die Art von Munition, die man zum Schießtraining benutzte.
Hunter steckte das Magazin wieder in die Pistole und legte sie zurück in die Schublade. Bis auf den Waffenschein befand sich nichts weiter darin.
»Sie sagten, die Handtasche des Opfers wurde auf dem Sofa im Wohnzimmer gefunden?«, wandte sich Hunter an Sergeant Velasquez.
»Ja, das ist richtig.«
»War irgendwas Interessantes drin?«
»Nein.«
Hunter kratzte sich unter dem Kinn und ging langsam den Raum ab, während er sich aufmerksam umsah. Als er an der Stelle zwischen Kleiderständer und Kommode vorbeikam, blieb er kurz stehen, ehe er zum Bett zurückkehrte und die Aufmerksamkeit wieder auf den Nachttisch richtete.
»Irgendwie kommt mir das alles völlig verkehrt vor.«
»Was?«, fragte Garcia. »Die Waffe?«
»Die auch«, sagte Hunter. »Aber eigentlich rede ich von dem Zimmer hier.«
Verunsichert schaute Garcia sich um.
Hunter bemerkte, wie Dr. Slater und Sergeant Velasquez dasselbe taten.
»Was meinst du, Robert?«, fragte Garcia.
»Angenommen, es wäre dein Zimmer«, sagte Hunter, »und das hier wären deine Sachen – würdest du dich so einrichten?«
Garcia zögerte eine Zeitlang und betrachtete nacheinander jedes Möbelstück. »Na ja … wahrscheinlich würde ich das Schuhregal nicht brauchen und die Kommode mit dem ganzen Make-up-Kram auch nicht.«
»Nein, das meine ich nicht, Carlos. Ich meine die Raumaufteilung – den Platz, an dem das Bett steht, die Kleiderstange und alles andere, was du hier siehst. Wenn das hier dein Zimmer wäre, würdest du die Sachen so platzieren?«