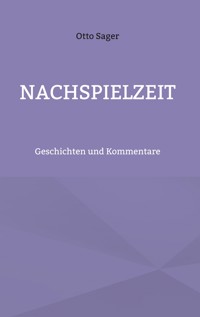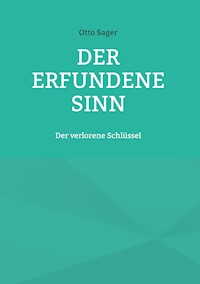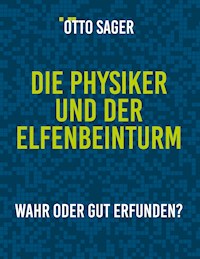Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der Fortschritt in der Physik erfolgte meist erst nach heftigen Auseinandersetzungen und Diskussionen. Auch wenn sich dann eine Auffassung als Lehrmeinung durchsetzte und die Gegner langsam ausstarben, so starben die Ideen nur selten. In 32 Debatten wird dieser Aspekt der Physikgeschichte aufgezeigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch
Jede Zeit hat ihre eigene Physik und Physiker sind Kinder ihrer Zeit. Physiker entwickeln Theorien und Modelle, sie machen Experimente und beobachten Naturphänomene. Nur selten sind ihre Ideen und Interpretationen aber unumstritten. Der Fortschritt in der Physik erfolgte meistens erst nach heftigen Auseinandersetzungen und Diskussionen. Daraus ergab sich dann eine Lehrmeinung, die vom Grossteil der Physiker geteilt wurde. Aber Ideen sterben nicht und kommen später wieder in gewandelter Form an die Oberfläche. Darüber soll im Folgenden berichtet werden, wobei dies in Form von Debatten dargestellt wird. Einige der Debatten fanden zwischen den Physikern statt, welche diese Ideen als erste entwickelt haben; die meisten aber fochten die Anhänger der verschiedenen Interpretationen aus, wobei diese nicht weniger heftig sein mussten.
Natur oder Kultur?
Natur bezeichnet das, was nicht vom Menschen geschaffen wurde. Die Naturgeschichte beschreibt die Veränderungen der Natur im Verlaufe der Jahrhunderte. Dagegen ist Kultur alles, was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt. Dazu gehören nebst der bildenden Kunst, Musik und Sprache auch Landwirtschaft und Technik, sowie Recht, Wirtschaft und Religion. Auch die Geisteswissenschaften gelten als Teil der menschlichen Kultur. Wie steht es mit den Naturwissenschaften? Ein Teil beschreibt die verschiedenen Phänomene, welche man in der Natur beobachten kann und ordnet sie nach bestimmten Kriterien. Andere wie die Chemie bauen aus den Grundelemente neue Produkte. In der Physik will man die Naturgesetze erforschen. Dazu führt man in einer selbsterstellten Umgebung Experimente durch, wobei durch Einschränkungen viele natürliche Störeffekte unterdrückt werden. Die Resultate werden in mathematischer Sprache beschrieben, wobei Mathematik eine Schöpfung des menschlichen Geistes ist. Die Geschichte der Physik ist deshalb Teil der Kulturgeschichte.
Inhalt
Vorwort
Teil 1 Physik als Teilgebiet der Philosophie
Die Demokrit-Zenon von Kition – Debatte
Atome oder Kontinuum?
Die Aristoteles-Archimedes – Debatte
Philosophie oder Physik?
Die Thomas-Ockham – Debatte
Realismus oder Nominalismus?
Die Ptolemäus-Kopernikus – Debatte
Geozentrisch oder heliozentrisch?
Teil 2 Debatten auf dem Weg zur klassischen Physik
Die Galilei-Kepler – Debatte
Messungen oder Berechnungen?
Die Descartes-Bacon – Debatte
Deduktiv oder induktiv?
Die Newton-Leibniz – Debatte
Absoluter oder relationaler Raum?
Die Faraday-Maxwell – Debatte
Bildhafte oder abstrakte Physik?
Die Boltzmann-Ostwald – Debatte
Statistische oder phänomenologische Physik?
Die Planck-Mach – Debatte
Realisten oder Positivisten?
Teil 3 Debatten zur Physik des 20. Jahrhunderts
Die Einstein-Heisenberg – Debatte
Relative oder unbestimmte Physik?
Die Bohr-Schrödinger – Debatte
Revolutionäre oder traditionelle Physik?
Die Pauli-Scherrer – Debatte
Theoretische oder experimentelle Physik?
Die Noether-Meitner – Debatte
Mathematik oder Physik?
Die Dirac-Bardeen – Debatte
Mathematische oder pragmatische Physik?
Die Feynman-Gell Mann – Debatte
Reale oder virtuelle Physik?
Die Hawking-Laughlin – Debatte
Reduktionistische oder emergente Physik?
Modelle
Teil 4 Physik als Basis für andere Fachgebiete
Die Lesch-Unzicker – Debatte
Physik und Kosmologie
Die Millikan-Pauling – Debatte
Physik und Chemie
Die Delbrück-Watson – Debatte
Physik und Biologie
Die Zuse-Shannon – Debatte
Physik und Informatik
Die Ziegler-Yorke – Debatte
Physik zwischen Ordnung und Chaos
Die Rohrer-Moulton – Debatte
Physik und Engineering
Die Röntgen-Dessauer – Debatte
Physik und Medizin
Die Langmuir-Sacharow – Debatte
Physik und Energietechnik
Teil 5 Physik und Gesellschaft
Die Popper-Kuhn – Debatte
Wissenschaftstheorie und Physik
Die Zwicky-Vester – Debatte
Klimawandel und Physik
Die von Weizsäcker-Feynman – Debatte
Philosophie und Physik
Die Goethe-Newton – Debatte
Kunst und Physik
Die Jung- Pauli – Debatte
Psychologie und Physik
Die Bohr-Heisenberg – Debatte
Weltpolitik und Physik
Die von Zahnd-Möbius – Debatte
Dürrenmatts Physiker
Glossar
Zeittafeln
Personenverzeichnis
Wir müssen uns daran erinnern, dass das, was wir beobachten, nicht die Natur selbst ist, sondern Natur, die unserer Art der Fragestellung ausgesetzt ist.
(Werner Heisenberg)
Wir müssen unbedingt Raum für Zweifel lassen, sonst gibt es keinen Fortschritt, kein Dazulernen. Man kann nichts Neues herausfinden, wenn man nicht vorher eine Frage stellt. Und um zu fragen, bedarf es des Zweifelns.
(Richard Feynman)
Vorwort
‚Und sie bewegt sich doch‘, soll der Legende nach Galileo Galilei nach seiner Verurteilung gemurmelt haben. In der Kulturgeschichte der Physik gab es immer solche Situationen, bei denen ein Dogma oder eine dominierende Lehrmeinung vorherrschte und man der Überzeugung war, dass nun alles bekannt sei. Als Max Planck Physik studieren wollte, riet ihm sein Professor mit der Bemerkung ab, dass ‚in dieser Wissenschaft schon fast alles erforscht sei, und es gelte nur noch, einige unbedeutende Lücken zu schliessen‘. Heute glauben viele, dass man bald eine grosse vereinheitlichte Theorie habe, die dem Standardmodell der Elementarteilchen zugrunde gelegt werden könne. Und nach einiger Zeit werde man auch eine Theorie der Quantengravitation entwickeln können, sodass einer Weltformel nichts mehr im Wege stehe. Solche Aussagen sind Anzeichen für eine sich anbahnende Krise. Mit diesem Buch möchte ich aufzeigen, dass die Physikgeschichte von den Auseinandersetzungen über verschiedene Grundauffassungen vom Wesen der Natur geprägt wurde. Oft hat sich dann eine Auffassung als Lehrmeinung – als ‚Mainstream‘ – durchgesetzt, während die andere in den Hintergrund gedrängt wurde. Dazu eine Aussage von Max Planck: „Eine grosse wissenschaftliche Idee pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, dass ihre Gegner allmählich überzeugt und bekehrt werden, sondern viel mehr in der Weise, dass die Gegner allmählich aussterben!“ Hier irrte Planck: Die Gegner mögen aussterben, aber Ideen sterben nur selten. Vielfach ersteht die unterlegene Grundauffassung später – oft in gewandelter Form – wieder. So findet man zum Beispiel die fünf Platonischen Körper in neueren Büchern wieder, um auf mögliche Extradimensionen hinzuweisen. In diesem Buch lasse ich deshalb auch Ideen von Physikern zu Worte kommen, welche nicht die momentan vorherrschende Lehrmeinung vertreten.
Zwei Themen treten immer wieder in der Kulturgeschichte der Physik auf. Beim ersten Thema geht es um die Frage nach der Existenz einer vom menschlichen Bewusstsein unabhängigen Aussenwelt. Wenn wir dies bejahen, dann muss die Physik von allen anthropischen Elementen befreit werden. Die zweite Frage ist mit der ersten verwandt: ‚Kann das menschliche Gehirn, welches von der Evolution zuerst dazu ausgestattet wurde, in einer oft feindlichen Umwelt zu überleben, alle Vorgänge und Phänomene in der Natur verstehen?‘ – Diese Frage spielt bei der Interpretation der Quantenphysik eine zentrale Rolle.
Im vorliegenden Buch werden in den ersten drei Abschnitten Debatten beschrieben, die zu ihrer Zeit von grosser Wichtigkeit waren. Sie sind unter den Titeln ‚Physik als Teilgebiet der Philosophie‘, ‚Auf dem Weg zur klassischen Physik‘ und ‚Die Physik des 20. Jahrhunderts‘ zusammengefasst. Physikalisches Denken und physikalische Messmethoden hatten auch Auswirkungen auf Fachgebiete wie die Chemie, die Biologie und die Kosmologie. Davon handelt der vierte Teil. Zusätzlich wird auch einen Einblick in das Arbeiten der Ingenieur-Physiker in der Industrie und beim Bau grosser Anlagen gegeben. Im letzten Teil soll aufgezeigt werden, wie andere Leute über die Physik und die Physiker denken. Dies beginnt mit der Aussage von Karl Popper, dass eine physikalische Theorie solange als nützlich anzusehen sei, als sie nicht falsifiziert wurde. Auch Goethes scharfe Kritik an der Lichttheorie von Newton gehört in diesen Teil. Ein Kommentar zu den Physikern aus der Komödie von Dürrenmatt bildet den Abschluss dieses Buches.
Bei der Auswahl der Debatten habe ich Themen gewählt, denen ich in verschiedenen Büchern und Artikel begegnet bin. Das vorliegende Buch ist kein wissenschaftliches Geschichtsbuch. Zudem mischten sich zwangsläufig subjektive Elemente ein; dies beginnt mit der Auswahl der Themen, wobei diese aus heutiger Sicht beschrieben und beurteilt werden. Ich habe die Debatten an Namen geknüpft, da Namen und Menschen der Leserin und dem Leser wohl geläufiger sind als abstrakte Begriffe, die dann in den Debatten abgehandelt werden. Einige dieser Debatten fanden direkt zwischen den Kontrahenten statt. Ein Beispiel ist die Boltzmann-Ostwald – Debatte. Bei anderen Debatten lebten die Exponenten in anderen Jahrhunderten, und es waren ihre Schüler oder Anhänger, die über die Wahrheit stritten. Das schönste Beispiel findet man im ‚Dialogo‘ von Galileo Galilei, bei dem ein Anhänger des ptolemäischen mit einem Vertreter des heliozentrischen Weltbilds diskutiert. Ich habe jeweils die Exponenten nur kurz porträtiert, da das Hauptgewicht des Buches auf dem Wettstreit der Ideen liegt. Ausführlichere Beschreibungen findet man zum Beispiel in den Büchern von E.P. Fischer, die ich mit grossem Vergnügen gelesen habe, oder im Wikipedia, dem Lexikon im Internet. Die einzelnen Debatten sind so verfasst, dass man sie für sich alleine lesen kann. Damit gibt es Redundanzen, sodass die eine oder andere Aussage in gleicher oder ähnlicher Form an verschiedenen Stellen des Buches vorkommen kann. Mit diesen Erläuterungen hoffe ich, dass nun auch meine Leserinnen und Leser das vorliegende Buch mit Vergnügen lesen werden.
Zollikon, im Mai 2018 Otto Sager
Teil 1: Physik als Teilgebiet derPhilosophie
Einleitung
Die heutige theoretische Physik steht weitgehend in der Tradition der griechischen Philosophie. So basiert die Theorie der Elementarteilchen auf Symmetrieüberlegungen, welche in mathematischer Sprache formuliert werden. In der Antike waren die Pythagoreer der Meinung, der gesamten Weltordnung lägen Zahlenordnungen zugrunde. In seinem Werk ‚Timaios‘ sagte Platon, dass die physikalischen Körper aus den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft aufgebaut seien. Diesen seien jedoch geometrische Objekten zugeordnet, die durch einfache Zahlenverhältnisse gegeben sind. „Damit leitet Platon eine spezifische Tradition in der Physik ein, die bis in die Gegenwart andauert und in der versucht wird, die gesamte Physik in der einen oder anderen Form auf Geometrie zu reduzieren.“ (N. Sieroka) Nebst den Philosophen hatte Euklid, der um 300 v.Chr. in Alexandria lebte, einen gewaltigen Einfluss auf das abstrakte Denken. Seine axiomatische Methode wurde zum Vorbild für die gesamte spätere Mathematik.
C.F. von Weizsäcker, der von der theoretischen Physik herkam und später Professor für Philosophie wurde, ging mit seinen Überlegungen zum Verständnis der Quantenphysik auch auf die alten Griechen zurück. Ein wesentlicher Unterschied zwischen der heutigen Physik und den Theorien der Philosophen liegt darin, dass physikalische Theorien durch Experimente überprüft werden müssen. Erst dadurch werden sie ‚richtig‘ oder ‚falsch‘. Die Philosophen der Antike – von den ‚Vorsokratikern‘ bis zu den Philosophen in Rom – suchten dagegen durch reines Nachdenken nach einer Erklärung der Naturphänomene. Ihre Ansichten konnte man akzeptieren oder verwerfen; man konnte und wollte sie jedoch nicht überprüfen. So entstanden verschiedene philosophische Schulen und physikalische Theorien, die über Jahrhunderte nebeneinander existierten.
Im Mittelalter beherrschten die Aussagen von Aristoteles die naturwissenschaftlichen Vorstellungen der Menschen. Sie passten auch gut in das biblische Weltverständnis eines Thomas von Aquin. Das Mittelalter war nicht nur ‚dunkel‘ und eine Zeit des Stillstandes. Durch Gründung der Universitäten in verschiedenen Landesgegenden entstand eine gelehrte Oberschicht. Nebst den philosophischen Fächern lernte man Logik, Rhetorik und Dialektik. Dabei mussten die Schüler ihre Thesen in Debatten verteidigen, bevor sie einen Titel wie Magister oder Doktor bekamen. Für diese Art der Bildungseinrichtungen gab es kein Vorbild in der Antike. Eine weitere positive Entwicklung im Mittelalter ist das Entstehen der Zünfte, in denen sich die Handwerker in den Städten zusammenschlossen. Sie waren die Träger des technischen Fortschritts und es gelang ihnen, neue Geräte zur Erleichterung ihrer Arbeit zu entwickeln. Theorie und Praxis konnten sich damit soweit entwickeln, dass im 17. Jahrhundert eine wissenschaftliche Revolution stattfand, wobei die Physik sich als eigenständige Disziplin neben der Philosophie etablieren konnte.
Die Demokrit-Zenon von Kition – Debatte
Atome oder Kontinuum?
Zum Thema
Demokrit von Abdera und Zenon von Kition versuchten die Naturvorgänge rational zu erfassen, um darauf ein logisch konsistentes Bild der Natur zu konstruieren. Ihr Ansatz ging von der Ratio aus: Durch Nachdenken – und weniger durch Beobachtung oder gar Experimente – sollte so eine stimmige Erklärung gefunden werden. Dies ist die Denkweise aller griechischen Philosophen, auch wenn sie sich zu physikalischen Problemen äusserten. Beide entwarfen eine physikalische Theorie, die bis heute immer wieder in gewandelter Form das physikalische Denken beeinflusst. Dazu folgender Ausschnitt aus dem Buch ‚Der Weg der Physik‘ von S. Sambursky: „Der Prozess der Theoriebildung begann an einem Thema von zentraler Bedeutung für die gesamte Naturwissenschaft, nämlich durch die Ausarbeitung zweier gegensätzlicher physikalischer Systeme, der Atomistik und der Kontinuumslehre…………Bei beiden Systemen geht es um das Wesen der Materie und die Art und Weise physikalischer Wirkungen. Während die Atomlehre von Leukipp, Demokrit und Epikur auf der Partikelvorstellung aufbaut und mit den Konzepten von Stoss, Anordnung und Form assoziiert war, stand im Mittelpunkt der Kontinuumslehre der Stoiker die Vorstellung vom alldurchdringenden Pneuma, dem wissenschaftlichen Analogon des allgegenwärtigen Gottes, verbunden mit dem Begriff der Spannung und dem Prinzip der Superposition von Zuständen. Die beiden miteinander rivalisierenden Systeme waren die Vorläufer der jahrhundertelangen Antithese der Begriffe von Korpuskel und Feld.“
Porträts
Demokrit wurde in Abdera in Thrakien um 460 v. Chr. geboren und verstarb anfangs des vierten Jahrhunderts vor Christus. Man zählt ihn zu den Vorsokratikern. Er reiste viel und hatte Kenntnisse über den ganzen Umfang des damaligen Wissens. Seine philosophische Lehre sollte bewirken, dass die Seele eine heitere Stimmung erlange und frei von Furcht, Angst und Hoffnung sei. Er bezeichnete dies als ‚Euthymia‘ (Wohlgemut) und sie ergibt sich aus der Erkenntnis des Wesens aller Dinge, die aus Atomen aufgebaut sind. Zudem gilt das richtige Mass als Wegweiser: „Wenn einer das Mass überschreitet, wird das Erfreulichste zum Unerfreulichen!“ „Wenn du nicht nach vielem begehrst, wird dir das Wenige viel erscheinen. Denn bescheidenes Begehren macht die Armut gleich stark wie der Reichtum!“ Demokrits Philosophie ist im Grunde materialistisch. Und der Materialismus hat auch heute noch viele Anhänger.
Zenon von Kition wurde um 333 v. Chr. in Kition auf Zypern geboren und starb um 262 v.Chr. Er kam nach Athen und gründete dort seine philosophische Schule, die Stoa. Der Name stammt von der Säulenhalle beim Markt, wo sich Zenon mit seinen Schülern traf. Seine philosophische Lehre basiert auf der ganzheitlichen Welterfassung, aus der sich ein in allen Naturerscheinungen ein universell wirkendes Prinzip ergibt. Dies wirkt sowohl im Kosmos als auch in allen Individuen. Der Mensch sollte seinen Platz in diesem Ordnungssystem finden, sollte tugendhaft leben und nicht seinen Begierden nachgeben. Den Wechselfällen des Lebens sollte er mit ‚stoischer‘ Ruhe begegnen. Durch Kontrolle der Affekte und Indifferenz gegenüber Schmerz und Lust kann er die ‚Apatheia‘ und die Weisheit erlangen. Die Philosophie der Stoiker war in Rom Wegweiser für Leute wie Cicero (106-43 v. Chr.), Seneca (4 v. Chr.-65 n. Chr.) und für den Kaiser Marc Aurel (121-180). Cicero prägte den Begriff ‚Humanismus‘, der für eine Weltanschauung steht, die den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt rückt. Auch heute noch sind die Werte des Humanismus für viele Menschen zentral.
Das physikalische Weltbild
Demokrit nahm weder eine Kraft oder einen Geist an, der in die Naturprozesse eingreift. Das Einzige, was es gibt, sind die Atome und der leere Raum. Die Atome unterscheiden sich durch Form und Grösse. Die Atome bewegen sich im Raum, stossen aneinander, wodurch sämtliche Erscheinungen in der Welt hervorgebracht werden. Es gibt keine Mischung der Substanzen, sondern nur die Verbindung und Trennung der Atome. Es gibt keine ‚Absicht‘; aber alles, was passiert hat eine natürliche Ursache, die in den Dingen liegt. Er stimmte auch Heraklit zu, dass alles in der Natur fliesst, das heisst, einem ständigen Wandel unterworfen ist. Ewig und unveränderlich sind einzig die Atome.
Zenon und die Stoiker waren Monisten; für sie gibt es keinen Gegensatz zwischen ‚Geist‘ und ‚Stoff‘. Es gibt auch keinen Zufall; alles ergibt sich notwendigerweise aus den Naturgesetzen. Diese Kausalität ist bestimmend für ihr Weltbild. Aus einem Urfeuer – dem Aither – entstand alles Seiende. Aller ‚Stoff‘ ist durch die göttliche Vernunft – dem ‚Logos‘ – beseelt. Der Logos steht sowohl für Sprache als auch für Vernunft. Dabei ergeben sich klare Regeln für das Argumentieren, wobei der Dialektik (These – Antithese – Synthese) eine zentrale Rolle zukommt. Als ‚wahr‘ wird nur anerkannt, was aufgrund dieser Argumentation einleuchtet. Mark Aurel hat die Weltsicht der Stoiker wie folgt beschrieben: „Alles ist wie durch ein heiliges Band miteinander verflochten. Nahezu nichts ist sich fremd. Alles Geschaffene ist einander beigeordnet und zielt auf die Harmonie der Welt. Ein alles durchdringender Körperstoff bewirkt ein Gesetz, eine Vernunft und eine Wahrheit.“
Nachwirkungen in der Physik
Demokrits Atomtheorie trat über Jahrhunderte in den Hintergrund. Dominierend war die Lehre des Aristoteles, der die vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde als zentral ansah. Newton interpretierte dann das Licht als Strom von Korpuskeln und später in der Thermodynamik wurde die Vorstellung von Atomen wieder zentral. Seit dem Beginn des Zwanzigsten Jahrhunderts wird die Existenz von Atomen allgemein akzeptiert. Sie wurde durch den Nachweis von Elektronen, Protonen und Neutronen weiter verfestigt. Demokrits Atomlehre müsste eigentlich der Chemie zugeordnet werden. Dabei kennen wir gemäss dem Periodensystem eine grosse Zahl verschiedener Atome, die chemisch nicht weiter zerlegt werden können. Diese Atome gehen Verbindungen ein, wobei neue Substanzen entstehen. Wenn man die Verbindungen wieder auflöst, dann bleibt nichts als die Atome.
Zenon und die Stoiker mussten bis ins neunzehnte Jahrhundert warten, bis ihre Ideen in der Thermodynamik in neuerer Form aufgenommen wurden. Energie und Entropie spielten dabei eine zentrale Rolle, wobei in einem geschlossenen System die Energie erhalten bleibt und die Entropie zunimmt. Die physikalische Chemie arbeitet mit Potenzialen, wenn sie chemische Reaktionen quantitativ erfassen will. Der wichtigste Vertreter dieser Sichtweise war Wilhelm Ostwald, der sie in einer grossen Debatte gegen Ludwig Boltzmann vertrat, welcher die Zustandsgrössen der Gase – Temperatur, Druck, Entropie – mit der Bewegung von Atomen oder Molekülen begründete. Grosse Bedeutung erlangten die Feldideen in der Elektrodynamik. Faraday führte den Begriff der Kraftfelder ein und Maxwell zeigte, dass sich die elektromagnetische Strahlung mit einer endlichen Geschwindigkeit ausbreitet. Dazu brauchte man ein Medium, den Äther, dessen Name dem Aither der Stoa entliehen war. Später wurde aufgrund von Experimenten die Ätherhypothese aufgegeben. Dafür hat jetzt das Vakuum ähnliche Eigenschaften wie der Äther. Laughlin meint dazu: „Die moderne, jeden Tag bestätigte Vorstellung des Raumvakuums ist die eines relativistischen Äthers. Wir nennen ihn nur nicht so, weil dies tabu ist.“ In neuester Zeit verfolgt Hans Widmer ähnliche Ziele wie die Stoa. In seinem Modell des konsequenten Humanismus stehen philosophische Fragen im Zentrum: Wie kann die Gesellschaft zweckmässig organisiert werden, sodass sich Menschen individuell entfalten können und ihr Glück finden? – Sein Modell umfasst verschiedene Stufen und es will nicht nur die materielle Welt erklären. Dazu gehören auch das Denken und das lebensförderliche Handeln. Basis der Überlegungen ist seine deduktive Physik. Dazu führt er wie die Stoiker neben Raum und Zeit das Kontinuum als a priori – Element ein. Damit sollen alle physikalischen Gesetze und Phänomene abgeleitet oder beschrieben werden. Das Modell des konsequenten Humanismus ist ein anthropozentrisches System. Es erklärt die Physik anders, macht aber keine zusätzlichen Vorhersagen, die experimentell überprüfbar wären. Es wird sich deshalb – wie alle philosophisch begründeten Systeme – kaum in der nüchternen Welt der Physik durchsetzen können.
Literaturhinweise:
Laughlin R.B. Abschied von der Weltformel. München 2007: Piper. Mason St., Geschichte der Naturwissenschaft. Bassum 1997: Verlag für Geschichte der Naturwissenschaft.
Sambursky S. Der Weg der Physik: Texte von Anaximander bis Pauli 1975: Zürich: Artemis.
Sieroka N., Philosophie der Physik. München 2014: Beck.
Widmer H., Das Modell des konsequenten Humanismus. Zürich 2013: rüffer & rub.
Die Aristoteles-Archimedes – Debatte
Philosophie oder Physik?
Zum Thema
Zwei Städte prägten im Altertum das Denken über naturwissenschaftliche Themen: Athen und Alexandria. In Athen entstanden die grossen philosophischen Schulen: Platons Akademie und die Peripatetiker des Aristoteles. Platon (428-348 v.Chr.) war der Schüler von Sokrates (469-399 v.Chr.), der selbst nichts Schriftliches verfasst hat. Aristoteles (384-322 v. Chr.) war wohl der Philosoph, der die meisten Spuren bis hinein in die Neuzeit hinterlassen hat. Nach dem Niedergang von Athen wurde Alexandria in Ägypten zum Zentrum des naturwissenschaftlichen Denkens. In Alexandria wurde die Geometrie durch Euklid (330-260 v.Chr.) systematisiert. Aristarchos (310-230 v.Chr.) vertrat schon damals ein heliozentrisches System, welches auch auf Archimedes (287-212 v.Chr.) grossen Einfluss hatte. Nicht unerwähnt bleiben darf Claudius Ptolemäus (85-165 n.Chr.), der das nach ihm benannte geozentrische Weltbild perfektionierte. Archimedes kann als Gegenpart von Aristoteles gelten. Er war nicht nur ein experimenteller und theoretischer Physiker, sondern auch ein Ingenieur, und er hatte auf das Denken und Handeln der nachfolgenden Generationen einen ebenso wichtigen Einfluss. Auch wenn Aristoteles und Archimedes nie miteinander diskutieren konnten, so prallten ihre Ideen zur Zeit der wissenschaftlichen Revolution voll aufeinander. Für die Kirche und ihre Institutionen war Aristoteles die philosophische Autorität. Leonardo da Vinci und Galileo Galilei dachten und arbeiteten nach den Methoden von Archimedes. Der Höhepunkt der Debatte endete im Prozess gegen Galilei, der nach seiner Verurteilung gemurmelt haben soll „und sie bewegt sich doch!“Aristoteles und Archimedes, diese Giganten der Antike, sind aus der Geistesgeschichte nicht wegzudenken.
Porträts
Aristoteles wurde 384 v.Chr. in Stageira auf der Halbinsel Chalkidike geboren. Sein Vater war Leibarzt des makedonischen Königs und vermögend genug, um seinem Sohn ein Leben als Philosoph zu ermöglichen. Als 17-jähriger ging Aristoteles nach Athen und trat in die Akademie des Platons ein. Dort blieb er bis zum Tode seines Lehrers. Dann siedelte er nach Mytilene auf der Insel Lesbos um und begann seine Studien zu biologischen Problemen. Der makedonische König Philipp II berief ihn 342 v.Chr. nach Pella als Erzieher seines Sohnes Alexander, der dann als Alexander der Grosse in die Geschichtsbücher einging. Ab 334 v.Chr. ist Aristoteles wieder in Athen und begründet dort die peripatetische Schule. Die Peripatetiker wurden so genannt, weil sie bei ihren Diskussionen in einer Säulenhalle hin- und herschritten und ihre Gedanken austauschten. Als die Gefahr bestand, dass man ihm in Athen wie Sokrates den Prozess wegen Lästerung der Götter machen wollte, floh er nach Chalkis auf der Insel Euboia, wo er im Jahr 322 v.Chr. starb.
Archimedes wurde 287 v.Chr. in der Hafenstadt Syrakus in Sizilien geboren. Sein Vater Pheidias war Astronom am Hofe des Königs. Bei einem längeren Aufenthalt in Alexandria studierte er dort Mathematik (Euklidsche Geometrie), Astronomie und Physik und war mit Eratosthenes befreundet. Dieser leitete dort die grosse Bibliothek und es gelang ihm, den Erdumfang zu berechnen. In Alexandria soll Archimedes die sogenannte ‚Archimedische Schraube‘ erfunden haben, eine Wasserhebevorrichtung, wie sie heute noch in Ägypten zum Einsatz kommt. Nach seiner Rückkehr nach Syrakus beschäftigte er sich mit Geometrie und Physik. Daneben musste er als Ingenieur viele Aufträge für den König erledigen. Um diese seine Tätigkeiten ranken sich viele Legenden. So musste er den Gold-Gehalt einer Krone des Königs überprüfen, wobei er an der Krone selbst keine Änderung vornehmen durfte. Als Archimedes in ein Bad stieg, entdeckte er, dass so viel Wasser aus der Wanne ausfloss, wie er mit seinem Körpervolumen verdrängte. Er soll aufgesprungen und nackt durch Syrakus gerannt sein und ‚Heureka‘ – ich hab’s gefunden – gerufen haben. Dieses sein ‚Archimedisches Prinzip‘ gestattete ihm dann, den Auftrag des Königs zu erfüllen. Weiter entwarf er Wurfmaschinen zur Verteidigung von Syrakus, als die Stadt von den Römern belagert wurde. Nach einer anderen Legende soll er auch mit Spiegeln die Segel der Römer in Brand gesetzt haben, was aber wohl kaum möglich war. Die Römer eroberten trotzdem Syrakus und Archimedes wurde von einem römischen Soldaten getötet. Nach der Legende war Archimedes mit einem mathematischen Beweis beschäftigt, wobei er Kreise in den Sand zog. Zum eindringenden Soldaten soll er ‚störe meine Kreise nicht‘ gesagt haben. Der dadurch erzürnte Soldat soll ihn deshalb wütend erschlagen haben.
Das naturwissenschaftliche Weltbild des Aristoteles
Die Philosophie des Aristoteles umspannt ein weites Wissensgebiet: Ontologie (Seinslehre), Logik, Biologie, Physik und Kosmologie, Ethik, Staatstheorie, Rhetorik und Dichtungstheorie. Aristoteles beobachtete zunächst einmal genau, was ihm vor die Augen kam, und entwickelte nachher dazu seine Theorien. Auch wenn wir uns hier zwar auf seine Aussagen zur Logik und Physik beschränken, so müssen wir doch die aristotelischen Axiome aus der Ontologie an den Anfang stellen:
Identitätsprinzip: Jedes Ding ist das, was es ist.
Prinzip des ausgeschlossenen Dritten: Zwischen Sein und Nichtsein gibt es kein Mittleres.
Prinzip des hinreichenden Grundes: Nichts existiert ohne hinreichenden Grund.
Dies ergibt für die Logik die folgenden Prämissen:
Eine Aussage kann nicht ‚wahr‘ und gleichzeitig ‚falsch‘ sein (A ist nicht gleich Nicht-A).
Zwischen einer wahren und einer falschen Aussage gibt es kein Drittes (tertium non datur).
Alles, was geschieht, hat seinen hinreichenden Grund.
Der Satz vom hinreichenden Grund wurde in der obigen Form erst von Leibniz formuliert. Aristoteles hatte aber sehr klare Ansichten bezüglich der Ursachen. Danach können Körper nur solange in Bewegung bleiben, wie sie in unmittelbarer Berührung zu einem unausgesetzt auf sie einwirkenden Beweger stehen. Er unterschied zwischen vier Ursachen, für das, was geschieht:
Die Materialursache (causa materialis) ist das, aus dem eine Sache besteht oder was in ihr enthalten ist.
Die Formursache (causa formalis) gibt die Struktur oder den Bauplan eines Dings an.
Die Wirk- oder Bewegungsursache (causa efficiens) beschreibt die Ursache von Bewegung oder Ruhe eines Gegenstands.
Die Ziel- oder Zweckursache (causa finalis) beschreibt den Zweck, warum etwas Bestimmtes passiert. Jeder Stein, jedes natürliche Etwas, trägt ein Ziel in sich, das es zu erreichen trachtet.
Eine weitere Unterscheidung aus der Ontologie, die später in geänderter Form in der Physik wieder auftauchte, ist die zwischen Akt und Potenz. Im Akt realisiert sich das Wesen eines Dings. Potenz stellt die Möglichkeiten dar, welche ein Ding – sofern es zum Akt kommt – entfalten kann. Jedes Ding ist insoweit tätig, als es ein Akt ist, und ist leidend oder aufnehmend, soweit es Potenz ist. Und keine Potenz kann sich selber in den Akt überführen. Dazu braucht es einen äusseren Auslöser.
Die wichtigste Bedeutung für die Mathematik und Physik hat bis heute die Logik. Markus Fierz schreibt dazu: „Die Lehre von den Syllogismen ist unbestreitbar eine bedeutende und originelle Leistung des Aristoteles. Sie ist der erste Schritt zur formalen Logik und offenbart die mathematische Struktur des Schliessens.“ Dazu hatte Aristoteles Postulate aufgestellt, die man heute zur Mengenlehre zählen würde. Aussagen, die zu logischen Schlüssen führen sind
Allgemein bejahend: alle A sind B
Allgemein verneinend: kein A ist B
Partikulär bejahend: einige A sind B
Partikulär verneinend: einige A sind nicht B
Ein Schluss (Syllogismus) besteht nun aus drei Urteilen, die sich auf drei Begriffe beziehen: Im Obersatz (Maior) wird eine Aussage zu einem Mittelbegriff (M) gemacht. Der Mittelbegriff ist in diesem Satz das Prädikat (P). Im Untersatz (Minor) wird eine Aussage eines Subjekts (S) zum Mittelbegriff (M) festgestellt. Aus diesen beiden Urteilen eliminiert man den Mittelbegriff und erhält so als Drittes das Urteil oder die Konklusion. Dabei gilt die Regel: Der Maior muss allgemein, der Minor muss bejahend sein. Etwas weniger theoretisch ist das folgende Beispiel:
Maior: Alle Menschen (M) sind sterblich.
Minor: Sokrates (S) ist ein Mensch (M).
Konklusion: Also ist Sokrates sterblich.
Mit den oben gemachten Postulaten ergeben sich die verschiedenen Formen des Syllogismus (vgl. Fierz).
Die Beschreibung des Weltbilds von Aristoteles wäre unvollständig, wenn man nichts über seine Auffassungen zu den Elementen sagen würde. Von Empedokles (490-430 v.Chr.) übernahm er die Lehre von den vier Elementen, die es auf der Erde gibt: Feuer, Erde, Wasser, Luft. Aristoteles nahm an, dass die Substanz des Himmels von der irdischen Materie absolut verschieden sei. Diese himmlische Materie wurde in der Folge als ‚Quintessenz‘ bezeichnet. Die vier irdischen Elemente werden durch die beiden Gegensatzpaare ‚warm-kalt‘ und ‚feucht-trocken‘ gesteuert. Sie führen zur Entstehung und Umwandlung der Elemente.
Ergänzt man die seit Hippokrates (460-370 v.Chr.) bekannte Lehre von den vier Säften (Blut, Schleim, gelbe Galle, schwarze Galle) und den vier Temperamenten (Sanguiniker, Choleriker, Melancholiker und Phlegmatiker) so ergibt sich das obenstehende Bild (Fierz).
Die Leistungen Archimedes als Mathematiker, Physiker und Ingenieur
Archimedes war stolz auf seine Leistungen als Mathematiker und Physiker; seine Leistungen als Ingenieur, für die wir ihn bis heute bewundern, schätzte er dagegen gering ein. So behandeln seine Schriften nur seine theoretischen Überlegungen. Dabei ging er von evidenten Voraussetzungen oder Axiomen aus und leitete daraus deduktiv seine wissenschaftlichen Erkenntnisse ab. Norman Sieroka schreibt dazu: Archimedes Schriften „betrafen, in griechischen Termini ausgedrückt, den Bereich der ‚epistéme‘ als Wissen in seiner höchsten Form, das nach letzten Prinzipien und Ursachen sucht. Archimedes praktische Erfindungen gehören einer anderen Wissensform an: der ‚téchne‘. Sie ist insbesondere im Bereich des Hand- und Kunstwerks relevant und bezieht sich auf die Fähigkeit, etwas Bestimmtes tun oder herstellen zu können. ….. Die Trennung zwischen epistéme und téchne bewirkte (zumindest bis zur Zeit des Archimedes) eine intellektuelle Geringschätzung konkreter Anwendungen und Umsetzungen mechanisch-technischer Einsichten. – In diesem Sinne haben die Animositäten, die man bis heute gelegentlich zwischen Natur- und Ingenieurwissenschaften als eher theoretischen bzw. eher praktisch-orientierten Disziplinen antrifft, also eine sehr lange Vorgeschichte.
Nun einige Beispiele zu den Leistungen von Archimedes als Mathematiker und Physiker:
Archimedes bewies, dass sich der Umfang eines Kreises zu seinem Durchmesser genauso verhält wie die Fläche des Kreises zum Quadrat des Radius. Er nannte dieses Verhältnis noch nicht π, gab aber eine Anleitung, wie man sich dem Verhältnis bis zu einer beliebig hohen Genauigkeit nähern kann.
Archimedes erweiterte den Bereich der Platonischen Körper auf Körper mit regelmässigen Polygonen (Vielecke). Meist geht man von der Existenz von 13 Archimedischen Körpern aus.
Das Archimedische Axiom besagt Folgendes: Hat man zwei Strecken auf einer Geraden, so kann man die grössere der beiden übertreffen, wenn man die kleinere nur oft genug abträgt. Diese Aussage wurde schon vor Archimedes gemacht, trägt aber bis heute seinen Namen, da es die mathematische Beweisführung von Archimedes widerspiegelt.
Archimedes hat das Hebelgesetz nicht nur gekannt, sondern auch begründet, indem er es auch theoretisch abgeleitet hat. Ihm wird die Aussage ‚Gebt mir einen festen Punkt, und ich hebe die Erde aus den Angeln‘ in den Mund gelegt.
Das Archimedische Prinzip besagt, dass der statische Auftrieb eines Körpers in einem Medium genau so gross ist wie die Gewichtskraft des vom Körper verdrängten Mediums.
Als Beispiel seiner Leistungen als Ingenieur gelten seine Erfindung verschiedener Maschinenelemente wie z. B. Schrauben, Flaschenzüge, Seilzüge mit Wellenrädern, Zahnräder sowie seine Kriegsgeräte.
Nachwirkungen
Die peripatetische Philosophie des Aristoteles spielte zur Zeit der Hochblüte Roms eine untergeordnete Rolle. Die Lehren der Stoiker und Epikureer standen im Vordergrund und etwas später kam der Neuplatonismus auf. Es ist Boethius (480-524), der zur Zeit des Ostgotenkönigs Theoderichs lebte, zu verdanken, dass einige der antiken Texte ins Lateinische übertragen und erhalten blieben. Dafür wurde Aristoteles zur unbestrittenen Autorität im Mittelalter, vor allem, nachdem Thomas von Aquin seine Philosophie mit der christlichen Lehre in Einklang brachte. Im Mittelalter kamen die Universitäten auf. Dort lernte man die sieben freien Künste (septem artes liberales): Grammatik, Rhetorik, Logik, Musik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie. Demgegenüber fristeten die Schriften des Archimedes ein Schattendasein. Von grösserem Einfluss waren dafür seine technischen Leistungen, die im Verlaufe der Jahrhunderte verbessert wurden. Dabei waren es vor allem die Handwerker, die zum technischen Fortschritt beitrugen. Die Achtung der manuellen Arbeit im Mittelalter zeigte sich darin, dass man neben den sieben freien Künsten auch die sieben mechanischen Künste (septem artes mecanicae) hochschätzte: Webkunst, Schmiedekunst, Baukunst, Landwirtschaft, Jägerei, Schauspielkunst, Heilkunst. Einen Höhepunkt erreichte das handwerkliche Können in der Renaissance. Leonardo da Vinci war nicht nur Maler, sondern auch Erfinder und Ingenieur. Ganz in der Tradition von Archimedes entwickelte er verschiedene Kriegsgeräte. Erst der handwerkliche und technische Fortschritt machten die wissenschaftliche Revolution möglich. Durch verbesserte Techniken der Metallbearbeitung gelang es, genauere Instrumente zu bauen und Fortschritte in der Astronomie zu erzielen. Und wäre die Kunst des Linsenschleifens nicht weit fortgeschritten gewesen, so hätte man kein Fernrohr bauen können und Galileo Galilei hätte die Jupitermonde nicht entdeckt. Galilei war es dann, der die Theorien des Archimedes weiterentwickelte und selbstständig Experimente durchführte. Damit wurde er zum Begründer der modernen Physik. Nach ihm ist das Buch der Natur in mathematischer Sprache geschrieben und darauf basiert die theoretische Physik. Er war es auch, der die physikalischen Auffassungen des Aristoteles aus der Physik verbannte. In seinem Bewegungsgesetz braucht es keine Zweckursache und keinen konstanten Beweger. Allerdings ganz verbannt wurde die causa finalis aus der Physik nicht. Physiker sind Menschen, und wenn sie Experimente durchführen, verfolgen sie einen bestimmten Zweck. Meist wollen sie damit die Richtigkeit einer Theorie beweisen. Sie greifen mit ihrem Versuchsaufbau in das ursprüngliche Verhalten der Natur ein. Oder wie später Heisenberg gesagt hat: „Wir müssen uns daran erinnern, dass das, was wir beobachten, nicht die Natur selbst ist, sondern Natur, die unserer Art der Fragestellung ausgesetzt ist.“
Literaturhinweise:
Fierz M., Naturwissenschaft und Geschichte. Basel 1988: Birkhäuser.
Fischer E.P., Aristoteles, Einstein & Co. München 1995: Piper.
Mason S.F., Geschichte der Naturwissenschaft. Bassum 1997: Verlag für Geschichte der Naturwissenschaften und Technik.
Sager O., Technik als Motor des wissenschaftlichen Fortschritts. Norderstedt 2014: Books on Demand.
Sieroka N., Philosophie der Physik. München 2014: C.H. Beck.
Simonyi K., Kulturgeschichte der Physik. Leipzig, Jena, Berlin 1990: Urania.
Die Thomas-Ockham – Debatte
Realismus oder Nominalismus?
Zum Thema
In der Thomas-Ockham – Debatte geht es um ein erkenntnistheoretisches Grundproblem. Man könnte solche Diskussionen als einen Philosophen- oder Theologenstreit abtun; sie haben aber auch einen Bezug zum Verständnis der Physik. Im Mittelalter wurde über diese Frage vor allem zwischen den Dominikanern und den Franziskanern heftig gestritten. Diese beiden Orden wurden zu Beginn des zwölften Jahrhunderts gegründet. In den Streitigkeiten ging es sachlich um den ‚Universalienstreit‘ zwischen Vertretern des Realismus und denen des Nominalismus. Politisch weit bedeutender war jedoch der ‚Armutsstreit‘, der die Sachdiskussion überschattete. Die Franziskaner forderten, dass die Kirche arm sein müsse, weil Jesus arm war. Obwohl die Dominikaner selbst das Gelübde der Armut befolgten, forderten sie dies nicht von der Kirche. In diesen Streit mischten sich die Päpste ein, die damals in Avignon residierten, und es ist unschwer zu erraten, wem sie in dieser Frage recht gaben. Die Lehrmeinung der Kirche basiert bis heute auf dem Realismus. Der Nominalismus konnte aber nicht endgültig beseitigt werden und die Debatte ist bis heute nicht beendet. Hier wollen wir nur einen kleinen Teilaspekt herausgreifen, der mit physikalischen Fragestellungen zu tun hat. Dabei steht Thomas von Aquin und seine Sicht der Dinge stellvertretend für die Dominikaner, William Ockham und seine Sicht für die Franziskaner.
Porträts
Thomas wurde 1225 in der Nähe von Aquin geboren. Anstatt in den Benediktinerorden trat er – entgegen dem Wunsch seiner Eltern – 1244 in den Dominikanerorden ein. Er studierte an der Universität von Paris, wobei Albertus Magnus einen grossen Einfluss auf seinen Schüler hatte. Nach verschiedenen Stationen in Paris und Neapel verfasste er sein Hauptwerk – die Summa theologica – in Rom. Thomas verstarb noch nicht fünfzigjährig am 7. März 1274 auf der Reise zum zweiten Konzil von Lyon, wobei sich um seinen Tod verschiedene Legenden ranken. Thomas wurde 1323 durch Papst Johannes XII heiliggesprochen.
William of Ockham wurde um 1288 in der Grafschaft Surrey in England geboren. Schon früh trat er in den Franziskanerorden ein und studierte an der Universität von Oxford. Später übersiedelte er nach London. Der in Oxford lehrende Kanzler der Universität war ein eifriger Thomist und bekämpfte die Ansichten der Franziskaner. Er reiste an den päpstlichen Hof in Avignon und bezichtigte Ockham der Häresie. Darauf musste sich Ockham 1324 nach Avignon begeben, um sich gegen den ihm drohenden Prozess zu stellen. In Avignon traf er mit dem Ordensgeneral Michael von Cesena zusammen, der von Papst Johannes XII hierher zitiert wurde. Der Papst hatte die Armutshypothese der Franziskaner als Häresie verurteilt. Um dem drohenden Prozess und dem Scheiterhaufen zu entkommen, flüchteten Michael und William aus Avignon und schlossen sich Kaiser Ludwig IV von Bayern an. Der Papst exkommunizierte Ockham, der nun seinerseits den Papst als Häretiker brandmarkte. Ockham starb 1347 in München.
Das philosophische Problem
Ausgangspunkt der Debatte über die Universalien ist die Ideenlehre Platons. Danach sind die irdischen Erscheinungen ein Abbild der Grundidee eines Gegenstandes oder eines Lebewesens. Die Anhänger des Realismus schreiben solchen Gattungsbegriffen eine eigene Existenz zu, wobei zum Beispiel die Gattung ‚Mensch‘ Eigenschaften besitzt wie die, dass alle Menschen sterblich sind. Die Vertreter des Nominalismus sind der Auffassung, dass alle Allgemeinbegriffe wie ‚Pferd‘ oder ‚Rose‘ gedankliche Abstraktionen sind, die von Menschen gebildet werden. Obwohl man solchen abstrakten Begriffen wie ‚Rose‘ oder ‚Pferd‘ Eigenschaften zuordnen kann und sie für vieles nützlich sind, haben sie keine Existenz an sich. Existieren tut nur ein konkretes Pferd oder eine konkrete Rose, die man pflücken kann. Umberto Eco lässt in seinem Roman ‚Der Name der Rose‘ den Franziskanermönch Williamvon Baskerville auftreten, in dem man viele Züge von William Ockham erkennen kann. In einem Schlüsselsatz des Romans erklärt er die Position des Nominalismus in einer Sprache, die wir heute besser verstehen: „Die Ordnung, die unser Geist sich vorstellt, ist wie ein Netz oder eine Leiter, die er sich zusammenbastelt, um irgendwo hinaufzugelangen. Aber wenn er dann hinaufgelangt ist, muss er sie wegwerfen, denn es zeigt sich, dass sie zwar nützlich, aber unsinnig war.“
Physikalische Positionen
Thomas übernahm die Philosophie des Aristoteles praktisch kritiklos und erarbeitete damit eine logische Begründung der Glaubenssätze der katholischen Kirche. Nach Thomas hat der ‚tätige Verstand‘ des Menschen die Fähigkeit, aus Sinneserfahrungen auf eine allgemeingültige Wahrheit zu schliessen. Dies ist die realistische Grundposition. Entsprechend der aristotelischen Überzeugung braucht jede physikalische Bewegung einen stetig auf den Gegenstand einwirkenden Beweger. Darauf aufbauend entwickelte Thomas seinen Gottesbeweis. Da es in der realen Welt offensichtlich Bewegungen gibt, muss es einen ersten Beweger geben, der alles in Bewegung gesetzt hat, und dafür sorgt, dass die Bewegung aufrechterhalten wird. Und dieser erste Beweger ist Gott.
Ockhams Verständnis der Physik stützte sich weitgehend auf die Denkweise von Roger Bacon (1220-1292). Bacon vertraute nicht blind den früheren Autoritäten. Stattdessen war er ein Verfechter der empirischen Methode, die auch Erfahrungen aus Experimenten mitberücksichtigte. Ockham vertrat die Impetustheorie für bewegte Körper. Danach erhält zum Beispiel ein Geschoss durch den Abschuss einen Impetus (innerer Antrieb, Schwung), wodurch es sich vorwärtsbewegt. Auch die bewegten Himmelskörper haben einen Impetus und brauchen keinen auf sie ständig einwirkenden Beweger. Damit geriet der Gottesbeweis von Thomas ins Wanken. Bis heute berühmt ist Ockhams Rasiermesser oder das Sparsamkeitsprinzip. Es besagt, dass bei verschiedenen Erklärungsversuchen für ein Phänomen die Theorie wahrscheinlich die beste ist, die mit den wenigsten Annahmen auskommt. Solche Theorien sind auch einfacher zu überprüfen oder zu falsifizieren, wie später Popper sagen wird.
Nachwirkungen in der Physik
Der Nominalismus konnte sich bis in die Neuzeit nie gegen den Realismus durchsetzen. Der Realismus entspricht besser dem gesunden Menschenverstand und alle Techniker sind Realisten. Trotz der grossen Autorität eines Aristoteles gab es aber noch im Mittelalter Zweifel an seinen Aussagen zur Physik und am geozentrischen Weltmodell. Johannes Buridan (1295-1363) vertrat weiterhin die Impetustheorie und Nikolaus von Oresme (1320-1382) entwickelte schon vor Galilei Gedanken zur Relativbewegung, gemäss denen die Erde nicht stillstehen müsste.
Sowohl die Bewegungslehre des Aristoteles als auch die Impetustheorie hatten endgültig ausgedient, als Isaac Newton 1687 sein Trägheitsgesetz formulierte1. Newton als Realist betrachtete Raum und Zeit als absolute Grössen mit eigenen Eigenschaften, während es für Leibniz nur Abstandsbeziehungen gab. Heute streiten die Philosophen über Einsteins vierdimensionale Raumzeit. Die Anhänger des Substanzialismus nehmen an, dass der Raumzeit eine von der Materie unabhängige Existenz zukommt. Dem widersprechen die Nominalisten oder Relationisten, wie man sie heute bezeichnet. Die Raumzeit kann zwar Beziehungseigenschaften haben, ihr kommt aber keine eigenständige Existenz zu.
Einen neuen Höhepunkt erreichte die Debatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Für Ernst Mach und die Positivisten sind Abstrakte Begriffe Teil einer Denkökonomie. Sie sollten so sparsam, wie möglich, verwendet werden, wobei man sich vor Spekulationen hüten müsse. Gegeben ist nur die Mannigfaltigkeit der Wahrnehmungen, sei es direkt oder über physikalische Messungen. Alles andere ist nach Mach ein theoretisches Konstrukt. Dem widersprach Max Planck auf das Heftigste. Nach ihm beschreiben die in der theoretischen Physik verwendeten Begriffe die real existierende Natur so, wie sie ist. Dazu schreibt Scheibe: Es geht in der Planck-Mach – Debatte um „die Frage nach einer hinsichtlich ihrer Existenz vom menschlichen Bewusstsein unabhängigen, realen Aussenwelt. Dies ist ein für die philosophische Basis der Physik entscheidendes Problem. Für den Realisten bildet diese Basis die Gesamtheit aller materiellen Gegenstände, für den Positivisten besteht sie aus Sinnesdaten, Empfindungen und dergleichen.“ Auch nach diesem Streit setzte sich der Realismus von Planck durch, der bei den Physikern als grosse Autorität galt. Erst ganz in der neusten Physik zeigen sich wieder Züge des Nominalismus. Jürg Fröhlich, ein theoretischer Physiker, hat eine Schrift unter dem Titel „Abschied von Determinismus und Realismus in der Physik des 20. Jahrhunderts“ veröffentlicht, wobei er auf den mathematischen Modellcharakter in der Quantenphysik Bezug nimmt. Auch Anton Zeilingers Aussage ‚Wirklichkeit und Information sind dasselbe‘ weist nominalistische Züge auf. Der Universalienstreit ist also noch nicht endgültig beigelegt.
Anmerkungen:
1 Erstes Newtonsche Gesetz: Ein kräftefreier Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit
Literaturhinweise:
Carrier M., Die Struktur der Raumzeit in der klassischen Physik und der Allgemeinen Relativitätstheorie. Beitrag in
Esfeld M., Philosophie der Physik. Berlin 2012: Suhrkamp.
Eco U., Der Name der Rose. München, Wien 1982: Carl Hanser.
Fröhlich J., Abschied von Determinismus und Realismus in der Physik des 20. Jahrhunderts. Stuttgart 2011: Steiner.
Mason S.F., Geschichte der Naturwissenschaft. Bassum 1997: Verlag für Geschichte der Naturwissenschaften.
Sager O., Physik in nullter Näherung. Norderstedt 2014: Books on Demand.
Scheibe E., Die Philosophie der Physiker. München 2006: C.H. Beck.
Simonyi K., Kulturgeschichte der Physik. Leipzig, Jena, Berlin 1990: Urania.
Zeilinger A., Einsteins Schleier. München 2005: Goldmann
Die Ptolemäus-Kopernikus – Debatte
Geozentrisch oder heliozentrisch?
Zum Thema
Der Übergang vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild wird oft als Beginn der wissenschaftliche Revolution bezeichnet. Sie fand in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts statt. Der wichtigste Wegbereiter war Nikolaus Kopernikus, der das heliozentrische Weltbild dem geozentrischen Weltbild von Claudius Ptolemäus gegenüberstellte. Ptolemäus lebte in der Antike, Kopernikus in der Renaissance. Diese Epoche war geprägt vom Wunsch der Gelehrten und Künstler, an die kulturellen Leistungen der Griechen und Römer anzuknüpfen, um so das finstere Mittelalter hinter sich zu lassen. Man vertraute nicht mehr blind den Autoritäten, wobei dem menschlichen Verstand eine höhere Bedeutung zukam. Nördlich der Alpen fand die Reformation statt, wobei anstelle des Lehramtes der Kirche nun die Bibel ins Zentrum rückte. Deutschland wurde dadurch aufgeteilt in katholische und reformierte Gebiete. Eine direkte Debatte zwischen Ptolemäus und Kopernikus konnte zwar nicht stattfinden, dafür hat Galilei in seinem Dialog über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme eine solche Geschichte erfunden. Sowohl Ptolemäus als auch Kopernikus gingen von der Überzeugung aus, dass sich die Himmelskörper auf vollkommenen Kreisbahnen bewegen müssten, wobei diese Annahme sich auf weltanschauliche oder philosophische Überlegungen stützte. Beide waren hervorragende Mathematiker, wobei die Euklidsche Geometrie die zentrale Rolle spielte.
Porträts
Claudius Ptolemäus – ein griechischer Mathematiker, Astronom und Astrologe – lebte im zweiten Jahrhundert in Ägypten. Er verwarf das von Aristarchos vertretene heliozentrische Weltbild und verfeinerte das von Hipparchos von Nicäa vorgeschlagene geozentrische Weltbild, das dann nach ihm als ptolemäisches Weltbild bezeichnet wurde. Ptolemäus hat in der berühmten Bibliothek von Alexandria gearbeitet. Sein Modell kam über den Almagest der Araber zurück nach Europa, wo es über das ganze Mittelalter zum Standardwerk der Astronomie wurde. Es war zudem mit der Bibel verträglich, wobei auf die Stelle verwiesen wird, in der Josua Gott bat, die Sonne für einen Tag stillstehen zu lassen. Nach Ptolemäus befindet sich die Erde fest im Mittelpunkt des Weltalls. Alle anderen Himmelskörper bewegen sich in kristallenen Sphären auf als vollkommen angesehenen Kreisbahnen um die Erde. Um jedoch die Planetenbahnen richtig zu beschreiben, brauchte es Hilfskonstruktionen (Epizyklen), die mit der Zeit immer komplizierter wurden. Obwohl das Ptolemäische Weltbild in der wissenschaftlichen Revolution definitiv abgelöst wurde, lebt sein Werk bis heute weiter in der Astrologie. In einem seiner Bücher beschrieb er die Auswirkungen der Himmelskörper auf die Menschen und deren Schicksal. Und daran glauben auch heute noch viele Menschen.
Nikolaus Kopernikus wurde am 19. Februar 1473 in Thorn im heutigen Polen geboren. Er studierte zuerst an der Universität Krakau. 1495 wurde er katholischer Kanoniker, dann studierte er an der Universität von Bologna Jura und später Medizin an der Universität in Padua. 1503 promovierte er zum Doktor des Kirchenrechts. Er war dann Domherr, Jurist und Arzt und stand im Dienste des Fürstentums Ernland in Preussen. Im Jahre 1503 erwarteten die Astronomen eine Konjunktion der Hauptplaneten und sie sagten den Tag voraus, wann dies geschehen sollte. Sie irrten sich aber um mindestens 10 Tage und Kopernikus machte sich Gedanken über die Unzuverlässigkeit der Astronomie. Bereits Nikolaus von Kues (1401-1464), genannt Cusanus, befasste sich mit dem heliozentrischen System. Er vertraute auf den menschlichen Verstand und die Vernunft, damit man die Natur immer besser verstehen könne. Die absolute Wahrheit könne man zwar nie erreichen, die kenne nur Gott. Kopernikus wird die Schriften von Cusanus gekannt und in seine Überlegungen einbezogen haben. Ihn störte am ptolemäischen Weltbild, dass dieses viele ausgleichende Kreise benötigte, um die Planetenbahnen zu berechnen. Er suchte nach einer einfacheren Art der Harmonie. E.P. Fischer zitiert ihn wie folgt: „Als ich dies nun erkannt hatte, dachte ich oft darüber nach, ob sich vielleicht eine vernünftigere Art von Kreisen finden liesse, von denen alle sichtbare Ungleichheit abhinge, wobei sich alle in sich gleichförmig bewegen würde, wie es die vollkommene Bewegung an sich verlangt.“ 1509 entwarf Kopernikus sein heliozentrisches Weltbild, bei dem die Sonne im Mittelpunkt stand. Kurz vor seinem Tode am 24. Mai 1543 in Frauenburg veröffentlichte er sein Hauptwerk ‚De revolutionibus orbium coelesticum‘1. Die Theorie von Kopernikus ging von folgenden Annahmen aus: Die scheinbar tägliche Bewegung der Sterne rührt davon her, dass sich die Erde um ihre eigene Achse dreht. In der Mitte des Universums steht die Sonne. Die Planeten und die Erde umkreisen ein Zentrum in der Nähe der Sonne auf idealen Kreisbahnen. Die scheinbar rückläufige Bewegung der Planeten ist eine Folge der Beobachterposition auf der sich bewegenden Erde. Die erste und oberste von allen Sphären ist die der Fixsterne, die sich selbst und alles andere enthält. Allerdings wurde das Werk des Kopernikus nur wenig beachtet. Bekämpft wurde es vor allem von der protestantischen Seite. Martin Luther soll Kopernikus als Narr betitelt haben. Melanchton behauptete, die Lehre des Kopernikus sei lediglich eine Erneuerung oder Wiederholung der heliozentrischen Theorie, die Aristarchos in der Antike aufgestellt habe. Und der Reformator Andreas Osiander fügte nach dem Tod von Kopernikus ein Vorwort zur gedruckten Ausgabe hinzu, in der er das neue Weltbild als blosses Rechenmittel darstellte, welches mit der Wirklichkeit nichts zu tun habe. Nachdem schon die verhassten Reformatoren die Lehre des Kopernikus als Hirngespinst diffamiert hatten, gab es für die katholisch Kirche keinen Grund zur Aufregung, und das System des Kopernikus galt nicht als Häresie oder Ketzerei. Die Astronomen der Kirche hatten andere Sorgen. Sie hatten wie schon Kopernikus bemerkt, dass der Frühlingsanfang des julianischen Kalenders sich um 10 Tage vom astronomischen Frühlingspunkt, der durch den Schnittpunkt des Himmelsäquators mit der Ekliptik gegeben ist, entfernt hatte. Das vom Frühlingsanfang und dem darauffolgenden Frühlingsvollmond abhängige Datum des Osterfests, wie es vom Konzil von Nicäa festgelegt wurde, hatte sich damit verschoben. Das war nun ein ernsthaftes Problem für die Kirche. Es brauchte zusätzliche Schalttage, damit der Frühlingsanfang immer auf den 21. März fallen wird. Dies war der Inhalt der Kalenderreform, die Papst Gregor XII mit seiner Bulle verordnete.2 Im Oktober 1582 folgte auf den 4. Oktober der 15. Oktober, wodurch die 10 Tage korrigiert wurden. Die reformierten Länder verzögerten die Annahme des gregorianischen Kalenders aus ideologischen Gründen, weil sie nichts vom Papst annehmen wollten.
Die Wegbereiter
War das heliozentrische Modell des Kopernikus nur ein mathematisches Hilfsmodell zur Errechnung der Gestirnspositionen oder kam ihm Realität zu? – Drehte sich die Erde um die Sonne und um ihre eigene Achse? – Es vergingen 67 Jahre, bis Galilei die Venusphasen und die Jupitermonde entdeckte und so das heliozentrischem Weltbild als ernsthafte Konkurrenz zum System des Ptolemäus zur Debatte stellte. In der Zwischenzeit hatten sich Handwerk und Technik soweit entwickelt, dass man Messskalen mit sehr feinen Strichen herstellen konnte, wodurch die Position der Gestirne genauer bestimmt werden konnte. Wie weit fortgeschritten diese Kunst war, kann man beim Betrachten der Kupferstiche von Albrecht Dürrer (1471-1528) erkennen. Beispiele solcher Stiche sind die ‚Meerjungfrau‘ und die ‚Melancholie‘. Dürrer hatte sich auch mit der Geometrie und Befestigungskunst auseinandergesetzt. Dabei ist er in der darstellenden Geometrie bis an die Grenzen der damals bekannten Mathematik vorgestossen. Als Universalgenie überragte Leonardo da Vinci (1452-1519) nicht nur seine Zeitgenossen. Als Maler war er ein Meister der Perspektive, und es gelangen ihm Darstellungen mit sehr hohem Auflösungsvermögen. Als Erfinder entwarf er Maschinen für alle möglichen Zwecke, und als Ingenieur befasste er sich mit der Kraft- und Hebelwirkung. Er machte sich auch Gedanken über die Art und Weise, wie er an die Probleme heranging: „Zuerst stelle ich bei der Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme einige Experimente an, weil meine Absicht ist, die Aufgaben nach der Erfahrung zu stellen und dann zu beweisen, weshalb die Körper gezwungen sind, in der gezeigten Manier zu agieren. Das ist die Methode, die man beachten muss bei allen Untersuchungen über die Phänomene der Natur.“ (E.P. Fischer). Damit war der Weg frei für die grossen Umwälzungen, welche wir gerne als die wissenschaftliche Revolution bezeichnen. Es waren dann die mit wissenschaftlichen Methoden durchgeführten Arbeiten von Tycho Brahe, Galileo Galilei und Johannes Kepler, die dem heliozentrischen Weltbild endgültig zum Durchbruch verhalfen.
Anmerkungen:
1 Von den Umschwüngen der himmlischen Kugelschalen
2 Nach dem julianischen Kalender dauerte das Jahr 365,25 Tage, nach dem gregorianischen Kalender neu 365,2425 Tage.
Literaturhinweise:
Fischer E.P., Aristoteles, Einstein & Co. München 1995: Piper.
Fischer E.P., Leonardo, Heisenberg & Co. München 2000: Piper.
Nussbaumer H., Das Weltbild der Astronomie. Zürich 2007: VDF.
Sager O., Technik als Motor des wissenschaftlichen Fortschritts. Norderstedt 2014: Books on Demand.
Simonyi K., Kulturgeschichte der Physik. Leipzig, Jena, Berlin: Urania 1990
Teil 2: Debatten auf dem Weg zur klassischen Physik
Einleitung
Zu Beginn des siebzehnten Jahrhunderts löste sich die Physik von der Philosophie und wurde eine selbstständige Wissenschaft. Anstelle auf Autoritäten zu vertrauen, führte man nun Beobachtungen, Messungen und Experimente durch, womit man einen Einblick ins Naturgeschehen erhielt. Dies ist der Kern der wissenschaftlichen Revolution und seit dieser Zeit ist Physik eine experimentelle Wissenschaft. Die beobachteten Vorgänge versuchte man zu erklären, wobei man dazu die Sprache der Mathematik benutzte. So entstand die theoretische Physik. Mit der Mathematisierung verlor die Physik einen Teil der Anschaulichkeit. Dies ist wohl der Hauptgrund, dass viele Schüler bis heute sich schwertun im Physikunterricht. Mit der Entwicklung der Infinitesimalrechnung durch Newton und Leibniz erreichte die klassische Physik einen Höhepunkt. Man könnte somit die klassische Physik als ‚Physik der Differenzialgleichungen‘ bezeichnen. Die Theorie der Mechanik erhielt durch die Newtonschen Gesetze axiomatischen Charakter, ebenso die Elektrodynamik durch die Maxwell-Gleichungen. Axiomatische Systeme wirken als Paradigmen und diese haben zum durchschlagenden Erfolg der Physik und der darauf beruhenden Technik beigetragen. Etwas schwieriger war es beim dritten Pfeiler der klassischen Physik, der Thermodynamik. Dort sind die beiden Hauptsätze – der Energiesatz und der Entropiesatz – zentral. Beide sagen aus, dass es in der Welt kein ‚Perpetuum mobile‘ geben kann. Die Interpretation der thermodynamischen Gesetze führte dann zu heftigen Diskussionen. Die Frage war, ob die Energie ein Urprinzip sei oder ob alles auf die Bewegungen