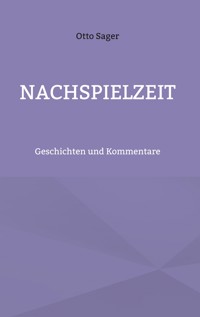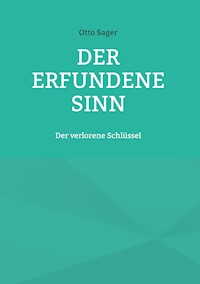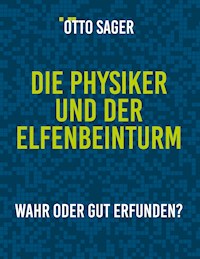
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wahr oder gut erfunden? Gibt es den Elfenbeinturm oder will man damit die Forscher als Sonderlingen abstempeln? Sind die Aussagen der theoretischen Physik wahr oder fehlt der experimentelle Beweis? Können Physiker einen Beitrag leisten zu religiösen oder philosophischen Fragestellungen? Und wie verhalten sie sich bei den grossen Herausforderungen der heutigen Zeit: Gentechnik, Digitalisierung, Klimawandel? Damit einher geht die Frage nach der Verantwortung der Wissenschaftler.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch
‘Wahr oder gut erfunden?’ ist der Untertitel zu diesem Buch. Gibt es den Elfenbeinturm oder will man damit die Forscher als Sonderlingen abstempeln? – Sind die Aussagen der theoretischen Physik wahr oder fehlt der experimentelle Beweis? – Können Physiker einen Beitrag leisten zu religiösen oder philosophischen Fragestellungen? – Und wie verhalten sie sich bei den grossen Herausforderungen der heutigen Zeit: Gentechnik – Digitalisierung – Klimawandel? – Und wie versuchen Politiker Forscher für ihre Zweck einzuspannen? – Dies sind die Themen, die in diesem Buch behandelt werden. Dabei stehen folgende Fragestellungen im Vordergrund: Kann das hoch entwickelte Gehirn des Menschen die Natur in ihren Grundfesten erkennen oder nicht? – Gibt es eine wertfreie Physik, die nur das Ziel kennt, Wissen zu vermehren? – Damit einher geht die Frage nach der Verantwortung der Wissenschaftler. – Wenn ein Forscher einzig für seine Aufgabe lebt und sich um die gesellschaftlichen Folgen seiner Tätigkeit nicht kümmert, dann arbeitet er im Elfenbeinturm. Der praktische Wissenschaftler – oder der Ingenieur – trägt die Verantwortung für sein Tun und die Folgen seiner Entwicklungen. Wertneutrales Wissen gibt es hier nicht. Am Schluss geben die Dichter Bert Brecht, Michael Frayn, Heinar Klipphardt und Friedrich Dürrenmatt in Theaterstücken ihre Sicht der Physiker und deren Aufgaben in der Gesellschaft wieder. Die Komödie ‚Die Physiker‘ bildet den Abschluss dieses Buches, wobei sich alle ihre Gedanken machen können, ob die heutige Welt eine Irrenanstalt sei.
Inhalt
Vorwort
Die Physiker im Elfenbeinturm
Hawking und Laughlin
Die Physiker und das anthropische Prinzip
Nussbaumer und Gassner
Die Physiker und die Krise im Elfenbeinturm
Weinberg und Hossenfelder
Die Physiker und die Religion
Einstein und Lemaître
Die Physiker und die Philosophie
von Weizsäcker und Feynman
Die Physiker und die Psychologie
Pauli und Jung
Die Physiker und die Kommunikation
Dirac und Scherrer
Die Physiker und die Biophysik
Schrödinger und Watson
Die Physiker und die Digitalisierung
Leonardo und Zuckerberg
Die Physiker und der Klimawandel
Capra und Gates
Die Physiker und die Politik
Archimedes und Heisenberg
Die Rolle der Physiker im Theater
Brechts ‘Galilei’
Frayns ‘Heisenberg’
Kipphardts ‘Oppenheimer’
Dürrenmatts ‘Möbius’
Glossar
Für meine Frau
Ingeborg
und unsere FamilieThomas, Silvia, Stephan, Rita Christoph, Nicole, Ron, Nick
se non è vero, è ben trovato
(Giordano Bruno 1548-1600)
Vorwort
‘Wahr oder gut erfunden?’ ist der Untertitel zu diesem Buch. Gibt es den Elfenbeinturm oder will man damit die Forscher als Sonderlingen abstempeln? – Sind die Aussagen der theoretischen Physik wahr oder fehlt der experimentelle Beweis? – Können Physiker einen Beitrag leisten zu religiösen oder philosophischen Fragestellungen? – Und wie verhalten sie sich bei den grossen Herausforderungen der heutigen Zeit: Gentechnik – Digitalisierung – Klimawandel? – Und wie versuchen Politiker Forscher für ihre Zweck einzuspannen? – Dies sind die Themen, die in diesem Buch behandelt werden. Beim Schreiben haben mich immer wieder folgende Fragestellungen beschäftigt:
Kann das hoch entwickelte Gehirn des Menschen die Natur in ihren Grundfesten erkennen oder nicht?
–
Sind die Begriffe und Erfahrungen, die wir aus unserer Umwelt benutzen, universell gültig?
– Dies ist die Position des wissenschaftlichen Realismus. Ohne den Glauben an eine real existierende Aussenwelt, die man mit wissenschaftlichen Methoden erforschen kann, ist eine sachlich begründete Physik kaum denkbar. Diese Vorstellungen von der Aussenwelt sind aber nicht objektiv überprüfbar, sie sind höchstens ein brauchbares Modell oder ein nützliches Konstrukt unseres Geistes. Für Physiker, die diese Auffassung vertreten, enthält der wissenschaftliche Realismus anthropologische Elemente, die keinen Platz in der Physik haben sollten. Auch die Astronomen wollen keine anthropologischen Elemente zulassen, glauben aber an eine real existierende Aussenwelt, die man mit immer besseren Beobachtungsinstrumenten erforschen kann.
Gibt es eine wertfreie Physik, die nur das Ziel kennt, Wissen zu vermehren? –
Damit einher geht die Frage nach der Verantwortung der Wissenschaftler. Ein Forscher, der einzig für seine Aufgabe lebt und sich um die gesellschaftlichen Folgen seiner Tätigkeit nicht kümmert, arbeitet im Elfenbeinturm, um diese Metapher zu gebrauchen. Für Bert Brecht muss der Physiker sich um die gesellschaftlichen Belange kümmern. Er legt deshalb Galileo Galilei folgende Aussage in den Mund: «
Ich halte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu erleichtern. Wenn Wissenschaftler sich damit begnügen, Wissen um des Wissens willen anzuhäufen, kann die Wissenschaft zum Krüppel gemacht werden.»
Um aber Wissen produktiv einsetzen zu können, braucht es zusätzlich Ingenieure oder Ingenieur-Physiker, welche das neueste Wissen dazu benutzen, um neue Lösungen zu finden. Der praktische Wissenschaftler – oder der Ingenieur – trägt die Verantwortung für sein Tun und die Folgen seiner Entwicklungen. Wertneutrales Wissen darf es hier nicht geben. Die Ingenieur-Physiker führen kein Leben im Elfenbeinturm. Beispiele ihrer grossen Leistungen sind der Bau des Large Hadron Collider am CERN, die modernen Analysegeräte der Medizin (MRI, CT, Szintigramme) oder ihre Beiträge zur Erforschung des Klimawandels.
Bei der hier vorliegenden Betrachtung ist der ‘elfenbeinerne Turm’ auf eine wertfreie Naturwissenschaft, wie man sie vor allem in der ‘reinen’ Physik findet, eingeschränkt. Res Jost (1918-1990) hat in seinem vielbeachteten Aufsatz ‘Das Märchen vom elfenbeinernen Turm’1 einen anderen Kreis gezogen. Nach ihm steht jede naturwissenschaftliche Tätigkeit im Verdacht, dass sie in einem Elfenbeinturm stattfindet. Für ihn ist die Aussage, der Forscher lebe in seinem Elfenbeinturm, eine Beschimpfung. Dabei bemerkt er, dass er nirgends dieses Märchen finden konnte. Auch das Leben eines Forschers wird nicht nur von edlen Motiven geleitet und muss nicht so idyllisch verlaufen, wie das gerne von Leuten angenommen wird, die durch harte Arbeit Geld verdienen. Für diese Leute sind Forscher Schmarotzer. Jost erzählt dann die turbulente Geschichte bei der Erforschung der räumlichen Struktur der DNA durch James D. Watson und Francis Crick. «Aber von der stolzen Abgeschiedenheit im blöden Elfenbeinturm ist hier nichts zu merken.»2 – Im vorliegenden Buch ist der Elfenbeinturm keine Beschimpfung. Ein Grossteil der heutigen Physiker im Elfenbeinturm ist mit dem Suchen nach einer grossen vereinheitlichten Theorie beschäftigt, die dem Standardmodell der Elementarteilchen zugrunde gelegt werden könnte. Und nach einiger Zeit, so hofft man, werde man auch eine Theorie der Quantengravitation entwickeln können, sodass einer Weltformel nichts mehr im Wege stehe. Dabei wird Wissen um des Wissens willen angehäuft. Solche Erkenntnisse können als ‘schön’ empfunden werden, vor allem wenn sie symmetrische Strukturen aufzeigen. Hier zeigt sich die Verwandtschaft zu Kunstwerken, die oft auch symmetrischen Gesetzen gehorchen.
Später im Buch von Jost erfolgt eine wichtige Aussage: «Der Naturforscher untersucht nicht das Einmalige, was er wegwerfend als zufällig bezeichnet …. sondern das Wiederholbare, Regelmässige, das Gesetzmässige, was ein Avantgardist als das Langweilige bezeichnen könnte.» Auch Ingenieur-Physiker verlassen sich nicht auf das Zufällige. Viele bauen Geräte, die dann industriell in grösseren Serien fehlerfrei hergestellt werden können. Dabei müssen Störeffekte eliminiert werden. Jost fährt dann weiter und bemerkt, dass Geschäftsleute das Einmalige und Zufällige brauchen. Und dies findet man auch in der realen Umgebung. Wenn Wissenschaftler die Natur beobachten, dann sehen sie auch das Einmalige und Zufällige. Dir Natur ist ein komplexes System mit Nichtlinearitäten und Rückkopplungen. Das Verhalten solche Systeme ist nicht prognostizierbar. Leider wird dies bei den Diskussionen um den Klimawandel zu wenig beachtet. Physiker im Elfenbeinturm, die sich auf das streng Gesetzmässige konzentrieren, können zu diesen komplexen Fragen nur wenig beitragen.
Alle Beiträge beginnen mit ‘Die Physiker und … ‘ Damit meine ich alle Physiker, Frauen und Männer! ‘Die Physiker’ ist also wie ‘Die Eltern’ oder ‘Die Grosseltern’ nicht geschlechtsspezifisch gemeint. Leider sind die Physikerinnen im Folgenden untervertreten. Dabei könnten Physikerinnen wie Sabine Hossenfelder oder Lavinia Heisenberg neue Wege aufzeigen, die aus der Krise der modernen Physik führen könnten. Die von mir angesprochenen Sachverhalte versuchte ich auf nur wenigen Seiten feuilletonhaft-elegant darzustellen. Die einzelnen Beiträge sind in sich abgeschlossen, so dass die Leserinnen und Leser diejenigen herauspicken können, die sie speziell interessieren. Diese Form habe ich in meinem Buch ‘Debatten zur Kulturgeschichte der Physik’3 verwendet. Einige der Beiträge aus diesem Buch habe ich weiterverwendet und überarbeitet. Zusätzlich habe ich neue und aktuelle Themen aufgenommen, so dass ich viele gesellschaftlich relevante Aspekte im vorliegenden Buch zur Diskussion stellen kann.
Nach den Sachbeiträgen zur heutigen Physik, den religiösen und philosophischen Ansichten der Physiker und den Herausforderungen der modernen Gesellschaft lasse ich Theaterautoren ihre Sicht der Physiker und deren Aufgaben in der Gesellschaft darlegen. Das erste Stück ist Brechts ‘Leben des Galilei’, welches eine breite Resonanz gefunden hat. Physiker sind Menschen, und sie sind in Extremsituationen besonders exponiert. Dies zeigt die Begegnung von Niels Bohr mit Werner Heisenberg zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Diese Episode wäre wohl in Vergessenheit geraten, hätte nicht Michael Frayn das Theaterstück ‚Kopenhagen‘ geschrieben. Im Theaterstück ‘In Sachen J.R. Oppenheimer’ zeigt Klipphardt, wie Politiker und Militärs die Arbeit der Physiker bewerten. Mit Friedrich Dürrenmatts Komödie ‚Die Physiker‘ findet dieses Buch den Abschluss, wobei sich alle ihre Gedanken machen können, ob die heutige Welt eine Irrenanstalt sei.
Zollikon, im April 2021 Otto Sager
Vom Standardmodell der Elementarteilchen zu Physik und Chemie
1 Jost R., Das Märchen vom elfenbeinernen Turm. Berlin 1995: Springer (Lecture Notes in Physics). Vgl. dazu den Beitrag ‘Die Physiker und die Biophysik’ in diesem Buch.
2 Watson J.D., Die Doppelhelix. Hamburg 1969: Rowohlt.
3 Sager O., Debatten zur Kulturgeschichte der Physik. Norderstedt 2018: Books on Demand.
Die Physiker im Elfenbeinturm
Hawking und Laughlin
Zum Thema
Seit die Physik als eigenständige Wissenschaft betrieben wird, ist die reduktionistische Sicht- und Arbeitsweise die Richtschnur der Physiker. Schon Galilei musste versuchen, Störeffekte auszuschliessen, damit er sein Fallgesetz formulieren konnte. René Descartes (1596-1650) hatte die Überzeugung, dass alles im Universum nach streng mathematischen Gesetzen ablaufe. Auch die Idee, dass man ein kompliziertes System dadurch einer mathematischen Beschreibung zugänglich machen könne, indem man es in Teilsysteme zerlegt und diese analysiert, geht auf Descartes zurück. Heutzutage versucht man mit Hilfe der grossen Beschleuniger immer tiefer in die Materie vorzudringen und man möchte wissen, ‚was die Welt im Innersten zusammenhält (Goethe).‘ Die mathematischen Physiker suchen nach einer vereinheitlichen Theorie und nach der Weltformel. Der ‚Mainstream‘ der heute tätigen Physiker hängt dieser Weltsicht an und in populärwissenschaftlichen Büchern wird diese Sicht dem Publikum ‚als der Weisheit letzter Schluss‘ dargestellt. Stephen Hawking hat zusammen mit Leonard Mlodinow diese Weltsicht in seinem Buch ‚Der grosse Entwurf – Eine neue Erklärung des Universums‘ ausführlich beschrieben.
Nun aber zeigt sich, dass oft das Ganze mehr ist als die Summe der Teile. Solche emergente Systeme weisen eigene, neue Ordnungssysteme auf, die auch mit einer noch zu findenden Weltformel nicht erklärt werden können. Dies gilt nicht nur für physikalische, sondern auch für soziale Systeme. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts kam vor allem aus den Sozialwissenschaften erste Kritik an der reduktionistischen Denkweise auf. Man sprach vom überholten linearen Denken, dem das vernetzte Denken entgegengesetzt wurde. Dabei sollte die Newton – Kultur durch die New Age – Kultur abgelöst werden. Der grosse Prophet des New Age war der Physiker Fritjof Capra (*1939) mit seinem Bestseller ‚Wendezeit‘ und der Aussage: «Weiterleben kann die Menschheit nur, wenn sie von Grund auf anders denken lernt: komplex statt linear – in Netzen und Bögen statt in Zielgeraden, in Werten statt in Quantitäten. Denn die Welt ist mehr als die Summe der Teile.» In der Zwischenzeit ist es wieder ziemlich still um das New Age geworden. Nun aber hat der Nobelpreisträger Robert Laughlin die Physiker mit Nachdruck darauf aufmerksam gemacht, dass eine Vielzahl der beobachteten Phänomene und Messresultate auf emergenten Eigenschaften der Materie beruhen. Diese Sicht hat er in seinem Buch: ‚Abschied von der Weltformel – Die Neuerfindung der Physik‘ einem breiteren Publikum vorgestellt.
Porträts
Stephen Hawking wurde am 8. Januar 1942 in Oxford geboren. Er erwarb 1962 seinen Bachelor an der Universität Oxford. Er promovierte 1966 mit einer theoretischen Arbeit über Astronomie und Kosmologie in Cambridge. Von 1979 bis 2009 war er der Inhaber des Lucasischen Lehrstuhls für Mathematik an der Universität Cambridge (GB), den einst Newton und später Dirac innehatten. 1963 wurde bei ihm eine schwere Nervenkrankheit (Amyotrope Latheralsklerose – ALS) diagnostiziert, die ihn an den Rollstuhl fesselte. Seine geistigen Fähigkeiten wurden aber durch die Krankheit nicht betroffen; er verlor aber mit der Zeit seine Fähigkeit zu sprechen. Dass er trotz dieser Behinderungen weiter wissenschaftlich tätig blieb und auch populärwissenschaftliche Bücher verfasste, machte ihn zu einer Kultfigur ähnlich wie Albert Einstein. In seinen wissenschaftlichen Arbeiten zeigte er, dass in der Allgemeinen Relativitätstheorie notwendigerweise Singularitäten existieren müssen. Solche Singularitäten stellen insbesondere die ‚Schwarzen Löcher‘ dar. Er gab eine Formel für die Entropie eines schwarzen Lochs an und 1974 entwickelte er das Konzept der ‚Hawking-Strahlung‘. Danach können schwarze Löcher zerstrahlen1. All dies kann wegen der Kleinheit der Effekte nicht beobachtet werden, bleibt also Theorie. Eine grundsätzliche Frage stellt das Informations-Paradoxon dar. Geht die Information beim Kollaps eines Sterns verloren oder nicht. Hawking hat verschiedene Antworten gegeben, die er später wieder verworfen hat. Die schwarzen Löcher hüten noch immer ihre Geheimnisse. Stephen Hawking starb am 14. März 2018.
Robert B. Laughlin wurde 1950 in Visalia in Kalifornien geboren. Er studierte an der University of California in Berkley und am MIT in Cambridge, Mas. Von 1979 bis 2004 arbeitete er in den Bell Laboratories und am Lawrence Livermore National Laboratory. R.B. Laughlin ist Professor für Physik an der Stanford University. Für die theoretische Erklärung des gebrochenen Quantenhalleffekts2 erhielt er 1998 den Nobelpreis für Physik. Seine Erkenntnis gilt als Durchbruch beim Verstehen makroskopischer Quantenphänomene.
Das unterschiedliche Verständnis der Physik
Hawkings Verständnis der Physik basiert aus einer Kombination von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie und der Quantenphysik. Dabei stützte er sich auf die Pfadintegralmethode, die Richard Feynman für die Quantenfeldtheorie entwickelt hatte. Hawking versuchte vergebens eine Theorie der Quantengravitation zu entwickeln. Er war aber weiterhin von der Existenz von Singularitäten überzeugt. Danach stellt der Urknall eine solche Singularität in der Relativitätstheorie dar; in der Nähe des Urknalls ist aber die Quantenphysik mit dem Standardmodell der Elementarteilchen dominant. Hawkings Denken ist deterministisch, wobei die Naturgesetze alles bestimmen. Ziel der wissenschaftlichen Forschung in der reduktionistischen Sichtweise der Physik muss es sein, die vereinigte Theorie der Fundamentalkräfte zu finden. Aus dieser mathematischen Weltformel kann dann die gesamte Entwicklung des Universums vom Urknall bis heute und in der weiteren Zukunft abgeleitet werden.
Verfechter des kosmologischen Weltbilds – und mit ihnen Stephen Hawking – sind weiter unermüdlich in der Suche nach einer umfassenden Theorie. Da spricht man von der Supergravitation, bei der eine elfdimensionale Welt (Brane) stipuliert wird, welche die Allgemeine Relativitätstheorie als Spezialfall enthalten soll. Auf der anderen Seite wurden die String- und die Superstringtheorie entwickelt. Die Kombination der beiden spekulativen Theorien führt zur M-Theorie und zum Multiversum: «Quantenfluktuationen führen zur Schaffung winziger Universen aus dem Nichts. Einige erreichen eine kritische Grösse, expandieren dann inflationär; in ihnen entstehen Galaxien, Sterne und, mindestens in einem Fall, Wesen wie wir.»
Laughlin ist davon überzeugt, dass die Physik vom Zeitalter des Reduktionismus ins Zeitalter der Emergenz treten muss. Dabei gelten die Gesetze auf mikroskopischem Massstab weiter. Aber neben dieser tiefsten Stufe gibt es Ordnungsprinzipien auf höherer Stufe, die sich nicht aus der Mikrophysik (Quantenphysik) ableiten lassen. «Die Aussage, das Ganze sei mehr als die Summe der Teile, bezeichnet also – das jedenfalls hat uns die wissenschaftliche Physik mitzuteilen – nicht nur eine blosse Vorstellung, sondern ein physikalisches Phänomen.» Und weiter: «Ich bin zunehmend davon überzeugt, dass alle und nicht nur einige der uns bekannten physikalischen Gesetze aus kollektivem Geschehen hervorgehen. Anders gesagt, die Unterscheidung zwischen grundlegenden Gesetzen und den aus ihnen hervorgehenden Gesetzen ist ebenso ein Mythos wie die Vorstellung, das Universum allein durch die Mathematik beherrschen zu können.» In der Weltsicht von Laughlin ist es deshalb sinnlos, nach einer Weltformel zu suchen. Zudem will er die Physik auf ihre eigentliche Aufgabe zurückführen. Eine korrekte physikalische Theorie muss deshalb in der Lage sein, bestimmte Experimente verlässlich vorherzusagen. Nur dann kann durch das Experiment bewiesen werden, dass die Theorie korrekt ist. Alles andere, wie zum Beispiel das Standardmodell der Kosmologie, ist Spekulation und die Urknalltheorie sei ‚nichts als Marketing‘. Derartige Theorien bezeichnet Laughlin als ‚quasireligiös‘, wobei er dabei das Suchen nach einer Weltformel meint. – Laughlins Neuerfindung der Physik führt noch nicht zu einem abgerundeten Weltbild. Er fordert einen Paradigmawechsel, und bis ein solcher erfolgt, braucht es meistens Jahrzehnte. Zudem lehnt er alles, was nicht den strengen Kriterien seiner physikalischen Überzeugung entspricht, kategorisch ab. Für ihn sind Computermodelle, wie man sie zum Beispiel bei der Simulation komplexer Phänomene und in der Chaostheorie braucht, nicht wissenschaftlich.3
Sowohl der physikalische Ansatz von Hawking als auch der von Laughlin wurden im Elfenbeinturm entwickelt. Dies bedeutet, dass Wissen um des Wissens willen erarbeitet wurde, welches einem grösseren, staunenden Publikum vorgestellt wurde. Diese Physik ist wertfrei. Je tiefer die modernen Physiker in das innerste der Welt vordringen, desto mehr entfernen sie sich vom Alltagsleben. Und für die Ingenieure wird es immer schwieriger, dieses Wissen zu nutzen und daraus neue, nützliche Produkte zu entwickeln.
Anmerkungen:
1 Im Vakuum werden gemäss dieser Theorie ständig Teilchen-Antiteilchen-Paare erzeugt. Die Hawking-Strahlung entsteht, wenn eines dieser Teilchen durch das Schwarze Loch verschluckt wird, das andere aber entkommt.
2 Dabei treten unerwartet gebrochenzahlige Quantenzustände auf.
3 Darin unterscheidet er sich von Philip Warren Anderson (1923-2020), der 1977 den Nobelpreis für seine Arbeiten über die Elektronenstruktur in magnetischen und ungeordneten Systemen. Anderson ist bekannt für seine Ansichten zur Emergenz und zur Biophysik. Dabei spielt Komplexität eine wichtige Rolle. In der nichtlinearen Physik kommen wir in ein Gebiet, in welchem ‚nur‘ aus der Erfahrung Regeln abgeleitet werden können, wobei das künftige Verhalten des Systems nicht prognostizierbar ist. Obwohl die auf diesem Gebiet arbeitenden Physiker mathematische und physikalische Methoden anwenden, gehört das Gebiet der Chaostheorie und der komplexen Systeme gemäss Laughlin nicht mehr zur reinen Physik.
Literaturhinweise:
Capra F., Wendezeit. Bern, München, Wien 1986: Scherz.
Eckhardt B., Chaos. Frankfurt am Main 2004: Fischer Kompakt.
Fischer E.P., Aristoteles, Einstein & Co. München 1995: Piper.
Fritzsch H., Das absolut Unveränderliche. München 2005: Piper.
Hawking St., Mlodinow L., Der grosse Entwurf. Reinbeck bei Hamburg 2010:
Rowohlt.
Laughlin R., Abschied von der Weltformel. München 2007: Piper.
Richter K., Rost J.M., Komplexe Systeme. Frankfurt am Main 2002: Fischer Kompakt.
Rössler W., Eine kleine Nachtphysik. Reinbeck bei Hamburg 2009: Rowohlt.
Sager O., Physik in nullter Näherung. Norderstedt 2014: BoD.
Von Weizsäcker C.F., Zum Weltbild der Physik. Stuttgart, Leipzig 2002: Hirzel.
Die Physiker und das anthropische Prinzip
Nussbaumer und Gassner
Zum Thema
Schon immer haben die Menschen den Sternenhimmel beobachtet und angenommen, er müsste ihnen etwas zu ihrem Schicksal aussagen. Das Weltbild der Astrologen ging von einem unveränderlichen Sternenhimmel aus, vor dem die Wandelsterne (oder Planeten) in die verschiedenen Sternbilder wandern.1 Aber das Universum ist weder unveränderlich, noch unendlich alt und die Sterne können kein unendliches Alter erreichen. Der Astrologie fehlt die naturwissenschaftliche Basis. Aber auch in der Astronomie – der Wissenschaft von den Gestirnen – gibt es viele ernsthafte Vertreter, die dem Menschen, welcher den Sternenhimmel beobachtet, eine zentrale Bedeutung zuweisen. Diesem anthropischen Denkansatz fehlt auch die naturwissenschaftliche Basis.
Zwei kurze Porträts
Harry Nussbaumer wurde am 16. November 1935 in Glattfelden bei Zürich geboren. Er studierte Physik an der ETH Zürich und doktorierte in Astronomie. Nach verschiedenen Stationen im Ausland wurde er 1972 Professor für Astronomie an der ETH Zürich. Er ist Mitglied verschiedener internationaler astronomischer Gremien und war Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Astrophysik und Astronomie. Nach seiner Emeritierung verfasste er das vielbeachtete Buch ‘Das Weltbild der Astronomie’.
Josef M. Gassner wurde am 19. Mai 1966 in Landshut geboren. Er studierte Mathematik in Regensburg und Physik in München. Er promovierte 2008 mit einer theoretischen Arbeit zur Astrophysik. Er ist als freier Mitarbeiter an der Universitätssternwarte in München tätig und ist Lehrbeauftragter für Astronomie und Kosmologie in Landshut. In seinen Publikationen und durch populärwissenschaftliche Vorträge versucht er einem breiten Publikum die komplizierten Zusammenhänge der Kosmologie zu vermitteln. Ein grosser Erfolg war sein gemeinsam mit Harald Lesch verfasstes Buch ‘Urknall, Weltall und das Leben.’
Das Standardmodell der Kosmologie
Nachdem Hubble durch Beobachtungen nachweisen konnte, dass sich das Universum expandiert, hat die Vorstellung eines statischen Fixsternhimmels keinen Platz mehr in der Wissenschaft. Durch Zurückrechnen der Expansion gemäss dem nach Hubble benannten Gesetz2 kann man das Alter des Universum abschätzen; man nimmt an, dass der Urknall vor etwa 13,7 Milliarden Jahre stattfand. Die ältesten verfügbaren Informationen findet man im Mikrowellenbereich in der Hintergrundstrahlung. Sie stammt aus der Zeit von ca. 300‘000 Jahren nach dem Urknall. Was im Intervall zwischen dem Urknall und der Bildung der Hintergrundstrahlung wirklich passiert ist, bleibt Spekulation. Das bekannteste Szenario für diese Zeit ist das Standardmodell der Kosmologie3. Es kombiniert die Allgemeine Relativitätstheorie mit dem Standardmodell der Elementarteilchen. Eine weiter Entwicklung ist das Konkordanzmodell, welches die räumliche Struktur des beobachtbaren Raumes besser erklären kann.
Sowohl das Standardmodell als auch das Konkordanzmodell leiden an gravierenden Schwachstellen. Schon Fritz Zwicky (1898-1974) hat aufgrund von Beobachtungen festgestellt, dass es im Universum dunkle Materie geben müsse, die keine elektromagnetische Strahlung aussendet. Später zeigten die weiteren Beobachtungen der Astrophysiker, dass sich das Universum beschleunigt ausdehnt. Es müsste deshalb eine unbekannte Kraft vorhanden sein, die man dunkle Energie nennt. Für jeden unbekannten Effekt kann man spekulativ ein entsprechendes Feld definieren, das zeitlich und räumlich schwanken kann. Dieses hypothetische Feld nennen einige Theoretiker ‘Quintessenz‘.4 Andere nehmen an, dass man in die Lösung der Einsteinschen Relativitätstheorie eine kosmologische Konstante einführen müsste, wodurch die dunkle Energie eine Eigenschaft des Raumes wäre. Heute geht man davon aus, dass das Weltall nur zu 5% aus sichtbarer Materie besteht, die direkt beobachtet werden kann. 25% werden der dunklen Materie zugeschrieben und 70% der unbekannten dunklen Energie. Welche Rolle die dunkle Energie und die dunkle Materie kurz nach dem Urknall gespielt haben, weiss man nicht. Für die verschiedenen Hypothesen und Szenarien fehlt eine konsistente Physik, die einer kritischen Prüfung standhält.5 Nussbaumer schreibt: «Dieser Zustand erinnert an die Zeit vor Kopernikus, Kepler und Newton, als exzentrische Epizykel und Equant, eingebettet im geozentrischen System, eine genügend genaue Beschreibung der vor- und rückläufigen Planetenbahnen, aber keine physikalische Erklärung anboten.»
Der Mensch im Zentrum
In der biblischen Schöpfungsgeschichte erschuf Gott am sechsten Tag den Menschen nach seinem Ebenbild. Und am siebten Tage ruhte Gott. Die Naturwissenschaftler erzählen eine andere Geschichte, wobei alles mit dem Urknall begann. Der Philosoph Richard Precht (*1964) gibt dazu seinem Sohn Folgendes zu bedenken: «Jeder kann sich seine eigene Geschichte ausdenken, woher die Welt kommt. Und weisst du, woran das liegt? Weil man niemals herausfinden wird, was die Wahrheit ist.» Sein Sohn meint, nachdem er mit seinem Vater eine Computersimulation über die Entstehung des Universums angeguckt hat: «Aber was wir gesehen haben, ist doch die Wahrheit. Das Universum ist durch den Urknall entstanden.» Und der Vater antwortet: «Ja, das vermuten wir. Jedenfalls soweit wir das heute wissen. Vielleicht gibt es aber auch bald eine neue Theorie. Und in hundert Jahren sieht man die Sache wieder anders. Genau wissen werden wir es nie.» Umso erstaunlicher ist es, dass angesehene Astronomen ihre Spekulationen als gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse einem gutgläubigen Publikum schmackhaft machen.
Über Jahrtausende glaubte man fest daran, dass die Erde und mit ihr der Mensch im Zentrum des Universums stehen würde. Die Naturwissenschaft hat diesen Glauben zerstört. Seit Kopernikus, Kepler und Galilei wissen wir, dass die Erde ein Planet ist, der sich um die Sonne und um die eigene Achse dreht. Auch die Sonne ist nicht das Zentrum des Universums; sie ist ein Stern in der Milchstrasse und gehört zu einer Galaxie, von denen es eine Riesenzahl gibt. Anzumerken bleibt, dass die Astronomen immer nur einen beschränkten, kleinen Ausschnitt aus dem Universum beobachten können. Diese Einschränkung kommt daher, dass die Lichtgeschwindigkeit einen endlichen, festen Wert besitzt. Beobachtbar sind nur solche Ereignisse, die im Vergangenheits-Lichtkegel liegen. Der Rest des Universums bleibt im Verborgenen. Trotzdem gibt es viele Leute, die dem Menschen immer noch eine zentrale Rolle im ganzen kosmischen Geschehen zuweisen wollen.
Auch wenn die Astrologie heute von den Wissenschaftlern nicht mehr ernst genommen wird, gibt es immer noch viele Theorien, die einem Beobachter – sei es ein Mensch oder ein Messinstrument – eine besondere Bedeutung zuweisen. Man spricht dann vom anthropischen Prinzip. Im Wikipedia wird dieses wie folgt definiert: ‚Das anthropische Prinzip besagt, dass das beobachtbare Universum nur deshalb beobachtbar ist, weil es alle Eigenschaften hat, die dem Beobachter ein Leben ermöglichen. Wäre es nicht für die Entwicklung bewusstseinsfähigen Lebens geeignet, so wäre auch niemand da, der es beschreiben könnte‘.
Für den Astrophysiker Harry Nussbaumer ist das anthropische Prinzip Ausbund der menschlichen Hybris: «Man unterscheidet zwei Varianten, das starke und das schwache anthropische Prinzip. Davon gibt es eine Menge Varianten, aber im Grunde genommen sagen alle etwa dasselbe. Das starke anthropische Prinzip besagt, dass das Universum so beschaffen sein müsse, damit zu irgendeinem Zeitpunkt Leben entstehen kann. Oder auf den Menschen bezogen: Das Universum ist so, wie es ist, damit der Mensch entstehen konnte. Das ist wohl der Gipfel menschlicher Überheblichkeit.» Und weiter: «