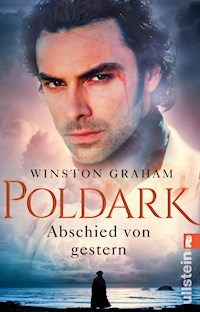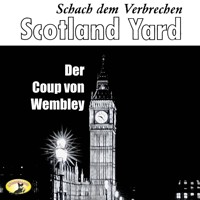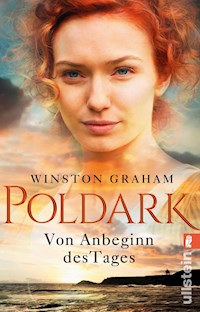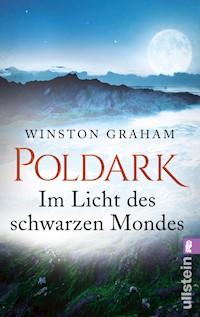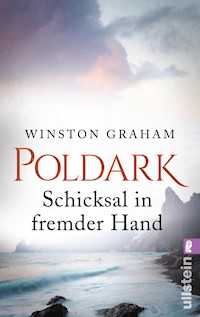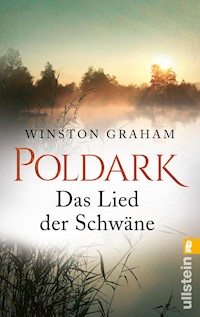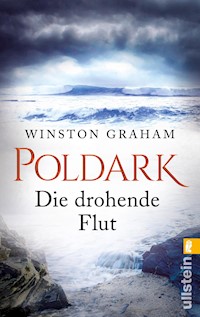3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Debbie glaubt nicht daran, daß sich je ein Mann für sie interessieren könnte. Erst Leigh macht ihr klar, daß ein Iahmes Bein kein Hindernis bedeuten muß. Bis sie eines Tages entdeckt, daß er ihre Liebe nicht uneigennützig gesucht hat. Leigh will mit ihrer Hilfe den Coup seines Lebens landen ... In diesem Roman variiert Winston Graham das Thema seines weltberühmten, von Hitchcock verfilmten Psychoschockers »Marnie« – die Geschichte einer Liebe, die in einen Kriminalfall umschlägt. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Ähnliche
Winston Graham
Debbie
Aus dem Englischen von Robert Wirth
FISCHER Digital
Inhalt
1
Fast auf dem ganzen Nachhauseweg hatte der Mann mich angestarrt, und er war sogar »rein zufällig« an derselben Haltestelle ausgestiegen; sobald ich aber aus dem Bus kletterte, verlor er das Interesse und trollte sich, die Schultern hochgezogen gegen den Wind und seine Enttäuschung. Ich ging nach Hause, Holly Hill hinan, und der Aprilregen klatschte mir um die Beine. Die Straße glänzte wie nasser Kunststoff. Ich war spät dran. Es würde bald dunkel werden.
Wir wohnten in einem von den großen Häusern im klassizistischen Stil, einem geschmacklosen Kasten, der aber geräumig und für die Ewigkeit gebaut war. Ein eisernes Tor führte zu dem Haus hin; vor dem Tor stand eine alte Straßenlaterne, deren Lichtschein auf eine Messingplatte mit der Aufschrift J. Douglas Dainton, M.R.C.S., L.R.C.P.[1] fiel.
Ich sperrte die Haustür auf und trat ein. Vater und Mutter waren zu Hause; sie hatten das Abendessen schon fast hinter sich. Wir aßen immer in der Küche, sommers wie winters und sogar dann, wenn wir Besuch hatten. Es war ein langer Raum, der an ein Eisenbahnabteil erinnerte; am einen Ende war viel Platz zum Kochen und am andern zum Essen. Die Küche war mit allen Schikanen ausgerüstet, denn Erica mochte das: Spülmaschine, Mixer, Toaster, Infrarotgrill, Brotschneidemaschine, Kartoffelschälmaschine, elektrische Kaffeemühle, so daß die Gegend um den Herd wie der Kommandostand eines Weltraumfahrzeugs aussah. An der einen langen Wand war eine Sammlung von Pinsel- und Bleistiftzeichnungen befestigt, die wir Geschwister als Kinder gemalt hatten, vor allem meine ältere Schwester Sarah, deren Stil der primitivste und darum der geschätzteste gewesen war. An der anderen Wand reihten sich moderne Glasschränke aneinander, voll von Gewürzen und chinesischem Tee und glänzend polierten, nie benutzten Kupferformen und -pfannen.
Abgesehen von meinem Schlafzimmer war die Küche der einzige gemütliche Raum im ganzen Haus.
Als ich hereinkam, war Dr.J. Douglas Dainton, M.R.C.S., L.R.C.P., gerade damit beschäftigt, einen Schmelzkäserest aus dem Silberpapier auf ein Knäckebrot zu kratzen. Gegen den Toaster gelehnt war ein Buch über Herzkrankheiten, das er zur gleichen Zeit zu lesen versuchte. Dr. Erica Dainton, M.B., Ch.B.[2], rührte in ihrer Kaffeetasse und las irgendein Paperback für Intellektuelle, dessen Titel ich nicht erkennen konnte. Als sie mich erblickte, gab sie der Brille auf ihrer Nase einen leichten Stups und sagte:
»Du kommst wieder mal sehr spät. Bist du auf einer Party gewesen?«
Sie wartete ständig darauf, daß ich plötzlich ein fröhliches Eigenleben entfalten würde.
»Nein, ich hab bloß eine Arbeit fertig gemacht. Habt ihr mir was zu Essen übriggelassen?«
»Selbstverständlich. Aber es wird längst kalt sein. Es kam auf den Tisch, bevor Minta gegangen ist.«
Mein Vater sah von seinem Silberpapier hoch und lächelte mich mit seinem Arztblick an. »Du bist ja ganz durchnäßt, Debbie. Gott sei Dank muß ich heute nacht nicht raus.« Er ergriff das saubere Messer, das eigens zu diesem Zweck neben seinem Teller lag, und blätterte damit eine Seite um.
Ich ging zum Ofen und tischte mir die Überbleibsel eines kaltgewordenen Steaks auf. Stumm begann ich sie zu verspeisen. Meine Mutter fragte: »Bist du mit der U-Bahn gekommen?«
»Nein, mit dem Bus. Das ist fast ebenso einfach.«
»Aber es dauert sehr viel länger, mein Schatz.«
»Ich fahr lieber Bus.« Das wußte sie doch schon. Sie wußte genau, daß ich Tunnels, Abteile, Schränke, Höhlen, einfach alles, was eng und dunkel war, nicht leiden konnte.
»Sarah hat vor einer halben Stunde angerufen.«
»Oh … Was wollte sie denn?«
»Ich glaube, sie will dich irgendwohin einladen. Sehr gesprächig ist sie ja nie.«
»Sie wird schon wieder anrufen.«
Damit war die Unterhaltung für den Augenblick erschöpft. In unserer Familie wurde eine Menge diskutiert, aber im Austausch von Banalitäten waren wir nie sehr gut. Als meine Mutter merkte, daß ich nichts mehr zu sagen hatte, zog sie ihre Brille dankbar wieder auf die Nasenspitze herunter.
Ich wollte gerade die Zeitung zur Hand nehmen, als im Flur das Telefon klingelte. Beide blickten mich an. »Das ist wahrscheinlich Sarah«, meinte meine Mutter, und Vater sagte: »Wenn’s für mich ist, sag, ich sei grad nicht daheim und würde in einer Viertelstunde zurückrufen.«
»Debbie«, hörte ich die Stimme meiner älteren Schwester, als ich den Hörer abhob, »wann kommst du eigentlich neuerdings nach Haus?«
»Am Donnerstag geht’s manchmal ein bißchen durcheinander. Warum?«
»Ich geb morgen abend eine Party für ungefähr ein Dutzend Leute – so gegen acht Uhr. Hast du was vor?«
»Hm … wart mal.« Ich blickte auf das Gesicht, das mir aus dem trüben Spiegel entgegensah. Ich hatte mich noch nicht gekämmt, seit ich nach Hause gekommen war, und mein Haar war vom Regen ganz strähnig geworden. Ich sah einfach fürchterlich aus. »Hat Erica vorgeschlagen, daß du mich einladen sollst?«
»Natürlich nicht, du Kuh. Und wenn schon – glaubst du, ich kümmere mich um ihre Vorschläge?«
Das tat sie wirklich nicht. »Wird getanzt?«
»In einer Dreizimmerwohnung? Aber klar. Mit Zwölfmannorchester!«
»Was du nicht sagst. Kenn ich jemand?«
»Also, ich bin da und Arabella. Früchte aus demselben Schoß. Du erkennst mich an der roten Rose.«
Ich zupfte an einem Stückchen Nagelhaut und biß es ab.
»Na?« fragte sie ungeduldig.
»Danke. Vielen Dank, Liebling. Ich komm riesig gern. Was zieh ich an?«
»’n bißchen was Besseres. Ich kann die Gammelpartys nicht mehr ausstehen, wo jeder daher kommt, als wäre er durch die Kanalröhre gekrochen.«
»Wie hübsch«, sagte ich. »Wieviel Uhr hast du gesagt?«
»Ungefähr um acht. Iß vorher nichts, es gibt was.«
Nachdem ich eingehängt hatte, machte ich mich einen Moment an den Strähnen zu schaffen, bevor ich in die Küche zurückging. Warum bloß so ein späte Einladung zu einer Party? Da war wohl jemand krank geworden? Dumm. Na, vertrauen wir auf Sarahs Ehrlichkeit; wenn sie mich als Lückenbüßerin gebraucht hätte, würde sie es wahrscheinlich gesagt haben.
Schade, es mußte immer etwas zwischen mir und der Familie stehen. Sie strengten sich schrecklich an, zu mir netter zu sein, als sie es eigentlich sein wollten. Das machte mich wachsam; ich legte überhaupt keinen Wert auf Extrabehandlung.
Ich ging wieder in die Küche zu Vater und Mutter und erzählte ihnen, was los war. Douglas war froh, daß der Anruf nicht für ihn gewesen war. Erica machten den ehrlichen Versuch, sich für die Frage zu erwärmen, was ich anziehen solle, wandte sich aber, als ich die Zeitung wieder zur Hand nahm, gleich von neuem ihrem Intellektuellenschmöker zu.
Es wurde wieder still, Erica trank ihren Kaffee aus, Douglas machte sich eine Kanne Soochong-Tee, und ich kratzte die angebackenen Rest aus der Pfanne in den Mülleimer; dann setzte ich mich mit einer Tasse Kaffee hin, und wir lasen alle friedlich.
Mein Vater war damals 58, aber ich glaube nicht, daß man ihm sein Alter ansah. Er hatte zwar einen sehr dürftigen Haarwuchs – auf dem Kopf sowie an den Augenbrauen, Kinn, Beinen und Brust –, sah aber im übrigen recht gut aus mit seinem frischen Teint, dem feinen Profil und den offen lächelnden blauen Augen. Ich weiß nicht, ob er ehrlicher, treuer, vertrauenswürdiger und aufrichtiger war als irgendein anderer; er erweckte den Eindruck, als liege diese Redlichkeit strahlend an der Oberfläche. Wenn mehr Wärme in seinen Augen gewesen wäre, hätte er wie ein Heiliger ausgesehen. Aber da gab’s keine Wärme, oder jedenfalls nicht viel – und auf keinen Fall mehr, als ein im Berufsleben stehender Mann es sich seinen Patienten gegenüber leisten kann. Für die Leute, die ihn gut kannten, war nach meiner Meinung sogar dieses bißchen ein wenig zu glatt und unverbindlich und gleichmäßig verteilt.
In seiner Jugend war er ein ziemlich guter Sportler gewesen, und er hatte seine Figur bewahrt. Er sah immer erstaunlich gepflegt aus; selbst dann, wenn er einen schmutzigen Anzug trug, hatte man das Gefühl, daß sein Körper darunter sauber war. Seine Hände waren, genau wie seine Stimme, immer kühl. Er schwitzte nie. Man konnte sich ihn kaum krank vorstellen; ebensowenig konnte man sich denken, daß er nicht immer Herr der Lage gewesen wäre; wenn er etwas befahl, dann klang das nach dem Kommando im Generalstab – nicht nach dem auf dem Schlachtfeld. Manche Leute hielten ihn für faul.
Als der Wohlfahrtsstaat geschaffen wurde, waren sie beide noch jung, die Familie wuchs, und sie hatten zusammen eine Praxis. Es ging gegen Ericas Prinzipien, ihren Beruf aufzugeben, nur um Kinder großzuziehen. Douglas entschied sich gleich von Anfang an gegen das neue Regime. Seit 18 Jahren führte er eine winzige, aber recht einträgliche Praxis für Privatpatienten und behauptete immer, er würde damit für ein Viertel der Arbeit das gleiche Geld verdienen. Erica reagierte genau entgegengesetzt. Sie hatte sofort zusammen mit drei Ärztinnen eine Praxis samt chirurgischer Abteilung im neuen und weniger wohlhabenden Teil von Hampstead auf die Beine gestellt; Privatpatienten wurden nicht angenommen, und die Praxis wurde strikt nach Geschäftsprinzipien geführt. Jede Ärztin hatte eine genau geregelte Arbeitszeit, und Kinkerlitzchen, wie etwa persönliche Beziehungen zwischen Arzt und Patient, kamen nicht in Frage.
Meine Mutter war eine sehr kluge, hochgewachsene Frau. Im Jahr ihrer Heirat legte sie das Examen ab. Sie sagte einmal: »Natürlich hab ich Kinder sehr gern, aber sie dürfen das Eigenleben nicht gefährden. Sonst ist man mit 45 oder 50 eine abgetakelte alte Gans. Das ist doch nicht auf der Höhe unseres Jahrhunderts.«
Die vernichtendste Kritik meiner Mutter besagte, daß etwas nicht auf der Höhe des Jahrhunderts war.
Auch sie hatte einmal gut ausgesehen, aber es hatte leider nicht so lange vorgehalten wie bei Douglas. Ihr Teint wirkte zwar noch so frisch wie der einer Bäuerin – aber nur bei günstiger Beleuchtung. Ihr lockiges Haar war ergraut; es sah großartig aus, wenn sie am Freitagnachmittag vom Friseur kam, doch schon am Samstag schwand die Frisur dahin, und für den Rest der Woche sah es wirr und struppig wie Stroh aus. Ihre großen braunen Augen waren, weil sie ständig Entscheidungen zu treffen hatte, schmal geworden, und weil diese Entscheidungen immer autoritativ sein mußten, sah sie ein bißchen herrisch aus.
Ich glaube, man konnte mit Fug und Recht behaupten, daß sie beide zur Intelligenzija von Hampstead gehörten. Sie hielten viel von Keimfreiheit, Freud, dem Wort mit den fünf Buchstaben, dem Berliner Schauspielensemble, dem Nouveau Roman, Joan Littlewood, dem Observer, der linksintellektuellen Presse überhaupt, und sie fanden, daß Kinder ihre Eltern mit Vornamen anreden sollten.
Was ich über sie sage, ist keinesfalls etwa zynisch gemeint; ich möchte nur mein Elternhaus beschreiben, so wie es war, damit sich das, was dann geschah, deutlich vom Hintergrund abhebt.
Vielleicht werden ein paar überschlaue Leute gleich irgendeinen Zusammenhang des folgenden Geschehens mit meiner Herkunft sehen.
Vielleicht war es auch einfach unausweichlich.
In gewissem Sinn waren mein Vater und meine Mutter in manchen Dingen sogar altmodisch. Immerhin waren sie korrekt verheiratet und das ganze 29 Jahre lang geblieben. Zumindest von dem Zeitpunkt an, als ich alt genug war, um solche Dinge mitzukriegen, kann ich sagen, daß keines von ihnen jemals mit einem Außenstehenden geschlafen hat. Sie betranken sich nie sinnlos und nahmen auch keine Drogen, von einem gelegentlichen Aufputschmittel abgesehen – sogar dann nicht, wenn sie als Arztmuster von den Herstellerfirmen kamen. Wenn sie einmal die Nerven verloren, dann wurde ihr Ton nicht gleich beißend, was ich von mir nicht behaupten kann. Schulden hatten sie nie, und sie zahlten ihre Steuern korrekt. Irgendwie hatten sie drei Töchter aufgezogen, von denen zwei jetzt endgültig auf eigenen Füßen standen. Sie waren nützliche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft, und sie machten jedes Jahr einen Monat Urlaub im Ausland, stets getrennt.
Sie waren zweifellos zwei erfolgreiche Bürger der Stadt, und wenn etwas ihre gerechtfertigte Zufriedenheit störte, dann war ich es.
Ich habe mich oft gefragt, warum sie das so sehr beschäftigte. Ich vermute, daß sie es als eine Herausforderung ihrer eigenen beruflichen Zuständigkeit ansehen.
Meine Schwester Sarah war eine charmante junge Frau und hatte dem akademischen Titel, den sie schon besaß, gerade einen weiteren hinzugefügt; dem zu Ehren wurde die Party gefeiert. Noch vier bis fünf Jahre in Krankenhäusern – dann wollte sie sich als Frauenärztin niederlassen. Sie war groß und ein klein wenig üppig, aber alles in allem gerechnet sah sie blendend aus mit ihren blauen Augen, bei denen sogar das Weiße die Farbe der Pupille zu haben schien. Sie war zweimal verlobt gewesen und hatte immer einen jungen Mann um sich, aber ihr jeweiliges Verhältnis dauerte offenbar nie sehr lange, vielleicht weil sie zu stolz war, sich an eine Deichsel spannen zu lassen. Es gab schließlich soviel im Leben außer der Liebe. Sie ähnelte vermutlich sehr meinem Vater in seinen jüngeren Jahren.
Meine andere Schwester, Arabella, war erst 20 und studierte Medizin in London. Sie war ebenso hoch aufgeschossen wie Sarah, aber bedeutend schlanker, und sah ganz süß aus mit ihrem aufreizend blonden Haar, das eine Gesichtshälfte und ein Auge verbarg, und mit einer tollen Figur.
Obwohl auch ich überdurchschnittlich groß bin, komme ich mir in meiner Familie immer wie ein Zwerg vor; meine Mutter mit einsdreiundsiebzig ist die nächstkleinere.
Als ich in Sarahs Wohnung in Ennismore Gardens ankam, war schon ungefähr ein halbes Dutzend Leute da. Zwei von ihnen kannte ich flüchtig. Alle schwatzten und tranken bereits fröhlich.
»Hallo«, sagte Sarah von ihrer Höhe herab. »Sieht man dich mal wieder! Philip kennst du, nicht? Und hier ist Greta. Oh, es klingelt schon wieder. Kannst du Arabella beim Ausschenken helfen?«
Ich ging auf den Tisch mit den Flaschen zu, an dem Arabella mit ihrem neuen Verehrer Bruce Spring stand. Er hatte wahre Ungetüme von edwardianischen Koteletten, dazu ein behaartes Muttermal auf der Wange, und wenn er sprach, so klang es, als zöge man einen Korken aus einer Flasche.
Das Zimmer wurde allmählich voll, aber, wie Sarah schon angekündigt hatte, es war keine schäbige Bottle-Party mit Kord und Wollhemden und speckigen Blue Jeans. Sarah teilte die Wohnung mit einem Mädchen namens Virginia, und sie hatten für diesen Abend ihr großes Schlafzimmer in ein Speisezimmer verwandelt. Eine Stunde lang redeten und tranken wir im Wohnzimmer, und Arabella und ich gossen fleißig nach. Gerade als wir zum Essen ins andere Zimmer überwechseln wollten und Sarah mir zugenickt hatte, die Gläser nicht wieder zu füllen, kamen noch zwei späte Gäste. Der eine war David Hambro, ein junger Chirurg, den ich schon kannte. Der andere hieß Leigh Hartley.
Wenn man jemanden sehr gut kennt, dann fällt es oft schwer, sich an die ersten Eindrücke zu erinnern. Am deutlichsten entsinne ich mich seiner krausen Haare, seiner alltäglichen Stimme, seines Ausdrucks von zerquälter Kraft. Er war nicht groß, doch wurde er von größeren Männern nicht übersehen; er hatte schwere Lider, die sich manchmal über die Augen schoben, wenn er einem Wort oder Blick Nachdruck verleihen wollte; seine Nase war für das breite Gesicht zu schmal, der Mund groß und sensibel, und die Zähne glänzten wie auf einer Zahnpastareklame.
Hübsch war er also nicht, aber er hatte kein Dutzendgesicht.
Die ersten Worte, die er, soweit ich mich erinnere, zu mir sagte, waren: »Gebrannte Umbra.«
Ich sah ihn an, er lächelte, aber ich gab keine Antwort, weil ich nicht begriff.
»Müßte mit Gelb gemischt werden«, meinte er, »wegen der Beleuchtung. Sarahs Schwester?«
»Ja.«
»Lustig – drei Schwestern und alle so attraktiv! Vor drei Wochen erst hab ich Sarah kennengelernt, letzte Woche Arabella, und jetzt Sie.«
»Darf ich Ihnen was zu trinken geben?« fragte ich.
»Natürlich. Sehr nett. Genau das, was ich brauche.«
Ich zögerte. »Und was?«
»Was?« Er ließ die schweren Lider sinken. »Ach so, Sie meinen zu trinken. Ach, irgendwas. Wie ist das Leitungswasser dieses Jahr, ein guter Tropfen?«
»Ja«, sagte ich, »aber nur auf der Sonnenseite.«
»Gießen Sie mir ein halbes Glas ein und verlängern Sie es mit einem Schuß Scotch.«
Während ich das tat, blickte er mich prüfend an. Ich ertappte mich dabei, wie ich auf Sarah wütend wurde, weil sie mich hinter einen Tisch gestellt hatte, wo ich nicht richtig gesehen werden konnte, und ich auf den Trick hereingefallen war.
»Im Ernst«, sagte er, »Ihre Haare sind wirklich große Klasse.«
»War’s das, was Sie beschäftigt hat? Danke schön.«
»Kommt’s jemals in Unordnung?«
»Wie bitte?«
»Das Haar.«
»Ach ja, oft.«
»Das glänzt, du meine Güte!«
Er trank einen Schluck, dann sagte er: »Vielleicht red ich zuviel.«
Ich lächelte unentschlossen, blickte ihn aber nicht an.
»Wie heißen Sie?«
»Debbie.«
»Ich heiße Leigh. Mit gh am Ende. Leigh Hartley. Auch Ärztin?«
»Nein. Ich arbeite im West End.«
»Hm, die einzige Dainton, die was gegen Medizin hat, was? Gott sei Dank. Der Onkel Doktor jagt mir immer fürchterliche Angst ein. Und weibliche Onkel Doktors, die lassen es mir kalt über den Rücken laufen.«
»Warum?«
»Ach, ich weiß nicht. Weil irgendwie Röcke nicht zum Arztberuf passen, glaube ich. Und wenn Röcke zu einem Beruf nicht passen, dann sieht das immer unheimlich aus …«
Sarah regelte den Zustrom ins Schlafzimmer zum Abendessen.
Ich sagte: »Ihre Vorstellungen sind ein bißchen viktorianisch, wie?«
»Altmodisch, kann sein. Aber warum denn gleich die arme alte Königin beleidigen? In den Tagen vom braven Edward gab’s doch auch noch keine Ärztinnen. Oder bei den frühen Georges oder den Stuarts oder –«
»Ja, damals hat man sie verbrannt«, sagte ich. »Vielleicht gefällt Ihnen die Idee.« Ich nahm meinen Stock. »Das Abendessen ist fertig.«
»Ob ich neben Ihnen sitzen kann, was meinen Sie?«
Ich lächelte. »Nein, ich muß helfen. Folgen Sie Arabella. Dann verlaufen Sie sich nicht.«
Er lächelte zurück und wandte sich ab, das Glas mit dem Scotch in der Hand.
Bevor er ganz weg war, kam ich langsam hinter dem Tisch hervor und humpelte neben ihm zur Schlafzimmertür.
»Hier rein.«
Er tat, als hätte er nichts gemerkt, nickte und schlüpfte durch die Tür.
In Wirklichkeit half ich nicht viel, weil es mir immer ein bißchen schwerfällt, schnell aufzustehen, und weil die Küche sowieso nicht mehr als drei Personen faßte. Nachdem ich ein paar Sachen gereicht hatte, schnappte ich mir einen Teller und ein Weinglas, und ein paar Leute rückten zusammen, damit ich mich zwischen sie auf ein Bett setzen konnte.
An dem großen, runden Tisch, der sonst im Wohnzimmer stand, saßen sieben. Drei oder vier hockten um den niedrigen Couchtisch, andere auf oder zwischen den beiden Betten, wieder andere standen oder hatten sich auf den Boden gekauert. Leigh Hartley saß an dem kleinen Tisch und redete fast während des ganzen Essens mit einem strammen dunklen Mädchen, dessen Name ich nicht wußte; aber ich merkte, wie er sich öfters umdrehte, und einmal sah ich kurz hoch, und unsere Blicke trafen sich.
Das Essen dauerte ungefähr eine Stunde. Es gab Vichyssoise, danach Schinken à la crème und dazu Chablis. Virginia kam sich wichtig vor mit ihren ausländischen Spezialitäten. Aber es schmeckte wirklich sehr gut. Der Mann neben mir war Arzt und der auf dem Bett gegenüber gleichfalls. Sie sprachen über die Einrichtung einer neuen psychiatrischen Abteilung. Der Mann neben mir sagte: »Was ich gern hätte, das wäre eine Auswahl von ungefähr fünfzehn Schizophrenen, fünf Paranoiden und rund einem Dutzend Manisch-Depressiven für den Anfang. Das wäre so ungefähr die rechte Richtung.« Es klang, als wollte er Pflanzen für sein Herbarium bestellen.
»Na ja, mag sein, wir können das so einrichten«, sagte der zweite Arzt. »Ich rede gleich morgen mit Vilars-Smith.«
Der Mann auf meiner anderen Seite war gerade von einem Ski-Urlaub aus Norwegen zurückgekommen, und er erzählte pausenlos mit lauter Stimme davon. Ich saß still da und hörte zu und blickte immer wieder auf sein rotes, vor Selbstgefälligkeit schwitzendes Gesicht, das anschwoll wie bei einem Frosch, als es im Raum wärmer wurde: genau der Typ, der mit 48 das Opfer eines Herzinfarkts wäre. Aber noch lagen zwanzig Jahre vor ihm, in denen er anschwellen und brüllen und hin und wieder kleine Stückchen Nahrung spucken konnte. Wie er sich wohl als Ehemann ausnahm? Das arme Mädchen …
Das Abendessen ging gegen elf zu Ende, und jeder war ausgelassen und geschwätzig. Ich ging in die Küche, aber nach einer Weile zog Sarah mich heraus. »Ich hab’s dir doch schon gesagt, Debbie, du bist eine Kuh. Komm rein und unterhalt dich.«
Also ging ich wieder hinein, und jemand machte einen Stuhl für mich frei, und nach ungefähr fünf Minuten kam Leigh Hartley aus der gegenüberliegenden Ecke und ließ sich in meiner Nähe auf der Armlehne des Sofas nieder.
»Hallihallo«, rief er. »Erinnern Sie sich noch an mich?«
»Nicht besonders gut.«
»Ich bin der liebe Junge, der Sie damit beleidigt hat, daß er Ihr Haar bewunderte.«
Ich gab keine Antwort, und nach einer Weile sagte er: »Ich glaub, die gute alte kalte Schulter ist immer noch die beste Methode, um Wölfe wie mich in Schach zu halten.«
Unsere Blicke trafen sich. Seine Augen waren grau, ein vollkommen klares Grau, das Weiß genauso strahlend wie seine Zähne.
»Gewöhnlich hab ich keine Mühe, sie loszuwerden. Nach dem ersten Heulen lassen sie mich meist in Ruh.«
Er wandte die Augen nicht ab: »Weil Sie gelähmt sind, meinen Sie?«
Die meisten Leute waren nicht so taktlos, es auch noch auszusprechen. Aber alles, was ich erwiderte, war: »Kann sein«; dann wandte ich mich um und sprach mit David Hambro, der auf einem Kissen in der Nähe hockte. Ich vermied es eine gute Weile sorgfältig, mich nach ihm umzudrehen, und wußte, daß er mehr oder weniger isoliert dasaß, denn das Mädchen auf dem Sofa unterhielt sich mit Arabella. Ich überlegte, wie ich am besten aufstehen und weggehen könnte, ohne noch einmal mit ihm zu sprechen, aber da stand er selbst auf und durchquerte den Raum. Es war zum Lachen, wie ärgerlich man doch immer werden konnte, denn es war wahrscheinlich gar nicht beleidigend gemeint gewesen. Man sollte einen Mann nicht quälen, bloß weil er die Wahrheit sagt …
Er kam mit zwei Gläsern in der Hand zurück. »Ihres war fast leer, und darum hab ich Ihnen ein volles gebracht«, sagte er.
Ich lächelte ihn an. »Danke, aber mir genügt, was ich hier hab.«
Er setzte sich auf die Armlehne des Sofas. »Okay, dann trink ich beide.«
Damit waren die diplomatischen Beziehungen eine Weile abgebrochen. Gegen Mitternacht fingen ein paar Leute zu tanzen an und David Hambro forderte Arabella auf. Hartley ließ sich auf dem Kissen nieder, umfaßte die Knie und blickte zu mir hoch.
Er sagte: »Ich bin kein richtiger Wolf, wissen Sie. Ich hab nicht die Zeit dazu.«
Ich lächelte wieder, aber nachdenklich.
Er fuhr fort: »Ich freß einen Besen, Sie sind wirklich hübsch. Vielleicht ist es lästig für sie, aber denken Sie an den Schlag, den das anderen versetzt.«
Die Platte war endlich abgelaufen, aber Sarah ging zum Apparat, um sie umzudrehen. Es war eine LP, und ich wußte, daß ich weitere zwanzig Minuten hier festgenagelt war.
»Warum haben Sie keine Zeit?« fragte ich. »Sie sollten sie sich nehmen.«
»Tut mir leid«, erwiderte er, »aber Sarkasmus kommt bei mir nicht an.«
»Sie haben mir noch nicht geantwortet.«
»Ich male.«
»Ach, deswegen das Gelb vorhin?«
»Was für ein Gelb?«
»Sie sagten vor dem Essen etwas von einem Gelb.«
»Ach so, ja. Das paßt zu mir. Ich bin ein Tölpel, hab noch nicht die Zeit gehabt, die geschliffenen Umgangsformen der feinen Gesellschaft anzunehmen.«
Ich blickte auf seine Hände: Sie waren breit und kurz, sahen aber nach den Händen eines Ingenieurs oder Tischlers aus. Auch seine Kleidung war ungewöhnlich, ganz flott, aber zu auffällig. Mittlerweile gingen die ersten Leute; zwei von ihnen kamen her, um mir gute Nacht zu sagen. Mein Stock war im Weg, und einer stolperte drüber. Die Musik paßte zu der späten Stunde, träumerisch, geeignet für verliebte Pärchen auf der Tanzfläche. Ich wünschte, ich wäre nicht gekommen. Ich wünschte mir so sehr, daß Sarah jetzt nicht herkam, um mich zu sich zu holen. Sie tat es aus Herzensgüte, versuchte immer, mich in den Kreis ihrer Freunde zu ziehen – und immer war es ein Schlag ins Wasser.
»Was malen Sie?«
»Bilder, Öl auf Leinwand. Oder auf Hartfaserplatte, wenn mir das Geld ausgeht. Oder auf Packpapier, wenn ich pleite bin. Es ist einfach eine Frage des Geldes.«
»Sind Sie ein guter Maler?«
»Nein.« Er sah nicht mehr mich an, sah durch mich hindurch. »Ich bin ein guter Zeichner. Aber das genügt nicht.«
»Sie sind bescheiden.«
»Nein – nur klarsichtig.«
»Warum malen Sie dann weiter?«
Ich dachte, er würde auf mein lahmes Bein schauen, und rückte es für ihn zurecht, damit er es besser sehen konnte.
Er sagte: »Warum hören Sie nicht auf zu atmen?«
»Verkaufen Sie Ihre Bilder?«
»Eins oder zwei bin ich losgeworden.«
»Dann arbeiten Sie daneben noch?«
»Nein. Meine Tante hat mir was hinterlassen. Sie heiratete einen Schrotthändler, und ich war ihr einziger verkommener Neffe. Ich hab grad so viel, daß ich nicht verhungere.« Er trank das zweite Glas Wein mit einem Schluck leer. »Kann ich Sie nach Haus bringen?«
»Danke, ich bleib die Nacht hier.«
»Sie wohnen aber nicht bei Sarah – ich meine normalerweise?«
»Nein, bei meinen Eltern in Hampstead.«
Sein Gesicht nahm einen strengen Ausdruck an. »Gehen Sie mal an einem Abend mit mir aus?«
»Eigentlich geh ich nicht viel aus. Ich komme sowieso an den meisten Abenden zu spät nach Haus.«
»Dann also an einem Sonntag.«
»Ich weiß nicht …«
»Gut, abgemacht. Ich ruf Sie an. Oder wie wär’s mit nächsten Sonntag?«
»Nein, da hab ich was vor.«
»Okay, dann ruf ich an.« Er blickte sich im Zimmer um. »Ich weiß immer noch nichts von Ihnen. Komisch, nicht? Aber Sie sind schön – oder fast schön. Hab Sie beobachtet. Bei einem gewissen Ausdruck und in bestimmter Beleuchtung – da ist sie wie Licht auf Wasser. Schneller da und wieder fort als ein Regenbogen.« Er grübelte. »Sie ist unfair.«
»Wer ist unfair?«
»Die Schönheit. Sie läßt einen nicht in Ruh. Oder?«
Auch die Häßlichkeit nicht. Aber wenn er anrief, brauchte ich ja nicht dazusein.
Er sagte: »Es gibt, verdammt noch mal, keine Fairneß in der Kunst. Gefühl allein reicht nicht; man muß es auch zum Ausdruck bringen können. Wenn’s auf unser Gefühl ankommen würde, auf das, woran wir unseren Spaß haben, dann könnten wir alle Rembrandts, Roaults, Picassos sein. Aber nicht einer unter Millionen kann es ausdrücken.«
Die meisten Leute gingen jetzt. Ich war bald erlöst.
Er sagte: »Was tun Sie? Sie sehen anders aus als Ihre Schwestern. Machen Sie Musik?«
»Nein.«
»Ihre Schwestern haben längliche Gesichter. Moderne Gesichter. Sie nicht. Ihres ist oval – hätte eine gute Vorlage für den alten Rossetti abgegeben. 19. Jahrhundert. Sehr unzeitgemäß.«
»Vielen Dank.«
»Nein. Es hat was an sich. Es ist sensibel und zart. Ich mein, Sie sind nicht zart. Sie sehen zart und romantisch aus, aber hinter diesem Aussehen verbirgt sich …«
Ich erfuhr nicht mehr, was sich nach Leigh Hartleys Meinung dahinter verbarg, denn Sarah kam auf uns zu und unterbrach uns, um uns ein Mädchen vorzustellen, das wir noch nicht kannten. Ich wartete ab, bis die Unterhaltung wieder in Gang gekommen war, und schlüpfte dann in die Küche. An diesem Abend sah ich ihn nicht mehr.
2
Ich arbeitete bei Whittington, dem Kunstversteigerungshaus. Das könnte in unserer Arztfamilie ein wenig nach Abstieg aussehen, wenn es sich nicht um Whittington handeln würde.
Als ich aus der Schule kam, war mir völlig klar, daß ich auf keinen Fall Medizin studieren wollte. Daher schickte mich meine Mutter nach Frankreich, wo ein Vetter von ihr verheiratet war. Ich blieb dort, in der Nähe von Avignon, und bereitete mich auf die Universität vor, kam aber nicht weit, weil ich kein Akademikertyp bin. Die Tatsache, daß ich so lange bettlägerig war, hat meine Lesegewohnheit gefördert, aber nicht diszipliniert; ich kann schnell aufnehmen und behalten, was mich interessiert, aber was mich nicht interessiert, gleitet an mir ab, und mein Gedächtnis ist davon so unberührt wie ein unbelichteter Film.
Mein Halbonkel war Archäologe und schrieb populärwissenschaftliche Bücher über Pompeji, Arles und Perpignan. Ich las sie, und sie zündeten bei mir, so daß ich auf die wissenschaftlichen Werke zurückgriff, aus denen er die meisten Fakten übernommen hatte, und dann konnte ich einfach nicht mehr genug davon bekommen.
Später ging ich also zu Whittington. Das war zu der Zeit, als es gerade Mode wurde, bei Whittington, Sotheby oder Christie angestellt zu sein. Ich trug meinen Namen ans Ende einer langen Liste ein. Aber es dauerte nicht lange, bis ich zu einem zweiten Gespräch gebeten wurde; mit 19 bekam ich eine Anstellung beim Empfang. Es gab eben einige Dinge, die zu meinen Gunsten sprachen. Über frühe Kunst wußte ich bereits eine ganze Menge. Mr. Hallows, der mich einstellte, muß sich überlegt haben, daß ich wahrscheinlich nicht heiraten würde – für einen Arbeitgeber ein nicht zu verachtender Vorteil.
Nach zwei Jahren wurde ich in die Abteilung für Antiquitäten versetzt und später in die Porzellanabteilung, die mich am meisten interessierte. Ein Jahr darauf arbeitete ich am Katalog mit und wurde Mr. Mills rechte Hand. Gewöhnlich ging ich mit, wenn auswärts eine Porzellansammlung zu begutachten war. Bei kleineren Sachen war ich auch allein unterwegs.
Whittington ist die kleinste Firma unter den drei großen, aber in gewisser Weise die exklusivste. Es ist die älteste, und ihre Beziehungen zur englischen Aristokratie sind seit eh und je eng.
Am Mittwoch darauf gegen neun Uhr abends rief er mich an.
»Hören Sie«, sagte er, »haben Sie kommenden Sonntag frei? Ich bin Mitglied im Seven Arts Club, und wir zeigen jeden Sonntagabend einen Film. Ich bin sicher, daß es diese Woche sehr interessant wird, es –«
»Tut mir leid«, entgegnete ich. »Ich bin schon verabredet.
»Oh.« Das klang ehrlich enttäuscht. »Schade.«
»Ja. Trotzdem vielen Dank.«
Er spürte wohl, daß ich gleich einhängen würde, und sagte schnell: »Wirklich schade, denn es handelt sich um den Picasso-Film – einen älteren Film von vor vielleicht zehn Jahren, aber ich hab ihn noch nicht gesehen. Der alte Knabe in Aktion. Leute, die ihn gesehen haben, sind restlos hin.«
»Oh … Ja, ich hab davon gehört.«
»Der Film beginnt erst um neun. Wie sind meine Aussichten?«
»Schlecht … Tut mir leid. Ich muß jetzt auflegen, ich hab den Wasserkessel auf dem Herd.«
»Okay … Debbie?«
»Ja?«
»Wann haben Sie Ihren nächsten freien Sonntag?«
Verflixter Kerl! »Also … ich weiß nicht genau. Vielleicht im nächsten Monat.«
»So lang dauert’s noch? Also gut, ich ruf wieder an.«
»Ja, in Ordnung. Auf Wiedersehen!«
»Tschau.«
Meine Mutter war im Wohnzimmer und hatte gerade mit ihrem Klavierspiel aufgehört. Es war ein asketischer, steriler Raum mit zwei Hamadan-Teppichen auf dem polierten Parkettboden. Das schwarze Ledersofa hatte keine Kissen. Auf dem schwarzen Flügel stand eine Anglepoise-Lampe. Sonst befand sich nichts weiter in dem Raum außer drei gerahmten Drucken von Abstrakten, zwei kleineren modernen Skulpturen und drei Stühlen. Douglas, mein Vater, war der Ansicht, daß jemand, der über erwähnenswerte Intelligenz verfüge, keine überladenen Wohnräume nötig habe. Die Leute stopften ihre Räume voll, meinte er, wie sie auch ihr Gehirn mit allem möglichen Kram vollstopften. Dennoch sammelten seine drei Töchter: ich Porzellan, Sarah altes Silber, Arabella bisher nur junge Männer.
Erica kam auf den Flur; sie trug ein teures graues Kostüm, allerdings schon den siebten Winter.
»War es für dich?«
»Ja.«
»Keins von den Mädchen? Ich wollte nämlich Sarah fragen –«
»Nein, es war jemand, den ich auf Sarahs Party kennengelernt hab. Ich wurde nur nach einer Adresse gefragt.«
Oben in meinem Zimmer tat es mir beinahe doch leid. Den Picasso-Film hatte ich noch nicht gesehen, und weiß der Kuckuck, es tat doch schließlich nicht weh, mal einen Abend mit einem Mann auszugehen. Ich konnte mir Leigh Hartley gewiß vom Leibe halten, für den unwahrscheinlichen Fall, daß das nötig werden sollte. In meinem Leben hatten sich nur wenige Männer für mich interessiert, sehr wenige. Die meisten zogen sich beim Anblick meines lahmen Beines sofort zurück, und die übrigen spürten wohl, daß ich empfindlich war und dazu neigte, zu denken, daß sie sich mein Handicap zunutze machen wollten.
Ich starrte nachdenklich auf die leicht beschädigte italienische Majolika-Schüssel, die ich in einem Laden in Brighton entdeckt hatte. Die simple Lösung meines Problems war, daß Männer einfach nichts für mich waren.
Leigh Hartley in seinem Eigensinn hatte sich wohl immer noch nicht damit abfinden können, denn er rief mich am folgenden Montagabend an und sagte mir, daß die Klubmitglieder den Picasso-Film wegen des großen Erfolgs ein zweites Mal vorführen wollten. Ob ich nächsten Sonntag um neun Uhr kommen könne?
Ich erwiderte: »Sie haben ihn schon einmal gesehen. Sie werden ihn nicht noch einmal sehen wollen«, und dann fluchte ich lautlos, denn er versicherte mir, daß er sich ihn auf jeden Fall zweimal ansehen würde. Wenn man nicht gleich nein gesagt hat, ist es später kaum noch möglich. Natürlich hätte ich entgegnen sollen: »Scheren Sie sich um Himmels willen fort und hören Sie auf, mich zu belästigen!« Aber die Gedanken, die mich letzte Woche beschäftigt hatten, spukten mir noch im Kopf herum, und schließlich wollte mir der arme Junge ja nur einen Gefallen tun. Seine eigentlich ganz drollige Unbeholfenheit war entschieden angenehmer als die geschniegelte Selbstbeweihräucherung so vieler Gleichaltriger.
So hörte ich mich also kleinlaut zustimmen, daß wir uns abends um halb neun an der U-Bahn in Hampstead treffen würden. Er wollte gern zum Haus kommen, aber ich konnte den Gedanken nicht ertragen, mich unter den kritischen Augen meiner Eltern abholen zu lassen. Ich wußte niemals genau, was sie von solchen Dingen hielten.
Der fragliche Sonntag war der erste Sonntag im Mai, und als ich an der U-Bahnstation ankam, stand er wartend neben einem kleinen roten Sportwagen. Ich überquerte die Straße, ohne daß er es bemerkte, und er hielt mir den Rücken zugekehrt, als ich auf ihn zuging. Sein Gesicht erhellte sich, als er mich erblickte. Er war jünger als in meiner Erinnerung, vielleicht um Jahre jünger als ich; verrückt, daß er mich noch attraktiv fand, ausgesprochen komisch. Großzügig und warmherzig war er aber, das mußte man ihm lassen. Schade um seine Stimme, das Timbre klang ziemlich matt, was so gar nicht zu seiner Statur paßte, die stämmig und kräftig war. Ein Künstler? Und diese Kleider …
»Passen Sie hier rein? Geben Sie mir Ihren Stock. Geben Sie auf Ihren Mantel acht – die Tür muß mit Gewalt zugeknallt werden. Gut. Atmen Sie nicht, wir wollen sehen, ob er startet.«
Die Vorstellung fand in einem kleinen Kino in der Wardour Street statt und hatte gerade begonnen, als wir ankamen. Ich hatte mich um Malerei nie gekümmert, aber da Möbel und Bilder die beiden größten Abteilungen bei Whittington waren, hatte ich dennoch eine Menge mitgekriegt.
Als das Licht wieder anging, nahmen wir einen Drink an der Kinobar, aber sie war gerammelt voll und laut. Also schlug er vor, um die nächste Ecke zu gehen und in Frieden einen Kaffee zu trinken. Das taten wir auch, saßen im Café und schwatzten eine gute Weile ganz freundschaftlich miteinander.
Dann sagte er: »Sie wollten heut abend gar nicht mit mir ausgehen, nicht wahr?«
Ich zupfte an einem Fingernagelhäutchen. »Eigentlich nicht.«
»Sie halten mich für einen bedauernswerten Schwachkopf, der ein ›Eigentlich nicht‹ zufrieden als Antwort hinnimmt.« Er lächelte, aber man hatte den Eindruck, daß er scharf aufpaßte, was ich jetzt sagen würde.
»Ganz so ist es nicht. Vielleicht bin ich ein bißchen abrupt, ein bißchen grob. Oder es wirkt so. Ich möchte es gar nicht sein.«
»Gut. Ich bin froh, daß ich das weiß.«
Ich sagte mit Bedacht: »Natürlich hat mir der Film gefallen, und natürlich wollte ich ihn gern sehen. Es war ein Vergnügen … Vieles in meinem Leben macht mir Vergnügen, aber es ist nicht immer das gleiche Vergnügen wie bei anderen Leuten.«
Ich stockte. Er sagte: »Gut, reden Sie weiter.«
»Es gibt nichts weiter zu sagen, wirklich nicht.«
»Sie meinen, weil Sie gelähmt sind?«
Das war das zweitemal, daß er davon sprach, und eine Welle von Abneigung stieg in mir hoch.
»Jawohl. Aber ich bin trotzdem glücklich, das kann ich Ihnen versichern. Wirklich glücklich, vielen Dank.«
Er stülpte die Unterlippe nach außen und schlürfte an seinem Kaffee. »Okay, okay, Sie sind glücklich. Das ist prima. Hätte nichts Besseres hören können. Aber ich frage mich eines: Wenn Sie den Film gern sehen wollten, warum sind Sie dann eigentlich nicht gern mitgekommen, um ihn sich mit mir anzusehen? Hab ich die Masern?«
Ich blickte an ihm vorbei auf einen dunkelhaarigen Mann in der Ecke, der mich anstarrte.
»Was ist los mit Ihnen?« fragte Leigh dann. »Ich meine, warum sind Sie gelähmt?«
»Ein schöner Abend, nicht?«
»Oh, ich hab schon verstanden. Sagen Sie mir nur noch eins: Warum sollte Sie das von anderen Leuten unterscheiden? Ich weiß, vielleicht sind Sie nicht so gut im Ballett oder beim Wasserski. Aber sieben Millionen andere Mädchen sind auch nicht gut darin. Warum sollte sich also Ihr Vergnügen in allen anderen Dingen von dem der anderen Mädchen unterscheiden? Das interessiert mich wirklich, Debbie. Ich möchte es gern wissen.«
Ich hob meine Kaffeetasse. In der Untertasse war ein schmaler brauner Ring. Jemand hatte eine Münze in den Musikautomaten geworfen, und einer der Hits vom vergangenen Jahr dröhnte aus der Box.
»Wenn man glattes Haar hat, warum sollte man sich nach Locken sehnen?« sagte ich. »Wenn –«
»Das ist doch keine Antwort. Sie weichen aus.«
»Also gut, ich weiche aus.«
Wir schwiegen eine Weile. Dann fragte er:
»Was arbeiten Sie? Sind Sie Sekretärin?«
Ich klärte ihn auf.
»Hm. Interessant. Ich dachte, Sie wären vielleicht schüchtern, aber Sie müssen doch den ganzen Tag mit Leuten zu tun haben.«
»O ja, aber das ist doch geschäftlich.«
»Nun, wie wär’s, wenn Sie mich behandelten, als wäre das auch geschäftlich.«
Ich mußte lachen. »Was haben Sie zu verkaufen?«
»Mich.«
Wir sahen uns an. Der Beatsänger auf der Platte empfahl, keinen Fehler zu machen. Keinen F-e-e-e-e-ehler …
Ich sagte: »Puh, es ist fast halb zwölf. Ich glaub, ich muß gehen.«
»Kommen Sie mit zu mir auf einen Drink.«
»Jetzt nicht, danke.«
»Sehen wir uns wieder?«
»Stöbern Sie noch einen Picasso auf, und ich komme mit.«
»Ich werd mich mal umschauen. Wir werden schon was finden.«
Der dunkelhaarige Mann in der Ecke verließ gerade das Lokal. Ich war froh, daß er gegangen war, bevor ich aufstand.
Leigh fragte: »Haben Sie viele Freunde?«
»O ja, sehr viele.«
»Wollen Sie mich nicht dazurechnen?«
»Aber doch.«
Er atmete geräuschvoll aus. »Okay, gehen wir.«
»Warum haben Sie geseufzt?«
»Weil Sie ›aber doch‹ sagten, als wären wir auf einer verdammten Party, wo es gar nichts bedeutet. Ich glaub, ich sollte wenigstens wissen, wenn ich aus dem Rennen bin.«
Irgendwas ließ mich sagen: »Tut mir leid.«
»Aber nicht doch; wenn Sie so fühlen, dann ist das eben so. Sie sind schließlich ein freier Mensch. So, jetzt warten Sie an der Tür, und ich hol den Wagen.«
Er holte den Wagen, und wir fuhren in einer Art Kalter-Krieg-Stimmung zurück nach Hampstead.
»Bemühen Sie sich nicht, erst hochzufahren«, meinte ich. »Es ist eine scheußliche Steigung und Einbahnstraße dazu.«
»Auf keinen Fall. Party-Sitten triumphieren auch über einen Korb.«
Wir röhrten geräuschvoll Holly Hill hinauf. »Wohin jetzt?«
»An der Gabelung nach rechts. Hier sind wir. Das dritte Haus auf der rechten Seite.«
Wir hielten mit einem Ruck an. Ich sagte: »Ich danke Ihnen. Es war sehr nett.«
»Aber Sie wollen mich nicht wiedersehen?«
»Nun, man muß den Tatsachen des Lebens ins Gesicht blicken.«
»Welchen zum Beispiel?«
»Sie haben sie schon ausgesprochen. Gute Nacht.« Ich begann mich aus dem Wagen zu schälen.
Ein Wagen fuhr dicht hinter uns auf, um in die Garage einzubiegen, die offenstand, wie ich erst jetzt bemerkte. Die Scheinwerfer tauchten Leighs kleinen Sportwagen ins Helle. »Moment«, sagte er, »ich fahr nur ein Stück vor, um den andern reinzulassen. Jemand aus Ihrer Familie?«
Er fuhr ein paar Meter vor, und ich erkannte an dem schnellen, gekonnten Schwung, daß es meine Mutter war.
»Ich gehe jetzt«, sagte ich. »Nochmals vielen Dank. Gute Nacht.«
Natürlich mußte er erst aussteigen und mir zu Hilfe eilen, obwohl ich das weiß Gott schnell genug allein konnte; aber mein Stock war hinter die Sitze gerutscht; bevor er ihn gefunden hatte, kam Erica herbei, und ich mußte ihn vorstellen. Wir sprachen ein paar Minuten lang, dann fuhr er davon, und wir gingen durchs Tor.
»Hast du Dienst heute abend?« fragte ich und hoffte, sie damit vom Thema abzubringen.
»Ja, natürlich, sonst hätte ich nicht noch mal fort müssen. Wer war der junge Mann? Hat er dich von Sarah zurückgebracht?«
»Nein, ich war mit ihm im Kino.«
»Komische Stimme. Wo hast du ihn kennengelernt?«
»Bei Sarah. Er ist Künstler.«
»Oh?« Es war ein Fehler, daß ich ihr das erzählte. Ihre Stimme klang interessiert. »Lad ihn doch irgendwann einmal zu einem Drink ein.«
»Ja … irgendwann.«
Wir gingen die Treppe hinauf. »Du solltest wirklich mehr Freunde haben, Debbie. Es gibt keinen Grund, weshalb du keine haben solltest.«
»Nein, überhaupt keinen.«
In dieser Nacht hatte ich wieder einmal meinen alten Traum. Ich träumte, daß ich in einem Sarg lag, aber er war nicht lang genug, und mein Kopf ragte durch ein Loch an einem Ende heraus. Meine Hände, Arme und Beine waren gefesselt, und ich konnte keinen Muskel bewegen. Die Leute schauten mich an – drei oder vier Leichenbestatter –, und ich wußte, daß ich in den nächsten Minuten begraben werden und Erde in meinen Mund geschaufelt würde. Ich versuchte zu protestieren, zu schreien, zu erklären, daß ich noch nicht richtig tot war, daß nur mein Körper tot war und Kopf und Hirn noch durchaus lebten. Jedesmal, wenn ich mit den Leichenbestattern reden wollte, wandten sie sich ab.
Dann wußte ich plötzlich, daß es kein Begräbnis war, was sie mit mir vorhatten, sondern eine Art Folter. Die ganze Zeit über atmete irgendein großes Tier, das ich nicht sehen konnte, geräuschvoll in der Nähe, und unablässig beobachteten die Männer den Zeiger auf einer Art Uhr, um zu sehen, wieviel Schmerz ich ertragen konnte. Der Schmerz war noch nicht da, aber ich wußte, ich wußte sehr genau, es würde gleich losgehen.
Dann kam einer der Leichenbestatter mit einem langen Gummischlauch auf mich zu und begann ihn in meine Nase hineinzuschieben, und immer wieder sagte er »Schlucken!« und stieß ihn ein Stück weiter hinein, und dann konnte ich nicht mehr atmen, und es tat weh. Ich bekam keine Luft mehr, um zu sprechen, keine Luft mehr, um zu schreien. Jetzt war es doch ein Begräbnis, Zentner auf meiner Brust, ich starb und starb – und der Schmerz, der furchtbare Schmerz – ich bekam keine Luft mehr –
Ich flog vor und zurück, als mich Erica an der Schulter packte und wach rüttelte.
»Debbie! Du weckst Vater auf!«
Niemand, wirklich niemand, der nicht einmal unter solchen Alpträumen gelitten hat, kann die unaussprechliche Wonne ermessen, die man beim Erwachen empfindet, beim Wiederfinden eines vertrauten Bettes, eines vertrauten Raumes, von Bewegung in den Gliedern; man atmet leicht, nichts tut weh.
»Hab ich dich geweckt?« sagte ich, und es schüttelte mich noch.
»Ja. Du hast geschrien und schrecklich gewimmert. Es ist ungefähr zwei. Ich muß gerade eingeschlafen sein.«
»Tut mir leid, Erica, wirklich leid. Es ist alles in Ordnung.«
»Hast du dich heute abend über etwas aufgeregt?«
»Nein, überhaupt nicht.«
»Ich frage mich, ob es daher kam, daß du mit dem jungen Mann aus warst. Es ist Jahre her, seit du diese Anfälle hattest.«
Ich richtete mich im Bett auf. »Das sind doch keine Anfälle. Ich hab keine Anfälle! Es sind nur Träume, schreckliche Träume. Tut mir leid, daß ich dich aus dem Bett geholt hab. Soll ich dir Tee machen?«
»Nein, nein«, sagte meine Mutter entsetzt. »Damit wäre die Nacht wirklich zu Ende. Tein regt ebenso sehr auf wie Koffein.«
Ich legte mich zurück und streckte mich wohlig aus. Sogar mein dünnes Bein fühlte sich kühl und entspannt an.
»Vielen Dank, daß du gekommen bist. Ich wurde gerade lebendig begraben.«
»Aber Debbie! Manchmal glaube ich, du bist auch noch stolz darauf.«
»Ich bin nicht stolz«, sagte ich. »Aber ich freue mich so riesig, wenn ich auf wache.«
3
Manchmal denke ich, daß gewisse letzte Errungenschaften die fadenscheinigsten Dinge der Welt sind, und zu diesen Errungenschaften gehört bestimmt die Mode, die Eltern mit Vornamen anzureden. Die erklärte Absicht ist natürlich, daß die Generationen von Anfang an in kameradschaftlichem Ton miteinander verkehren, damit der Unterschied zwischen ihnen abgebaut und die Spannungen vermindert werden sollen. In Wirklichkeit ist das glatter Unsinn, denn nichts auf der Welt kann den Unterschied von 20, 30 Lebensjahren aufheben. Weit wichtiger ist eine gute Vorstellungskraft seitens der Kinder und ein gutes Gedächtnis seitens der Eltern; das zweite gibt den Ausschlag, denn ein Kind kann nur versuchen, sich in die Rolle der Eltern hineinzudenken, die Eltern müßten sich aber daran erinnern, wie ihnen als Kindern zumute war.
Trotz ihrer fortschrittlichen Ideen war Erica in dieser Hinsicht nicht besonders gut. Vielleicht hatte sie sich durch den langen Umgang mit Kranken die sensiblen Fühler abgestoßen, die es einem Menschen ermöglichen, sich vorzustellen, wie ein anderer empfindet. Sie war entsetzlich stolz auf ihre beiden anderen Töchter, machte aber ständig ungeschickte Bemerkungen über deren Liebesleben, und ihre Haltung mir gegenüber schwankte zwischen dem Versuch, mich in persönliche Bindungen mit Außenstehenden geradezu hineinzustoßen, und dem Versuch, mich davor zu bewahren.
Alles, wonach ich mich wirklich sehnte, war, das Leben zu leben, das ich selbst gewählt hatte.
Aber niemand zeigte sich übermäßig bereit, mir dieses Leben zu gewähren, mit Ausnahme vielleicht von Douglas, der grundsätzlich alle Bestrebungen unterstützte, die keinen Aufwand von seiner Seite erforderten.
Am nächsten Samstag trafen wir uns alle zum Abendessen, auch Sarah und Arabella, und wir waren kaum mit der Grapefruit fertig, als Erica äußerte, sie habe gehört, der junge Mann namens Hartley hätte zweimal angerufen und ich hätte Minta gesagt, sie solle ihm erzählen, ich sei ausgegangen.
Also mußten wir alle über ihn reden und die Frage diskutieren, ob es gut oder nicht gut sei, wenn ich ihm den Laufpaß gäbe. Jeder vermied umsichtig zu erwähnen, daß dies meine erste Männerbekanntschaft seit vier Jahren war; sie redeten statt dessen von ihm. Sarah kannte ihn gar nicht näher, sie hatte ihn bei David Hambro kennengelernt, und David Hambro hatte ihn durch einen Antiquar kennengelernt und eine Ausstellung von ihm in einer Galerie im East End gesehen. Sie meinte, sie wolle David das nächstemal, wenn sie sich träfen, nach ihm fragen. Ich entgegnete daraufhin, die Familie sei schrecklich, sie lasse absolut niemanden in Frieden.
In der darauffolgenden Woche hatten wir bei Whittington viel zu tun, und am Dienstag aß ich zum Mittagessen nur ein Sandwich und ging erst um vier Uhr aus dem Haus, um eine Tasse Tee zu trinken. Der Tee, den man im Büro von Whittington bekommt, ist nämlich gräßlich.
Als ich in die lärmvolle Düsternis der Grafton Street hinaustrat, sagte eine Stimme: »Wisset, daß das Königreich des Himmels euch nahe ist!«
Ich hätte die Stimme gleich erkennen müssen, aber einen Augenblick lang stutzte ich.
Ich fragte: »Was tun Sie denn hier? Woher wußten Sie, daß ich jetzt herauskomme?«
»Ich wußte es nicht. Heute morgen hatte ich noch keine Plattfüße.«
»Sie wollen doch nicht sagen, daß Sie seit dem Mittagessen auf mich warten?«
»Ich kam gegen zwölf.«
Ein paar Sekunden lang fühlte ich mich sehr sonderbar: geschmeichelt und zornig zugleich, weil ich mich geschmeichelt fühlte, auch zornig auf ihn, der mich zornig auf mich machte, und zudem ein bißchen glücklicher, als ich es zwei Minuten vorher gewesen war. Ich wünschte aber immer noch, ich hätte nichts mit ihm zu schaffen. Ich wandte mich zum Gehen, und er ging neben mir auf der Seite, an der ich keinen Stock habe.
Ich sagte: »Sie müssen verrückt sein. Arbeiten Sie eigentlich irgendwann auch?«
»Unaufhörlich. Aber sehen Sie sich diesen Tag an. Das Licht ist unmöglich.«
»Wie, Sie … Aber es gibt doch noch andere Dinge, die Sie tun könnten …«
»Aber ja. Wohin gehen Sie? Einen Tee trinken?«
»Ja.« Die Unterhaltung war von Beginn an auf ein falsches Gleis geraten. »Warum können Sie mich nicht –«
»Was?«
Ich wollte sagen »in Ruhe lassen«, aber es kam einfach nicht heraus.
»Begleiten, Sie begleiten?« vollendete er den Satz.
»Wenn Sie wollen.«
Wir bogen in die Bond Street ein und überquerten sie. Schräg gegenüber lag ein Café, wir betraten es und bestellten Tee und Toast. Er wirkte jedesmal derber, als ich ihn in Erinnerung hatte. Er saß auf der Kante des Röhrenstuhls wie ein während der Arbeitszeit in einen Salon gebetener Zimmermann.
Er sagte: »Sie sind nie da, wenn ich anrufe.«
»Ja … ich gehe oft aus. Ich –«
»Als wir uns letztesmal trafen, baten Sie mich, den Tatsachen des Lebens ins Gesicht zu blicken, nicht? Soweit ich weiß, beginnen die meisten Tatsachen des Lebens mit: junger Mann trifft Mädchen. Würden Sie mich bitte aufklären, welche weiteren Tatsachen es im vorliegenden Fall gibt?«
Ich fummelte in meiner Tasche. »Wie Sie schon sehr richtig bemerkt haben, als wir uns das erstemal trafen, bin ich gelähmt.«
»Was fehlt Ihnen?«
»Ich hatte Kinderlähmung.«
»Und?«
»Und seitdem ist mein Bein hin. Kapiert? Es ist gute zwei Zentimeter kürzer als das andere, es hat Muskelschwund, es ist so dünn wie ein Stock und zu nichts mehr nütze. Sehen Sie das nicht selbst?«
»Ist das ein Grund, um mich zu hassen?«
Zornig sagte ich: »Kann ich eigentlich nicht lieben oder hassen, was ich will?«
An diesem Punkt der Unterhaltung kam die Kellnerin mit unserer Bestellung, und er blickte mit rotem Kopf beiseite, als ob er darüber brütete, ob er gehen oder bleiben solle. Er blieb, und mit einer vor Erregung zitternden Hand rührte ich in meinem Tee.
Er fragte: »Wie alt sind Sie?«
»26.«
»Ich bin 25. Ich möchte Sie malen.«
»Ach so, deshalb … Und ich dachte immer, Sie seien von meinem unwiderstehlichen Charme gefesselt.«
»Das bin ich auch, verdammt noch mal.«
»Zucker?«
»Nein, danke … Ich glaube, Sie nehmen mich überhaupt nicht ernst.«
»Und das sollte ich wohl?«
»Ja.«
Wir sahen einander feindselig an.
»Wann haben Sie heut abend frei?«
»Warum?«
»Nur so. Sagen Sie mir’s bitte.«
»Oh, erst spät. Halb sieben oder sieben.«
»Ich warte auf Sie.«
»Sie verschwenden Ihre Zeit.«
»Ist doch meine Zeit – oder?«
Ich schlürfte den Tee und verbrannte mir die Lippen.
»Ich wohne in Rotherhithe«, sagte er. »Wissen Sie, wo das ist?«
»In der Nähe der Tower Bridge.«
»Ungefähr. Ich hab ein Atelier in der Nähe von Cherry Garden Pier. Mit Blick über den Fluß. Ich möchte es Ihnen gern zeigen.«
»Einverstanden«, sagte ich.
»Sie kommen wirklich mit?« Er sah ehrlich verblüfft aus.
»Ja … um es anzusehen. Warum nicht?«
»Wann – heut abend?«
»Ja, nur um es zu sehen. Nicht, um mich malen zu lassen. Schlagen Sie sich den Gedanken aus dem Kopf. Heut abend nicht und sonst nicht. Daraus wird nichts.«
»Okay, okay, ich hab ja nur gefragt. In Ordnung also? Wir treffen uns um halb sieben. Dann sind die verfluchten Parkuhren außer Betrieb. Ich steh so nah wie möglich vor dem Eingang. Einverstanden?«
»Einverstanden.«
Er sah mich an. »Sie werden nicht durch den Hinterausgang entrinnen, wenn ich grad nicht herschau?«
»Nein, warum sollte ich?«
Tatsächlich war mir die Idee durch den Kopf geschossen, das zu tun, was er argwöhnte; aber so tief darf man einfach nicht sinken. Er wartete in seinem unbequemen kleinen roten Wagen auf mich, und wir fuhren in südlicher Richtung über Westminster Bridge und bogen dann in die New Kent Road ein. »Der Verkehr ist immer zäh wie Brei um diese Zeit«, sagte er, und sein Gesicht verzerrte sich zu einem Ausdruck des Unbehagens, als er auf die Wagen vor uns starrte, »aber dieser kleine Umweg ist immer noch besser, als gradaus zu fahren.«
Auf der Tower Bridge Road wurde der Brei dünnflüssiger, und er schoß nach vorn. Der Wagen war offen, und der Luftzug blies mir das Haar über die Augen. Ich hob beide Hände, um es festzuhalten, aber er meinte: »Lassen Sie doch, es sieht fabelhaft aus.«
Kurz vor der Brücke bogen wir rechts ab, fuhren an baufälligen Häusern und Strecken von Ödland vorbei, gerieten dann in eine Siedlung des sozialen Wohnungsbaus mit Kinderspielplätzen; danach tauchte eine Gasse mit Kränen am Ende auf. Noch ein paar Kehren, und er hielt in einer engen Straßenschlucht zwischen zwei Lagerhäusern. Wir stiegen aus.
Er machte das Tor mit offenem Vorhängeschloß auf und ging auf einem Weg dem Lagerhaus entlang auf eine zerbröckelnde Backsteinwand zu, dann drei Stufen zu einer alten Tür hoch.
»Hier rauf. Ich geh vor. Da sind wir. Vorsicht, nicht den Kopf anstoßen.«
Wir betraten einen langgestreckten Raum mit abgeschrägten Wänden, die sich nach oben zu offenen Dachsparren hin wölbten. Es waren zwei große Fenster und ein Oberlicht da. Über das Zimmer waren Staffeleien, Kleider, Kissen, Spachtel, Pinsel, Farbtupfen verstreut; es herrschte eine beträchtliche Unordnung. Die Sitzmöbel waren, soweit man sehen konnte, mit abgewetztem grünem Samt, einige mit Leder bezogen. Die Fenster gingen auf den Fluß hinaus.
»Früher war das ein Stall«, sagte er, zog einen Kamm hervor und fing an sich zu kämmen. »Er sollte eigentlich abgerissen werden, als das Lagerhaus gebaut wurde, aber das kleine Fleckchen wurde nicht zur Anlage gebraucht, und so setzte ich mich hier fest. Man kann es natürlich nur mit allem Vorbehalt Wohnung nennen.«
Er war nervös. Eine seltsame Veränderung.
»Ein wunderbarer Ausblick«, sagte ich.
»Kommen Sie zu diesem Fenster; von hier aus sehen Sie die Tower Bridge.«