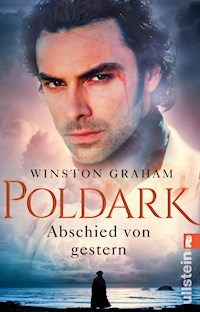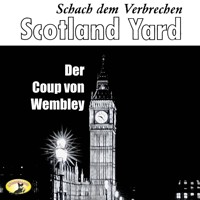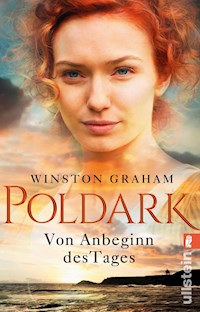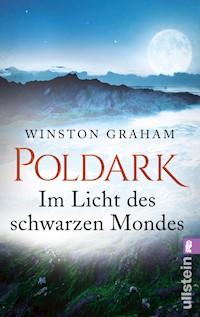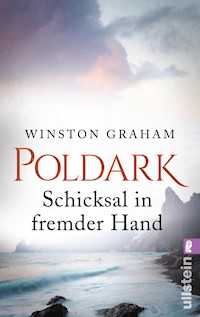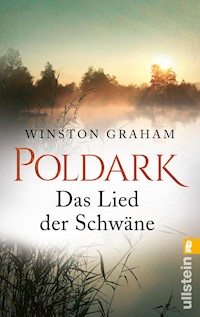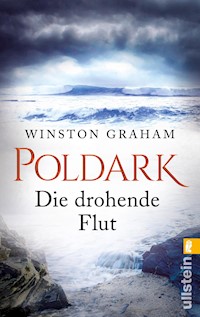3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Durch die Wirklichkeitsnähe und die Lebendigkeit der Erzählung wird der Leser von der ersten bis zur letzten Seite in Atem gehalten. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 224
Ähnliche
Winston Graham
Das Rätsel der Anya Stonaris
Aus dem Englischen
FISCHER Digital
Inhalt
I
Der Jockey-Club in Athen war kaum mehr als ein möblierter Keller; Vanbrugh fand ihn nach kurzem Suchen in der Nähe des schwachbeleuchteten Ommoniar latzes. Zwölf steinerne Stufen führten in die dunkle Tiefe hinunter. Unten nahm ihm ein Portier in der Nationaltracht der Evzonen den Mantel ab. Dann ging es eine zweite Steintreppe hinab und durch einen Vorhang in das Lokal.
Der Jockey-Club war zu ungefähr zwei Dritteln besetzt. Vanbrugh bekam einen Tisch in guter Lage. Er scheuchte die Animiermädchen weg, die ihm unbedingt Gesellschaft leisten wollten, aber als schließlich eine hagere Litauerin ihn anblinzelte, «Amerikani?» fragte und sich an seinen Tisch setzte, machte er keine Einwendungen mehr. Der Kellner, der schon darauf gewartet hatte, goß eilig ein zweites Glas voll.
Vanbrughs Erscheinung hatte nichts Besonderes an sich; sein etwas zerklüftetes Gesicht mit den tiefliegenden Augen hinterließ keinen nachhaltigen Eindruck. Er hätte ebensogut fünfundzwanzig wie vierzig Jahre alt sein können. Er unterhielt sich nicht mit seiner ungebetenen Tischgenossin, die immer wieder von neuem ihr Glas und auch das seine füllte.
An einem Ecktisch saß ein beleibter, schwarzgekleideter Mann mittleren Alters. Ein ungepflegter Bart bedeckte sein Kinn. Vanbrugh runzelte die Stirn wie bei einer unbehaglichen Erinnerung …
Der dicke Mann war der einzige Gast im Lokal, der eine Mahlzeit verzehrte. Ab und zu hielt er dabei inne, um die Krümel von seiner abgewetzten Hose zu fegen oder um in einem Anflug von Wohlerzogenheit ein Rülpsen hinter der Hand zu verbergen. Einmal rutschte ihm ein Stück Fisch aus dem Mund und blieb wie ein Insekt in seinem Bart hängen. Sein Tischgenosse war ein hochgewachsener junger Mann mit einer schmalen Nase und einem weibischen Mund.
Die vier Mann der Tanzkapelle hockten auf einem vergitterten Balkon wie Kanarienvögel in einem Käfig. Sie spielten einen modischen Schlager, und ein halbes Dutzend Paare bewegten sich wie Schlafwandler auf der Tanzfläche.
«Wer ist der Mann da drüben?» fragte Vanbrugh das Mädchen. «Der dicke Mann, der da drüben in der Ecke ißt?»
«Wer? Der da drüben? Kenne ich nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen.»
«Ich schon! Aber das ist nicht wichtig.»
«Kennst du dich in Griechenland aus, Schatz?» fragte sie.
«Ein bißchen.»
«Ich bin noch ganz neu hier.»
«Wo kommst du her?»
«Aus Memel.»
«Weit weg», sagte er einsilbig.
«Ich hab’ ja leichtes Gepäck. Und du?»
Keine Antwort.
Die Kapelle schwieg jetzt, und die Tanzenden gingen an ihre Tische zurück. Zwei der Paare setzten sich an einen Tisch nebenan. Es waren offensichtlich wohlhabende junge Griechen, beide Männer stattlich, aber schon leicht verfettet, eines der Mädchen ziemlich ordinär aussehend, das andere eine wirkliche Schönheit.
Vanbrugh musterte sie durch die dichten Rauchschwaden. Ihr rabenschwarzes Haar war hinten mit einer Brillantspange zusammengehalten. Das elfenbeinzarte Profil zeigte eine schmale, fast zu schmale Nase und Augen von ungewöhnlichem Feuer – die Inkarnation klassischer Schönheit, jedoch auf höchst moderner Grundlage, von den pfirsichfarbenen Fingernägeln bis zu dem mokanten, weltkundigen Lächeln auf ihren Lippen.
Mit jenem sechsten Sinn aller Frauen spürte sie sofort, daß sie angestarrt wurde, und sie schaute zu Vanbrughs Tisch herüber. Ihr Blick glitt flüchtig über den unscheinbaren Amerikaner, das billige Taxi-Girl, den Kellner, der gerade wieder diskret eine neue Flasche in den Kühler schmuggelte, und Belustigung und Verachtung glitzerten kurz in ihren Augen auf, bevor sie sich abwandte.
«Wie lange bist du schon hier?» fragte Vanbrugh das Mädchen.
«Acht Wochen, Schatz.»
«Was habt ihr hier für eine Tanznummer?»
«Die drei Tolosas. Spanier. Sie tanzen wie alle Spanier.»
«Sind sie ganz neu hier?»
«Sie sind seit letzter Woche hier. Kommen direkt aus Paris. Sehr zugkräftige Nummer. Vorher hatten wir eine Truppe aus Mazedonien. Sie war gräßlich.»
«Wann kommt die Tanznummer?»
«Muß jetzt jeden Moment drankommen. Möchtest du vorher noch tanzen, Schatz?»
«Danke, nein.»
«Sehr viel ist offenbar nicht mit dir los.»
Der dicke Grieche hatte jetzt zu Ende gegessen. Er nahm sein Taschentuch, das er sich in den Kragen gesteckt hatte, und wischte sich den Mund ab. Sein lauernder Blick schien Vanbrughs Tisch zu streifen.
«Da sind schon die Tolosas.»
Die Kerzen wurden ausgeblasen, und der Raum füllte sich mit bizarren Schatten. Ein Lichtkegel zitterte auf der kreisrunden Tanzfläche.
«Weißt du zufällig», erkundigte sich Vanbrugh, «wer das Mädchen nebenan ist–das Mädchen mit der Brillantspange?»
«Ich kenne hier keinen Menschen. Ach, die meinst du, wart mal … Stonaris heißt sie, glaube ich, Anya Stonaris. Ich habe ihr Bild in den Illustrierten gesehen.»
Ihre Stimme wurde übertönt vom Trommelwirbel der Kapelle. Vier Mädchen erschienen im spanischen Nationalkostüm und tanzten einen Flamenco. Die Kastagnetten klapperten, und ihre Füße stampften auf den Boden, während im Hintergrund ein als Matador gekleideter Mann zur Begleitung gelegentlich einen Akkord auf der Harfe anschlug. Als Gene Vanbrugh kurz zu ihm hinblickte, sah er, daß er ganz in Schweiß gebadet war.
Nach dem Tanz gingen die Mädchen unter dürftigem Applaus ab, und nur der Matador mit seinem Instrument blieb zurück. Seine blutunterlaufenen Augen blickten forschend in dem kleinen Raum umher.
«Wer ist sie?» fragte Vanbrugh.
«Wer?»
«Diese Anya Stonaris.»
Das Mädchen zuckte mit den Schultern.
«Keine Ahnung. Der Mann neben ihr heißt Manos. Ein Politiker. Er war schon oft hier, aber bisher immer allein.»
Durch die Vorhänge trat jetzt eine Frau auf die Tanzfläche. Sie war jung, etwa zweiundzwanzig, ziemlich dick und ziemlich klein. Die Hände in die Hüften gestemmt, sang sie mit großer Routine und Selbstsicherheit ein französisches Chanson mit voller und etwas heiserer Stimme.
Fast jeder im Lokal verstand französisch, und wer es nicht tat, der verstand doch die unmißverständlichen Andeutungen. Die Augen der Sängerin waren klein, scharf und glitzernd wie Brillanten. Sie verbreitete Stimmung, noch ehe man die Pointen verstanden hatte. Ihr schwarzes Abendkleid paßte ihr wie eine Wursthaut der Wurst. Und als sie nun zu tanzen anfing, benutzte sie ihr Fett, wie ein Komiker eine falsche Nase benutzt, und erntete große Heiterkeit damit.
An dem anderen Tisch drückte Anya Stonaris ihre Zigarette aus. Der Politiker bot ihr sofort devot eine neue an, die sie nahm und langsam in eine lange Spitze aus Bernstein drehte. Dann blickte sie kurz zu Gene herüber, um sich gleich darauf wieder den Vorführungen zuzuwenden. Die dicke Tänzerin hatte ihre erste Nummer beendet, und der Harfenspieler schlug plötzlich zwei, drei dröhnende Akkorde an. Darauf folgten einige Sekunden der Stille, und El Toro persönlich trat in den Ring.
Applaus begrüßte ihn und wurde diskret von den Kellnern verstärkt, denn El Toro war der Star des Abends. Er war mit allem Pomp und aller Großartigkeit des Toreros gekleidet, jedoch an Gestalt nicht größer als seine Partnerin, schön und edel in jedem Detail des Körperbaus und der Gesichtszüge – ein Apoll en miniature.
Der Mann und das Mädchen begannen zu tanzen. Es war der Tanz der Stierkampfarena, heiß und blutig, begleitet vom schrillen Zirpen der Harfe. Sie war der Stier, nicht er. Sie sah jetzt auch fast einem Stier ähnlich mit ihren vollen, schweren Formen, ihrer breiten Nase, ihren dunklen zottigen Locken. Sie schnaubte und stampfte, während er nach uraltem Ritus seinen Körper an dem furchtbaren Gegner entlanggleiten ließ. Der Tanz glich nicht nur einer allegorischen Darstellung des klassischen Stierkampfes, sondern auch der des ewigen Kampfes der Geschlechter.
Vanbrugh nippte an dem gepantschten Sekt. Der Tanz des sterbenden Stiers und des siegreichen Matadors endete. Beide bedankten sich für den stürmischen Applaus.
«Sie sind wirklich gut, nicht wahr?» sagte das litauische Mädchen. «Aber die Dicke, Maria Tolosa, ist natürlich am besten.»
Vanbrugh reagierte nur einsilbig auf den Redefluß des Mädchens. Von den vielen Dingen, die ihn beschäftigten, war das Problem, wie er seine Tischgenossin loswerden könnte, das unwichtigste. Das bei weitem wichtigste war, ob er noch heute nacht versuchen sollte, mit Juan Tolosa zu sprechen. Er war erst vor drei Stunden auf dem Hellenikon-Flugplatz gelandet, und man soll die Dinge nicht übereilen. Außerdem war er ziemlich sicher, daß der dicke, schmatzende Mann, dessen Name vermutlich Mandraki war, ihn erkannt hatte. Und in diesem Fall war es ratsam, vorsichtig zu sein.
Also beschloß er, abzuwarten.
Zu diesem Zeitpunkt konnte er natürlich nicht wissen, daß es morgen schon für alles zu spät sein würde.
II
George Lascou trank gerade eine Tasse Kaffee, als Anya ihn anrief.
«Guten Morgen, Liebling», sagte sie. «Du bist bestimmt schon seit Stunden auf, nicht wahr?»
«Seit sechs Uhr früh. Aber solche Strapazen hast du ja nicht nötig. Noch vier Wochen, und dann habe ich alles hinter mir.»
«Oder es fängt erst richtig an. Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, daß du dich so oder so entspannst.»
«Ich entspanne mich, wenn ich mit dir zusammen bin. Du bist meine Erholung.»
«Dann bist du aber in der letzten Zeit nicht sehr erholungsbedürftig gewesen!»
«Es tut mir leid, Liebling. Mir geht es genauso gegen den Strich wie dir, aber du weißt doch, wie mein Leben augenblicklich aussieht. Heute morgen haben wir eine Pressekonferenz um elf. Um fünf findet ein Treffen der Parteileitung statt. Heute abend muß ich eine Rede vorbereiten. Wenn die Wahlkampagne erst richtig anläuft, wird alles leichter sein. Und was hast du heute vor?»
«Um elf habe ich eine Pressekonferenz mit meinem Friseur. Um fünf werde ich einen Hut kaufen. Das wird mir die Zeit bis sieben vertreiben, und dann gehe ich zu einer Cocktailparty bei Maurice Taksim.»
«Und was hast du gestern abend gemacht?»
«Ich habe mit Jon Manos und zwei Bekannten von ihm gegessen, dann gingen wir in den Jockey-Club und tanzten ein bißchen. Ohne dich hat’s mir nicht viel Spaß gemacht.»
«Wohin seid ihr gegangen?»
«In den Jockey-Club.»
«Hat Manos das vorgeschlagen?»
«Ja. Es gibt dort ein recht gutes neues Programm. Ich bin so gegen zwei wieder zu Hause gewesen. Liebling, es ist ein hochanständiges Lokal. Man ist eher von Langeweile als vom Laster bedroht. Wir müssen einmal zusammen hingehen.»
«Ja, ja, natürlich, ich kenne das Etablissement.»
Er schenkte sich eine zweite Tasse Kaffee ein. Das schwere silberne Kaffeeservice und der riesige Smaragdring an seiner linken Hand blitzten in der Morgensonne.
«Aber du scheinst trotzdem etwas verstimmt zu sein, nicht?»
«Nicht im geringsten.» Er rieb einen Kaffeetropfen von der Tischdecke und leckte die Feuchtigkeit von seinen Fingern.
«Was hast du denn?»
«Vielleicht sollte man augenblicklich doch besonders vorsichtig sein», sagte er leicht irritiert. «Die Presse der Gegenpartei weiß von unserer Beziehung, und sie ist dauernd auf irgendwelche Skandalgeschichten aus. Ein unbeobachteter Schnappschuß … eine Chance, mich zu kompromittieren.»
«Du kannst dich ja jederzeit von mir distanzieren.»
«Das werde ich vielleicht tun, in meinem Sarg, aber vorher bestimmt nicht.»
«So galant, Liebling, und noch vor dem Mittagessen!»
Er lachte.
«Man tut, was man kann», antwortete er. «Wie hat dir das neue Programm im Jockey-Club gefallen?»
«Es war sehr spanisch.»
«Ist das alles?»
«Nein. Die Gesangsnummern waren mäßig, aber sie tanzten gut.»
«Waren es nur Mädchen?»
«Nein, zwei Männer waren dabei. Einer tanzte, und einer spielte auf der Harfe. Außerdem eine Frau. Sie nennen sich die drei Tolosas.»
«Schön. Ich freue mich, daß es dir gefallen hat. Aber ich muß mit Jon Manos reden.»
«Wozu denn? Ich kann ja die nächsten vier Wochen von der Bildfläche verschwinden.»
«Unsinn, Liebling, du übertreibst. Sag mir lieber, wann du wieder nach Sounion fährst …» Er machte jetzt leichte Konversation, um das früher Gesagte belanglos erscheinen zu lassen.
Nachdem er den Hörer aufgelegt hatte, schlürfte George Lascou nachdenklich seinen Kaffee. Dabei betrachtete er sich selbst im Wandspiegel und vergewisserte sich, daß er immer noch ganz stattlich und immer noch Anfang Vierzig war. Dennoch ärgerte er sich, denn Anya hatte natürlich seine Erregung bemerkt. Er hätte sich beherrschen sollen.
Sein Sekretär trat ins Zimmer.
«Wo waren wir stehengeblieben, Otho?»
«Der letzte Absatz hieß: ‚Aristoteles sagte, daß die wahre Tugend darin bestehe, Liebe und Haß in der richtigen Proportion zu empfinden. Bei der bevorstehenden Wahl sollten wir also …‘»
«Richtig, aber lassen wir das für den Moment. Verbinden Sie mich bitte mit Manos, bevor wir fortfahren.»
Otho legte seinen Stenoblock auf die Seite und wollte den Raum verlassen.
«Und auch mit Major Kolono!» fügte Lascou hinzu. «Sie erreichen ihn im Polizeipräsidium. Sagen Sie ihm, ich erwarte ihn hier heute nachmittag um halb fünf. Es handelt sich um eine persönliche Angelegenheit.»
Lascou las inzwischen Briefe, schrieb grobe Bemerkungen an den Rand, stand auf, zündete sich eine Zigarette an und blickte aus einem der Fenster auf die Straße hinunter. Er konnte von diesem oberen Stockwerk aus das Grab des Unbekannten Soldaten sehen und das Alte Schloß, in dem das Parlament tagte.
Wer ihn so sah, gedankenvoll und in sich selbst gekehrt, mußte anerkennen: ein gutaussehender Mann, mit jener wächsernen Blässe, die vielen Griechen eigen ist. Er wandte sich um, als Otho wieder ins Zimmer trat.
«Ich habe Mr. Manos in seinem Büro angerufen, aber er war bei Gericht. Ich habe hinterlassen, er möge nach seiner Rückkehr sofort hier anrufen.»
Lascou drückte seinen Zigarettenstummel wütend im Aschenbecher aus.
«Nein! Holen Sie ihn aus dem Gericht heraus. Ich muß ihn sofort sprechen.»
Es war genau elf Uhr morgens.
III
Um drei Uhr nachmittags desselben Tages ging eine stämmige junge Frau durch die Anlagen des Zappeionparks. Ein leuchtend rotes Kopftuch bedeckte ihre schwarzen Haare. Ihre Augen waren vom vielen Weinen geschwollen, aber jetzt weinte sie nicht mehr. Ziellos ging sie durch den Park, ohne auf den Weg zu achten. Zufällig blieb sie vor einem Denkmal stehen und starrte es an, ohne es aber recht wahrzunehmen. Ein Mann, der ihr gefolgt war, trat neben sie und betrachtete das Denkmal ebenfalls. Nach einer Weile drehte er sich zu ihr um.
«Er ist auch hier gestorben», sagte er auf englisch.
«Was? Wer?» Sie starrte ihn mit kalten, wütenden Augen an. «Was sagen Sie da?»
«Der Dichter Byron. Das ist sein Denkmal. Er liebte Griechenland mehr als sein eigenes Vaterland.»
«Wenn Sie von der Polizei sind, dann spucke ich Ihnen ins Gesicht!»
«Wenn ich von der Polizei wäre, könnten Sie sich dadurch Unannehmlichkeiten zuziehen.»
«Sie sind also nicht von der Polizei?»
«Nein.»
«Dann scheren Sie sich weg!»
Sie drehte ihm den Rücken und ging schnell davon. Es waren nicht viele Leute in der Nähe, und er folgte ihr in seiner geschmeidigen, katzenhaften Gangart.
«Sagen Sie mir eines», fing er an, als er sie eingeholt hatte und neben ihr herging, «wie ist der Unfall eigentlich passiert? Ich wollte Juan heute vormittag aufsuchen und erfuhr davon.»
Sie waren nun am andern Ende des Parkes angelangt. Kurz vor dem Ausgang blieb sie stehen und blickte ihn an. Sie schnaubte wieder wie ein Stier. Sie wirkte trotz ihrer kleinen Statur irgendwie bedrohlich und durchaus fähig, ihn auf offener Straße mit einem Hieb zu Boden zu schlagen.
«Wer sind Sie?»
«Ein Freund. Ich heiße Gene Vanbrugh.»
«Was wollen Sie von mir?»
«Gestern abend war ich im Jockey-Club. Heute morgen wollte ich Ihrem Mann einen geschäftlichen Vorschlag machen, aber ich kam zu spät.»
«Sie kamen zu spät! Das tut mir leid. Aber damit ist die Angelegenheit ja wohl erledigt, nicht wahr?»
«Nicht unbedingt.»
«Warum nicht?»
«Ich könnte meinen Vorschlag unter Umständen auch Ihnen machen, Madame Tolosa.»
«Glauben Sie, daß mir jetzt nach geschäftlichen Vorschlägen zumute ist? Machen Sie, daß Sie wegkommen.»
«Wie ist der Unfall passiert? Er ist überfahren worden, nicht wahr?»
«Scheren Sie sich weg, oder ich rufe einen Schutzmann! Da drüben steht schon einer.»
«Vielleicht hat Ihr Mann manchmal etwas zuviel riskiert, glauben Sie nicht?»
Das schien ihr einen Schock zu versetzen.
«Wie meinen Sie das?»
«Trinken Sie eine Tasse Kaffee mit mir, und ich werde Ihnen sagen, was ich meine.»
Sie zögerte, faßte mit der Hand an einen ihrer Ohrringe und sah Vanbrugh von der Seite an. Sie musterte die scharfe Linie seiner Backenknochen, den alten, schlecht gebügelten Anzug, die knochigen Hände, die er aus Nervosität abwechselnd in die Taschen steckte und wieder herausnahm.
«Ich brauche keinen Kaffee. Aber wenn Sie mir etwas zu sagen haben, dann will ich mit Ihnen kommen.»
Er nickte mit verkniffenem Mund.
«Ja. Ich habe Ihnen etwas zu sagen.»
Sie setzten sich an einen Tisch, der durch eine Glasscheibe vor der Zugluft geschützt war. Es war ein kühler und windiger Tag. Nur wenig Leute befanden sich zu dieser Stunde in dem Café, und der gähnende Kellner wischte in mehr symbolischer als nützlicher Weise mit seiner Serviette über die Tischplatte. Gene Vanbrugh bestellte Kaffee für sich und einen Kognak für die Frau.
«Also?» sagte sie und sah ihn an.
«Wie ist der Unfall passiert?»
«Unfall? Es war kein Unfall.»
«Erzählen Sie’s mir.»
«Heute morgen um neun rief ihn jemand an. Ich weiß nicht, wer es war, er hat es mir nicht gesagt. Als er aus dem Haus trat, wurde er von einem Auto überfahren, das auf ihn gewartet hatte. Ich habe es vom Fenster aus gesehen, denn ich wollte ihm etwas nachrufen. Der Wagen fuhr langsam die Straße herunter. An der Ecke versperrte ein Lastwagen die Kreuzung, so daß keine anderen Fahrzeuge in der Nähe waren. Der Wagen schwenkte direkt hinter Juan seitlich auf den Bürgersteig. Juan versuchte in der letzten Sekunde, beiseite zu springen, aber der Wagen drückte ihn gegen die Wand. Ich … ich sah sein Gesicht in dieser Sekunde, es war gräßlich …»
Sie schwiegen beide.
«Das tut mir sehr, sehr leid …» murmelte Gene schließlich. «Es konnte also bestimmt kein Unfall gewesen sein?»
Sie wischte die Tränen von ihrem Gesicht.
«Die Polizei tut so, als glaube sie an die Geschichte mit dem Unfall. Aber sie sind entweder Idioten oder Lügner.»
«Wurde der Wagen beschädigt?»
«Ja, vorn am Kühler. Er wendete dann schnell und fuhr den gleichen Weg zurück.»
«Haben Sie den Fahrer erkennen können?»
Sie schüttelte den Kopf.
«Nein. Nun, was haben Sie mir zu sagen?»
Er bot ihr eine Zigarette an, aber sie schüttelte wieder ungeduldig den Kopf und blickte ihn mißtrauisch an, als er sich langsam, fast bedächtig selber eine anzündete.
«Ich wollte Ihren Mann aufsuchen», erklärte er dann, «weil er, soviel ich weiß, etwas zu verkaufen hat.»
«Ich weiß nicht, wovon Sie reden.»
«Hat die Polizei seine Sachen durchsucht?»
«Nein, ich glaube nicht, ich bin aber nicht ganz sicher. Seitdem es passiert ist, bin ich nicht recht zum Bewußtsein gekommen. Ich bin schließlich aus dem Haus gelaufen, nur um zu laufen, zu atmen, zu denken.»
Der Kellner brachte den Kognak und den Kaffee und klapperte unnötig laut mit den Gläsern und Tassen. Der Kaffee war breiig und süß. Beim Trinken runzelte Vanbrugh die Stirn.
«Vor zwei Wochen waren Sie und Ihre Truppe in Paris, nicht wahr?»
«Na und?»
«Im Katalan-Club. Ich wohne nämlich in Paris.»
«Sie haben uns tanzen gesehen?»
«Nein. Ich muß gestehen, daß ich mir nicht viel aus Nachtlokalen mache. Aber ein Freund von mir hat Juan Tolosa kennengelernt. Ihr Mann spielte ziemlich viel Poker, nicht wahr?»
«Was geht das Sie an?»
«Mein Freund und Juan haben oft miteinander Poker gespielt. Ihr Mann hat meistens verloren. Einmal hat er zuviel getrunken und wurde etwas unvorsichtig. Er erwähnte einen gewissen Plan, den er später in Athen ausführen wolle, er nannte auch einen bestimmten Namen. Mein Freund wußte, daß ich mich für diesen Namen interessiere. Als er mich kurz danach traf, erzählte er mir davon, inzwischen waren Sie aber schon abgereist. Ich arbeite in Paris und konnte nicht auf der Stelle wegfahren. Ich bin erst gestern in Athen angekommen.»
Die Frau griff nach dem Glas, zögerte kurz und goß dann den Kognak in einem Schluck hinunter.
«Sagen Sie mir, wer Juan umgebracht hat. Das ist alles, was ich wissen will!»
«Ich habe keine Beweise, die genügen würden.»
«Nennen Sie mir den Namen, und ich gehe nicht zur Polizei.»
Er sah sie scharf an.
«Ich glaube Ihnen, aber es hätte keinen Zweck. Sie würden sich nur selbst in Gefahr begeben und …» Er hielt inne. Ein leichter Schatten war über ihren Tisch gefallen. Vanbrugh stand auf. «Nehmen Sie Platz», sagte er, «ich hatte schon gehofft, daß Sie kommen würden.»
Philip Tolosa, der Harfenspieler, entgegnete auf englisch: «Ich habe jetzt nicht den Wunsch, mich mit Reportern zu unterhalten. Komm, Maria.»
Das Gesicht des Spaniers war verhärmt, und seine Jacke starrte vor Schmutz. Er war viel größer als sein Bruder, fast so groß wie Gene. Maria erhob sich ebenfalls. Zwischen den beiden erfolgte ein kurzer heftiger Wortwechsel in kastilischem Dialekt. Tolosa musterte Gene mit mißtrauischen und blutunterlaufenen Augen. Er schien sehr nervös zu sein.
«Sind Sie sicher», fragte Vanbrugh, «daß Sie über die Grenze kommen werden? Wissen Sie genau, daß man Sie hinauslassen wird?»
Die Frau stieß ihren Stuhl heftig beiseite.
«Was wollen Sie eigentlich? Womit drohen Sie uns die ganze Zeit?»
«Ich drohe Ihnen mit nichts. Aber vielleicht weiß Ihr Schwager, was ich meine.»
«Ich weiß überhaupt nichts und will auch nichts von Ihnen wissen. Komm, Maria!»
«Dieser Mann sagt …»
«Komm, Maria!»
Sie zuckte die Schultern und blickte Gene unentschlossen an.
«Falls Sie mich irgendwann brauchen sollten», bemerkte Gene, «ich wohne im Astoria. Sie können mich dort jederzeit anrufen oder aufsuchen.»
Mehr konnte er jetzt nicht tun. Er setzte sich wieder und beobachtete die beiden, wie sie sich entfernten.
IV
Als es fünf schlug, überquerte Vanbrugh den Kolonakiplatz. Die Gegend, in der er sich hier befand, war ein vornehmes Viertel mit stattlichen Häusern und hübschen Gärten.
Er steuerte einem Haus zu und klingelte. Dem Halbblutmädchen, das ihm öffnete, schien es mehr als zweifelhaft, ob Madame Lindos diesen Fremden empfangen würde. Er nannte seinen Namen und wartete vor der Tür.
Bald darauf wurde er in einen kleinen Salon geführt, wo eine vornehme alte Dame vor einem Kaminfeuer saß und ein Fotoalbum in der Hand hielt.
Er küßte erst ihre Hand, dann ihre Wange, während ihr sanfter, aber kluger Blick ihn forschend von Kopf bis Fuß musterte.
«Du bist also wieder einmal aufgetaucht, Gene. Hast du kein richtiges Heim?»
Er lächelte.
«Nein, kein Heim. Wie geht es dir?»
«Wenn man so alt ist wie ich, ist man dankbar, daß man überhaupt noch am Leben ist. Hast du übrigens Monsieur Vyro schon kennengelernt?»
Gene erblickte einen untersetzten älteren Herrn mit einem grauen Backenbart, der am Fenster stand.
«Monsieur Vyro ist der Besitzer von Aegis, einer unserer ältesten Tageszeitungen.»
«Und einer der bedeutendsten», ergänzte Gene.
Monsieur Vyro verbeugte sich.
«Sehr liebenswürdig. Sind Sie Engländer oder Amerikaner?»
«Amerikaner.»
«Und womit beschäftigst du dich jetzt, Gene?» fragte Madame Lindos. «Das letztemal warst du …»
«Ja, ich bin noch im Verlagsgeschäft.»
«Mr. Vanbrugh ist der europäische Vertreter des New-Yorker Verlagshauses Muirhead und Lewis.»
«Dann haben wir ja gemeinschaftliche Interessen», meinte Vyro. «Sind Sie geschäftlich hier?»
«Zum Teil. Wir vertreten zwei griechische Autoren, Michaelis und Paleocastra.»
«Ah, Michaelis, den Lyriker. Ja, er ist ein echter Repräsentant unseres klassischen Stils.»
«Ich bin aber auch hier, um alte Freunde aufzusuchen – darunter Madame Lindos, die sich immer so gut in allen Angelegenheiten auskennt, die mich interessieren.»
«Das stimmte vielleicht früher, Gene; heutzutage besuchen mich nur noch wenig Leute.»
«Aber die allerwichtigsten», sagte Gene.
«Nur gerade meine ältesten Freunde. Monsieur Vyro hier kenne ich seit beinahe fünfzig Jahren. Und was führt dich gerade jetzt hierher?»
«Eure Wahlen interessieren mich. Ich wollte dich fragen, wer siegen wird.»
«Um die Ecke wohnt ein Wahrsager. Meine Zofe kann dich bei ihm einführen.»
Wenn Vanbrugh lächelte, veränderte sich sein Gesicht vollkommen; alle Härte und Verkniffenheit wich aus ihm.
«Was ist diese EMO unter Führung von George Lascou für eine neue Partei?» erkundigte sich Gene.
«Wie ich sehe, bist du immer noch ziemlich gut informiert», sagte Madame Lindos trocken.
«Wie ist dieser Lascou?»
Niemand antwortete zunächst auf diese Frage; es schien, als ob sie in einem leeren Zimmer geäußert worden sei. Schließlich sprach Vyro.
«Er ist intelligent und gebildet», erklärte er. «Sein Vermögen verschafft ihm großen Einfluß. Aber ich persönlich bezweifle, ob er dynamisch genug ist, um eine volkstümliche Figur abzugeben. Er hat etwas Dilettantisches an sich.»
«Du bleibst doch zum Tee, Angelos?» fragte Madame Lindos.
«Nein, vielen Dank, aber ich muß fort. Sie bleiben noch einige Zeit hier, Mr. Vanbrugh?»
«Etwa eine Woche. Ich weiß es selbst noch nicht genau.»
«Heute in einer Woche wird das Jubiläum des fünfzigjährigen Bestehens meiner Zeitung gefeiert. Ich bin stolz darauf, sie in einem Hinterhof gestartet zu haben, als ich dreiundzwanzig Jahre alt war. Anläßlich dieses Jubiläums wollen wir zwei neue Druckpressen einweihen. Ich sprach gerade mit Madame Lindos über den Empfang, der vorher hier stattfinden wird. Es wäre eine Ehre für uns, besonders im Hinblick auf Ihren Beruf, wenn Sie daran teilnehmen würden.»
«Mit großem Vergnügen. Vielen Dank.»
«Das ist mein ältester noch lebender Freund», sagte Madame Lindos, nachdem Vyro sich verabschiedet hatte. «Er war auch der Freund meines Mannes. Ein fabelhafter Mensch.»
«Sprich bitte griechisch mit mir, Sophia», bat Gene, «ich komme ganz außer Übung.»
«Glaubst du, daß du Übung demnächst brauchen wirst?»
«Sie könnte jedenfalls von Nutzen sein.»
Madame Lindos stand auf. Der Gelenkrheumatismus erschwerte ihre Bewegungen, aber sobald sie auf den Füßen war, stand sie so aufrecht wie er selber.
«Komm jetzt in den großen Salon zum Tee, und nachher will ich wissen, was du hier treibst.»
«Ich glaube, du traust mir nicht ganz?»
«Da hast du recht.» Das Dienstmädchen trat ein und öffnete die Doppeltüren, die zu einem sehr großen und eindrucksvollen Raum führten. Ein kleiner Tisch war für den Tee gedeckt: eine silberne Kanne, die Tassen dünn wie Eierschalen, Löffel mit dem Familienwappen der Lindos.
«Gefällt dir dein Verlegerberuf wirklich?» erkundigte sich Sophia, als sie sich gesetzt hatten.
«Er macht es mir möglich, in Paris zu leben.»
«So lang wie diesmal hast du noch nie irgendwo gelebt, nicht wahr? Bisher warst du immer auf der Wanderschaft. Du bist zuviel herumgekommen, hast zuviel gesehen, als du jung warst.»
«Ich komme immer noch ganz schön herum – mal nach Deutschland, mal nach England oder nach Italien …»
«Und manchmal nach Griechenland. Weiß hier sonst niemand, daß du wieder da bist?»
«Wen interessiert das schon? Sag mal, Sophia, kennst du eine Frau namens Anya Stonaris?»
«Die Mätresse von George Lascou?»
Gene blickte in seine Teetasse.
«Was weißt du von ihr?» fragte er zurück.
«Sehr wenig. Sie ist noch ziemlich jung, aber sie sind schon lange zusammen. Sie wird oft fotografiert und abgebildet, denn sie ist sehr schön und sehr apart. Sie soll aber ein harter, kalter Mensch sein, der einen schlechten Einfluß auf ihn ausübt. Er hat eine Frau und zwei Kinder, und vor den Wählern posiert er als der liebende Familienvater. Aber fast jeder in Athen weiß über die Liaison Bescheid.»
«Von Lascou habe ich schon vor Jahren gehört», sagte Gene, «aber bevor er sich politisch betätigte, habe ich mich nicht weiter für ihn interessiert.»
«Und jetzt?»
«Man hört verschiedene Meinungen. Manche sagen, daß er bald die einflußreichste Figur in Griechenland werden wird.»