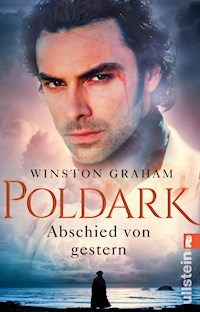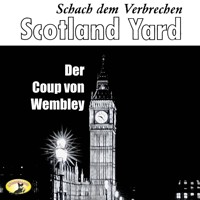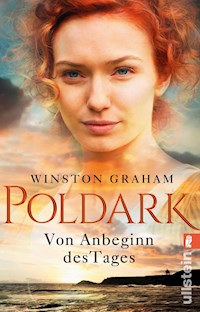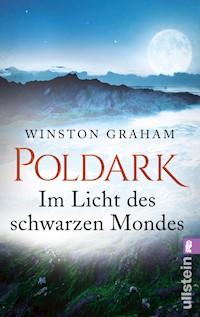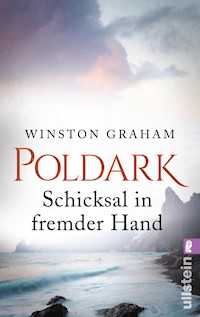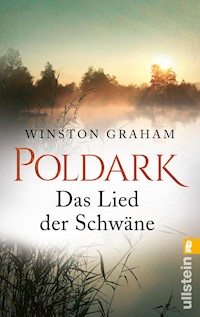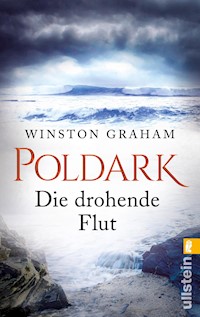3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Sie hatte ihm den Weg zum erfolgreichen Dramatiker mit allen Mitteln geebnet. Als sie dann unheilbar erkrankt und er zudem an die große Liebe seines Lebens gerät, da kommt es zu dieser unbegreiflichen Tat. Er droht, an seiner Schuld zu zerbrechen, und will sie tilgen – koste es, was es wolle ... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Ähnliche
Winston Graham
Tödlicher Dank
Aus dem Englischen von Eva Schönfeld
FISCHER Digital
Inhalt
Erstes Buch
1
Einen Tag nach unserer ersten Begegnung flog ich nach London zurück. Ich hatte Harriet versprochen, Freitag abend pünktlich zu Hause zu sein.
Wir waren gerade in die neue Wohnung am Spanischen Platz umgezogen. Bei der Ankunft erfuhr ich, daß sie vier Freunde zum Abendessen eingeladen hatte – wahrscheinlich, weil sie ein bißchen mit der neuen Wohnung protzen wollte, und weniger aus reiner Sehnsucht nach Gesellschaft – obwohl im Fall Tim Dickinson vielleicht beides zusammenkam.
Der Mittelpunkt der Wohnung war das große Wohnzimmer; es war hoch und geräumig, mit zwei gewaltigen Fenstern. Den gekachelten Kamin hatten wir durch einen größeren aus Ziegelsteinen ersetzt. Davor standen zwei smaragdgrüne Plüschsofas rechteckig an den Kanten eines Angola-Teppichs. Hinter dem einen Sofa war eine geschnitzte afrikanische Truhe, die als Bar diente. Der lange Eßtisch, eine Marmorplatte auf schmiedeeisernen Beinen, stand zwischen den Fenstern.
Normalerweise kümmerte Harriet sich nicht viel um die Küche. Aber bei besonderen Gelegenheiten zeigte sie, was sie konnte. Das heutige Abendmenü war vorzüglich. Trotzdem konnte ich meine Gedanken kaum von dem Mädchen losreißen.
Nun bin ich weiß Gott alles andere als ein Schürzenjäger. In den sieben Jahren meiner Ehe mit Harriet hatte ich kaum eine andere angesehen. Natürlich hatten wir unsere Höhe- und Tiefpunkte; an letzteren war meist Harriets schwankende Gesundheit schuld. Ich hatte zielbewußt gearbeitet und war ganz zufrieden gewesen. Jedenfalls hatte ich nicht entfernt vorgehabt, in Paris über die Stränge zu schlagen.
Aber man braucht sich so etwas nicht vorzunehmen. Der Blitz schlägt ein, und «es» ist passiert.
Unsere Gäste heute waren: Ralph Diary, mein Agent, der nach acht Jahren «in der Wüste» endlich an mir verdiente, Jude, kahlköpfig, lispelnd, ruhig und gescheit; Tim Dickinson, ein alter Freund Harriets, groß und hager, Rechtsanwalt mit gutem Einkommen und guten Verbindungen, kriegsversehrt – er trug eine Beinprothese – und geschieden; die blonde Schauspielerin Mary Arlett und die Bühnenbildnerin Isabel Chokra, die mit dem Marine-Attaché der thailändischen Botschaft verheiratet war.
Sie fragten mich nach Paris aus. Ich erzählte ihnen, daß Paul Charisse die Regie meines neuen Stücks übernehmen wollte, und daß er hoffte, zwei Prominente für die Hauptrollen zu bekommen. Man wartete nur noch auf die französische Übersetzung, die in etwa einer Woche fällig war.
Was ich nicht erwähnte, war die Cocktailparty, die Charisse im Hotel gegeben hatte. Es war die banalste Art und Weise, ihr zu begegnen. Aber das Leben ist nun mal banal; man weicht ihm nicht aus, indem man vor dem Üblichen zurückschreckt.
Der Regisseur Paul Charisse brauchte sich als Sohn eines Zeitungsmagnaten nicht einzuschränken. Er war auch nicht sklavisch ans Theater gefesselt. Jules Leblanc, der fast sichere Hauptdarsteller, war ein untersetzter Zyniker. Er kommentierte die anwesende Gesellschaft.
«Das ist der Herzog Beloff. Sein Monokel verbirgt ein Glasauge. Er behauptet, er hätte das Auge im Krieg verloren, aber in Wirklichkeit hat Madame Job es ihm ausgestochen. O ja, Madame Job ist auch hier … da drüben. Gesicht wie ein Wolfshund, nicht? Hübsch war sie nie, aber in ihrer lasterhaften Vitalität rasend interessant. Ihr Gatte ist so eine stinkreiche Toulouse-Lautrec-Figur; er besitzt eine Jacht in Cannes, die er nie benutzt, aber auch niemandem borgt. Und da, erkennen Sie unseren ehemaligen Kriegsminister? Er wird demnächst an seiner Schüttellähmung eingehen; er hat sich das Leiden durch zu häufiges Nicken zugezogen. Und das ist Lord Antar … Als das Penicillin auf den Markt kam, war seiner Nase leider nicht mehr zu helfen …»
Leblancs Lästerreden wurden von zarten Melodien untermalt, die eine ältere Dame in Chiffon, deren Gichtknoten an den Alten Fritz erinnerten, einem Konzertflügel entlockte. Wie weit war das alles von meiner vollgestopften Schriftstellerbude entfernt, in der ich vor knapp anderthalb Jahren den Grundstein zu diesem seltsamen Treffen gelegt hatte!
Sie saß in der Nähe des Flügels und unterhielt sich mit einem ausgehöhlten, aschgrauen Herrn. Als ich sie ansah, erwiderte sie meinen Blick.
Liebe, Sympathie, der erotische Funke – egal, wie man’s nennt – hängen, glaube ich, kaum von Äußerlichkeiten ab. Als ich jetzt, nur vierundzwanzig Stunden später, beim Abendessen mit meiner Frau und unseren vier Freunden plauderte, konnte ich mir ihr Gesicht nicht mehr genau vergegenwärtigen. Es war auf jeden Fall reizend; aber daran lag es nicht. Es liegt nie nur daran. Trotzdem beunruhigte es mich als Schriftsteller, daß ich dieses plötzliche Verliebtsein nicht richtig begründen konnte. Wie sollte ich je glaubhafte Figuren auf die Bühne stellen, wenn ich nicht einmal über mein eigenes Innenleben Bescheid wußte?
Tim Dickinson fragte mich wieder etwas. Zugleich sah ich, daß Harriet ihr Sektglas nachfüllte.
«Charisse hat schon bei zwei Anouilh-Stücken Regie geführt», antwortete ich. «Zwei von den ‹schwarzen› Stücken. Mein Stil liegt ihm sicher. Allerdings verstehe ich nicht recht, warum manche Leute dauernd über die Ähnlichkeit zwischen Anouilh und mir –»
«Blödsinn, lieber Morris. Anouilh – verzeih – ist immer noch der Meister dieses Genres. Euch verbindet lediglich der Sinn für wüste Komik und verzweifelte Groteske. Und daß ihr euch darüber halbtot lacht.»
Wir diskutierten darüber eine Weile in aller Freundschaft. Tim als Theaterliebhaber hatte mehr Argumente als wir andern zusammen. Er war der hochgebildete Amateur, wie sie uns oft Vergnügen, aber noch öfter Ärger machen. Er hatte ein paar Semester Psychologie studiert, bevor er auf Jura umsattelte, und sich nach seiner Amputation als Psychiater in einem Lazarett betätigt.
Isabel Chokra, die ich vom Theater her länger kannte als die anderen Gäste, verwickelte Tim nun glücklicherweise in ein Gespräch über Anouilh; ich überließ mich wieder meinen eigenen Gedanken.
Ich weiß nicht mehr, wie wir uns kennenlernten; unser erstes Gespräch jedenfalls war nicht am Flügel. Ich fragte sie auf französisch, ob ich ihr noch ein Glas Champagner holen dürfte, und sie erwiderte: «Danke, der Kellner bringt mir grad eins. Übrigens bin ich Engländerin.» Von nahem wirkte sie nicht so zerbrechlich wie von weitem; ihre Lippen waren voller. Auch war sie jünger, als ich gedacht hatte. Sie lächelte offen und rückhaltlos; sie schien lebensfreudig und lebenshungrig zu sein.
«Macht’s Ihnen Spaß hier?» fragte ich.
«O ja. Und Sie sind also Morris Scott …» Ihre Stimme war sehr reizvoll und seltsam singend. «Haben Sie nicht gerade einen sensationellen Erfolg in London gehabt?»
«Das Stück läuft noch. Verzeihung, darf ich nach Ihrem Namen fragen? Offizielle Vorstellungen scheinen hier nicht üblich zu sein.»
«Warum auch? Ich bin nur zufällig hier. Alexandra Wilshere, Sekretärin.»
Ein Kellner kam mit einem vollen Tablett, und wir nahmen beide ein Glas. Es war keine gewöhnliche Party, wo man nur mit Fußschmerzen und leichtem Sodbrennen herumsteht; hier bahnte sich etwas Neues an. Ich war zwar erst zweiunddreißig, aber darauf war ich nicht gefaßt.
Der Sekt hatte nichts damit zu tun. Auch heute gab es drei Flaschen, für die Harriet gesorgt hatte. Vielleicht löste er den andern die Zunge; meine nicht. Ich sah mir meine Frau über den Tisch hinweg genau an.
Sie war neununddreißig, hochgewachsen und überschlank. Ihr feinknochiges, intelligentes Gesicht war nie im üblichen Sinne «schön» gewesen und mit den Jahren und wegen ihres Leidens war sie immer herber geworden. Sie trug ihren bevorzugten Hausanzug; cremefarbene Seidenbluse und schwarze Samthosen. Das also war Harriet, die mich sieben tapfere Ehejahre hindurch ermutigt, beraten, angeregt und unterstützt hatte.
Sie sprach über ihr ewiges Thema: mich. Leider vertrug sie seit zwei Jahren keinen Alkohol mehr. Eine Abstinenzlerin war sie nie gewesen, aber jetzt stieg ihr ein harmloses Gläschen manchmal zu Kopf wie andern eine halbe Flasche Whisky. Das hing mit ihrer geschwächten Widerstandskraft zusammen.
«Hauptsache», sagte sie gerade, «er läßt sich nicht einschüchtern und fängt nicht an zu klügeln. Ich halte Morris für ein Naturtalent. Das Technische schafft er instinktiv – so was hat man eben, oder man hat es nicht. Hoffentlich wird er nie so hochgelobt, kritisiert und analysiert, wie der arme Christopher Fry; den hat man ja total zerredet. Wenn er sich bl-bloß von allem zurückziehen könnte, v-von all der Klugschnackerei, den hinkenden V-vergleichen …»
Was sie sagte, stimmte, aber ihr alkoholbedingter Scharfsinn reizte mich heute mehr als sonst. In diesem Stadium redete sie immer von mir als ob ich gar nicht dabei wäre. Ich kam mir vor wie ein Rennpferd, auf das Fachkundige die größten Hoffnungen setzten. Ihr Besitzerstolz war verständlich, aber konnte ihr nicht mal irgendein Psychologe, notfalls sogar Tim, die Auswirkungen auf mich klarmachen?
Mechanisch glitten meine Gedanken wieder zu dem zweiundzwanzigjährigen Mädchen von gestern abend. Unsere Unterhaltung war bald von Paul Charisse unterbrochen worden, der mich mit ein paar französischen Bühnengrößen bekannt machte.
Ich entwich ihm bei erster Gelegenheit und ging wieder zu Alexandra. Da brach die Gesellschaft leider schon auf.
«Ich bin Sekretärin der Comtesse de la Fayarde», erwiderte sie auf meine Frage. «Das ist die dunkle Dame da. Amerikanerin. Der Graf ist ihr vierter Mann. Heute abend bin ich nur so mitgeschleppt worden, weil wir alle auf dem Rückweg von Longchamp waren. Sonst bin ich meistens in Neuilly. Nein, über zuviel Arbeit kann ich mich nicht beklagen.»
Wir sprachen gehemmt, in abgehackten Sätzen; wie Leute, die sich auf dem Bahnsteig für längere Zeit verabschiedeten. Ihre Mutter war Französin, ihr Vater Schotte. Sie war in Edinburgh aufgewachsen. Das erklärte ihren melodischen Sprechrhythmus.
Ich sah aus dem Augenwinkel, wie die Gräfin sich eine Silbernerzstola über den blaugeäderten Arm hängte und auf uns zusteuerte. «Morgen muß ich wieder nach London», sagte ich schnell, «aber nächste Woche bin ich wahrscheinlich wieder in Paris. Haben Sie Telefon?»
«Ja.» Sie nannte mir die Nummer. Ich konnte sie nicht mehr aufschreiben; ihre Chefin war schon zu nah.
«Privat?» stieß ich hervor.
«Nein, aber ich bin fast immer zu erreichen.»
«Mein lieber Mr. Scott – Sie sind doch Mr. Scott?» rief die Gräfin. «Es war so entzückend bei Ihnen – vielen, vielen Dank.» Offenbar hielt sie mich irrtümlich für den Gastgeber. «Leider müssen wir Sie jetzt verlassen. Sandra, würden Sie bitte meinem Mann Bescheid sagen … Und welch eine hübsche Idee, diese zauberhaft-altmodische Musikuntermalung …» Während Alexandra sich entfernte, legte sie mir ihre brillantenüberladene Hand auf den Arm und sah mit blutunterlaufenen, bis zur Unkenntlichkeit verschminkten Augen zu mir auf. «Nein, diese Franzosen! Sie verblüffen mich immer wieder.»
«Oh?»
«Das raffinierteste Volk der Erde, kultiviert, hochgezüchtet bis zur Dekadenz, und andererseits auch das naivste, provinziellste, bürgerlichste … Verstehen Sie mich?»
«Nicht ganz», sagte ich höflich.
«Mein lieber Mr. Scott! Wer kann noch über diese französischen Boulevardstücke lachen außer den Franzosen? Und wer unter uns grobschlächtigen Angelsachsen ließe es sich einfallen, eine wirklich erstklassige Cocktailparty zu geben und dazu eine derart miserable Pianistin zu engagieren, die unerträgliche alte Schmachtfetzen spielt?»
Alexandra hatte sich inzwischen zu einem kurzbeinigen, breitschultrigen, aggressiv aussehenden Herrn begeben.
«Ich fand die Pianistin gar nicht so schlecht», sagte ich.
«Natürlich, so was rührt an Erinnerungen. Ich war dabei, als Oklahoma zum Weltschlager wurde.» Die Gräfin hustete hohl. «Damals angelten wir in Nassau von Booten aus, durch deren Glasboden man die Fische sah. Erinnerungen … Man wird ebenso schwer damit fertig wie mit Kreislaufstörungen. Sie sind noch zu jung, Mr. Scott, um da mitreden zu können …»
Heute, nachdem unsere Gäste gegangen waren, sagte Harriet plötzlich: «Was pfeifst du denn da? Kommt mir so bekannt vor – aber was ist es?»
«Ich glaube, irgendwas aus Oklahoma.»
«Kann sein. Wie war der Text? Na, ist egal. Du pfeifst so selten.»
«Hab ja auch selten Grund dazu.»
«Aber jetzt hast du Grund, nicht? Was hat Ralph über die Besuchsziffern gesagt?»
«Jeden Abend ausverkauft. Vorbestellungen für ein halbes Jahr.»
«Ich war während deines Pariser Aufenthalts bei ihm und habe die amerikanische Aufführung mit ihm besprochen. Er meint, wir sollten mindestens bis Weihnachten abwarten. Wenn das Stück dann hier immer noch erfolgreich läuft, lohnte eine separate Einstudierung in New York; sonst könnten wir das ganze Ensemble so hinüberschicken, wie es ist.» Harriet kämmte beim Sprechen ihr langes schwarzes Haar; es glänzte wie frischgeteert.
«Die Mühe hättest du dir sparen können», sagte ich. «Ist doch klar, daß ich das alles längst mit Ralph und Basil abgemacht habe.»
«Warum hast du mir das denn nicht gleich gesagt?»
Solche Gespräche reizten mich sonst maßlos; besonders wenn Harriet den bewußten Schluck zuviel getrunken hatte. Aber heute abend war ich merkwürdig geduldig.
«Ich kann dir nicht immer alles sagen, meine Liebe. Vielleicht hättest du besser meine Rückkehr abgewartet.»
«Gott, ist ja egal. Schaden konnte es ja nichts.» Sie begann ihr Haar zu flechten. Der große Karneol an ihrem Finger leuchtete regelmäßig auf. Harriet machte sich nichts aus Schmuck und trug außer dem Trauring immer nur diesen Ring. «Hast du dich in Paris auch um die Übersetzung gekümmert?» fragte sie.
«Was könnte ich dazu tun?»
«Na, es zeigt sich doch, daß du einen wirklich intel-intelligenten Berater brauchst, der das Ganze noch mal Satz für Satz mit dir durchgeht. Sicher, es muß dem … dem französischen Geist angepaßt werden, aber ich habe mit Kitty darüber gesprochen, und sie meint auch, daß Kluseman sich unverschämte und unnötige Freiheiten herausnimmt.»
«Dann laß es doch Kitty machen.»
«Sie hat erstens keine Zeit, und zweitens kennt sie Frankreich ja auch nicht so gut.»
Ich stand am Fenster, sah auf geparkte Autos und einsame Fußgänger hinunter und streichelte den Brokat des Vorhangs, der sich glatt wie eine Frauenwange anfühlte.
«Charisse hat den Originaltext gelesen und das Stück zweimal hier in London gesehen», erwiderte ich. «Bei meinen mäßigen Französischkenntnissen kann ich wirklich nicht mit einer langen Beschwerdeliste in Paris aufkreuzen und den Fachleuten ins Handwerk pfuschen.»
«Typisch!» rief Harriet ärgerlich. «Schließlich bist du doch der Autor! Es ist dein Stück! Ohne dich … ohne dich hätten sie überhaupt nichts. Du bringst dich nie genügend zur Geltung! Du läßt dich behandeln wie eine Nebenfigur! Von jedem läßt du dich in den Hintergrund schieben. Und dabei weißt du so gut wie ich, daß es gerade bei diesem Stück auf Halbtöne und Andeutungen ankommt, auf den ‹Haken unter dem Köder, den man erst merkt, wenn man ihn verschluckt hat›, wie es der gescheite Kritiker – wie heißt er noch – mal ausgedrückt hat.»
Sie ging von dem indirekt beleuchteten Frisiertisch weg, auf dessen spiegelnder Glasplatte wohlgeordnete Reihen von Medizinfläschchen standen. Unser Badezimmer roch immer nach Krankenhaus und das Schlafzimmer nach einer ganz bestimmten Mischung von schönheitsfördernden und keimtötenden Mitteln. Harriet war etwa einsfünfundsiebzig groß; ihr Körper wirkte auch jetzt noch nicht eckig; er hatte sich die schlaksige, leicht gehemmte Anmut der Jugend bewahrt. Das erstemal hatte ich ihn gesehen, als sie mit einer Gelenkentzündung in ihrer kleinen Wohnung in Hampstead lag. Ich erinnere mich genau, wie peinlich sauber schon damals alles gewesen war, obwohl sie keine Hilfe hatte: Das pfirsichfarbene, langärmelige Nachthemd sah aus, als hätte sie es erst vor zwei Minuten angezogen; Laken und Kissen waren blütenrein und kaum zerknittert. Würde ich den Körper, den ich jetzt begehrte, je zu sehen bekommen? Begehrte ich ihn überhaupt? War mir das so wichtig? Eine zufällige Begegnung, ein paar Blicke, ein höfliches Lächeln, ein Händedruck, eine Telefonnummer – führten diese Nichtigkeiten unvermeidlich zum Ehebruch? Unsinn. Vor meiner Ehe hatte ich schließlich auch ein paar kleine Anfechtungen gehabt, ohne daß sie tiefere Spuren hinterlassen hätten. Warum sollte es diesmal anders sein?
«Morris», sagte Harriet, «woran denkst du eigentlich?»
Ich kniff kurz die Augen zusammen, als ob mich ihr Zigarettenrauch störe. Nie zuvor hatte ich bemerkt, wie scharf ihre Stimme sein konnte. Sie ließ mich nicht aus den Augen. Sie sah mich beinahe anklagend an. In unseren sieben Ehejahren hatten wir beide einen sechsten Sinn für Stimmungen entwickelt.
«Ich dachte gerade an jemanden, den ich auf der Cocktailparty von Charisse kennengelernt habe. Ein Schotte mit französischer Mutter. Offenbar intelligent und mit einiger Bühnenerfahrung. Mit dem kann ich ja das nächstemal die Übersetzung durchgehen. Ich halt’s zwar nach wie vor für Zeitverschwendung. Aber da dir daran liegt, versuch ich es mit ihm.»
Harriet zog den Morgenmantel aus und schlug die Steppdecke ihres Bettes zurück.
«Morris, ich brauche wirklich bald eine Hausgehilfin!»
«In dieser kleinen Wohnung?»
«Oh, sie soll natürlich nicht hier wohnen; ich brauche sie nur vormittags und gelegentlich abends, wenn wir Gäste haben. Ich hätte dann mehr Zeit für dich, und du weißt ja, ich … ich hasse diesen ganzen Haushaltskram. Wie heißt er?»
«Wer?»
«Der Schotte mit der französischen Mutter.»
«Wilshere. Alexander Wilshere. Charisse hat seine Nummer. Ich ruf ihn gelegentlich mal an.»
2
«Mademoiselle Wilshere», sagte ich. «Est-ce que je peux lui parler?»
«Un moment. Ich rufe sie an den Apparat.»
Ich war in einer öffentlichen Telefonzelle. – «Oui? Allo?»
«Mademoiselle Wilshere?»
«Oui.»
«Hier spricht Morris Scott. Ich bin wieder in Paris, und ich hatte doch so halb und halb versprochen, Sie anzurufen.»
«O ja, richtig. Wie geht’s Ihnen denn?» Sie sprach zögernd; ich vermißte ihren singenden Tonfall.
«Danke, gut. Sind Sie heute mittag frei?»
«Leider nicht.»
Wahrscheinlich war sie nicht allein im Zimmer. «Wann also könnten wir uns treffen?» fragte ich.
«Ich … ich weiß nicht.»
«Morgen?»
«Wirklich, ich –»
«Morgen zum Mittagessen?»
«Nein, aber vielleicht kann ich’s später einrichten. Sagen wir um fünf?»
Ich war am nächsten Abend verabredet, aber das war mir jetzt egal. «Schön», sagte ich, «dann essen wir anschließend irgendwo. Und wo treffen wir uns? Unter dem Obelisken auf der Place Vendôme?»
«Ja. Danke für den Anruf.»
«Also morgen um fünf!»
«Um fünf.»
Als ich den Hörer auflegte, bemerkte ich, daß er feucht geworden war. Dabei habe ich noch nie Schweißhände gehabt.
Ich wohnte im Hotel Scribe. Es war ein ordentliches, zentralgelegenes Haus und keineswegs billig, wenn auch nicht der übliche «Rahmen» für einen erfolgreichen Bühnenschriftsteller. Daß ich neuerdings viel Geld verdiente, daran hatte ich mich noch nicht so recht gewöhnt. Manche Leute verstehen es herrlich, die Feste zu feiern, wie sie fallen. Heute pumpen sie ihre Freunde an, stopfen ihre Cordhosen und Rollkragenpullover, laufen kilometerweit, um das Fahrgeld zu sparen, und können sich kaum einen Drink leisten. Morgen fahren sie einen Bentley, haben eine Zimmerflucht im feinsten Hotel und speisen grundsätzlich nur an den Treffpunkten der großen Welt. Für solche Eskapaden war ich viel zu bürgerlich und spießig erzogen worden.
Ich war gegen halb fünf auf der Place Vendôme. Ein selbstbewußterer Mann hätte sich die Wartezeit mit einem Aperitif im Ritz vertrieben. Ich aber wanderte die Rue Castiglione auf und ab und verbot mir strikt, an die Zukunft zu denken. Auch diese Gewohnheit war schwer abzulegen, aber dies eine Mal gelang es mir. Zehn Minuten vor fünf hatte ich mich, wohl zum erstenmal in meinem Leben, in einen freien, ungebundenen Menschen verwandelt.
Alexandra kam in Rot und Marineblau. Sie sah wieder ganz anders aus. Vielleicht lag es an der sinkenden Sonne, aber ich fand ihre Haut rosig angehaucht. Ihr seidiges Haar war vom Wind leicht zerzaust, und ihre Augen funkelten vor Lebenslust. Sie trug so gut wie gar kein Make-up.
Mir fehlten die Worte. «Wohin jetzt?» war alles, was ich fragen konnte. «Sind Sie noch Engländerin genug, um Tee zu trinken?»
«Ja, sicher.»
Wir gingen in ein nettes Café, wo wir vor dem Wind geschützt waren. Alexandra zog sehr langsam ihre Handschuhe aus. Es war wie ein öffentliches Entkleiden jedes einzelnen Fingers, sehr schöner Finger mit gutgeformten, unlackierten Nägeln. Ihre Hände entpuppten sich als erstaunlich lang und kräftig für ihre sonst so zarte Erscheinung. Als sie fertig war, strich sie die Handschuhe sorgfältig glatt und legte sie beiseite. Wir schwiegen.
Sie trug keinen Ring. Der Kellner kam. Ich bestellte.
«Wie geht’s Ihrem neuen Stück?» fragte Alexandra.
«Noch nicht viel zu sagen. Die Proben werden kaum vor September anfangen. Wir warten noch auf die Übersetzung.»
Wir redeten eine Zeitlang über dieses Thema weiter, aber es war, als ginge es eigentlich keinen von uns beiden etwas an. Neulich war das anders gewesen: Unsere ersten paar Worte hatten wir hastig und intensiv gewechselt, als wären wir uns der Vergänglichkeit der Zeit und unseres Lebens bewußt. Jetzt nebelten wir uns ein.
Schließlich fragte sie abrupt: «Wollen Sie mir nicht ein wenig von sich erzählen? Sie sind doch vermutlich verheiratet?»
«Ja. Und Sie?»
«Oh!» Sie lachte leise auf. «Nein.»
«Verlobt?»
«Noch nicht.»
«Aber da ist jemand?»
«Da … war jemand.»
«Sprechen Sie absichtlich in der Vergangenheitsform?»
«Vielleicht.»
«Franzose?»
«Nein, Schotte. Darf ich Ihnen noch mal einschenken?»
«Ja, bitte.»
Sie füllte meine Tasse auf und runzelte ein wenig die Stirn. «Jackie versucht dauernd, mich zu verkuppeln.»
«Wer ist Jackie?»
«Meine Chefin, die Gräfin. Die geborene Heiratsvermittlerin. Man sollte meinen, sie wäre es endlich leid –»
«Warum?»
«Nach so vielen Enttäuschungen.»
«Davon lassen sich die wenigsten abschrecken. Auch Enttäuschungen werden zur Gewohnheit.»
«Sie ist eine geborene Bunt, falls Ihnen das was sagt. Eine der reichsten Erbinnen Amerikas. Ihre ersten drei Männer waren Gauner und erlösten sie schneller von ihrem Geld als Bankräuber. Als sie den Grafen nahm, hatte sie nur noch eine knappe Million Dollar.»
«Da blutet einem ja das Herz.»
«Nicht nötig. Monsieur le Comte war nämlich von anderem Schrot und Korn. Damals war er bloß Major oder so etwas, und alle Leute prophezeiten, daß er Jackies letzte Million im Rekordtempo durchbringen würde. Falsch! Das genaue Gegenteil trat ein. Er begann mit französischer Sparsamkeit ihr Restvermögen zu verwalten und zu vermehren. Das ist ihr noch nie passiert. Sie beklagt sich manchmal, daß er sie zu kurz hält.»
Für mich war es eine Wonne, ihr zuzuhören; ihre Stimme fand im leichten Geplauder den ganzen melodischen Reiz vom ersten Mal wieder.
«Aber er ist doch ein echter Graf?»
«Oh, Sie hören gut hin. Nein, ich glaube zwar, daß er halb und halb von Adel ist, aber den Titel hat er meines Wissens erst später gekauft. Warum nicht! Es schmeichelt seiner Frau und tut keinem weh. Er gibt nicht weiter damit an, und summa summarum: Es ist eine glückliche Ehe.» Sie sah lächelnd an mir vorbei. «Das alles war natürlich vor meiner Zeit. Ich weiß es nur vom Hörensagen.»
«Und nun hat die Gräfin den ganz besonderen Ehrgeiz, Sie zu verkuppeln? Auch mit verheirateten Männern?»
«Sie spezialisiert sich nicht gerade darauf. Aber sie hält das natürlich nicht für ein unüberwindliches Hindernis; das müssen Sie ihrer eigenen Lebensgeschichte zugute halten.»
«Da ist ein Tee in der Rue de Rivoli auch vergleichsweise harmlos.»
Sie überhörte meine Bemerkung. Ihre linke Hand baute ein Häuschen aus kleinen Zuckerpackungen.
Ich erzählte ihr jetzt von Harriets Bedenken wegen der Übersetzung und fragte sie, ob sie das Stück noch einmal mit mir durchsehen wolle. Sie war sichtlich überrascht und geschmeichelt.
«Oh, wenn Sie’s mit mir versuchen wollen … Gewiß, die französische Mentalität kenne ich jetzt ein bißchen. Aber ob ich es sprachlich schaffe, weiß ich nicht. Wann kann ich einen Durchschlag der Übersetzung bekommen?»
«Morgen, hoffe ich. Einen englischen habe ich mitgebracht, den kriegen Sie selbstverständlich zum Vergleich.»
«Fliegen Sie morgen schon zurück?»
«Nein, erst Freitag.»
«Bis dahin komme ich aber bestimmt nicht durch.»
«Das erwarte ich doch gar nicht! Es hat gar keine Eile.»
«Wie soll ich mich mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn ich Änderungsvorschläge habe? Soll ich Ihnen nächste Woche schreiben?»
«Warten Sie lieber, bis ich wieder herkomme.»
Sie lächelte plötzlich. «Sie scheinen sehr gern nach Paris zu kommen?»
«Ja, ich liebe es sehr.»
«Ich auch. Aber meine Mutter stammt aus Marseille. Sie ist dunkel und zierlich.»
«Ist sie so schön wie Sie?»
Das war ein kühner Vorstoß. Alexandra trank ihren Tee aus und überlegte sich meine Frage reiflich. «Sie sieht besser aus als ich, finde ich – auch heute noch. Sie ist irgendwie … rassiger, feingliedriger und … Lachen Sie mich aus?»
«Nein.»
«Schönheit ist so ein relativer Begriff. Wenn man auf den Champs-Elysées sitzt und sich die Pariserinnen ansieht … Nach einer Weile komme ich mir dann immer fett, plump, unelegant, kurz absolut reizlos vor. Tja, was ist Schönheit!» Sie stupste ihr Zuckerhäuschen um.
«Richten Sie sich etwa nach Modeidealen?» fragte ich. «Nach der vorschriftsmäßigen Form einer Augenbraue, nach der Farbe der Wimperntusche?»
Sie blieb nachdenklich. «Ich glaube, die wahre Französin – egal, wie sie aussieht – zieht sich immer nach ihrem eigenen Geschmack an. Das gibt ihr diese unglaubliche Überlegenheit.»
«Mag sein. Ich rede aber nicht nur von äußerlichen Tricks.»
«Ich auch nicht. Übrigens ist das kein besonders ergiebiges Gesprächsthema – oder wollen Sie durchaus dabei bleiben?»
«Nein. Schlagen Sie ein anderes vor.»
Sie lachte. «Ich möchte lieber spazierengehen. Laufen Sie gern? Die Tuilerien sind gegen Abend am hübschesten.»
Wir marschierten etwa eine Stunde lang tüchtig drauflos und gingen dann in ein Kino. Danach aßen wir an den Champs-Elysées zu Abend und blickten von oben herab in das Verkehrsgewühl. Ich wußte noch immer nicht, woran ich war. Ich hatte sie wiedersehen wollen, aber zwischendurch hätte ich die ganze Sache auch lieber wieder fallengelassen. Schließlich war ich nicht unglücklich verheiratet; ich war meiner Frau verpflichtet und befand mich auf dem ersten Höhepunkt meiner Laufbahn. Es war die reinste Idiotie, gerade jetzt das Schicksal herauszufordern.
Aber je weiter der Abend vorschritt, desto weniger konnte ich mich bremsen.
Offenbar war Alexandra genauso unsicher wie ich. Wir waren und blieben beide etwas scheu.
Sie erzählte mir von ihren Eltern, ihren Brüdern, ihren paar Studiensemestern an der Sorbonne und stellte mir ihrerseits Fragen, die ich leider nicht so offen beantworten konnte; ich hatte Angst, den Zauber dieses Abends zu zerstören. Doch nach ein paar Stunden war sie mir so nahegekommen, daß ich die Probe aufs Exempel wagte.
«Schön, ich gebe Ihnen einen Kurzlebenslauf», sagte ich. «An sich sind ja sogenannte Erfolgsgeschichten grausam langweilig. Mein Vater ist Arzt. Das sollte ich auch werden. Aber ich wollte nicht. Wir fochten deswegen endlose Kämpfe aus, bis ich nachgab. Ich studierte Medizin und machte meinen Doktor. Nach einem Jahr Praxis gab ich den Beruf trotzdem auf, um nur noch zu schreiben. Das hat er mir natürlich nie verziehen.»
«Bis heute nicht?»
«Nein. Er ist ein Mann, der sein Leben nützlichen Zwecken weiht; er hält mich für eine Art Hanswurst. Als Arzt wäre ich wenigstens diskutabel gewesen.»
«Waren Sie ein guter Arzt?»
«Nein. Aber mein Vater meinte, ich hätte es werden können.»
«Und Ihre Mutter?»
«Sie ist vor acht Jahren gestorben. Aber sie war ganz seiner Ansicht. Sie hat vielleicht noch mehr Druck auf mich ausgeübt als er.»
«Sie haben den Arztberuf dann wohl erst nach ihrem Tode aufgegeben?»
«Ja – obgleich das ein bißchen zu sehr nach Ursache und Wirkung klingt. So war’s auch wieder nicht.»
Endlich kamen wir auf den Kern der Dinge. Bis jetzt war ich ehrlich gewesen. Die Wahrheit schmerzte nicht mehr.
Alexandra sah aus dem Fenster. Der vorbeiflutende Verkehr tauchte ihr Gesicht in wechselnde Beleuchtung. Sie hatte ein zartes, junges Gesicht.
Trotzdem spürte ich jetzt schon, daß dahinter mehr als Schwäche und Sanftmut steckte. Sie hatte Energie und Kraft genug, um sich nicht mit verschwommenen Motiven abspeisen zu lassen.
«Kurz nach dem Tod meiner Mutter vertrat ich zufällig einen Kollegen in Hampstead und lernte so eine seiner Patientinnen kennen, Harriet Quigley, meine jetzige Frau. Harriet war eine Theaternärrin; sie hatte sich auch selbst ein bißchen als Schauspielerin und Regieassistentin versucht. Die paar Sachen, die ich bis dahin geschrieben hatte, begeisterten sie. Sie hatte Verbindungen und auch etwas Geld – kein Vermögen, aber man konnte damit auskommen. Sie redete mir unablässig zu, das Herumdoktern zu lassen und lieber fleißig zu schreiben. Das tat ich. Und wie der Endeffekt zeigt, hat es sich auf die Dauer gelohnt.»
Alexandra sah immer noch aus dem Fenster. Ich bot ihr zur Ablenkung eine Zigarette an, aber sie schüttelte den Kopf. Dann sagte sie langsam:
«Mit sechzehn Jahren war ich furchtbar in einen Engländer verliebt. Wenn wir älter gewesen wären, hätten wir einfach geheiratet und unsere Ruhe gehabt. Aber so passierte nichts, gar nichts. Niemand hat je etwas von unserer Qual geahnt. Unsere Liebe erstickte unter dem, was man gute Erziehung nennt. Rührend, aber nicht besonders lustig. Seitdem habe ich so etwas nicht mehr empfunden.»
Der Kellner kam, und ich bestellte zwei Mokka.
«Liebe», fuhr Alexandra fort, «ist vielleicht so was wie Masern: heutzutage wird man rechtzeitig dagegen geimpft. Aber wenn man das Pech hat, mit einem resistenten Virus zusammenzugeraten – dann kippt man erst recht um.»
«Aus diesem Grunde kränkeln manche Leute ihr Leben lang», sagte ich lachend.
«Welcher Typ sind Sie, Morris?» Ihre Augen waren klar und kühl auf mich gerichtet.
«Ich bin vielleicht resistent geboren», antwortete ich. «Oder ich hatte immer zuviel andere Dinge im Kopf.»
«Kommt Ihre Frau nie mit nach Paris?»
«Bis jetzt wollte sie nicht. Sie fliegt nicht gern und findet es sinnlos, mich dauernd hin und her zu begleiten.»
«Ist sie älter als Sie?»
«Ein paar Jahre. Wer hat Ihnen das erzählt?»
«Niemand. Ich hab’s nur so herausgehört.»
«Der Altersunterschied ist kaum der Rede wert.»
«Sind Sie sonst glücklich mit ihr?»
Ich nippte an dem starken, süßen Mokka. «Wenn ich das sagen könnte …!»
«Wieso nicht?»
«Ich weiß es einfach nicht. Ich mag sie gern – ich schätze sie sehr – wir haben viel Gemeinsames –»
Alexandra griff plötzlich nach einer Zigarette. «Ich möchte jetzt doch eine, wenn Sie gestatten.» Ich gab ihr Feuer. «Furchtbarer Gedanke, daß mein Mann nach siebenjähriger Ehe das von mir sagen könnte!»
«Aber … ich wollte Ihnen doch nur eine ehrliche Antwort geben. Sie fragten mich, ob ich glücklich mit ihr bin. Was, zum Teufel, ist Glück? Momentan, zum Beispiel, bin ich glücklich, weil meine Schriftstellerei Erfolg hat. Damit rechtfertige ich meine Existenz. Und Harriet hat daran teil. Ich kann nicht säuberlich voneinander trennen, was mit ihrer Hilfe zustande gekommen ist und was ich auch allein geschafft hätte. Blindwütig verliebt bin ich nicht; war ich auch nie. Aber das schließt Zuneigung und Gemeinsamkeit nicht aus. Alles übrige … Ach, das führt zu weit.»
Danach herrschte längeres Schweigen.
«Ich möchte jetzt gehen», sagte Alexandra schließlich. «Ich muß morgens früh aufstehen.»
«Treffen wir uns noch vor meiner Rückreise?»
Ihr Gesicht war von Zigarettenrauch verhüllt. «Ich glaube kaum. Die Fayardes wollen in Dijon ein Rennpferd kaufen – da soll ich mitkommen.»
«Dann aber nächste Woche, wenn ich wiederkomme?»
«Wollen Sie das wirklich?»
«Ja. Wenn es Ihnen paßt.»
«Ich weiß nicht.»
«Nun strafen Sie mich bitte nicht für meine Aufrichtigkeit Das war nur ein Ausdruck meiner Hochachtung für Sie.»
«Hochachtung?» wiederholte sie und strich mit dem Fingernagel über das Tischtuch.
«Wäre Ihnen ein anderer Ausdruck lieber?»
«In diesem Stadium – nein.»
«Aber wir werden uns wiedersehen?»
Lange Pause. Dann: «Ja.»
3
Bei meiner Heimkehr lag Harriet mit unerträglichen Kreuzschmerzen im Bett. Wie so viele große, überschlanke Frauen litt sie von jeher an einer Schwäche des Rückgrats. Wir hatten uns dadurch kennengelernt. Die Röntgenplatten ergaben keine sicheren Anhaltspunkte, aber ich glaubte Anzeichen von Osteo-Arthritis zu erkennen, die sich jahrzehntelang nicht zu verschlimmern brauchten, aber im allgemeinen auch nicht mehr verschwanden. Sie war eigentlich jeden Monat ein paar Tage bettlägrig; wenn nicht wegen des Rückgrats, dann wegen ihrer besonders schmerzhaften Periode oder einer Nierenattacke.
Ihr Verstand arbeitete trotzdem tadellos. Ich setzte mich zu ihr auf den Bettrand und erzählte ihr – mit gewissen Auslassungen – von meinen Pariser Erlebnissen. Im Bett rauchte sie unaufhörlich. Heute ging der gewohnte Mischgeruch ihres Parfüms und der Desinfektionsmittel fast im blauen Dunst unter.
«Liebster», hörte ich sie plötzlich sagen, «nun verlier dich nicht wieder total in Trance.»
«Pardon – ich war ganz in Gedanken.»
Sie lächelte schwach. Ihr herbes Gesicht war wirklich reizvoll. Ich versuchte unwillkürlich nachzurechnen, wann wir das letztemal ehelichen Verkehr gehabt hatten. Ende April wohl, vor ungefähr sechs Wochen. Und es war durchaus nicht kalte Routine gewesen. Wir hatten ja so viel zu bereden, was uns beide anging. Mein plötzlicher Erfolg gab uns Auftrieb. Dazu kamen die Neuanschaffungen; das Wochenendhäuschen bei Odiham und der weiße Alfa Romeo, der fürstlich in einer Mietgarage untergebracht war.
«Dein Vater hat angerufen», sagte sie im Lauf der Unterhaltung. «Wir sollten uns mal wieder blicken lassen.»
«Sonst was Neues bei ihm?»
«Nein. Er hat nur rasend viel zu tun.» Sie schwieg eine Weile, dann fragte sie: «Wann fährst du wieder rüber?»
«Wohin? Nach Paris? Nächste Woche. Bis dahin hat Alexander Wilshere den Originaltext und die Übersetzung verglichen.»
«Na, siehst du, hatte ich nicht recht? Vier Augen sehen eben mehr als zwei. Aber kann er dir seine Korrekturvorschläge nicht mit der Post schicken?»
«Natürlich, aber ich sagte, es hätte Zeit bis zum nächstenmal.»
«Laß es dir doch vorher schicken. Ich möchte auch sehen, was er dazu meint.»
Ich schwieg. Im Moment konnte ich einfach nicht mit ihr darüber diskutieren.
«Hast du inzwischen weiter über den Kolibri nachgedacht?» erkundigte sie sich nun.
Der Kolibri sollte mein nächstes Stück werden. Harriet hätte eigentlich spüren müssen, daß mich ihre Frage jetzt irritierte. Ich besprach meine Ideen nicht selten mit ihr, doch hing das ganz von der jeweiligen Stimmung ab. Im Anfangsstadium einer Arbeit äußerte ich mich normalerweise ungern; der Impuls zum Schreiben wurde dadurch abgeschwächt. Erst wenn schon vieles dastand und ich ans Ausfeilen ging, sprach ich über dieses oder jenes Problem, und sie hatte mir schon oft wertvolle Ratschläge und Anregungen gegeben. Aber bei solchen Gesprächen mußte ich anfangen, nicht sie.
«Nein», erwiderte ich deshalb, «ich hatte noch keine Zeit.»
«Es wäre jammerschade, so ein Stück liegenzulassen. Der Aufbau ist vielversprechend und ganz dein Stil. Deine jetzigen Erfolge sind herrlich. Aber die Kritik fragt sich schon, was danach kommt.»