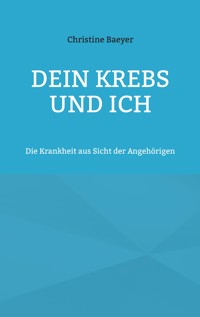
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
"Dein Krebs und Ich" beschreibt in typischen Fallbeispielen aus der psychoonkologischen Praxis, welchen Einfluss die Erkrankung auf die Angehörigen von Krebspatientinnen und Krebspatienten haben kann. Es werden sowohl Momente der Kraft und der Überforderung geschildert als auch Gefühle der Zuversicht und der Mutlosigkeit beschrieben. Es geht um den Tod und das Leben, um schwere Entscheidungen und gute Lösungen. Nahestehende Menschen von Krebserkrankten können sich in den Beispielen wiedererkennen. Sie finden außerdem kurze Informationen und Denkanstöße zum jeweiligen Kapitelthema sowie allgemeine Verhaltenstipps.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für die beste Schwester und den besten Ehemann der Welt
Dorothee und Frank
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Überforderung – hat viele Gesichter
Gesunder Egoismus - Wie geht es mir eigentlich?
Lebenshunger – Wenn das Privatleben verschwindet
Stark sein müssen - Zwischen Sorge und Selbstfürsorge
Doppelbelastung – Ungewohnte Aufgaben übernehmen
Soziale Verluste - Der schmerzhafte Rückzug der Anderen
Mundtot! – Wenn man nicht darüber reden darf
Kinder – die vulnerablen Mitglieder im Familiensystem
Kommunikation - Nur keine Scheu
Ambivalenzen – Im Wechselbad der Gefühle
Hoffnungslos! – Der Spagat zwischen Hoffen und Bangen
Fassungslos! - Der Angst begegnen
Zurückweisung – Wenn Hilfe nicht angenommen wird
Nicht schon wieder! – Wenn frühere Erfahrungen zu Vermeidungsverhalten führen
Narzisstische Kränkung – Dein Krebs ist meine Strafe!
Konventionen über Bord – Gemeinsam eine neue Basis schaffen
Wider besseres Wissen – Umgang mit eigensinnigen Entscheidungen
Gegen Windmühlen kämpfen – Wenn Akzeptanz schwerfällt
Der Tod – Aufforderung zum Leben
Anhang: Anregungen zur Selbsthilfe
Selbsthilfe - Übungen und Maßnahmen
TOP 100 – Was tut mir gut?
Angsttagebuch
Atemübungen
Bewegung
Energietagebuch
Entspannungsverfahren
Fokusverschiebung – auf andere Gedanken kommen
Kreative Techniken
Meditation
Positive Impulse
Vorwort
Wenn ein nahestehender Mensch an Krebs erkrankt, verändert die Welt ihr Gesicht. Ängste, Sorgen, Unsicherheit, Hilflosigkeit, Wut, Ohnmacht, Trauer – eine Achterbahn der Gefühle zwingt uns zur Mitfahrt. Plötzlich. Ist. Alles. Anders. Wir verlieren den Boden unter den Füßen. Gewohnte Strukturen lösen sich in Nichts auf. Wir möchten weinen, aber wir versuchen zu trösten. Wir wissen nicht wie es weitergehen kann, aber wir versprühen Zuversicht. Wir suchen nach Antworten und Informationen, aber wir haben doch nur Fragen. Wir möchten etwas tun, aber wir können gar nichts machen. Niemand hat uns gefragt, ob wir hier überhaupt mitfahren möchten. Und doch würde uns nicht einfallen, während der Fahrt auszusteigen. Tut man ja auch nicht. Nicht wir sind krank, sondern unser geliebter Mensch, die nahestehende Person, der Mann, Freund, Vater, Bruder, Sohn, die Frau, Freundin, Mutter, Schwester, Tochter… Wir sind ja nur Zuschauer, also bloß kein Selbstmitleid!
Liebe Leserin, lieber Leser, bitte atmen Sie einmal tief durch. Wir ziehen jetzt die Notbremse und finden zunächst heraus, in welche Achterbahn Sie da geraten sind und wohin die Fahrt gehen könnte. Ganz in Ruhe.
Nehmen Sie sich Zeit für die folgenden Seiten. Lesen Sie bewusst und halten Sie immer wieder inne. Reflektieren Sie. Erkennen Sie sich und andere wieder? Finden Sie heraus, was die Krebserkrankung in Ihrer unmittelbaren Umgebung mit Ihnen selbst macht. Wie gehen Sie mit den Veränderungen, den Sorgen und Aufgaben um? Sie mögen an mancher Stelle nicken und denken „Ja, genauso ist es.“ An anderer Stelle mag sich Widerstand regen, „Nein, das ist bei mir ganz anders.“ Oder Resignation: „Ist doch alles hoffnungslos. Was in anderen Familien hilfreich sein könnte, ist bei uns nicht möglich.“
Dieses Buch kann Ihnen kein Patentrezept anbieten, mit dem Sie die Krebs-Achterbahnfahrt besser überstehen. Krebs ist jedes Mal anders, die Lebens- und Familiensituation ist individuell sehr verschieden, der Umgang mit der Krankheit, aber auch das Miteinander, unterliegen keiner Norm. Es gibt kein definiertes „falsch“ und kein eindeutiges „richtig“ auf dem Weg durch die Erkrankung, nicht für die Patienten und auch nicht für Sie als Angehörige!
Dieses Buch möchte keine schlechten Gefühle schüren. Vielmehr geht es darum, Ihnen klarzumachen wie wichtig Selbstfürsorge ist. Auch Angehörige haben nämlich eine Gesundheit, auf die sie achten sollten. Auch Angehörige haben Sorgen. Und Schmerzen. Und Ängste. Möglicherweise sogar Depressionen. Angehörige von Krebspatienten sind wichtige Ansprechpartner und Vermittler während der Therapie. Oft hören sie die Frage „Wie geht es deiner/deinem Liebsten? Schlägt die Therapie an? Gibt es Fortschritte?“ Sehr selten oder vielleicht nie wird ihnen dagegen die Frage nach ihrem eigenen Befinden gestellt. „Wie kommst du zurecht mit deiner Sorge um …? Hast du Angst? Können wir dich irgendwie unterstützen?“ Schön wär’s!
Angehörige müssen also die Anteilnahme einfordern oder die Fürsorge selbst übernehmen. Damit sie nicht zerbrechen an der Krankheit des geliebten Menschen. Damit sie nicht an ihren eigenen Gedanken ersticken. Damit sie mit ihren Kräften haushalten. Damit sie endlich einmal wieder entspannen können. Angehörige sind doppelt belastet und nur sehr selten trauen sie sich, dies wahrzunehmen und einzugestehen.
Ich schreibe dieses Buch auf der Basis eigener Erfahrungen, als Betroffene und auch als Psychoonkologin. Die Beispiele in diesem Buch basieren auf realen Fällen. Namen und Umstände wurden so verändert, dass Niemand wiedererkannt wird. Ich habe dies auch in jenen Fällen getan, in denen mir ausdrücklich die Erlaubnis erteilt wurde, die tatsächlichen Namen zu verwenden. Nur für den Fall, dass sich diese Erlaubnis für die Betroffenen eines Tages vielleicht doch nicht mehr richtig anfühlen mag.
Ich danke allen Menschen, die mich täglich in meiner psychoonkologischen Praxis aufsuchen und mir Einsicht gewähren in ihre Leben und Krisen, in ihre Ängste und Erfolge. Nur durch diese vielen Lebenseinblicke war es mir überhaupt erst möglich, dieses Buch zu schreiben.
Ich möchte auf die Nöte der Angehörigen aufmerksam machen, für deren eigenes stilles Leid sensibilisieren. Dieses Buch richtet sich direkt an die Angehörigen von Krebspatienten. Aber ebenso an deren Freundeskreis und soziales Umfeld. Und natürlich soll dieses Buch auch den Krebsbetroffenen selbst einen Einblick und mehr Verständnis vermitteln. Also, eigentlich ist dieses Buch für alle. Denn jeder kennt jemanden, der jemanden liebt, der Krebs hat. Und es könnte uns alle jeden Tag selbst betreffen. Dieses Buch möchte aufklären und trösten. Und damit gleichzeitig Verständnis wecken für die vielen Menschen hinter den Krebskranken, die stillen Mitleidenden und die großartigen Unterstützerinnen. Vergesst sie nicht!
Liebe Leserinnen und Leser dieses Buches, ich bitte Sie um Nachsicht, dass ich mich hier bewusst gegen das konsequente Gendern des Textes entschieden habe. Manchmal benutze ich die weibliche und manchmal die männliche Form, weil es sich für mich beim Schreiben auf diese Weise leichter und realer anfühlt. Ich hoffe, dass Sie sich dennoch ALLE angesprochen fühlen können. Von Mensch zu Mensch.
Herzlichst, Christine Baeyer
Überforderung – hat viele Gesichter
In einer psychoonkologischen Gesprächsgruppe für Angehörige geht es dieses Mal um Überforderung. Alle Teilnehmenden sollen spontan äußern was ihnen dazu einfällt. Folgende Punkte werden gesammelt:
Beim Sammeln dieser unterschiedlichen Äußerungen wird schnell klar, dass fast alle Anwesenden Momente der Überforderung kennen. Jedes Gruppenmitglied berichtet nun über die Krebserkrankung in seiner Familie und die eigene Überforderung, die daraus entstanden ist. Aus der Gruppe heraus gibt es viel Zuspruch und Verständnis. Alle können sich gut vorstellen, wie es den anderen geht. Es wird deutlich, dass es ganz normal ist, in dieser ungewöhnlichen Lebenssituation nicht immer problemlos zu funktionieren, so unterschiedlich die Gründe der Überforderung auch sein mögen. Am Ende dieses Treffens haben die Teilnehmenden eine Telefonliste erstellt, die jedes Gruppenmitglied nun mit nach Hause nimmt. So wollen sie gewährleisten, sich in überforderten Momenten bei den anderen Zuspruch, Rat oder sogar tatkräftige Unterstützung holen zu können.
Beim nächsten Zusammentreffen erkundige ich mich nach den Erfahrungen mit dieser Liste. In einem Fall ist es zu einem sehr hilfreichen Telefonat gekommen. Alle berichten übereinstimmend, dass allein die konkrete Möglichkeit, sich einmal Zuspruch oder Rat holen zu können, ausgereicht habe, die jeweilige Überlastungssituation besser zu überstehen.
Wenn Sie selbst das Gefühl haben, durch die Krebserkrankung einer geliebten Person stark belastet und bisweilen überfordert zu sein, sollten Sie dies ernst nehmen. Es ist völlig normal, dass Menschen in Extremsituationen über sich hinauswachsen können. Genauso üblich sind aber auch Momente der Überforderung. Für Ihre eigene Gesundheit und zum Wohl Ihrer Angehörigen ist es erforderlich, dass Sie auch Ihr eigenes Wohlergehen weiterhin im Blick haben. Eine dauerhafte Stressbelastung kann krank machen und kostet sehr viel Kraft. Wenn Sie also gefühlsmäßig, zeitlich, pflegerisch oder anderweitig überfordert sind, suchen Sie Entlastung. Dies können regelmäßige Gespräche sein, schöne Unternehmungen, entspannende Tätigkeiten oder Sport. Manchmal ist es sinnvoll, tatkräftige Unterstützung zu organisieren. Bitten Sie Freunde und Angehörige um Hilfe bei der Betreuung der Krebskranken. Oder schalten Sie einen Pflegedienst oder eine seelsorgerische Institution ein. Auf keinen Fall aber sollten Sie dauerhaft über Ihre eigenen Grenzen gehen. Nehmen Sie sich in dieser Extremsituation selbst wahr und ernst. Ihr eigenes Wohlergehen ist wichtig!!!
Gesunder Egoismus - Wie geht es mir eigentlich?
Thea und Martin, etwa Mitte 60, sitzen mir gegenüber. Beide sind sehr angespannt, aus unterschiedlichen Gründen. Thea hat Krebs und befindet sich gerade in einer Chemotherapie-Phase. Sie kommt mit ihrer Erkrankung sehr gut zurecht. Jetzt ist sie angespannt, weil sie hofft, dass Martin in mir eine Gesprächspartnerin finden kann, die ihm ermöglicht, sich einmal losgelöst vom häuslichen Umfeld und mit Zeit und Muße auf sich selbst zu besinnen. Martin ist zunächst auf ausdrücklichen Wunsch seiner Frau hier. Er ist ebenfalls angespannt. Weil er nicht weiß, was eigentlich hier von ihm erwartet wird.
Zunächst bitte ich das sympathische Ehepaar, mir näher zu schildern, wie die Erkrankung in ihr Leben getreten und was seither geschehen ist. Vor drei Monaten wurde bei Thea Eierstockkrebs diagnostiziert. Es folgte eine radikale Operation, die kompliziert war, aber gut verlief. Nun befindet sich Thea in der Chemotherapie. Natürlich ist das eine anstrengende Zeit für sie und sie leidet unter starker Erschöpfung, der sogenannten krebsbedingten Fatigue. Aber Thea ist sehr zuversichtlich, dass die gesamte Krebsbehandlung am Ende erfolgreich und sie vom Krebs geheilt sein wird. Martin hat sich in den letzten Wochen liebevoll um sie gekümmert, ist stets an ihrer Seite und liest ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Bisher hat überwiegend Thea gesprochen. Als ich nun Martin die Frage stelle, wie es ihm geht, schaut er mich verständnislos an. „Naja, wie soll es mir gehen? Ich kann halt gar nichts tun. Thea ist die Kranke. Das kann ich ihr nicht abnehmen.“ „Ja, das ist sicher schwer auszuhalten.“ „Wie gesagt, sie ist diejenige, die alles aushalten muss. Ich bin ja nur Zuschauer.“ Ich bitte nun Martin, mir zu schildern, wie er die Krebskrankheit seiner Frau wahrnimmt. „Thea macht das ganz gut. Sie klagt nicht, obwohl sie doch einiges ertragen muss.“ „Das ist toll, wie sie das meistert. Sie wirken heute aber auch etwas erschöpft. Wie geht es Ihnen selbst denn eigentlich?“ Martin schaut mich bei dieser wiederholten Frage verständnislos an. „Ich weiß nicht recht, was Sie jetzt von mir hören wollen.“ „Ich habe mich einfach nur erkundigt, wie es Ihnen persönlich geht“, sage ich, lasse den Satz im Raum stehen und schaue Martin ermutigend an. Eine ganze Weile schweigt er. Als er das Schweigen wohl nicht mehr aushalten kann, sagt er: „Mir geht es ganz gut, denke ich.“
Ich erkläre den beiden, dass es ein sehr übliches Phänomen ist, dass der nicht erkrankte Partner, das Gefühl für sich selbst verliert. Der Krebs ist im täglichen Leben so präsent geworden, die gemeinsame Aufmerksamkeit richtet sich wie selbstverständlich vorrangig auf die Behandlungen und die Befindlichkeiten der erkrankten Person. Dabei nimmt sich der gesunde Partner automatisch zurück. Die Prioritäten sind klar: der Krebs ist das Wichtigste. Meist unbemerkt verliert der angehörige Mensch das Gefühl für sein eigenes Befinden. So scheint es auch bei Martin zu sein, wie ich an seinem verständnislosen Blick auf meine Fragen erkennen kann. Selbst wenn er sich große Mühe gibt, kann er kaum wahrnehmen, wie es in ihm aussieht. Er spürt weder Müdigkeit noch Erschöpfung. Er weiß nicht, ob es ihm eher gut oder eher schlecht geht. Er kann seine Stimmung weder fühlen noch benennen. Thea nickt zu meinen Ausführungen. Offenbar hat sie bereits seit längerem gespürt, dass Martin das Gefühl für sich selbst verliert. Darum wollte sie ja unbedingt dieses Gespräch in meiner Praxis.
Wir reden jetzt eine Weile über die Familiensituation, über die beiden erwachsenen Kinder, über die überwältigende Anteilnahme aus dem Freundeskreis und auch Martin beteiligt sich nun aktiver an der Unterhaltung. Am Ende stelle ich beiden die Frage, ob dieses Gespräch hilfreich war, ob es vielleicht Fragen aufgeworfen hat. Überraschenderweise antwortet Martin als erstes. „Ich habe durch Ihre Worte erst gemerkt, dass ich mich gerade selbst verliere. Sie haben Recht, ich fühle mich selbst überhaupt nicht mehr richtig. Das wäre mir von allein niemals aufgefallen. Und jetzt bin ich doch ein wenig erschrocken. Ich würde gerne noch ein weiteres Gespräch mit Ihnen führen. Vielleicht können Sie mir einige Tipps geben, wie ich mich in dieser schwierigen Zeit am besten verhalten kann, ohne mich selbst ganz aufzugeben.“
Tatsächlich kommt Martin danach noch zwei Mal. Wir erarbeiten gemeinsam kleine tägliche Rituale, die ihm helfen, wieder in Kontakt mit sich selbst zu kommen. So geht er nun täglich morgens zum Bäcker und nutzt diese Zeit, um die frische Luft zu atmen, sich sein momentan vorherrschendes Gefühl bewusst zu machen und es zu benennen. Gedanken an Thea und an die Termine und Herausforderungen des bevorstehenden Tages schiebt er dabei ganz bewusst zur Seite. Anfänglich findet er diese Übung überflüssig, aber er ist bereit, sich auf das Experiment einzulassen. Nachdem er gelernt hat, die morgendliche halbe Stunde ganz für sich allein zu nutzen, erzählt er begeistert, dass er plötzlich ein ganz anderes Lebensgefühl habe. Er freue sich geradezu auf den stillen Spaziergang und die ungewohnte Beschäftigung mit der Frage ‚wie geht es mir heute?‘. In der Folge macht er sich klar, dass es nicht seine Aufgabe sein kann, sich selbst so weit zurückzunehmen, dass er überhaupt nicht mehr spürbar ist. Dass er damit seiner Frau auch gar nicht hilft. Dass das Leben für beide nur weiter geht, wenn sie beide lebendig bleiben. Inzwischen formuliert er auf seinen Spaziergängen jeweils einen persönlichen Wunsch an den Tag. Das können ganz simple Dinge wie der Wunsch nach einem Mittagsschlaf sein. Manchmal nimmt er sich aber auch vor, dass er an diesem Tag mindestens einmal aus vollem Herzen lachen möchte. „Und wissen Sie, was das Beste ist?! Es funktioniert immer!“
Es kommt wirklich oft vor, dass Angehörige von Krebskranken aufhören, sich selbst wahrzunehmen. Sie vermissen dabei zunächst meist gar nichts. Sie konzentrieren sich ganz und gar auf das Befinden und die Stimmungen ihres geliebten Menschen. Ist die Frau heute besonders erschöpft? – Dann lassen wir es ganz ruhig angehen. Hat der Partner heute große Angst vor der nächsten Untersuchung? – Dann halten wir uns an den Händen. Hat die Freundin heute große Schmerzen? – Dann versuchen wir, eine Ablenkung zu finden. Diese Anpassung an das Befinden der erkrankten Person erfolgt ganz automatisch und ist völlig in Ordnung. Ungesund wird es erst, wenn die begleitende Person nur noch ausschließlich durch die Brille des Krebspatienten schaut und vor den eigenen Stimmungen, Gefühlen und Bedürfnissen die Augen verschließt.





























