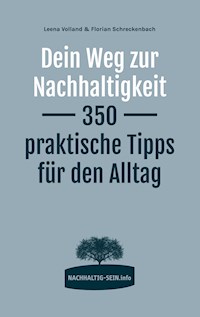
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Unser Konsum-Verhalten und unser Lebensstil haben langfristig keine Zukunft, denn wir leben über unsere Verhältnisse. Als Verbraucher haben wir täglich die Wahl: Jedes Produkt, das wir kaufen, und jede Dienstleistung, die wir buchen, haben Einfluss auf Klima, Umwelt, Ressourcen und Menschen. Wenn wir die globalen Zusammenhänge verstehen, können wir auch lokal nachhaltiger handeln. Dieses Handbuch ist der Startpunkt dafür: Es erklärt, wie der Kauf von Elektrogeräten die Konflikte im Kongo schürt, welche Lebensmittel mit dem Flieger nach Deutschland transportiert werden, ob die Bio-Gurke in Plastik die bessere Wahl ist und wie man nachhaltige Grillpartys feiert. Es ist ein Ratgeber, um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren - und zwar jetzt sofort. Von Ernährung und Mode bis zum Reisen und Schenken. Der Blog "nachhaltig-sein.info" der Autoren wurde 2013 von den Vereinten Nationen ausgezeichnet als Einzelprojekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort: Der Erde ist egal, ob wir sie retten
Fünf Prinzipien der Nachhaltigkeit
Konsum
Der wahre Preis der Dinge
Wie unser Konsum den Regenwald beeinflusst
Ernährung
Lebensmitteltransporte mit dem Flugzeug
Saisonal und regional – gut für die Umwelt
Fleisch, Tierprodukte und vegane Ernährung
Welchen Fisch dürfen wir noch essen?
Kleidung
Baumwolle: Wie kann Mode so günstig sein?
Warum Pelze zurück sind oder nie weg waren
Das blutige Geschäft mit der Wolle
Die andere Wahrheit über Altkleider
Strom
Kohle-, Atom- und Ökostrom: Ein Vergleich
Elektronik & Internet
Wertvolle und konfliktbehaftete Rohstoffe
Wie nachhaltig ist das Internet?
Plastik
Gibt es heute wieder Plastik zu essen?
Mikroplastik: Eine Gefahr für die Umwelt
Die Biogurke im Plastikmantel
Papier
Die Zukunft der Wälder und das Papier
Müll
Wie viel Wegwerfgesellschaft sind wir?
Balkon & Garten
Wie Hobby-Gärtner der Natur helfen können
Freizeit & Events
Wie man nachhaltige Mobilität umsetzt
Volkssport Grillen: Eine Ökobilanz
Von Green Weddings bis Klima-Weihnacht
Richtig schenken: Ein Leitfaden
Allein Taten sind gefragt
Über die Lüge, Gewohnheiten zu verändern
Quellenangaben
Die Autoren
Impressum
Vorwort: Der Erde ist egal, ob wir sie retten
Wir lieben unsere Erde mit ihren rauen Gebirgen, grünen Wäldern, weiten Stränden und wilden Ozeanen. Als Menschen sind wir ein Teil von ihr und sie ist die Grundlage unseres Lebens – und Überlebens. Schon vor Jahren haben wir uns entschieden: Wir wollen diese Welt erhalten, damit sie auch für unsere Kinder noch lebens- und liebenswert ist. Klar ist dabei: Unser aktuelles Konsum- und Lebensverhalten hat langfristig keine Zukunft.
Wir verbrauchen knapp 60% mehr Ressourcen als nachwachsen können. Unser Verlangen nach immer verfügbaren Gütern zu günstigen Preisen schürt eine Industrie und Landwirtschaft, die ignorant gegenüber dem ökologischen und sozialen Gleichgewicht ist. Daraus erwachsen die größten Umweltprobleme unserer Zeit: Klimawandel, Umweltverschmutzung, Artensterben und Wasserknappheit. Das Wissen und die Fakten darüber sind bekannt, durch wissenschaftliche Berichte gestützt und durch Medien verbreitet. „Wir müssen handeln! Wir müssen die Erde retten!“ heißt es dann.
Ehrlich gesprochen: Der Erde ist es egal, ob wir sie retten. Sie muss nicht gerettet werden. Seit rund 4,6 Milliarden Jahren bewegt sie sich durch den Weltraum, vor rund 3,5 Milliarden Jahren tauchten die ersten Fossilien auf, das erste Leben, und seit 195 Millionen Jahren entwickeln sich die Säugetiere. Der Mensch macht in dieser Zeitleiste nur einen kurzen Wimpernschlag aus. Sein Fußabdruck auf dem Planeten ist jedoch unübersehbar.
Der Erde ist das dennoch egal, denn die Natur findet ihren Weg. Es ist ein langsamer Prozess, aber über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg werden sich Pflanzen und Tiere anpassen. Wer es nicht schafft, sich an übersäuerte Böden, verschmutztes Wasser und extreme Klimata anzupassen, stirbt aus. Der Planet wird sich dennoch weiter drehen. Er hat kein Umweltproblem, der Mensch hat es. Und der Mensch muss sich ändern oder er wird geändert werden. Wenn wir also sagen: „Wir müssen die Erde retten“, meinen wir eigentlich: „Wir müssen uns retten.“
Damit alles so bleibt, wie es ist, muss sich vieles ändern. Und wenn jemand etwas verändern möchte, muss er bei sich selbst anfangen. Wir haben das Glück in unserer Gesellschaft, frei entscheiden und offen reden zu können. Wir haben nicht nur die Wahl, wir treffen sie auch. Jeden Tag, mit jeder Handlung und jedem Wort. Wir sind alle Teil des Problems. Und wir sind auch alle Teil der Lösung. Wir können uns jederzeit dazu entscheiden, Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen, unseren Lebensstil und unser Konsumverhalten zu reflektieren, umzudenken und Veränderungen zuzulassen.
Das ist nicht immer leicht und sicher ist auch nicht jede Lösung perfekt. Aber wir glauben, dass Nachhaltigkeit eine Pflicht ist, die wir uns und den nachfolgenden Generationen schuldig sind. Wir wollen nicht nach Gründen suchen, um etwas nicht zu machen, sondern es einfach tun. Nicht erst morgen, sondern schon heute. Wir wollen nicht zuschauen, sondern aktiv werden. Wir wollen etwas bewegen und zeigen, dass Nachhaltigkeit erlebbar und umsetzbar ist. Wir glauben, dass ein bewusster Konsum und eine angemessene Lebensweise etwas bewirken können, dass Verzicht glücklich machen kann und ein Wandel jederzeit möglich ist. Dass wir als Menschen etwas verändern und die Herausforderungen der Zukunft meistern können. Wir glauben, dass wir es uns nicht mehr leisten können, die Verantwortung abzuschieben auf „die Konzerne“ oder „die Politiker“. Nicht bei allem, was wir über den Zustand unserer Erde wissen.
Seit 2013 teilen wir das, was wir zur Nachhaltigkeit erfahren, reflektiert und gelernt haben, auf dem Blog nachhaltig-sein.info. Er ist ein ehrenamtliches Projekt und mit unseren Artikeln wollen wir Verständnis für die Zusammenhänge schaffen, unsere Motivation skizzieren und dazu beitragen, praktische Lösungen zu finden. So wollen wir allen, die selbst etwas verändern möchten, einen Startpunkt geben. Für dieses Konzept wurde der Blog von den Vereinten Nationen als Einzelprojekt „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet.
Aus unserem Blog ist dieses Handbuch gewachsen. Es greift die dort behandelten Themen auf und folgt dem gleichen Prinzip: Es erklärt, welche Auswirkungen unser tägliches Handeln auf Umwelt und Menschen hat und es nennt am Ende jedes Unterkapitels konkrete praktische Lösungsvorschläge. Denn neben dem „Warum?“ ist genau dieses „Wie?“ der Schlüssel für die dringend notwendige Veränderung. Dieses Buch ist gedacht als Anleitung, Nachschlagewerk und Inspirationsquelle für weitere Recherchen. Es gibt viele praktische Tipps zum Umsetzen im eigenen Alltag und zahlreiche Hinweise auf weiterführende Informationen, Studien, Apps und Tools. Um den Zugriff auf diese Quellen zu erleichtern und umständliche Links mit Sonderzeichen zu vermeiden, werden alle Links durch Kurz-URLs dargestellt, die auf die eigentliche Website weiterleiten. Sie sind benutzerfreundlicher und lassen sich leichter abtippen bzw. kopieren.
Es geht bei diesem Ratgeber nicht darum, jeden Lösungsvorschlag sofort umzusetzen. Ganz im Gegenteil: Wer sich zu viel auf einmal vornimmt, fühlt sich überfordert und wird scheitern (vgl. dazu das finale Unterkapitel Über die Lüge, Gewohnheiten zu verändern). Vielmehr geht es darum, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten zu agieren – und das ab sofort. In einem Umfeld, das wir beobachten und beeinflussen können, nach dem Motto „Global denken, lokal handeln.“ Auch wenn wir dabei kleine Schritte machen, sie bringen uns dennoch voran.
Wir danken Kilian Soddemann für seine Beiträge über vegane Ernährung, den Raubbau in der Tiefsee und das blutige Geschäft mit der Wolle. Seine Perspektiven der Tierrechte und Tierethik sind wertvolle Ergänzungen, nicht nur in diesem Buch, sondern auch bei unseren Gesprächen. Wir danken außerdem Simon Baar für sein Lektorat und sein konstruktives Feedback.
Ein Dankeschön geht zudem an unseren weiteren ehrenamtlichen Blog-Autor Matthias Heck und unsere Gastautoren, an unsere Blog-Leser, unsere Freunde und all die Menschen, die uns auf dem Weg der Nachhaltigkeit begleiten. Dieser Zuspruch, die Diskussionen, die ehrliche Kritik und die Impulse sind eine enorme Motivation. Und zuletzt danken wir unseren Familien, die mit viel Geduld jede neue Veränderung mittragen und so manche Traurigkeit auffangen, die bei diesem Thema zwangsläufig entsteht.
Leena Volland & Florian Schreckenbach
Fünf Prinzipien der Nachhaltigkeit
Wenn du etwas ändern willst, fange bei dir selbst an, und zwar heute.
Denke nicht in Problemen, sondern in Lösungswegen.
Es gibt keine Ausreden: Informiere dich und handle dann.
Investiere keine Zeit in die Kritik der Lösungsansätze anderer Leute, sofern du keinen besseren Weg kennst – und vor allem gehst.
Dein Handeln sollte stets bestimmt sein von der Frage: „Garantiert mein Lebensstil heute eine menschenwürdige Umwelt für meine Kinder und Enkel?“
Konsum
Das kaufe ich mir.“ – „Brauchst Du es denn?“ – „Naja, ist schon ganz praktisch. Es kostet ja eh nicht viel.“ Ganz ehrlich: Wir alle haben diesen Satz schon einmal gesagt. Aber was kostet unser Konsum wirklich? Einerseits kostet die Sache, die wir uns kaufen, natürlich Geld. Die Kenngröße für Konsum ist daher der monetäre Wert in Euro. Diese Kosten kennen wir. Aber dies ist nur eine Seite des Konsums.
Der wahre Preis der Dinge
Die andere Seite verlangt einen Perspektivenwechsel. Hier erkennen wir, dass die Kosten mehr sind als Geld und dass man die Kosten der materiellen Dinge noch quantifizieren kann – und auch sollte. Denn wir zahlen weit höhere Kosten für unseren Konsum, als uns oftmals bewusst ist.
Die Kosten der Umwelt
So wie wir und unsere Kinder die Staatsschulden irgendwann bezahlen müssen, so müssen wir auch die Kosten der Umwelt irgendwann bezahlen. In manchen Teilen der Welt zahlt die Bevölkerung schon heute den Preis für unseren Konsum. Mit Dürren und Hungersnöten, mit Luftverschmutzung und Gesundheitsbelastung. Für die Güter, die wir uns kaufen, braucht es Ressourcen: Holz aus dem Wald, Erz aus den Minen, Öl für Plastik und Transport. Egal, was wir kaufen, irgendwo auf dieser Welt hat das Produkt seinen Anfang genommen und fast immer bleiben die Ressourcen, die dafür entfernt wurden, der Welt entnommen. Die wenigsten sind regenerativ. Irgendwann werden uns diese Rohstoffe fehlen.
Die Kosten der Wertschöpfung
Was kostet Apfelmus? Die übliche Antwort ist: 1,50€. Eine andere Antwort lautet: ca. zwei bis drei Stunden Arbeit. Die Äpfel müssen gepflückt, gewaschen und klein geschnitten werden, jemand muss sie aufkochen, abschmecken, die Gläser auskochen und das Apfelmus abfüllen. Durch die Globalisierung und die ständige Verfügbarkeit von fast Allem verlieren wir das Bewusstsein für den Wertschöpfungsprozess. Bei jedem Ding, das wir kaufen, haben sich mehrere Unternehmen damit beschäftigt, es gut zu machen. Denn selten macht ein Unternehmen alles. Nachdem die Bestandteile des Produktes von verschiedenen internationalen Orten zusammen getragen und montiert wurden, wird es nach Deutschland transportiert. Dort holen wir es im Laden ab oder lassen es uns zuschicken. Was für die einen – nämlich die Mitarbeiter der herstellenden Unternehmen – ihre Arbeit ist, ist für uns „nur ein Produkt“. Ist dieses Produkt aber unser Apfelmus, das wir selbst in mühsamer Arbeit gemacht haben, wissen wir es viel mehr zu schätzen. Wir sollten uns daher vor jedem Kauf überlegen, von wem diese Sache hergestellt wurde, bevor wir sie achtlos erwerben, nicht wirklich brauchen und bald wieder wegwerfen.
Die Kosten des Aufbewahrens
Lange haben wir es vor uns hergeschoben. Wir haben keine Lust darauf, aber es ungetan zu lassen, belastet uns. Ist es dann getan, fühlen wir uns viel besser und nicht mehr so eingeengt. Die Rede ist vom Ausmisten. Es enthält schon eine gewisse Ironie, dass wir uns in einer aussortierten Wohnung wohler fühlen, aber trotzdem leichtfertig neue Dinge kaufen, für die wir den freien Platz wieder nutzen müssen. Ist eine Sache gekauft, fällt uns die Wahrnehmung in den Rücken: Der vorherige Gedanke „Es ist schon recht voll hier“ wird durch den neuen „Naja, wir haben doch noch Stauraum“ abgelöst. Irgendwie können wir die neuen Sachen noch unterbringen, sagen wir uns. Und schon ist der Weg frei, uns Schritt für Schritt weiter zuzustellen.
Die Kosten des Mehr-Wollens
Gekaufte Dinge gehen mal kaputt und wir müssen uns dafür einen Ersatz kaufen – auch wenn wir das Ding vielleicht nie wirklich gebraucht haben. Manchmal funktioniert ein Ding noch tadellos, aber wir glauben, dass es nicht mehr gut genug sei. Weil jemand, den wir kennen, ein neueres Modell hat und damit „voll zufrieden“ ist und „es nur jedem empfehlen kann“. Oder weil es eine „wichtige“ Erweiterung gibt. Schon kaufen wir es. Das alte Gerät verkaufen wir „ganz nachhaltig“ bei eBay, mit reinem Gewissen. So werden aus einem Kauf viele weitere Käufe.
Die Kosten der Entsorgung
Nicht immer schenken wir unseren alten Sachen ein zweites Leben. Wir geben sie nicht weiter, wir verkaufen sie nicht, wir heben sie auch nicht auf, sondern werfen sie in den Müll. 462 Kilogramm Abfall pro Jahr erzeugt jeder Deutsche im Durchschnitt. Die Recyclingquote liegt aber nur bei 66%, der Rest wird verbrannt. Recycling bedeutet nicht, dass aus dem weggeworfenen Ding das gleiche Produkt gefertigt werden kann. Vielmehr wird zum Beispiel aus einer Plastikflasche ein Fleece-Pullover. Und wird dieser nicht mehr gebraucht, entsteht aus dem Pulli vielleicht noch ein Putzlappen. Ganz am Ende wird dieser Lappen dann verbrannt. Von einer Kreislaufwirtschaft sind wir noch weit entfernt. Ein Kreislauf würde bedeuten, dass die Rohstoffe aus unseren weggeworfenen Produkten zurückgewonnen werden, um daraus wieder – oder zumindest mehrheitlich – das gleiche Produkt herzustellen. Solange wir noch keine Kreislaufwirtschaft erreicht haben, fallen immense Kosten an.
Die Kosten der Abhängigkeit
Wenn wir nicht wissen, was uns im Leben wichtig ist, dann können wir nie wirklich glücklich werden. Wir suchen nach einem Sinn und versuchen ihn umzusetzen. Und wir schließen die Lücken unserer Suche auch durch den Kauf materieller Dinge, die uns gefallen. Sie zu kaufen gibt uns ein positives Gefühl, eine Zufriedenheit, ohne die uns etwas fehlt. Was wir dabei aber nicht bemerken: Wir werden abhängig von unserem Besitz. Das Zeug besitzt uns und unsere Zufriedenheit. Wollen wir das? Sind die besten Dinge im Leben wirklich die Dinge, die wir kaufen können?
Die Herausforderung in Sachen Nachhaltigkeit ist, den persönlichen Weg zu finden und ihn zu gehen, in kleinen oder großen Schritten – eben so, wie es für uns gerade angemessen ist. So geht es dem Einen leicht von der Hand, seine Gewohnheiten in großem Maße zu ändern, dem Anderen ist es aber durch seine Lebenssituation oder seinen Gemütszustand (noch) nicht möglich. Es muss nicht immer die radikale, nachhaltige Revolution sein. Auch kleine Veränderungen tragen dazu bei, den ökologischen Fußabdruck ein Stück zu reduzieren. Würde sich zum Beispiel jeder von uns dazu entscheiden, keine Plastik-Trinkhalme mehr zu verwenden, könnten wir allein dadurch im Jahr 25.000 Tonnen Plastikmüll einsparen und 3.750 Tonnen CO2, die bei der Entsorgung durch Verbrennung entstehen. Dabei verzichtet jeder „nur“ auf einen Strohhalm.
Im Alltag fällt es uns häufig leichter, unsere Gewohnheiten sukzessive zu verändern. So dauert der ganze Prozess zwar länger, aber das Gefühl von Verzicht, Verlust oder Aufopferung bleibt aus. Das Ziel erreichen wir am Ende dann doch.
Der Weg aus kleinen Schritten
Beobachten und analysieren:
Indem wir unser eigenes Genuss- und Konsumverhalten erforschen, lernen wir nicht nur mehr über unsere Gewohnheiten, sondern können auch identifizieren, an welchem Hebel wir zuerst etwas verändern können und wollen. Hilfreiche Fragen in dieser Phase sind:
Welche Produkte kaufe ich eigentlich?
Auf welche kann ich nicht verzichten und auf welche schon?
Wie schwer fällt es mir, auf Alternativen auszuweichen?
Welche Aspekte der Nachhaltigkeit sind mir am Wichtigsten (Arbeitsbedingungen in den Herstellerländern, CO2-Reduktion, Aktivitäten gegen Kinderarbeit, Erhaltung der Regenwälder, Tierschutz etc.)?
Welche Informationen finde ich über meine Lieblingsprodukte?
Fühle ich mich besser, wenn ich ein „gutes Produkt“ gekauft habe?
Fühle ich einen Verlust und warum?
Sich für einen Themenbereich und ein Ziel entscheiden:
Sicher gibt es Bereiche, in denen es uns leichter fällt, etwas zu verändern. Genau hier ist ein guter Startpunkt, wenn wir unser Ziel erreichen und unser Verhalten langfristig verändern wollen. Oft sind das Bereiche, die kurzfristig und mit relativ wenig Aufwand umsetzbar sind, zum Beispiel: „Beim Kaffee nachhaltiger handeln, aber nicht ganz drauf verzichten.“
Nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen:
Haben wir uns für einen Bereich entschieden, den wir uns vornehmen wollen, müssen wir Alternativen finden. Wichtig ist hier, dass dadurch nicht ein negatives Gefühl von Verzicht entsteht, denn dann werden wir diesen Weg nicht bis zum Ende gehen:
Gibt es nachhaltigere Alternativen zu den gekauften Produkten, die ich vielleicht noch nicht verwendet habe, die mir aber sehr gut gefallen?
Wenn ich nicht verzichten möchte, kann ich den Verbrauch vielleicht reduzieren?
Was müsste geschehen, damit ich ganz verzichten kann?
Wie lassen sich neue Routinen für mich in den Alltag integrieren (z. B. ein veganer Tag)?
Kann ich die Perspektive wechseln und den vermeintlichen Verzicht so zu einem Erfolgserlebnis machen (z. B. die Handlung als „Challenge“ sehen)?
Sich auf einen Schritt festlegen und ihn dann gehen:
Haben wir uns für eine Veränderung entschieden, setzen wir sie um, und zwar konsequent, bis wir unser Ziel erreichen. Dabei können wir natürlich auch Alternativprodukte wechseln oder neue Methoden ausprobieren. Bleiben wir beim Beispiel „Kaffee“:
Wir kaufen ab sofort nur noch biologischen, fair gehandelten Kaffee.
Irgendwann fällt uns die alte Filterkaffeemaschine im Keller ein, die in der Ökobilanz erheblich besser abschneidet als unser Vollautomat. Wir tauschen das Gerät.
Unterwegs verzichten wir auf To-Go-Kaffee im Wegwerfbecher und kaufen im Supermarkt oder an der Tankstelle auch keinen gekühlten Kaffee in der Plastikflasche mehr. So reduzieren wir unseren ökologischen Fußabdruck immer weiter.
Nach eigenem Ermessen können wir dabei einzelne Handlungsmöglichkeiten Stück für Stück oder alle gleichzeitig umsetzen.
Den nächsten Schritt gehen:
Irgendwann werden wir feststellen, dass wir uns an eine Veränderung so sehr gewöhnt haben, dass wir sie automatisch umsetzen. Wir denken nicht mehr darüber nach und es kostet keine Anstrengung, sich für die nachhaltige Alternative zu entscheiden. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, sich den nächsten Schritt vorzunehmen: sich wieder beobachten, analysieren, entscheiden, nach Lösungen suchen und loslaufen.
Wie unser Konsum den Regenwald beeinflusst
Ein Beispiel für den wahren Preis, den wir mit dem Kauf von Produkten bezahlen, sind die tropischen Regenwälder. Mit ihrer vielfältigen Flora und Fauna haben sie eine besondere Faszination. Drei von vier der heute bekannten biologischen Arten (und das sind immerhin 1,85 Millionen) stammen aus den Tropenwäldern. In Peru beispielsweise wachsen auf einem Hektar Regenwald 283 Baumarten. Die meisten deutschen Wälder bestehen aus gerade einmal fünf Baumarten.
Doch die Tropenwälder sind noch viel mehr als eine Schatzkammer der Biodiversität. Auch in unserem täglichen Leben spielt der Dschungel am Ende der Welt eine größere Rolle als wir denken. Umso dramatischer ist, dass seine Fläche immer weiter abnimmt. Bis heute hat der Mensch schon die Hälfte aller ursprünglichen Regenwälder vernichtet und immer noch werden jeden Tag über 425 Quadratkilometer gerodet – eine Fläche größer als Köln.
Die Bedeutung der Tropenwälder
Die tropischen Regenwälder sind nicht nur Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten, sondern auch für Menschen. Nach Schätzungen der Welternährungsorganisation FAO leben weltweit rund 300 Millionen Menschen in oder am Rand der Urwälder, unter ihnen viele indigene Völker und Stämme, jeder mit einer eigenen Kultur und Sprache. Ihr Überleben ist eng mit dem der Regenwälder verbunden.
Obendrein haben die Tropenwälder einen erheblichen Einfluss auf Umwelt und Klima, denn das thermische Tiefdruckgebiet und die Verdunstung wirken sich auf den Verlauf der Luftströme und der Meeresströmungen aus. Diese Effekte beeinflussen nicht nur das regionale Klima, sondern haben die Funktion einer globalen Klimaanlage.
Daneben sind Biomasse und Böden ein enormer Kohlenstoffspeicher: Laut Schätzungen haben die Tropenwälder im Laufe ihres Entstehens 275 Milliarden Tonnen CO2 aus der Atmosphäre gezogen und gespeichert. Auch absorbieren sie CO2 – und zwar weit mehr, als man bisher angenommen hat. Eine Studie der NASA schätzt, dass die Tropenwälder rund 1,4 Milliarden Tonnen CO2 aufnehmen, das entspricht 56% der weltweiten jährlichen Absorption und ist mehr, als alle Wälder in Kanada, Sibirien und anderen nordischen Regionen aus der Atmosphäre binden.
Die Regenwälder speichern außerdem Wasser in großen Mengen. Der Wasserkreislauf ist für die stabile Feuchtigkeit verantwortlich und wirkt sich positiv auf angrenzende Gebiete aus: Die Niederschläge verteilen sich und verbessern die Standortbedingungen für landwirtschaftliche Nutzflächen in der Umgebung.
Neben alledem bieten die Böden viel Erosionsschutz, sodass auch bei Starkregen keine Hänge abrutschen, anders als bei gerodeten Flächen.
Der Mensch verdankt den Urwäldern zahlreiche Produkte, denn viele der heutigen Kulturpflanzen stammen ursprünglich aus den Tropen und wurden anfänglich dort angebaut: exotische Früchte, Kaffee, Kakao, Kartoffeln, Soja und Gewürze wie Chili, Ingwer, Nelken, Muskat, Zimt oder Vanille. Auch für die Medizin spielten – und spielen bis heute – die Tropen eine große Rolle als Zutaten für Medikamente. So hilft ein Stoff aus dem Amazonas-Chinarindenbaum gegen Malaria, Pilze produzieren Antibiotika und auch die Anti-Babypille hat ihren Ursprung in den Säften von Lianen. Weitere Ressourcen, vor allem Holz, Palmöl, Kautschuk und Pflanzenfasern, sind für viele Wirtschaftsbranchen unverzichtbar. Und die Regenwälder müssen dem Profit weichen.
Die Relation zwischen Konsum und Urwald
In Brasilien ist der Sojaanbau die größte Bedrohung für den Amazonas-Regenwald. Die Nachfrage der Viehwirtschaft an dem eiweißreichen Futtermittel ist unersättlich und der Fleischhunger der Verbraucher will gestillt werden. In deutschen Mastanlagen wird hauptsächlich Soja verfüttert, das aus Argentinien und Brasilien importiert und für dessen Anbau große Flächen Urwald gerodet wird. Soja findet sich aber auch in Biodiesel, Margarine, Mayonnaise, Kosmetika sowie veganen und vegetarischen Nahrungsmitteln wie Tofu, Soja-Milch oder veganer „Wurst“. Die Anbauflächen für Soja betragen weltweit über 90 Millionen Hektar und sind damit drei Mal so groß wie Deutschland. Soja wächst fast immer in industriellen Monokulturen. Das führt zu Bodenerosion und zur Verschmutzung der Gewässer, denn die Pflanzen müssen zum Schutz vor Krankheiten, Unkraut und Schädlingen mit ständig neuen Pestiziden behandelt werden. Das bedeutet nicht nur eine Belastung für die Umwelt, sondern zugleich für die lokale Bevölkerung.
Auch für Weideflächen der Angus-Rinder braucht man Platz. Und für Orangen-Plantagen, auf denen die Früchte wachsen, die sich in fast jedem unserer O-Säfte wiederfinden.
In Südostasien, insbesondere Indonesien, ist Palmöl der Hauptgrund für die Vernichtung der Wälder. Weltweit wird dafür pro Minute eine Fläche gerodet, die so groß ist wie 35 Fußballfelder. Das profitable Öl wird stark nachgefragt für Produkte wie Eis, Schokolade, Mayonnaise, Gebäck, Fertiggerichte, Kosmetika oder Duschgel. Seit Dezember 2014 gilt eine Kennzeichnungspflicht für Palmöl in Lebensmitteln und es muss in den Inhaltsstoffen namentlich aufgelistet sein. Bei anderen Produkten ist es schwieriger zu identifizieren, denn es versteckt sich hinter Begriffen wie „pflanzliches Öl“, „Pflanzenfett“, „Palmate“ oder „Palmitate“.





























