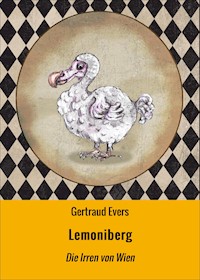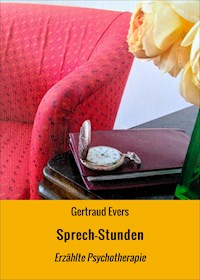2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Orlando-Bar in der Innenstadt ist ein magischer Ort. Luis hinterm Tresen hat alles im Blick, die Eroberungen des schönen Nino, die Versunkenheit der betrunkenen Judit, unglückliche Paare wie Martin und Nina. Nino wird von vielen begehrt, bleibt aber kalt. Mit Haarpflege kennt er sich aus, mit der Liebe nicht. Nina wird geliebt, kann sich aber selbst nicht leiden. Martin bemüht sich, aber vergeblich. Luis' eigene Ehe wackelt, Eva interessiert sich mehr für ihre Psychotherapiepatienten als für ihren Mann. Wer mehr liebt, so scheint es, muss mehr leiden. "Es ist eine alte Geschichte", heißt es bei Heinrich Heine, "und wem sie just passieret, dem bricht das Herz entzwei." Wird Nina bei ihrem Hausarzt Edwin Halt finden? Wird Martin dem Sog des Abgrunds widerstehen? Kann sich eine Alkoholikerin auf die große Liebe einlassen? Können Menschen sich ändern, vielleicht in einer Therapie? Gibt es überhaupt eine glückliche Liebe? Wer wird nach allem fragen, meint Luis, und schenkt nach. Im Lauf eines Jahres werden sieben Menschen von der Liebe bewegt, im Guten wie im Bösen, und was im Leben keinen Ort findet, fließt in die Träume.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gertraud Evers
Deine Nina
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Eine alte Geschichte
Der wunde Punkt (Nino)
Blitzeis (Eva)
Ich seh dich gern (Luis)
Verkündigung (Judit)
Niemand zu Hause (Edwin)
Nicht bei Trost (Judit)
Prinzenseele (Nino)
Raubtierkörper (Eva)
Nachricht gelöscht (Nino)
Kein grüner Zweig (Martin)
Bad Hair Day (Nina)
Wir sind zu gut füreinander (Luis)
Der entscheidende Augenblick (Judit)
Alles oder Nichts (Eva)
Jetzt nicht (Nina)
Ewige Baustelle (Nino)
Eine unlösbare Aufgabe (Martin)
Das arme Tier (Eva)
Ein Wind kommt auf (Edwin)
Goldene Angelhaken (Eva)
Noch nicht genug (Judit)
Nah am Wasser gebaut (Nino)
Vice versa (Eva)
Die kleine und die große Wut (Luis)
Atlantis (Judit)
Wie konnte ich nur (Edwin)
Verlorene Liebesmüh (Nino)
Kopf hoch (Nina)
3D (Martin)
Das Kleid der Mutter (Eva)
Zum Kotzen (Judit)
Ein schwarzer Brautstrauß (Luis)
Ist das wirklich zu viel verlangt? (Nina)
Der Verschmutzer (Martin)
Scheidung vor der Hochzeit (Eva)
Halten Sie sich vom Abgrund fern (Edwin)
Fremdgehen (Luis)
Der Duft des Schlehdorns (Martin)
Zwischen den Jahren (Eva)
Wunderkerzen (Judit)
Heißer Sand
Impressum neobooks
Eine alte Geschichte
Ein Jüngling liebt ein Mädchen,
Die hat einen andern erwählt;
Der andere liebt eine andre,
Und hat sich mit dieser vermählt.
Das Mädchen heiratet aus Ärger
Den ersten besten Mann,
Der ihr in den Weg gelaufen;
Der Jüngling ist übel dran.
Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu;
Und wem sie just passieret,
Dem bricht das Herz entzwei.
Heinrich Heine
Der wunde Punkt (Nino)
Mir ist kalt, sage ich zu der Frau, und obwohl ich sie nicht ansehe, weiß ich, dass sie mich ansieht und dass sie mich nicht aus den Augen lassen wird. Kalt, Nino, aber wieso denn, sagt sie, hier drin ist es doch warm. Mir wird immer kalt, wenn ich irgendwie aufgekratzt bin, keine Ahnung, sage ich, was ich sofort bereue, denn ich weiß haargenau, was jetzt kommt, sie wird weiter fragen, und ich werde den üblichen Schwachsinn reden. Sie beugt sich vor, aufgekratzt, wie meinst du das, fragt sie, und obwohl ich weiter in der Bar herumschaue, weiß ich ganz genau, wie inbrünstig sie mich jetzt ansieht, ich kenne diesen Blick auswendig. Mir wird immer kalt, wenn eine Frau mich wirklich reizt, sage ich, eine wirklich schöne Frau, sage ich, und wenn ich schön sage, dann meine ich schön, hübsch sind viele, ich meine schön, sage ich, und natürlich kenne ich längst ihren wunden Punkt, es ist das Kinn.
Sie ist eines von diesen Mädchen, bei denen alles in Ordnung ist, Figur, Geschmack, Lebenslauf und natürlich die Studienunterlagen, deswegen kann sie mir bei der Seminararbeit das schwachsinnige Recherchieren ersparen, das ist nicht bloß in Ordnung, das ist bestens, aber trotzdem hat sie eben dieses Kinn, die Proportionen sind gestört, selbst bei schmeichelnder Beleuchtung fällt es auf, dieses Kinn ist plump, eindeutig ein Makel, und ich weiß haargenau, dass sie schon oft vor dem Spiegel ihr Kinn verflucht hat, ich bin Experte für wunde Punkte.
Schön meinst du, fragt sie so leise, dass es wie ein Wimmern klingt. Ich bin plötzlich angewidert, was rede ich hier für einen Schwachsinn, sage ich und überschlage die Beine so, dass ich ihr fast den Rücken zukehre. Schwachsinn ist das keineswegs, Nino, sagt sie und fasst meine Hände, die auf dem Marmortischchen liegen, sie greift sich meine Hände, als seien sie Gegenstände, die ihr gehören, kalt, sagt sie, das verstehe ich so gut, ich bin nämlich ... Ach vergiss es, sage ich, aber sie hält immer noch eisern meine Hände, ich zähle innerlich bis zwanzig, dann ziehe ich sie weg. Ich schaue auf die Uhr. Sie ist nett, aber eine brillante Gesprächspartnerin kann man sie weiß Gott nicht nennen, ihre Bemerkungen kommen immer stoßweise, wie Rülpser, und ebenso komisch ist ihre Art, einem ohne Anlass auf den Leib zu rücken, man ist jedes Mal völlig überrumpelt. Eine Dampfwalze ist sie, nicht wirklich fett, aber irgendwie plump mit diesem vierschrötigen Kinn, ein Panzer, man muss ständig auf der Hut sein. Du weißt doch, in der Öffentlichkeit habe ich das nicht so gern, sage ich, aber da wirft sie mir erst recht die Arme um den Hals und summt, gern hab ich dich, so gern!
Ich weiß, sage ich.
Ich winke Luis wegen der Rechnung und schiebe sie zum Ausgang, geh doch schon mal vor, sage ich, vielleicht kriegst du gleich ein Taxi. Aber Taxi brauchen wir doch keines, protestiert sie, da sind sie alle schwer von Begriff, wenn der Nino keine Lust mehr hat, sei nicht kompliziert, sage ich, von wem soll man denn Verständnis erwarten wenn nicht von einer wirklich klugen Frau.
Luis ist nett, bei ihm habe ich immer Kredit, wenn ich nicht flüssig bin, und das kommt leider oft vor, weil meine Eltern knausern, besonders mein Vater, immer schön das Geld zusammenhalten, immer schön auf dem Teppich bleiben, also muss ich mir Leute wie Luis oder Edgar warm halten, was bleibt mir übrig. Luis ist echt nett, er ist nicht dumm, zumindest redet er keinen Schwachsinn, keine Ahnung, wieso er es nur zum Wirt gebracht hat, manchmal lässt er Bemerkungen fallen, die mir tagelang nicht aus dem Kopf gehen, aber er nervt auch irgendwie, er schaut einen immer so intensiv an, keine Ahnung, einladen will er einen ständig, zum Doppelkopf, zur Weinprobe, womöglich hat er für den Neujahrstag wieder so eine Einladung im Sinn, er kapiert es nicht, wenn der Nino keine Lust mehr hat, genauso wenig wie die Mädchen, also gebe ich mich schwer beschäftigt und tue so, als sei ich jetzt mit dieser Kinnfrau liiert. Also dann, sage ich zu Luis und deute mit einer Kopfbewegung zu der Musterstudentin, die mit all ihren Mappen und Ordnern an der Tür wartet wie bestellt und nicht abgeholt.
Am äußersten Ende des Tresens sitzt eine Frau im Mantel, raucht und rührt sich nicht. Da hat wohl eine zu tief ins Glas geschaut, sage ich zu Luis, ohne ihn anzusehen, ich lasse die Frau nicht aus den Augen. Zum ersten Mal fallen mir die Likörflaschen im Regal auf, direkt hinter ihr leuchten sie in Regenbogenfarben. Die Frau ist schwarz angezogen, genau wie ich, langes schwarzes Haar fällt über ihren Rücken, sie bewegt sich nicht, nur ihre Zigarette zerfällt ganz langsam, Asche fällt auf ihr Knie. Ach lass die in Ruhe, sagt Luis, die hat nicht mehr getrunken als sonst, die ist halt manchmal so in ihrer eigenen Welt. Die Asche zwischen ihren Fingern hört man beinahe knistern, es ist ganz still.
Weißt du übrigens, wo Esther steckt, fragt Luis plötzlich. Wir haben jetzt wohl eine Weile geschwiegen, ich stehe immer noch an der Theke, obwohl dieses Mädchen an der Tür auf mich wartet, manchmal verliere ich das Zeitgefühl, keine Ahnung, obwohl ich verlorene Zeit überhaupt nicht leiden kann. Die war doch sonst fast jede Nacht da, fährt Luis fort, als von mir keine Antwort kommt, ich habe natürlich keine Lust auf solche Fragen, welche Esther, sage ich, keine Ahnung, woher soll ich das denn wissen. Du warst doch mit ihr zusammen, Luis lässt nicht locker, die ist doch in der letzten Zeit immer dünner geworden, ist dir das nicht aufgefallen, die hatte doch so Probleme mit dem zweiten Staatsexamen. Luis, du nervst, sage ich, du weißt doch, dass ich mir keine Gesichter merken kann, und Namen schon gar nicht, und überhaupt, was soll das, ich mit dieser Esther „zusammen“, ich male die Anführungszeichen in die Luft, und da mischt sich jetzt auch noch diese Musterschülerin ein, zusammen warst du aber mit Esther nicht wirklich, oder, quengelt sie und hakt sich bei mir ein. Ich werfe Luis einen bösen Blick zu, man muss doch nicht immer über alles endlos reden, und damit ich endlich Ruhe habe, sage ich zu der Frau, nein, ich war nicht wirklich mit ihr zusammen. Allmählich dämmert mir, von wem die Rede ist, es geht um diese Jurastudentin mit dem Telefontick, Typ Bambi, leichte X-Beine, beim Flirt war sie recht spritzig, aber im Bett zum Vergessen. Tja, was soll´s, sage ich zu Luis, das Bett ist noch warm. Die Kinnfrau hat das zum Glück nicht richtig mitgekriegt. Warm anziehen, sagt sie, und zupft an meinem Schal herum. Von ferne hört man die ersten Böller der Ungeduldigen, die nicht bis Mitternacht warten mögen.
Hör zu, Elsa, sage ich und fixiere sie, damit sie mich richtig versteht. Elsa nennst du mich, sagt sie mit dieser wimmernden Stimme, eigentlich heiße ich Elisabeth, aber ..., hör zu, sage ich, das ist echt nett von dir, dass du mir die Unterlagen gebracht hast, das Seminar ist ja so was von öde, total verlorene Zeit, hast du übrigens diese Fragebögen für Statistik, die kannst du mir auch mal geben. Du bist echt einmalig, sage ich und fixiere ihr Kinn, so eine wie dich gibt es kein zweites Mal, bring mir das Zeug dann morgen, ja morgen, sagt sie, ach nein morgen geht nicht, sage ich, schick es mir doch einfach, theoneandonly@yahoo, alles zusammengeschrieben, das kannst du dir doch merken, merk ich mir, sagt sie und nickt irgendwie benommen, sie nickt wie diese Wackelhündchen auf den Hutablagen, mhm, summt sie, theoneandonly, jetzt muss sie nur noch gehen, also Prosit Neujahr, sage ich, und sie setzt sich in Bewegung, Prosit Neujahr, mein lieber Nino, sagt sie mit einer komischen Betonung, bis dann, sagt sie, und ich, also dann.
Blitzeis (Eva)
Komisch ist das schon, dass Sie heute Termine machen, sagte Herr Kaiser, und noch dazu so spät. Dabei sah er, wie gewöhnlich, seine Therapeutin nicht an, obwohl das für seine Verhältnisse eine ungewöhnlich persönliche Bemerkung war. Komisch, sagte ich, was genau finden Sie denn daran komisch? Ich bemühte mich, nicht beleidigt zu klingen. Immerhin hatte ich die Neunzehn-Uhr-Stunde für Manfred Kaiser an mein übliches Donnerstags-Pensum drangehängt, weil ich den Eindruck hatte, er sei nicht nur abwechselnd deprimiert und genervt, sondern allmählich tief verzweifelt darüber, dass er mit der Arbeit für sein Studium nicht weiterkam; genauer: damit nicht anfangen konnte; genauer: mit überhaupt nichts anfangen konnte. Für Anfang Januar plante ich zwei Wochen Urlaub, also meinte ich, meinem Patienten mit diesem Angebot etwas Gutes zu tun. Mittlerweile war mir das Muster vertraut: Es war ungewöhnlich schwer, Kaiser etwas Gutes zu tun. Eine Gabe anzunehmen, das hieß für ihn vor allem, seine Bedürftigkeit einzugestehen, und gegen diese Zumutung pflegte er sich zu verwahren, indem er das Angebot mal subtil, mal rüde herabsetzte. Wie so oft, empfand ich nach kurzem Wortwechsel mit ihm eine vage Beschämung, gerade so, als hätte ich mich ihm mit meinen eigenen Bedürfnissen aufgedrängt.
War da womöglich was dran? Ja, ich sah ihn gern, er war ein gut aussehender und gescheiter junger Mann. Ja, ich mochte ihn. Das trifft allerdings für nicht wenige Patienten und Patientinnen zu. Wenn man so lange Zeit so aufmerksam in ein Gesicht schaut und sich über eine Geschichte beugt, stellt sich fast immer eine Art Zuneigung ein. Und ja, Manfred Kaiser regte meine Fantasie an: Die junge Eva, die Studentin in ihren Zwanzigern, hätte sich wohl in einen wie ihn verlieben können. Auch als Siebenundvierzigjährige konnte ich mir lebhaft vorstellen, wie anziehend er auf Frauen wirken mochte. Und wie er sie sich wohl vom Leib zu halten wusste, denn von einer Freundin war noch nie die Rede gewesen. Obwohl Kaiser sich auch mir gegenüber oft abweisend verhielt und ständig etwas an der Behandlung auszusetzen hatte, war er immerhin bereits ein Dreivierteljahr geblieben und, wenn auch meist verspätet, regelmäßig zu den Gesprächsterminen gekommen. Ich reimte mir zusammen, dass er mich, oder jedenfalls das, was er von mir bekam, brauchte, mich aber gerade deshalb auf Abstand hielt und oft herabsetzte. Um keinen Preis wollte er sich bedürftig und damit abhängig fühlen. Warum ihm das so außergewöhnlich peinlich war, hatten wir noch nicht herausgefunden.
Manfred Kaiser war mir ein Rätsel.
Schon oft hatte ich versucht, ihm widerzuspiegeln, wie seine schroffe Art auf ein Gegenüber wirkte. Aus seinen kargen Erzählungen ergaben sich nämlich immer wieder Hinweise darauf, dass er auch bei anderen Menschen damit aneckte. Im Erstgespräch hatte Kaiser erwähnt, dass er sich häufig abends allein betrinke, weil er kaum Kontakte habe. Als ich weiter fragte, hatte er patzig reagiert. Ja, genau, er trinke allein, denn er sei eben allein! Einsam, könne man auch sagen! Und ja, er leide darunter, wer hätte das gedacht!
Stets von neuem irritierte es mich, wie mit diesem Patienten die Gesprächsatmosphäre urplötzlich umschlagen konnte. Eben noch unterhielt man sich angeregt, forschend oder amüsiert, da brach im nächsten Moment Blitzeis aus, sobald er befremdet die Stirn runzelte. Schlagartig schien alles an Bedeutung, was ich in neun Monaten Psychotherapie gesehen hatte, als Hirngespinst einer überengagierten Behandlerin entlarvt. Besonders abweisend verhielt Kaiser sich dann, wenn ich ihn besonders gut zu verstehen meinte und dies an den Mann bringen wollte. Sobald ich ihm näherzukommen glaubte, gab er mir das Gefühl, ihn zu belästigen. Er reagierte dann mit einem stumpfen Blick seitlich an mir vorbei, es gab kein Nicken, kein Kopfschütteln, kein Aufblitzen in seinen Augen, es war, als hätte ich nichts gesagt, nichts Bedenkenswertes, nichts von Wert, nichts! Auf dem Weg von meinem Platz zu seinem gefroren meine Worte zu grotesken, nutzlosen Gegenständen. Ich empfand den Dreißigjährigen in dieser Szene abwechselnd als ungnädigen Prüfer und verstocktes Trotzkind. Oder ließ er mich etwa abprallen, weil er einfach nicht verstand, was ich meinte? War dieser hochintelligente Psychologiestudent gefühlstaub?
Wie immer, wenn ich meinen Gedanken nachhing und den Blick von ihm abwandte, spürte ich, wie Kaiser mich fixierte, als müsse er etwas Wichtiges ergründen, das sich aber verflüchtigen würde, sobald sich unsere Blicke träfen. In flagranti, fiel mir ein, er will mich erwischen, wenn ich nicht aufpasse, er will mir etwas abgucken oder ablauschen. Als ich den Kopf hob und ihm fragend ins Gesicht sah, begann er hastig zu sprechen.
Sie klingen heute irgendwie genervt, Frau Mohn.
Wie kommen Sie darauf?
Ihr Ton, keine Ahnung. Vielleicht sind Sie ja einfach urlaubsreif. Genervt eben.
Nein, genervt bin ich nicht. Aber Sie haben schon etwas Zutreffendes wahrgenommen, ich war etwas irritiert über Ihre Bemerkung zum heutigen Termin. Ich hätte gern eine Antwort auf meine Frage von vorhin, was denn nun an diesem Termin so komisch ist. Wenn Sie es mir nicht bald verraten, werden wir es erst im nächsten Jahr klären können.
Sogleich registrierte ich meinen ungewöhnlich scharfen Unterton. Wahrscheinlich hatte er Recht, ich war genervt. Weil der Herr mein Entgegenkommen nicht zu würdigen wusste?
Kaiser zuckte die Achseln.
Keine Ahnung, man könnte meinen, Sie machen so einen Termin, weil Sie nichts Besseres zu tun haben. Vielleicht liegt ja Ihr Privatleben brach? Vielleicht brauchen Sie ja eine nette Abwechslung? Sie sind doch mit dem Professor Mohn verheiratet, so ein Chefarzt hat ja sicher nicht viel Freizeit.
Brachliegendes Privatleben, ganz schön unverschämt, dachte ich mit leisem Ärger. Aber zugleich war ich geschmeichelt von seinem Interesse an meiner Lebenslage, wofür ich mich sofort wieder schämte. Verriet sich da meine alte Bedürftigkeit nach Beachtung? Ich nahm mir vor, darüber genauer nachzudenken. Immerhin, er hatte mich erstmals mit meinem Namen angesprochen und sich überhaupt mal ein paar Gedanken über einen anderen Menschen gemacht. Ich stellte klar, dass mich mit dem Chef der Augenklinik nur eine zufällige Namensgleichheit verbindet.
Sie dachten also, dass ich auf Sie als Gesprächspartner angewiesen bin, um mich in der Leere eines Feiertags nicht zu langweilen? Aber dann müsste doch ich Sie bezahlen und nicht umgekehrt!
Kaiser lächelte mit leicht herabgezogenen Mundwinkeln. Er antwortete nicht mit der gewohnten Schlagfertigkeit, sondern schwieg eine Weile, was bei ihm ganz selten vorkam.
Komisch, jetzt musste ich an zu Hause denken. Am Samstagabend musste ich meiner Mutter immer die Haare machen, sobald der Salon endlich geschlossen war, das geht ja gar nicht, dass die Chefin unfrisiert herumläuft, und außerdem sieht sie sich ja jeden Tag hundert Mal im Spiegel. Mein Vater hat die Kasse gemacht, sie hat sich einen Martini eingeschenkt, ich habe ihr die Haare gemacht, ich war ja der Einzige, der es ihr recht machen konnte, früher habe ich das ganz gern gemacht, später aber nicht mehr.
Wieder trat eine Stille ein. Während ich das Bild des Frisiersalons vor mir sah, rosa Kittel, Trockenhauben, Nebel von Haarspray, dachte ich verschwommen über Scham und Sehnsucht nach. Ich beschloss, auf die alte Geschichte nicht sofort einzugehen, um den scheuen Erzähler nicht zu bedrängen, und stattdessen in der Gegenwart zu bleiben, zumal sich die Stunde dem Ende zuneigte.
Wie werden Sie denn Silvester verbringen?
Das hängt ganz davon ab.
Hängt wovon ab?
Welches Angebot mich am meisten reizt.
Ich überließ mich dem leicht metallischen Timbre seiner Stimme, während er erklärte, wie er auf seinem Handy Kontaktangebote speichernte, sich aber nie direkt erreichen ließ. Er will König Kunde sein, überlegte ich, er darf keinesfalls überrumpelt werden, er braucht die Macht, Gnade und Ungnade zu verteilen. Ob er überhaupt wählt, behält er sich vor. Vielleicht genügt es ihm, dass er wählen könnte, wenn er wollte. Ich stellte mir plötzlich eine Schnecke vor, ich sah ihr bräunliches Fleisch, sah das gewundene Gehäuse, schimmernd wie Messing. Wer den weichen Teil berühren will und den falschen Zeitpunkt erwischt, der prallt an der Schale ab und holt sich blaue Flecken.
Was sagten Sie eben, fuhr ich auf, hatte ich etwa, meinen inneren Bildern nachhängend, kurz nicht zugehört? Irgendwie hatte der junge Mann auch von Bildern geredet, ging es um Fotos? Schon okay, sagte Kaiser, nicht so wichtig, er zeigte auf seine Armbanduhr, wir haben überzogen, und als hätte er einen Weckruf bestellt, knallte auf der Hauptstraße eine voreilige Silvesterrakete.
Als wir uns an der Tür verabschiedeten, fiel Schnee, war schon eine Weile gefallen, war schon liegen geblieben. Im Lichtkegel der Straßenlaterne tummelten sich die Schneeflocken, warfen Schatten auf dem weißen Untergrund, wie Tiere huschten die schwarzen Abbilder über die Schneedecke, lautlose Hummeln. Schnee ist so schön, hat Luis einmal gesagt, weil er die Kanten weich und die Geräusche sanft macht.
Manchmal finde ich es sehr komfortabel, mit einem Mann verheiratet zu sein, der immer dann arbeiten muss, wenn die anderen Feierabend haben. Ich bin eigentlich gern allein. Und uneigentlich, frage ich dann meine Patienten immer, wenn sie sprachlich so herumeiern. Wer eigentlich sagt, meint eigentlich das Gegenteil, oder? Nein, doch, ich bin wirklich gern allein. Ich könnte sogar noch mehr Abstand vertragen. Aber Luis passt das nicht, Luis ist nicht gern allein.
Es war mir angenehm, dass ich nach dieser letzten Sitzung in Ruhe noch ein wenig nachdenken konnte. Weniger angenehm war die Frage, was ich gegen Mitternacht anziehen sollte, denn meine geliebten lockeren Leinenkleider gehören nicht zur Wintergarderobe, und mollige Frauen sehen nun mal in pompösen Festkleidern wie Matronen aus, oder wie diese Schlachtschiffe, wie heißen die noch mal, was für ein unerfreulicher Einfall! Ich bin doch mit ein bisschen über Mitte vierzig noch keine Matrone und schon gar kein Fregatte, dachte ich, und überhaupt, mein Liebster wird sich freuen, wenn ich ihn umarme, egal, was ich anziehe, Hauptsache tiefer Ausschnitt, er mag es doch füllig, das sagt er jedenfalls seit dreiundzwanzig Jahren, und in hundert Jahren sind wir alle tot, sagte ich mir, der junge Herr Kaiser und mein Mann, der demnächst fünfzig wird, und ich ebenso, carpe diem, Eva Mohn, nur die Mundwinkel nicht hängen lassen, all das sagte ich mir, aber schwermütig war ich doch.
Ich seh dich gern (Luis)
Wenn Nino auftaucht, freue ich mich immer, jedes einzelne Mal in den drei Jahren, seit er regelmäßig in die Bar kommt. Ich seh dich gern, habe ich eines Nachts zu ihm gesagt, ich hörte mich diesen Satz sagen und bemerkte den staunenden Tonfall, und ich staunte in der Tat, als mir klar wurde, wie genau das zutraf, was ich mich da sagen hörte, ich staunte über die Tatsache und darüber, dass ich sie erst jetzt erkannte und dass ich sie, um sie zu erkennen, erst hatte aussprechen müssen, der Satz hatte mich überrumpelt, als sei er mir gegen meinen Willen passiert, oder vielmehr ohne meinen Willen, so wie einem ein Niesen passiert, denn so etwas sage ich nie, nicht einmal zu meiner Frau. So ein kompliziertes Labyrinthdenken ist eigentlich gar nicht meine Art, eher ihre. Ich seh dich gern, das ist einfach da in meinem Kopf, wenn Nino auftaucht, das schlägt an wie eine Glocke.
Ein Barkeeper hat natürlich die Augen überall, der Chef schon überhaupt, aber diesen Gast lasse ich buchstäblich niemals aus den Augen. Das ist nicht schwer, denn Nino sitzt immer am gleichen Tisch, oder er stellt sich an die Theke, wenn er, was höchst selten vorkommt, allein unterwegs ist. Dutzende Bilder von Nino-Paarungen habe ich gespeichert, Nino mit Elvira, Nino mit Esther, mit Elisabeth, mit Evelyn, wie sie alle heißen. Eine schöner als die andere. Die Gesichter der Frauen sind verschwommen, Ninos Bild aber ist klar. Durch die Überlappung vieler ähnlicher Bilder bekommt seine Gestalt Tiefenschärfe, und wenn ich an ihn denke, sehe ich ihn in 3D. Der Glockenschlag, wenn ein Mensch auftaucht, das leichte Erschrecken, sobald sich die Blicke treffen, nun ja, man kennt das. Ich mag da nicht so genau hindenken, aber natürlich, wenn ich Eva all das erzählte, sie wüsste wohl, wie man das nennt, was sich da abspielt, sie fände Fachausdrücke für die Zuckungen der Zellen und den Fluss der Botenstoffe im Gehirn, nein, genau besehen lässt es sich nicht leugnen, wenn einer einem anderen gegenüber so empfindet, dann ist er verliebt.
Ich lebe mit meiner Frau zusammen, seit unser Sohn ausgezogen ist, sind wir wieder zu zweit. Und ich kann mir allerhand vorstellen. Da gibt es kurze Filme in meiner Fantasie, stumme ritualisierte Szenen, kommentiert von einer souveränen Stimme aus dem Off. Da kommen Männer vor, Frauen natürlich auch, aber eben Männer auch, oder genauer gesagt, zwei Männer, nämlich einer, der eine Idealversion von mir selbst ist, ein stilisierter Luis Fernwald, schöner und kraftvoller als in Wirklichkeit, und ein anderer, der Nino sehr ähnlich sieht. Der Nino ist. Bei ihm gibt es nichts zu verbessern. Nino findet so, wie er ist, Eingang in meine Tagträume, er braucht nicht einmal anzuklopfen, ich reiße die Tür auf und stürme ihm entgegen, sowie er sich am Horizont zeigt.
Wenn ich ehrlich bin, will ich es gar nicht wissen, was mich an Nino so reizt, und darüber sprechen mag ich schon gar nicht. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, sage ich häufig auf Evas Fragen, das kann sie partout nicht leiden. Ich habe ja überhaupt meine Zweifel an der Reichweite der Sprache. Anders als meine Frau fürchte ich, dass Reden zerstört. Ich fürchte, dass es in der Natur der Sprache liegt, das Erleben zu verderben, so wie das Zerschneiden im Wesen des Messers liegt. Eva widerspricht mir da seit Jahren, stur, wie sie ist. Sie sieht die Gefahr, führt sie aber auf ungeschickte Handhabung zurück. Nicht Vernunft sei kalt, sondern schlechte Vernunft, meint Eva, nicht Sprache sei zerstörerisch, sondern schlechte Sprache. Vielleicht hat sie Recht.
Bei diesem Thema kommt meine ohnehin sehr gesprächige Frau so richtig in Fahrt. Sprechen ist ja ihr Beruf, oder vielmehr Zuhören. Vielleicht wird ihr das Zuhören ja manchmal zu viel, und mit mir redet sie dann wie ein Wasserfall. Bei mir ist es ja nicht so viel anders mit dem Zuhören, aber das Reden ist in einer Bar nicht der offizielle Geschäftsgegenstand wie in einer psychotherapeutischen Praxis. Am Tresen gibt es immer die einsamen Herzen, die sich ausschütten müssen. Die meisten müssen sich zugleich zuschütten, also merkt sich kaum ein Gast, was er betrunken dahergeredet hat, und was ich dazu gesagt habe, schon gar nicht. Ich beschränke mich darauf, ein aufmerksames Gesicht zu machen und die Leute reden zu lassen. Auch wenn sie alles vergessen, vielleicht fließt ja doch ein Stau ab und es ist ihnen nachher leichter ums Herz. Viele Leute erzählen mir von ihrem Leben, ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Vielleicht flößt es ihnen Vertrauen ein, dass ich keinesfalls besser aussehe als sie. Mein Gesicht ist breit und voller Aknenarben, und von einem, der so aussieht, befürchten sie wahrscheinlich keine Verurteilung. Jedenfalls bin ich nüchtern und ausgeschlafen und achte darauf, dass die Kasse stimmt. Das alles ist bei Evas Beruf auch der Fall, aber sie denkt über alles so viel nach, und worüber sie viel nachdenkt, darüber muss sie dann auch viel reden.
Sprache als Messer, da ist Eva in ihrem Element. Ohne dieses zugegebenermaßen gefährliche Instrument gebe es keine Mahlzeit, keine Gärtner- oder Schneiderkunst, geschweige denn Chirurgie oder Pathologie, keine Unterscheidung zwischen Frucht und Strunk, meint Eva, alles sei dann eins, ein Brei ohne Namen und Bedeutung. Das mache ihr ein elendes Gefühl. Sie brauche die trennscharfe Sprache, sie brauche ein gutes Messer, oder eine Messer-Sammlung vielmehr, eins von diesen sündteuren Messer-Sets mit Instrumenten in verschiedenen Größen und Schliffen. Und sie lege darauf Wert, die Handhabung stetig zu üben, wobei sie auch anderen, etwa dem Ehemann, keinerlei Schnitzer durchgehen lassen wolle! Sie wisse, dass Zerlegen notwendig, aber natürlich nicht hinreichend sei, weder Kochen noch Nähen noch Gärtnern erschöpfe sich schließlich darin. Aber notwendig sei es doch!
Und wenn wir an diese Stelle der Diskussion kommen, bleibt mir gewöhnlich nichts übrig als einzulenken, denn allein die Tatsache, dass eine solche Debatte zwischen uns stattfindet, ist bereits Wasser auf Evas Mühlen. Siehst du, ruft sie dann triumphierend, siehst du, wie wir genau in diesem Gespräch genau das tun, was ich meine! Wir schärfen unsere Gedanken, indem wir sie aussprechen, wir schicken sie hin und her, sobald sie sich aus dem Wust in unserem Gehirn als kleine Gestalten herausgeschält haben, wir schicken kleine Boten hin und her, so kommen wir in Berührung, siehst du das denn nicht?
Man muss nicht alles sagen, kontere ich, und wenn sie sich daraufhin ereifert, natürlich muss man nicht, sterben muss man, man muss nicht alles sagen, aber man kann, man kann es versuchen, man wird es doch ohnehin nicht erreichen, aber warum nicht versuchen, wenn sie dann neuerlich in Fahrt kommt mit dieser unvergleichlichen Mischung aus Scharfsinn und Blauäugigkeit, die ich ja eigentlich liebe, aber manchmal einfach nicht aushalte, dann bleibt mir nur noch ein ganz bestimmtes Gedicht, Collin und Juliette, viele Strophen über den Schäfer und seine Geliebte, süß und anzüglich, ich kann den Refrain auswendig, meine beste Munition, um Eva vorübergehend zum Schweigen zu bringen: „Und etwas andres noch, ich wag´ es nicht zu sagen, und etwas andres noch, wer wird nach allem fragen.“ Gewöhnlich einigen wir uns auf diesen unlösbaren Rest. Uneinig aber bleiben wir über die Frage, wie weit man sich der Grenze zum Unaussprechlichen annähern darf oder muss oder soll.
Etwas andres noch ist gewiss im Spiel, wenn Ninos Anblick mich so reizt. Ich seh dich gern, schlägt die Glocke. Na schön, das ist der begehrliche Blick, das müsste ich natürlich zugeben, sollte ich je mit Eva darüber sprechen, der Blick des homoerotischen Verlangens, geschenkt, auch etliche meiner Träume könnten in diese Richtung weisen, sollten sie mir je am Frühstückstisch ihr gegenüber entschlüpfen. Na schön, so bist du also auch, müsste ich mir sagen lassen, aber bitte, wer ist das nicht.
Darüber hinaus gibt es die Augenblicke, in denen ich mich selbst in Nino gespiegelt sehe. Weil wir uns äußerlich wenig ähneln, ist das so schwer zu glauben, dass es mich fast magisch anmutet. Einmal hatte sich in einer Sommernacht bei geöffneten Fensterflügeln ein Blickwinkel eingestellt, der es mir erlaubte, Nino eine Weile indirekt anzustarren, während ich unaufhörlich dachte, ich seh dich gern, ich seh dich gern. Ich war wohl an diesem warmen Abend, an dem so gut wie nichts los war im Lokal, in eine Art Trance geraten, und während ich Ninos Profil ungestört betrachtete, ohne seinen spöttischen Blick fürchten zu müssen, fiel mir erst mit Verzögerung auf, dass sich auch meine eigene Gestalt in der Fensterscheibe abzeichnete, frontal, wie ich eben an der Theke stand mit aufgestützten Armen, aufgekrempelten Ärmeln, mein Spiegelbild verschmolz mit seinem, und allmählich verschwammen die Konturen, als schaute man auf einen gekräuselten Wasserspiegel. Wo sonst mein schwerer Oberkörper die Beine verkürzt, sah man auf einmal die Proportionen der Langbeinigkeit, robust wurde zu biegsam, breit zu schmal, wie in einem Zerrspiegel. Ein leichter Schwindel erfasste mich, wie ich mich da als kubistisches Gemälde sah, Facetten eines Bewegungsablaufes in einem Bild verdichtet, halb blond, halb dunkel, bis mich das Muster meines bunten Hemds aus der Träumerei holte. So etwas würde Nino nie tragen. Nino trägt immer Schwarz.
Um mich in die Gegenwart zurückzuholen, fuhr ich mir kräftig über das Gesicht, als prüfte ich meine Rasur, rieb das Kinn, die Backen, die Kiefergelenke, die ich kaum mit einer Hand umspannen kann, streifte den Rand des Rollkragens und sagte mir, Silvester ist keine Sommernacht, heute ist nicht dazumal, und ich bin ganz gewiss nicht Nino. Obwohl der doch spüren muss, dass ich ihn nicht aus den Augen lasse, könnte man immer wieder daran zweifeln, ob er mit dem Wirt seines Stammlokals überhaupt etwas zu tun haben will. Nino ist unberechenbar. Mal zeigt er sich interessiert, dann wieder kühl, mal gibt er sich geradezu zärtlich, dann wieder tut er, als ob er das Lokal zum ersten Mal beträte und dessen Chef noch nie zuvor gesehen hätte.
Grußlos hatte Nino sich kurz nach elf an die Bar gestellt. Sein Stammplatz war zu Silvester natürlich nicht mehr frei. Ein Paar, das ich zum ersten Mal in meinem Lokal sah, hatte sich schon gegen zehn dort auffallend umständlich niedergelassen. Junge Frau, sehr grazil, sehr elegant, steifer älterer Mann. Als hätten sie Reisegepäck mitgeschleppt, brauchten sie eine Weile, um sich einzurichten. Sie tat ständig mit ihrer riesigen Handtasche herum, er nestelte an einem Koffer, der sich schließlich als Fototasche entpuppte. Er hatte einen Piccolo bestellt, sie trank Kamillentee, später dann einen Underberg. Sie räumten und kramten, er hantierte mit seinen Objektiven herum, sie wühlte in ihrer Tasche, keiner redete. Ein Stummfilm, komisch und trist. Der grell geschminkte Mund der Frau erinnerte mich an die schmachtenden Bubikopf-Mädchen in Schwarzweißfilmen.
Wie kann sich ein Mann nur so zum Idioten machen, sagte Nino, nachdem er die beiden kurz betrachtet hatte wie zwei seltsame Insekten. Er hatte seinen Wodka bei Tamara bestellt, lehnte nun dekorativ am Tresen und sah beleidigt drein. Es sei denn, die Falte zwischen den zusammengezogenen Brauen gehört zur Pose des stolzen Adonis, dachte ich und wunderte mich, dass ich auf so hämische Einfälle kam. Aber viel Zeit hatte ich natürlich nicht, derlei Regungen nachzuhängen, denn die Bar wurde brechend voll.
Ich interessiere mich ja für Beziehungen, das war schließlich auch der Grund dafür, dass ich als junger Mann anfing, Psychologie zu studieren, genau wie Nino übrigens. Aber mein Interesse ist sprunghaft, das war der Grund dafür, dass ich nach sieben Semestern abbrach. Ich bin nicht so stetig wie Eva, die ihr Diplom und ihre psychoanalytische Ausbildung abgeschlossen hat, die sich monate- und jahrelang mit ihren Patienten beschäftigt, hundert Stunden lang und noch mehr. Das wäre nichts für mich. Ich brauche Abwechslung. Zappen ist mir ein Hochgenuss, und meine Beobachtungen in der Bar gleichen den Bildern eines Kaleidoskops, denn ich muss mich natürlich zwischendurch immer wieder dem Essen, Trinken und Zahlen zuwenden.
Das Silvestergeschäft lief blendend. Eva kam kurz vor Mitternacht, oder vielmehr, sie erschien. Überraschenderweise trug sie ein ärmelloses und wirklich sehr tief ausgeschnittenes dunkelgrünes Samtkleid, das ich noch nie an ihr gesehen hatte, dazu lange Handschuhe, die ich ebenfalls nicht kannte. Sie zog Blicke auf sich. Na, ob da nicht vielleicht das Kleid mutiger ist als die Trägerin, sagte ich schmunzelnd zu ihr. Normalerweise reagiert sie anders auf solche witzigen Bemerkungen. War doch eigentlich ein Kompliment, oder?
Wer wird nach allem fragen.
Ich hatte bis zum Morgengrauen alle Hände voll zu tun. Nino hatte ich im Gedränge aus den Augen verloren.
Verkündigung (Judit)
Ein Blitzlicht mitten in der Bar, was soll das? Ich bin Fotografin. Licht reizt mich immer, auch wenn ich wieder dabei bin, im Styx unterzugehen. Wenn etwas aufleuchtet, muss ich es sehen. Ich bin vernarrt in den Widerschein. Glanz auf einer Dachrinne. Kondenswasser in Juwelenfarben. Wie sich Nachmittagslicht auf ein Jochbein legt. Wie Fensterscheiben glühen, bevor die Sonne selbst auftaucht. Das machte mich glücklich. Sonst ja nicht viel. Wie wäre es sonst zu verstehen oder gar zu rechtfertigen, dass ich regelmäßig im schwarzen Fluss untertauche. Maßlos.
Die hat nicht mehr getrunken als sonst, hatte Luis zu dem jungen Mann gesagt. Lass die in Ruhe. Die ist versunken. Der Barkeeper kennt mich besser als meine Therapeutin. Ihr habe ich das noch nie erzählt von dem Fluss voll Pech. Ist das Maß voll, dann gehe ich unter, in schwarzen Sirup eingegossen, alles verklebt, nur die Augen bleiben blank, ich bin dann ein Steinzeitinsekt, in Harz gegossen, mit monströsen Facettenaugen.
Mitten im Silvestergetümmel fotografierte ein Mann seine Begleiterin. Ich schätzte ihn auf fünfzig. Graublond, strenger Haarschnitt, so penibel ausrasiert, dass die Frisur künstlich anmutete, wie aufgemalt. Der Mann war mager, sein Oberkörper gekrümmt wie ein Bogen in Hochspannung. Rheumatiker oder Extremsportler? Während er wieder und wieder abdrückte, dirigierte er seine Partnerin mit der freien Hand hierhin und dorthin. Von ihr war zunächst nur ein Kranz kupferrot gefärbter Locken zu sehen, dann ein langer dünner Hals. Kleine Nase, kleiner Mund, große Augen. Ihr kleines Schwarzes war kurz und eng und schulterfrei. Die Frau machte einen verdrossenen Eindruck. Dass die beiden allmählich die Blicke anderer Gäste auf sich zogen, schien ihr aber doch zu gefallen, das sagte jedenfalls ihr Kussmündchen, das sagten ihre leuchtenden Schultern, und hell schimmerten die vielen kleinen Perlen, die sich um ihre Schlüsselbeine rankten.
Ich beugte mich zu meiner Tasche hinunter, es reizte mich, die Fotografierszene zu fotografieren. Als ich wieder aufblickte, war der Mann verschwunden. Die Frau saß allein auf ihrem Stuhl, sie saß ganz aufrecht, ohne sich anzulehnen. Die Beine hatte sie ganz gerade eng nebeneinander gestellt, ihre Füße steckten in hochhackigen Sandalen. Komisch, Pantöffelchen mitten im Winter. Diese spitzen Absätze waren anscheinend aus blankem Metall, von weitem wirkten sie wie Klingen. Die Frau hatte jegliches Interesse an ihrer Umgebung verloren. Es war, als sei um sie herum ein Bannkreis gezogen, der sie von den anderen Gästen in der Bar isolierte. Sie befasste sich umständlich mit ihrer bräunlichen Umhängtasche, einem unförmigen Beutel, der gar nicht zu ihrer eleganten Aufmachung passte. Offenbar wollte sie die Tasche aus dem Weg, aber zugleich unter Kontrolle haben. Unter dem Stuhl war sie außer Reichweite, neben dem Stuhl kippte sie zwei Mal um, einmal nach rechts, einmal nach links. Dann packte die Frau die Tasche auf den Marmortisch, drapierte sie, das Köpfchen schiefgelegt, mehr zum Rand, mehr zur Mitte hin, prüfte einige Sekunden reglos, dann verzog sie das Gesicht, zuckte die Schultern, entfernte die Tasche vom Tisch. Die Frau war ganz mit sich allein. Hatte den Mann vergessen. Im nächsten Versuch schob sie die Tasche neben ihre Hüfte auf den Stuhl, ruckelte ungemütlich, schaute nun endlich auf, schaute verloren um sich. Ich prägte mir das Bild ein. Tatsächlich eine Aufnahme zu schießen, wäre mir nun unverschämt erschienen, als hätte ich die Frau bei einer unfreiwilligen Entblößung ertappt.
Um Mitternacht sollte dann natürlich die Hölle los sein. Einzelne Korken knallten bereits, Dutzende Flaschen harrten der Öffnung, um pünktlich überzuschäumen. Man starrte auf die Wanduhr. Kurz vor zwölf ebbte der Lärmpegel ab. Die Leute verstummten, als müssten sie Kraft sammeln vor dem Glockenschlag, der all die Fremdlinge in einer magischen Aufwallung vereinen sollte. Die meisten Gäste waren aufgestanden. Gesichter voll kindischer Erwartung.
Ich zündete mir eine Zigarette an.