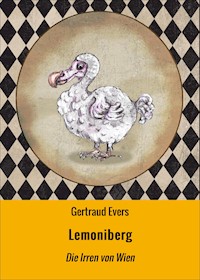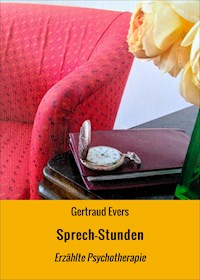
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was geschieht wirklich in einer Psychotherapie? Wenn Sie das erfahren wollen, machen Sie am besten selbst eine Therapie oder eine therapeutische Ausbildung, denn kein Buch ersetzt eigenes Erleben. Wenn Sie aber als Profi wissen möchten, wie andere Fachleute arbeiten, oder wenn Sie sich als interessierter Laie ein Bild von der Psychotherapie machen wollen, dann können Sie hier einer erfahrenen Therapeutin bei der Arbeit über die Schulter schauen, mit ihr Erfolge betrachten, Fehler überdenken, Erkenntnisse teilen. Zwischen beredter Theorie und verschwiegener Praxis öffnet sich der Raum zum Erzählen. Sie finden darin spannende Geschichten, brauchbare Anregungen, neue Sichtweisen auf Lebensprobleme und literarischen Genuss. Ausführlich geschilderte Sprech-Stunden zeigen Beispiele dafür, wie Psychotherapie verlaufen kann – mit Fortschritten und Rückschlägen, Durststrecken und Sternstunden. Die Geschichten haben sich nicht genau so zugetragen, wie sie erzählt werden, aber sie sind alle wahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gertraud Evers
Sprech-Stunden
Erzählte Psychotherapie
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Einleitung
Schwertlilien
Ein geordnetes Doppelleben
Das Mädchen in der Seifenblase
Frage nicht
Impressum neobooks
Einleitung
Ich bin eine Psychotherapeutin, die für ihr Leben gern liest und schreibt. Ich liebe Geschichten, und immer wieder bin ich dankbar, dass diese Neigung und mein Brotberuf so gut zusammenpassen. Schon wenn ich mich auf den internistischen oder neurologischen Stationen vorrangig um die Leberzirrhose oder den Schlaganfall meiner Patient*innen kümmern sollte, interessierte ich mich am meisten für ihre Herkunft, ihre Beziehungen, ihre Arbeit, ihre Leidenschaften.
Als Psychiaterin und Psychotherapeutin richte ich nun meine Aufmerksamkeit ganz gezielt auf die Lebens- und Leidensgeschichten der Patient*innen. Das ist schon eine anstrengende Profession, manchmal nervtötend, manchmal herzzerreißend, aber stets von Neuem erfahre ich sie auch als Passion und bin fasziniert von der Vielfalt menschlichen Erlebens und Verhaltens, der Fülle sinnlicher Details und intensiver Augenblicke.
Zwischen beredter Theorie und verschwiegener Praxis suche ich den Raum zur Entfaltung von Geschichten. In diesem Buch werden vier ausführliche Falldarstellungen lebensnah vorführen, wie Psychotherapie ablaufen kann – mit Fortschritten und Rückschlägen, Durststrecken und Sternstunden. Ich bin überzeugt, dass die erzählende Sprache geeignet ist, das professionelle Verständnis zu bereichern. Für Leser*innen, die nicht vom Fach sind, öffnen sich neue Einblicke in Lebensprobleme, mit denen sich beileibe nicht nur Psychotherapiepatient*innen herumschlagen.
Seit dem Beginn meiner Ausbildung habe ich in der Literatur begierig nach Fallgeschichten Ausschau gehalten, wurde aber meist mit recht kargen Ausschnitten abgespeist. Wenn konkrete therapeutische Interaktionen dargestellt werden, dienen sie häufig nur als illustrative Garnierung, während die Hauptmahlzeit aus Theorie besteht. Wie gerne hätte ich als Lehrling den Meister*innen der Zunft über die Schulter geschaut! Wäre das möglich gewesen, hätte ich übrigens schon früher feststellen können, dass sie alle mit Wasser kochen.
Neben dem theoretischen Wissen und der notwendigen Selbsterfahrung ist nämlich ein Teil des therapeutischen Berufs durchaus als Handwerkszeug vermittelbar. Aber die psychotherapeutische Praxis findet aus guten Gründen hinter verschlossenen Türen statt, daher gibt es so wenig Gelegenheit, durch Zuschauen und Zuhören zu lernen. Was ich als Lernende beinahe vergeblich gesucht habe, will ich mit diesem Buch selbst auf die Beine stellen: die Möglichkeit, einer mittlerweile erfahrenen Therapeutin bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen, mit ihr Erfolge zu betrachten, Fehler zu überdenken, Erkenntnisse zu teilen.
Damit sei keinesfalls in Abrede gestellt, dass Psychotherapie auch Kunst ist, nicht nur Handwerk. Wenn ich das Wasser, mit dem wir kochen, auf diese ernüchternde Art benenne, will ich zugleich deutlich machen, dass das persönliche Feuer unter dem Topf, nennen wir es Talent, Charisma oder Engagement, nicht in der Imitation, sondern nur im eigenen Herzen zu finden ist.
Ausführliche Falldarstellungen sind meines Wissens ziemlich rar, zumal auf dem Feld der psychoanalytisch orientierten Behandlungsformen. Was wirklich in den Therapiestunden passiert, bleibt im Dunkel. Die Verhüllung verheißt einerseits Sicherheit im geschützten Raum; andererseits kann sie unnötige Ängste schüren. Schon klar, man darf nicht alles ans Licht zerren; schon klar, manchmal ist Schweigen Gold, und manchmal versagt die Sprache vor dem Unbegreiflichen. Aber sollen wir deswegen aufhören, das Begreifen zu versuchen? Ich bin überzeugt, dass das therapeutische Geschehen – wie jede menschliche Beziehung – so komplex und geheimnisvoll ist, dass es keiner zusätzlichen Verrätselung bedarf, um seine Magie zu bewahren. Es ist nicht nötig, extra Gardinen zu drapieren. Hinter jeder Antwort tut sich sowieso die nächste Frage auf. Jeder gelüftete Schleier gibt den Blick auf den nächsten frei. Wenn ich eine Schicht nach der anderen betrachte und so genau wie möglich sprachlich zu fassen suche, stoße ich fortwährend an die Grenzen der Beschreibbarkeit. Ich muss respektieren, dass seelisches Geschehen letztlich unergründlich bleibt – und bin doch immerfort bemüht, es zu erkunden. Im günstigsten Fall gelingt der Sprache ein erhellender Augenblick.
Lebensgeschichten, Lebensumstände, Lebensträume – sie stehen in meiner psychotherapeutischen Tätigkeit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Geschichten bekomme ich da genug zu hören – mehr als genug! Viele von ihnen sind traurig, manche dramatisch oder grausam. Um nicht von ihnen überschwemmt zu werden, musste ich mir Bewältigungsmethoden suchen. Ich will mitfühlend sein, aber nicht rührselig werden; Abstand halten, ohne mich in kalter Routine abzuschotten. Es gilt, auf die Geschichten der Patient*innen tief einzugehen, ohne darin unterzugehen. Sich einlassen und sich zugleich heraushalten – die Quadratur des Kreises? Die angemessene therapeutische Haltung nannte eine britische Kollegin einmal „sitting on the fence“ („auf dem Zaun sitzen“). Mit einem Bein drin, stelle ich mir vor, und dem anderen draußen, so halte ich mich im Grenzbereich zwischen Innen- und Außenleben meiner Gesprächspartner auf.
Tue ich von dieser Schwelle aus einen Schritt nach innen, kann ich mich, wie es ja auch umgangssprachlich heißt, in die betroffene Person hinein-versetzen. Ich stelle mich in ihre Schuhe, sehe die Welt vorübergehend mit ihren Augen und bekomme ein Gespür dafür, wie die Brille getönt ist, mit der sie die äußere Realität wahrnimmt. Was ich als Therapeutin dabei fühle, entspricht einem identifizierenden Mitschwingen und wird in der psychoanalytischen Fachsprache als „konkordante Gegenübertragung“ bezeichnet.
Der Schritt nach außen macht mich wieder zum Gegenüber. Was ich als Interaktionspartnerin empfinde (die „komplementäre Gegenübertragung“), zeigt mir, wie es anderen Menschen mit dieser Person geht. So können wir wiederkehrende Muster in ihren menschlichen Beziehungen entdecken.
Was brauche ich, um „hinein“ zu kommen, also Zugang zur inneren Welt der kranken Menschen zu finden? Ich höre mir ihre Geschichten an. Dazu sind Zeit, Aufmerksamkeit, Genauigkeit und ein gutes Gedächtnis notwendig. Die professionelle Gesprächstechnik hilft beim Aufspüren, das theoretische Wissen beim Ordnen des Materials. Damit aus dem therapeutischen Arbeitsbündnis eine Vertrauensbeziehung wächst, muss darüber hinaus die „Chemie“ stimmen. Sie entzieht sich weitgehend der bewussten Einflussnahme. Ich meine da neben Sympathie und Respekt auch jenen Teil der Beziehung, den wir im Kollegenkreis bisweilen als therapeutischen Eros bezeichnen: Da bin ich begeistert von der unverwechselbaren Eigenart meiner Patient*innen; da verspreche ich, alles, was ich kann, für sie zu tun. In diesem Sinne darf ich sagen, dass ich dieses Buch auch geschrieben habe, weil ich meine Patient*innen liebe.
„Draußen“ brauche ich als authentische Therapeutin ein festes Standbein, indem ich mich laufend um Integrität und Selbstreflexion in meinem eigenen Leben bemühe. Persönliche Wünsche und wunde Punkte sollen sich nicht störend in die therapeutischen Beziehungen einmischen. Diesem Ziel dient zunächst die Lehranalyse im Rahmen der psychoanalytischen Ausbildung. Berufsbegleitend hilft mir heute die Supervision, blinde Flecken aufzudecken. Einen festen Halt „draußen“ gibt in der täglichen Arbeit das so genannte „Setting“, also der gesamte professionelle Rahmen der Psychotherapie: Sprechzimmer, Zeitbegrenzung, Bezahlung, formale Regeln (z.B. Absprachen über Urlaube oder Ausfallhonorare). Das Setting verweist ständig darauf, dass Psychotherapie eine Dienstleistung ist, auch wenn sie wie eine persönliche Beziehung erlebt wird; dass Therapeutin und Patient*in nicht befreundet sind, dass sie sich nach jeder Stunde am „Zaun“ verabschieden und in ihr eigenes wirkliches Leben zurückgehen. Die Therapie ist nicht das wirkliche Leben - aber therapeutisches Erleben ist wirklich und wirksam. Ein Aquarium ist nicht das Meer - aber Wasser bleibt Wasser.
Auf dieser Schwelle zwischen Innen und Außen ist für mich das Schreiben angesiedelt. Tagebücher und Briefe haben immer wieder als „Zaun“ gedient, um schönen Erlebnissen eine Fassung zu geben, von Unbill Abstand zu bekommen und Widersprüche dingfest zu machen. Schreibend habe ich begriffen, was ein Konflikt ist; und wie vielschichtig und verwickelt Konflikte sein können. Schreibend schickte ich mich als junge Psychiaterin an, die Fülle des Leidens zu Krankengeschichten zu portionieren.
Viele Jahre lang habe ich Aufnahmeberichte im Krankenhaus, Arztbriefe und Psychotherapie-Anträge in einer abstrahierenden Fachsprache verfasst. Lebens- und Leidensgeschichten müssen in diagnostische Raster eingepasst werden. Die sinnliche Oberfläche der Begegnung, Gesichter, Gewänder, Tonfälle, Gesten, Gerüche, all das wird bestenfalls als Illustration geduldet; geht es doch darum, Komplexität zu reduzieren, nicht sie zu entfalten.
Obwohl ich also meine Lust am Beobachten und Beschreiben kanalisieren musste, habe ich mir mit der professionellen Korrespondenz stets große Mühe gegeben; schließlich sollten aus den Kürzeln des Fachvokabulars brauchbare Leitlinien zur Behandlung entwickelt werden. Und was da mit meiner Unterschrift an die Öffentlichkeit der Profis gelangte, sollte mich als eine der Ihren ausweisen. Ich habe an alles Erdenkliche gedacht, riefen meine Berichte, und alles Menschenmögliche getan, lege artis, alles korrekt dokumentiert, hier habt ihr es schwarz auf weiß! Das Entlastungszeugnis sollte in seiner Ausführlichkeit beweisen, dass dem leider manchmal dürftigen Erfolg immerhin ein erstklassiges Bemühen vorangegangen war. Denn manchmal ist die Behandlerin machtlos. Aber immerhin, sie hat das Elend treffend beschrieben ...
Das Schreiben dient also auch dem Bedürfnis, sich in einem schwierigen Job vor dem eigenen Gewissen und vor potenziellen Kritikern zu rechtfertigen. Anders als der Chirurg, der seine Handgriffe und deren Folgen exakt beschreiben und annähernd exakt wiederholen kann, muss ich immer wieder innehalten und mich fragen: Was tue ich da? Dinge beim Namen nennen gibt immerhin ein Stück Bemächtigungsgefühl. Plausible Zusammenhänge konstruieren hält die Hoffnung auf Sinn aufrecht. Der amerikanische Psychiater und Psychotherapeut Irvin D. Yalom, aus dessen Büchern ich eine Menge gelernt habe, meint sogar, dass Diagnosen nur dazu gut sind, den Therapeuten jenes Sicherheitsgefühl zu verschaffen, das sie dann den Patient*innen weitergeben können. Darüber hinaus aber bin ich davon überzeugt, dass eine gute Beschreibung für die betroffene Person wertvoll ist, auch wenn sie ihren vollständigen Wortlaut vielleicht gar nicht kennt. Wenn ich als Therapeutin nämlich treffende Worte finde, dann habe ich vorher ganz genau hingeschaut. Das heißt, ich bin meinem Gegenüber nahe gekommen, ich habe gesehen, wie diese Person wirklich ist, ich habe das ausgehalten und bin immer noch an ihrer Seite. Davon ehrlich und liebevoll zu erzählen heißt für mich: dem anderen Menschen gerecht werden, Zeugnis ablegen von seinem Wesen. Ich glaube, das ist ein Wert an sich, auch wenn die angestrebten Veränderungen noch auf sich warten lassen. Und es hilft, gemeinsam eine maßgeschneiderte Behandlung zu entwickeln.
Wenn ich in den folgenden Geschichten detailliert von meinen Arbeitsstunden berichte, dann spielt außerdem das Bedürfnis nach Anerkennung eine Rolle. Von den Patient*innen selbst darf ich sie zwar erhoffen, aber nicht erwarten; deren schönstes Lob ist ja ihre Genesung, die unweigerlich mit unserer Trennung einhergeht. In der Supervision spenden wir einander wohl kollegiale Anerkennung, müssen uns aber zugleich der Kritik stellen. Hier erlaube ich mir nun, mich als Therapeutin zu zeigen, der einiges gut gelungen ist. Die Kehrseite nehme ich sehenden Auges in Kauf: Wer sich zeigt, riskiert, sich zu blamieren. Wenn ich selbsterkannte Fehler ausdrücklich benenne, dann gereicht mir das ja gerade noch zur Ehre, weil ich mich als lernfähig und freimütig erweise. Aber Leser und Leserin könnten mehr sehen als ich! Dort, wo ich vielfach durchdachtes Material vorzulegen meine, erspähen sie womöglich Motive, die mir selbst verborgen geblieben sind. Wo ich blauäugig das Richtige zu tun meine, stöhnen sie: Wie kann man nur?! Wo ich im Dunkeln tappe, geht ihnen vielleicht ein Licht auf. Aber so ist das nun einmal: Wer sich zeigt, liefert sich dem Blick aus, dem wohlwollenden und dem kritischen oder gar missbilligenden. Meinen Patient*innen geht es nicht anders, wenn sie Selbstoffenbarung wagen.
Seit Anfang der Neunzigerjahre arbeite ich als Therapeutin in freier Praxis, zunächst anderthalb Jahrzehnte gemeinsam mit einem zweiten Psychiater, der sich mit der medikamentösen Behandlung gut auskennt. Viele meiner Patient*innen wurden mir von ihm vorgestellt; andere überweist der Hausarzt. Manche haben sich meine Nummer aus dem Telefonbuch gesucht, andere orientieren sich an einer Therapeut*innenliste ihrer Krankenkasse, wieder andere kommen auf Empfehlung früherer Patient*innen. Anlass für die Therapie sind meist Depressionen, Angstzustände oder Beziehungsstörungen, gelegentlich Zwangssymptome, Suchtprobleme oder Persönlichkeitsstörungen. Vereinzelt habe ich Menschen behandelt, die schizophrene oder paranoide Episoden oder traumatische Erlebnisse zu verarbeiten hatten.
Nach dem Erstgespräch folgen bis zu fünf Probesitzungen, in denen wir Beschwerden und Ziele klären und ausprobieren, ob wir „miteinander können“. Wenn wir uns zur Zusammenarbeit entscheiden, treffen wir uns anschließend jede Woche zu einem fünfzigminütigen Gespräch. Die Therapie umfasst insgesamt mindestens fünfundzwanzig, maximal hundert Stunden; sie dauert also gewöhnlich, unter Berücksichtigung von Ferien und krankheits- oder berufsbedingten Stundenausfällen, von einem knappen Jahr bis zu etwa dreieinhalb Jahren, in Einzelfällen auch länger.
Mein Sprechzimmer ist klein und sparsam eingerichtet. Drei Wände werden von Bücherregal, Kommode und Schreibtisch eingenommen, an der vierten steht ein Holztisch mit Kalender und Uhr, an dessen beiden Seiten zwei Polstersessel in einem stumpfen Winkel zueinander angeordnet sind. So kann man einander gut in die Augen sehen, aber auch den Blick zu den Bildern an den Wänden oder zum Fenster hinaus schweifen lassen.
Die Behandlungsform, die ich anbiete, ist eine tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie. Ich bediene mich also der Erkenntnisse der psychoanalytischen Forschung. Am Beginn der Behandlung erläutere ich den tiefenpsychologischen Ansatz gewöhnlich so: „Sie sind ein erwachsener Mensch, Sie haben in Ihrem Leben gewiss schon zahlreiche Schwierigkeiten ohne Therapie bewältigt. Jetzt kommen Sie aber allein nicht weiter. Ich nehme an, dass die Wurzeln Ihres Problems Ihrem Bewusstsein nicht direkt zugänglich sind.“ Ein Teil meiner Arbeit besteht also darin, die Wirkungsweise unbewusster Kräfte aufzudecken. Dabei hilft eine Form des Zuhörens, bei der ich mich möglichst offen halte, ohne die Mitteilungen meiner Patient*innen sofort, entsprechend der Alltagslogik, als wesentlich oder unwesentlich zu bewerten. Ich halte mich dafür offen, nicht nur den Inhalt der Erzählung zu erfassen, sondern zugleich den Prozess, der sich in der Erzählung selbst und in der Beziehung zwischen der erzählenden Person und der Zuhörerin im Hier und Jetzt abzeichnet. Das Unbewusste zeigt sich gern verkleidet, etwa in Tag- oder Nachtträumen, es blitzt in den berühmten Freudschen Fehlleistungen auf, es lässt sich bisweilen am körperlichen Ausdruck erahnen, insbesondere, wenn dieser mit den begleitenden Worten nicht im Einklang steht. Manchmal tauchen unbewusste Facetten einer Therapie sogar in meinen eigenen Träumen auf. Oft genug bewirkt die Einsicht in die innere Welt der Fantasien, dass das Leben in der äußeren Welt stimmiger und reicher wird.
Vor allem aber glaube ich daran, dass eine gute Beziehung zwischen Therapeutin und Patient*in heilsam wirkt. Eine solche aufrichtige und bedeutungsvolle Beziehung ermöglicht die sogenannte „korrigierende emotionale Erfahrung“. Ich lege großen Wert darauf, neben den Erinnerungen, Träumen und Fantasien die aktuell gelebte Erfahrung nicht zu vernachlässigen. Deshalb interessiere ich mich für die Berufe, Wohnungen und Hobbys meiner Patient*innen. Ich will wissen, mit wem sie ihre Zeit verbringen, welcher Sport ihnen Spaß macht, welche Bücher, Lieder, Filme ihnen etwas bedeuten, ob sie einer Kirchengemeinde oder einem Verein angehören. Ein Kollege meinte einmal, das meiste, was die Patient*innen reden, sei ohnehin Makulatur. Mag sein, dass manche Stunde seicht dahinplätschert, weil man einem beängstigenden Thema ausweicht, oder auch einfach deswegen, weil einem gerade nichts Besseres einfällt; aber ich habe andererseits oft erlebt, dass die Beziehung verbessert wird, wenn man sich gemeinsam in ein Thema vertieft, das auf den ersten Blick oberflächlich erscheint, sei es ein Kuchenrezept, ein Fußballspiel oder eine Fernsehserie. Nie vergesse ich den Kommilitonen, dem ich einmal mangelnden Tiefgang vorwarf, als er mir endlos von seiner Forschung über die Ratten-Aorta erzählte. Gekränkt, aber würdevoll entgegnete er: „Wenn du mir genau zuhörst, wie ich über die Ratten-Aorta rede, wirst du etwas Tiefes über mich erfahren.“
Die Tiefe des Gesprächs bemisst sich für mich also nicht nur nach dem Gewicht des Einstiegsthemas; genauso wenig wie nur danach, wie weit die Erinnerungen in die Kinderjahre hinabreichen. Tief wird eine Begegnung, wenn sie existenzielle Fragen berührt – und damit den Anderen, der sich diesen existenziellen Fragen gleichermaßen stellt. Selbstoffenbarung vor und mit einem Anderen ermöglicht Selbsterkenntnis.
Der leidende Mensch stellt sich zur Reflexion vor einen Spiegel. Was er dem Spiegel zeigt, kann er nun annähernd so sehen, als ob er ein Anderer wäre und sich von außen betrachtete. Die Therapeutin als Spiegel empfängt sein Bild. Was sie widerspiegelt, ist kein ganz getreues Abbild, denn kein Mensch kann ein vollkommen glatter Spiegel sein. Grobe Verzerrungen sollen natürlich durch Professionalität vermieden werden. Dennoch ist der therapeutische Spiegel eigen, hat da eine Delle oder dort eine Brechung. Heraus schaut ein Bild, in dem sich der Reflektierte wiedererkennen kann, in dem er aber auch bisher unbekannte Züge wahrnimmt. Der Spiegel gibt die Anerkennung: Ja. So bist du. Die besonderen Unebenheiten in diesem besonderen Spiegel aber bereichern das Bild und erzeugen zugleich eine Irritation, die weiter vorantreibt: Aha! So bist du also auch. Sind Rahmen und Glas stabil, die Beleuchtung warm, die Zuwendung verlässlich, dann ist das Eigenleben des Spiegels keine Störung, sondern eine Hilfe. Der Spiegel spricht und reichert das zurückgeworfene Bild mit eigenen Lebensäußerungen an, mit Wohlwollen, Ironie oder Konfrontation. Damit sind Nähe und Unterscheidung, Innen- und Außenwelt gleichzeitig präsent.
In diesem Sinne steht mir als Theoriesystem die Relationale Psychoanalyse (Stephen A. Mitchell) nahe; für die Praxis besonders gut brauchbar finde ich die Psychoanalytisch-interaktionelle Methode („Prinzip Antwort“, Heigl-Evers). Ich habe nach meiner psychoanalytischen Ausbildung viele Anregungen von anderen Therapieformen empfangen und mit Gewinn verwerten können: u.a. aus der Verhaltenstherapie, der Systemischen Therapie, der Klientenzentrierten Gesprächstherapie, der Lösungsorientierten Kurztherapie (Steve de Shazer), der Provokativen Therapie (Frank Farrelly), der Existenziellen Therapie (Irvin D. Yalom), der Psychodynamisch-Imaginativen Traumatherapie (Luise Reddemann) und der Traumatherapie mit EMDR (Francine Shapiro).
Während beruflicher Durststrecken macht mich manchmal gerade die Fülle der Ansätze verzagt. Ich sehe vorübergehend den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und denke: Wärst du doch bei deinem einen Leisten geblieben ... Insgesamt aber erscheint mir die Integration der verschiedenen Instrumente auf dem Fundament der tiefenpsychologischen Orientierung hinreichend gelungen. Dann freue ich mich über die Vielfalt meines Handwerkszeugs, schließlich heißt es ja: „If your only tool is a hammer, every problem looks like a nail“.
Mein fachliches Angebot soll zum Anliegen der Patient*in passen, im Idealfall „wie maßgeschneidert”. Auf dass es dem hilfesuchenden Menschen nicht so übel ergehen möge wie dem Kunden des Schneiders in dem bekannten Witz: Bei der Anprobe seiner neuen Jacke reklamiert er, die Schulternaht sei schief geraten. Nun, dann solle er eben die Schulter schräg halten, empfiehlt der Schneider. Bei der nächsten Anprobe kommt der Kunde gehorsam verkrümmt daher, beklagt sich aber erneut: Die Ärmel seien zu lang. Ach, das könne er leicht ausgleichen, wenn er bloß die Arme so und so abwinkeln wolle, rät der Schneider. Als der brave Kunde auf die Straße geht, tuschelt man hinter ihm her: Was für ein armer Krüppel. Aber einen guten Schneider hat er!
Was ich in den Stunden tatsächlich tue und sage, lässt sich, wenn es denn glückt, vielleicht am ehesten mit einer Improvisation in der Jazzmusik vergleichen. Man muss miteinander üben, umaufeinander eingestimmt zu sein. (Nicht wenige Therapiestunden gleichen übrigens etwas faden Übungsstunden ohne zündende Inspiration.) Die Musiker*innen einigen sich auf eine Tonart, fangen mit einem Thema an, probieren Variationen aus, horchen auf ihre Mitspieler*innen und überlassen sich den Einfällen, die in und zwischen ihnen auftauchen.
Lässt sich dieses ganze Durcheinander überhaupt in Worte fassen? Als verwirrte Anfängerin habe ich eine Zeitlang während der Therapiestunden mitgeschrieben. Das hat aber nicht nur den Blickkontakt, sondern den Kontakt überhaupt behindert. Eine Patientin hat mir später gesagt, sie habe sich „protokolliert“ gefühlt. Das Gespräch verlor seinen Zauber. Seither habe ich Übung darin bekommen, in den zehn Minuten Pause nach den Stunden die wichtigsten Gedanken und Gefühle festzuhalten. Ganz genau notiere ich Traumberichte und besonders treffende Formulierungen meiner Patient*innen. Von diesen höchstpersönlichen, manchmal bildgewaltigen oder witzigen Wendungen bin ich oft so begeistert, dass ich sie wie etwas Kostbares aufzubewahren trachte.
Damit man sich aber nicht vor lauter Eifer im Dickicht der Einzelheiten verliert, braucht man eine Landkarte. Zum raschen Informationsaustausch und zur theoretischen Reflexion der Berufspraxis ist die klinische Sprache unverzichtbar. Wenn ich in den folgenden Geschichten an einigen Stellen Begriffe aus dem Fachvokabular verwendet habe, gab ich mir Mühe, sie für Nicht-Fachleute zu erläutern. Für Profis hingegen bieten detailreiche klinische Beschreibungen meiner Erfahrung nach einen guten Stoff, um die gewohnten Fachbegriffe auf Herkunft und Gültigkeit zu untersuchen. Sonst passiert es nämlich, dass diese Begriffe in der Diskussion wie abgegriffene Spielfiguren hin- und hergeschoben werden, wodurch sich ihre Verbindung zur gelebten Erfahrung bis zur Unkenntlichkeit ausdünnen kann. Somit sollten die Texte für Laien aufschlussreich genug, für Fachleute brauchbar genug sein.
In den vorliegenden Geschichten habe ich mir vier Therapieverläufe vergegenwärtigt. Dabei kristallisierten sich thematische Schwerpunkte als Kapitel heraus und wurden in typischen Szenen entfaltet. Die Patient*innen, von denen ich hier erzähle, nämlich Iris, Thomas, Lukas und Nelly, haben mir nach dem Abschluss der Behandlung die Erlaubnis gegeben, über die gemeinsame Therapieerfahrung zu schreiben. Ich habe dazu meine Notizen verwendet und sie mit Einzelheiten aus anderen Behandlungsverläufen und erfundenen Einfällen verfremdet. Namen, Berufe, persönliche Umstände und körperliche Merkmale der Patient*innen habe ich verändert. Die Betroffenen haben die Entwürfe gelesen, worauf ich entsprechend ihren Einwänden einzelne Korrekturen vornahm. Ich bin ihnen dankbar für ihren Mut zur Selbstoffenbarung und für alles, was ich mit ihnen erleben und erkennen durfte.
Schwertlilien
Bitte spiel mit mir
„Stört es Sie, wenn ich die Brille hier drin auch trage?“ fragte mich meine Patientin Iris Bausch, als sie meine Praxis in der Nähe des Wiener Stadtparks betrat.
Zu den Abendsprechstunden, wenn die Sekretärin schon Feierabend hat, empfange ich meine Kundschaft direkt an der Tür. Dadurch ergibt sich eine kleine Zeitspanne des Überganges, bevor sich der Rahmen des Sprechzimmers um uns schließt. Die Leute legen ihre Mäntel und Schirme ab, machen eine Bemerkung über das Wetter oder ersuchen darum, noch schnell die Toilette benutzen zu dürfen. Die meisten Patient*innen benehmen sich in dieser Zwischenzone eher förmlich und beginnen das eigentliche Gespräch, sobald sie ihren Platz im roten Polstersessel eingenommen haben. Iris dagegen sprudelt gewöhnlich sofort los, so auch an diesem schwülen Juniabend.
„Doch, ja, das stört mich schon“, antwortete ich, während wir noch gemeinsam das Wartezimmer durchquerten. Die dunkle Sonnenbrille verbarg ihre Augen vollständig.
„Na gut, dann setze ich sie ab. Sehe ich Sie halt verschwommen, macht auch nichts.“
Erst jetzt verstand ich, dass sich in ihrer Sonnenbrille offenbar eine korrigierende Linse befand, ohne die sie nicht klar sehen konnte. Aber ja, fiel mir ein, sie kniff doch häufig die Lider zusammen, wenn sie mich stumm fixierte. Einige Male hatte ich randlose Augengläser an ihr gesehen. Wieso hatte ich ihre Sehstörung bisher ausgeblendet? Immerhin kannten wir uns zu diesem Zeitpunkt bereits anderthalb Jahre und hatten einander wöchentlich gesehen. Ihre Kurzsichtigkeit, das hat sie mir später erzählt, sei erst in der Hauptschule entdeckt worden, als sie schon dreizehn war.
„Tut mir leid, das habe ich jetzt gar nicht bedacht“, lenkte ich ein. „So ein verschwommenes Bild muss sehr unangenehm sein. Lassen Sie die Brille doch auf.“
Es entspann sich ein Eiertanz der gegenseitigen Rücksichtnahme, der für unsere Beziehung typisch war. Wir machten beide freundliche Witzchen über das Missverständnis, aber dahinter spürte ich eine unbehagliche Spannung. Im Lauf der anschließenden Therapiestunde legte ich darauf Wert, gemeinsam über die Bedeutung dieses Randereignisses nachzudenken.
Wie so oft hatte sich Iris sofort auf ihr Gegenüber, dessen Befinden, Bedürfnis und Urteil eingestellt, ohne ihren eigenen Standpunkt zu orten, geschweige denn zu vertreten. Warum machte sie mir ein Angebot, das ihr eine Sehstörung bescheren würde? Ich hatte ein schlechtes Gewissen, war aber gleichzeitig vage ärgerlich, als hätte sie mich in eine Falle gelockt.
„Aber es ist doch wichtiger, dass Sie meine Augen sehen als umgekehrt“, beharrte sie. Mit ihren flinken Händen zeigte sie ein Oben-Unten-Gefälle: „Das hat mit diesem Unterschied zu tun. Sie machen doch die Diagnose und alles. Sie sind es doch, die mehr auf der Lauer liegt, oder?“
„Na, ich weiß nicht, wer da mehr auf der Lauer liegt“, entgegnete ich etwas gereizt. „Kaum mach ich die Tür auf, kommen Sie mir quasi entgegengelaufen und stellen sich total auf mich ein.“
Iris lachte. „Sie meinen, schwanzwedelnd, hm? Wie so ein Foxterrier. Oder so ein kleiner Spitz, der wartet den ganzen Tag in seinem Körberl, und wenn das Frauchen kommt, dann bellt der ganz aufgeregt, bitte bitte spiel mit mir.“
Ich konnte jetzt, da sie darauf bestanden hatte, die Brille abzunehmen, ihre blauen Augen sehen, und ich sah, wie sie sich mit Tränen füllten.
„Das sind Tränen der Rührung“, kam sie meiner Frage zuvor. „Weil Sie sich so intensiv mit mir beschäftigen.“
Im Lehrerhaus am östlichen Stadtrand, dort, wo Wien fast dörflich wird, kauert die kleine Iris auf der Hofstiege und streichelt die Katze. Sie wartet darauf, dass einer mit ihr spielt. Aber Erika ist so viele Jahre älter und steckt ihre Nase am liebsten in Papas Bücher. Rosi ist auch viele Jahre älter, hilft der Mama beim Kuchenbacken und löffelt als erste die frisch eingekochte Marillenmarmelade. Die Cousins und Cousinen sind alle viel älter und wohnen weit weg. Keiner mag mit Iris spielen, obwohl sie doch bei den Familienfesten von Schoß zu Schoß wandert und alle sie unglaublich süß finden mit ihren Kulleraugen und dem winzigen Puppenmund. Ihr Blick auf dem Kinderfoto: sehnsüchtig und argwöhnisch zugleich. Auf diesem Bild streckt sie die Arme aus und strengt sich an, die Tränen zurückzuhalten.
Iris Bausch besaß die Gabe, besonders lebhaft zu erzählen. Viele ihrer Geschichten stehen mir noch Jahre nach dem Ende der Therapie so plastisch vor Augen, als sei ich dabeigewesen. Im Frühsommer muss ich besonders oft an sie denken, wenn im Vorgarten unserer Praxis die Schwertlilien aufgehen. Sie hat mir die seltenen Pflanzen zum Abschied geschenkt, hat sie extra für mich ausgesucht im Naturschutzpark „Krautgarten“ in Oberwaltersdorf, wo ihre Eltern leben. Iris sibirica. Iris germanica. Blue-eyed grass.
Sie kam wegen Panikattacken. Im Aufzug, im Supermarkt, in der Disco, später sogar an ihrem Arbeitsplatz in der Frauenarztpraxis war sie von unerklärlicher Angst überfallen worden. Der letzte und schlimmste Anfall hatte sie beim Autofahren erwischt. Überraschender Anruf nach Arbeitsschluss: Sie sollte ihrem Chef bei einer ambulanten Operation assistieren.
Ah da schau her, dachte ich anzüglich, um mich gleich darauf zu schämen. Wir sind doch hier nicht in einem Arztroman, wies ich mich zurecht. Wart doch ab.
„Ich dachte zuerst, es ist der Kreislauf. Das Herz rast wie verrückt. Ich kenne das ja von meinem Vater, der ist ja auch nicht ganz gesund, Hochdruckpatient, wissen Sie, der muss auch aufpassen. Auf einmal setzt mein Herz aus. Ich schnappe nach Luft, weil ich so erschrocken bin. Ich kriege Angst: Was ist mit dir los, Bausch? Bist du im falschen Film oder was? Dann kommt so ein Druck im Kopf, wie wenn dir einer die Birne zusammenpresst, einmal, zweimal, und dann wieder loslässt.“ Sie illustrierte ihre Worte mit den Händen, als ob sie einen Schwamm ausdrückte. „Dann so ein Wegsacken, mir wird total schwindlig. Ich denke, ich falle gleich in Ohnmacht. Jetzt ist es soweit. Jetzt muss ich sterben. Und es ist nicht abgewaschen und die Katze hat keine Milch.“
In der ersten Stunde saß Iris vornüber gebeugt am vorderen Rand des Sessels, die Ellbogen auf die schlanken Jeans-Schenkel gestützt. An den spannendsten Stellen ihrer Schilderung warf sie den Oberkörper ruckartig nach hinten und stieß tiefe Seufzer aus. Sie erinnerte mich an ein Füllen, das mit den Hufen scharrt.
„Irgendwie ist es meine ganze Lebenssituation. Ich bin einfach nicht zufrieden. Manchmal sitze ich am Morgen so da“, sie beugte sich wieder vor, den Kopf gesenkt, fuhr sich mit gespreizten Fingern durch die kurzen schwarzen Strubbelhaare, „da könnte ich schreien, lass mich in Ruhe, Leben! Ich will nur mehr schlafen! Ich will ein Jahr schlafen!“
„Und dann wachgeküsst werden“, ergänzte ich.
Sie starrte mich an. „Wahnsinn. Wie Sie das jetzt auf den Punkt gebracht haben.“ Wir sahen uns in die Augen, so lange es ging. „Manchmal kommt mir vor, das Leben ist eine Straße, und ich bin immer irgendwie daneben, immer nur am Rand, einmal links daneben, dann rechts daneben, ich weiß auch nicht ...“ Ihre Stimme klang tränenerstickt.
„Jedenfalls ist es zum Weinen. Das Herz tut weh“, sagte ich.
„Sie versteht mich!“ rief Iris perplex einem unsichtbaren Publikum zu. Einige Sekunden lang fixierte sie mich schweigend, als sei sie total hingerissen von meiner Bemerkung. „Aber man kann doch nicht dauernd heulen. Also, ich sage mir: Du brauchst nicht unglücklich sein, Bausch. Du hast einen Beruf, eine gute Stelle, nette Kollegen, liebe Freunde, eine wunderbare Katze. Na gut, du hast keinen Mann, keine Kinder, aber was soll´s. Besser keinen Mann als ein Leben lang den falschen.“ Iris schnipste mit den Fingern. „Aus, Schluss, basta. Das ist wahrscheinlich die ganz banale Torschlusspanik. Bald ist sowieso alles zu spät. Mir wächst ja schon Moos zwischen den Beinen.“ Wir mussten beide lachen. „Ich war eben immer die Kleinste, die am längsten drinsteckt. Das dreibeinige Schaf, das hinterherhumpelt, wenn alle anderen schon angekommen sind.“ Wir lachten. Sie konnte sich wirklich witzig ausdrücken. „Die kleine Bausch. Wieder einmal als Letzte durchs Ziel. Jetzt bin ich achtunddreißig, ich habe meine Ausbildung, meinen Arbeitsplatz, wunderbare Freunde, aber allein bin ich trotzdem. Ach, diese vergeudeten Jahre.“ Sie fuhr energisch mit der Zunge über die Lippen und schniefte, dabei zeigten sich Grübchen in beiden Wangen.
So ein süßes tapferes Mädchen, dachte ich. Wie sie einen noch zum Lachen bringt, wenn ihr das Wasser schon bis zum Hals steht. Ich könnte ihr stundenlang zuhören und vor allem zuschauen. Jeden Augenblick konnte etwas Überraschendes passieren. Diese aparte Mischung von knabenhaftem Pfiff und Sexappeal. Beine wie ein Model. Selbst wenn sie ein bisschen sprunghaft sein sollte, ihr kann doch keiner böse sein. Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn so eine reizende Person keinen Mann kriegt.
„So hintennach war ich immer“, fuhr sie fort. „Im Sport bin ich als Letzte auf der Bank sitzen geblieben. Da war immer so viel Lärm, und ich hatte Angst, den Ball ins Gesicht zu kriegen. Wenn Schwierigkeiten kamen, bin ich eher weggelaufen. Wissen Sie, was in der Volksschule in meinem Zeugnis stand? ´Das verträumte Kind bemüht sich nach Kräften, allen Anforderungen gerecht zu werden.´ Bemüht sich. Ha! Aber vergebens.“
Iris war ganz klein geworden. Sie rutschte mit dem Hintern nach vorn an den Rand der Sitzfläche, sodass sie fast zum Liegen kam. Sie weinte leise und zog den Rotz hoch. Ich bot ihr ein Taschentuch an.
„Ja? Haben Sie eines?“ fragte sie mit einem großen violetten Augenaufschlag.
Ich gab ihr eine Packung von meinem Schreibtisch. Sie zupfte eine Zeitlang am Klebeverschluss herum und stieß dann unter Tränen hervor: „Sehen Sie, das ist es. Ich finde keinen Zugang.“
„Eben habe ich mir schon überlegt, ob ich die Packung für Sie öffnen soll“, sagte ich. Mein Gott, sie ging auf die Vierzig zu! „Aber jetzt haben Sie es ja doch selber hingekriegt.“
Zu früh, zu spät
In der fünften Stunde erzählte mir Iris Bausch, sie habe von mir geträumt.
„Vor Ihrer Praxis frage ich mehrere Leute um die Uhrzeit. Ich will unbedingt genau richtig kommen, nicht zu früh und nicht zu spät. Keiner sagt mir, wie spät es ist. Sie empfangen mich in der Praxis, aber es ist nicht diese Praxis hier, sondern eine Art Hotelhalle mit einer riesigen Rezeption, vielleicht mehr wie bei Blacky und Chris, wo ich arbeite, Frauenarztpraxis Schwarz&Schwarz. Sie führen mich rein und dann wieder raus. Da ist nämlich ein verliebtes Pärchen, bei dem müssen Sie noch was klären. Sie sagen zu mir: Sie haben doch Verständnis, das verschiebt sich noch etwas. Ich sagte ja, kein Problem. Ach so, Sie sagen noch, das ist ein Quiz, ich muss herausfinden, wer das Liebespaar ist. Ich warte und warte, schließlich ist fast die ganze Stunde vorbei, und ich denke, jetzt kommt doch gleich wieder jemand anderes dran! Die hat mich wohl vergessen, dann kann ich ja gehen. Draußen vor der Praxis sind lauter Leute, die mir ständig die Uhr verstellen.“
Iris verschränkte die Arme und machte ein komisch übertriebenes Schmollgesicht.
„Und? Wie verstehen Sie den Traum?“, fragte ich nach einem kurzen Schweigen.
„Überhaupt nicht“, winkte sie lachend ab. „So einen Traum kann man sicher nur falsch deuten. Ich träume ja so viel, dafür könnte ich jede Nacht Eintritt verlangen.“
„Was für ein Gefühl hat denn Ihren Traum begleitet?“
„Ach, da waren keine negativen Gefühle ...“
Ich verschränkte ebenfalls die Arme und machte ihr beleidigtes Gesicht nach.
„Oder doch, ja, kann sein. Angst, abgelehnt zu werden?“
Ich zog die Augenbrauen hoch und wartete. Wieso Angst? In ihrem Traum war die Ablehnung doch schon passiert. Kein Ärger? Hatte sie ihre Enttäuschungswut, um ja nicht anzuecken, komplett in eine putzige Grimasse umgewandelt?
Meine Einfälle sprudelten. Ein fantastischer Traum. Da ist ja alles drin, sinnierte ich. Die gynäkologische Doppelpraxis - ein nettes Bild für das Elternpaar. Nicht genug bekommen, sich nichts nehmen können - die orale Hemmung. Schmollgesicht - die unterdrückte Frustration. Rein, raus, wer ist das Liebespaar - die sexuelle Unsicherheit. Die kindliche Scheu vor der Verantwortung - die anderen Leute, die Großen, sind schuld, weil sie ihr nicht sagen, was es geschlagen hat. Zuerst warten müssen - zu früh; dann Torschlusspanik - zu spät. Ein vibrierendes Mosaik von möglichen Ansatzpunkten. Ein ganzer Strauß von Emotionen. All das enthalten in einer kurzen Traumgeschichte, genial verdichtet in einer inneren Filmszene, von deren Vielschichtigkeit der verbale Traumbericht ja nur das Drehbuch wiedergibt.
Was ihr Gesicht zeigte: Aggression. Was ihre Worte benannten: Angst.
„Ihre Angst hat offenbar einen guten Grund“, sagte ich. „Sie werden in dieser Praxis ja tatsächlich ziemlich übel behandelt. Sie haben das berechtigte Gefühl, zu kurz zu kommen. So manche andere Person an Ihrer Stelle würde sich ärgern und energisch protestieren. Aber Sie wissen nicht so recht, was Ihnen zusteht. Ob Sie überhaupt etwas verlangen dürfen.“
Ihr gebannter Blick. Kein Nicken, nicht einmal ein Lidschlag. Hatte sie mich nicht verstanden? War sie so fasziniert, dass es ihr die Sprache verschlagen hatte? Erforschte sie mein Gesicht, um herauszufinden, ob sie mir trauen konnte?
„Die Frau ist gut“, sagte sie im Tonfall verblüffter Anerkennung, als spräche sie zu einem imaginären Dritten. „Unglaublich. Wie finden Sie bloß so schnell die richtigen Worte?“
Sie lenkt ab, dachte ich, geschmeichelt zwar, aber um Abstinenz bemüht. Wir waren doch gerade bei ihrer Enttäuschung an der Traum-Therapiestunde. Sie hüpfte von ihrem Platz gewissermaßen auf meinen herüber und schmierte mir Honig um´s Maul.
Einer Therapeutin, die ein bisschen eitel ist und sich insbesondere auf ihre sprachliche Genauigkeit viel zugutehält, gehen solche bewundernden Worte natürlich runter wie Öl. Der ernüchternde Fachjargon macht aus diesem angenehmen Phänomen aber leider einen sogenannten Widerstand, den er „Idealisierung“ nennt. Der idealisierende Blick auf einen anderen Menschen nimmt selektiv dessen gute Seiten wahr und umgibt sie mit einem Glorienschein, während negative Eigenschaften ausgeblendet werden. Idealisierungen haben zwar etwas Beglückendes wie jede Verliebtheit. Aber bekanntlich führen die realen Erfahrungen regelmäßig zur Desillusionierung. Im Alltag mit dem Geliebten lauert die böse Kehrseite der Idealisierung, die totale Entwertung. Niemand wird so verteufelt wie jemand, den wir für einen Engel hielten.
Insofern muss ich also in der Therapie, so schwer es mir fällt, Idealisierungen analysieren, statt sie nur zu genießen. Da Iris Bausch und ich uns aber erst in der Anfangsphase befanden, entschied ich, dass ihre Bewunderung der Vertrauensbildung nützte und daher nicht auf der Stelle zerlegt werden musste. Ich notierte das Thema Idealisierung im Hinterkopf und konzentrierte mich eher auf die Art unserer Interaktion, die sich später als ganz bezeichnend herausstellen sollte: Iris befand sich mehr bei mir als bei sich. Eben hatte sie mit ihrem Traumbericht eine Szene dargestellt, in der ihr von der Therapeutin übel mitgespielt wurde. Und dann hatte sie nichts Eiligeres zu tun, als das Bild eben jener frustrierenden Person mit einem Goldrand zu verzieren.
An dieser Stelle zeigte sich wieder einmal die unfassbare Komplexität des therapeutischen Geschehens. Ein Zimmer, zwei Sessel, ein Tisch dazwischen. Zwei Menschen im Gespräch. Vom ersten Augenblick an ist alles da. Ein summendes Elektrizitätswerk mit Millionen Vernetzungen. Zwei Elektrizitätswerke, die miteinander in Kontakt treten. Unvorhersehbare Funken an den Berührungsstellen. Fünf oder sechs Sinne mal zwei, Biografien, Muttersprachen, Gerüche mal zwei, dazu all die Wandlungen, die sich durch die Interaktion ergeben. Neuronengewitter, auf den ersten Blick unverständlich wie ein Traum, sodass bisweilen der Verdacht der Beliebigkeit aufkeimt. Einige Kontaktstellen blinken aber immer wieder. Mit der Zeit leuchten Muster auf. Das Geflimmer ordnet sich, man meint Sternbilder darin zu erkennen. Leider handelt es sich nicht um eindeutige, geschlossene Gestalten. Manche Lichtpunkte gehören den Schnittmengen von mehreren Figuren an. Überdies verschiebt sich der Fokus in der Tiefendimension. Dennoch bleibt die Ahnung: Gelänge es uns nur, wirklich zu sehen, es wäre die Lösung.
Unfassbare Komplexität zu Mustern verdichten wollen: Wissenschaft? Kunst? Hybris?
Im Kontakt mit Iris Bausch hatten sich also, wie bei den meisten anderen Patient*innen, schon nach wenigen Stunden mehrere überlappende Themenfelder aufgetan. Das Motiv „mehr bei mir als bei sich“ zeigte sich gleich am Beginn, das Motiv „zu früh oder zu spät“ im Initialtraum, ebenso wie das Motiv „Idealisierung als Abwehr von Enttäuschungswut“. Später kam das Motiv „Dreiecksbeziehung“ hinzu und verflocht sich mit den anderen Themen.
Naheliegend und meiner Patientin bewusst war die Zukunftsangst einer nicht mehr ganz jungen Frau, es könnte für sie „zu spät“ sein, einen Partner zu finden und ein Kind zu bekommen. Die Uhr tickte unaufhaltsam.
Weniger einleuchtend erschien zunächst das Gegenteil: die Empfindung, für irgendetwas sei es „zu früh“. Ihre mädchenhafte Ausstrahlung, ihre jugendliche Figur, ihre saloppe, manchmal naive Art, all das passte dazu. Früh, nach ihrem Gefühl viel zu früh, sei sie eingeschult worden, nämlich mit fünf Jahren, die behütete Jüngste, das verträumte Schaf. Zu früh war auch ihre Geburt gekommen.
Im Lehrerhaus plagt sich die Lehrersfrau, ihrem nervösen Herrn und Gebieter alles recht zu machen, denn sonst steigt sein Blutdruck in den roten Bereich und dann schreit er und bekommt unerträgliche Kopfschmerzen und man muss fürchten, dass ihn gleich der Schlag trifft. Sie ist ein tapferer kleiner Kerl, Frau Roswitha Bausch, geb. Koller, und ihr Leben hat sie dem schwierigen Mann geweiht.
Was blieb ihr auch anderes übrig, nachdem sich die ganze Koller-Verwandtschaft von ihr abgewandt hat, weil sie sich just den Buben von der Konkurrenz aussuchen musste. Lebensmittel Koller und Delikatessen Bausch, zwei Greißler in einer so kleinen Ortschaft wie Oberwaltersdorf, da gab es schon böses Blut. Als ob sie nicht genug anderer Verehrer gehabt hätte, das fesche, stramme Mädel.
Da heißt es zu zweit zusammenhalten. Für Freundschaften hätten sie ohnehin keine Zeit. Ihr Gerhard hat viel Arbeit in der Schule und am Schreibtisch. Sie plagt sich mit dem Haus und dem Garten und den drei Kindern. Gerhard braucht sie ja praktisch nur anzuschauen, schon wird sie schwanger. Kein Stammhalter, leider Gottes. Die zwei Großen wären aus dem Gröbsten schon heraus, da kommt noch was Kleines. Rosl ist halt leider oft ungeschickt, ihr Mann versucht sie ja immer zur Besonnenheit anzuhalten, da muss sie doch trotzdem, wie sie ihm den Blauburgunder aus dem Keller holt, noch dermaßen hetzen, dass sie hinfällt, und das Kind kommt viel zu früh und muss ein Vierteljahr im Krankenhaus bleiben.