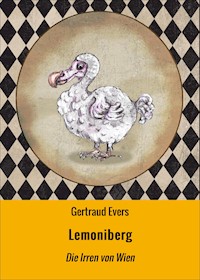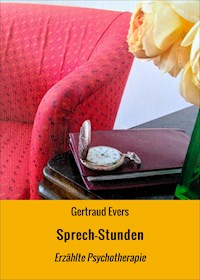2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als endlich etwas passiert, als Mella Just im Morgengrauen eine Unbekannte von der Friedensbrücke stürzen sieht, will sie einfach nur das Richtige tun. Sie zieht die Ertrinkende aus dem Donaukanal, und auf einmal ist alles im Fluss. Von ihrem Liebhaber trennt sie sich, mit ihrem Chef macht sie reinen Tisch, ihrem besten Freund kommt sie näher denn je. Nur die Stammgäste in ihrem Kaffeehaus ändern sich nicht. Mella aber tut in der mörderischen Hitze der Hundstage allerhand, was sie noch nie zuvor getan hat. Vor allem mit Viktor. Viktor Mangold, Rechtsanwalt, in Hassliebe verstrickt mit der kapriziösen Malerin Ruth, hat sich einfach nur nach Ruhe gesehnt. Aber ohne den Clinch mit Ruth droht sein Leben zu zerfallen. Viktor sucht die Lösung bei Mella, der Retterin seiner Frau. Was ist wirklich auf der Brücke passiert? Ist der Mann ein Trost suchender Witwer? Ein Mörder, der die Belastungszeugin verfolgt? Ein Verliebter? Ein Verrückter? Eine bizarre Reinszenierung soll helfen, das Geschehene zu begreifen. Ruth war selbstzerstörerisch, aber zugleich voll Lebensgier. Viktor hätte sie hundert Mal umbringen können, aber niemals verlieren wollen. Oder? Die Geschichte spielt in Wien, innerhalb einer Woche im Juli 1988.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gertraud Evers
Frau im Fluss
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Zweier Zeugen Mund
Es wird ernst
Das böse Gesicht
Spiegel Wiege Jakobsleiter
Wie du mir, so ich dir
Das Leben geht weiter
Schachmatt
Im Kaffeehaus
Touché
Vorübergehende Heimkehr
Hier ist vieles ungeklärt
Überleben wäre ein Wunder gewesen
Den Spieß umdrehen
Mimosen
Heiß und kalt
Kollision
Entgleisung
Tanz mit mir
Flüchtiger Mann, schuldiger Mann
Unwucht
Nicht zu retten
Was ist schon normal
Glück und Glas
Alles halb
Eine Schlange im Herzen
Adrenalinstoß
Gnade vor Recht
Impressum neobooks
Zweier Zeugen Mund
„Ja, gute Frau, durch zweier Zeugen Mund
Wird allerwegs die Wahrheit kund.“
Mephistopheles zu Marthe Schwerdtlein in:
Johann Wolfgang von Goethe, Faust I
Es wird ernst
Als es ernst wurde, im Morgengrauen eines windigen Julitages, wollte Mella endlich einmal einfach das Richtige tun. Sie war Mitte dreißig, ihr Leben war nicht verkehrt, aber richtig war es auch nicht, und aufregend schon gar nicht, sie hatte schon allerhand vermurkst und mancherlei verpasst und war mehr als einmal falsch abgebogen. Einfach nur das Richtige tun, wenn es drauf ankommt, das hatte sie im Sinn, und sie ahnte nichts von der Gewalt der Strömung, auf die sie sich einlassen sollte.
Seit sie denken konnte, hatte Mella darauf gewartet, einmal etwas richtig Aufregendes zu erleben oder wenigstens zu beobachten.Auf ihrem Schulweg hatte sie jeden Tag an einem Polizeikommissariat vorbeigehen müssen, sie konnte gar nicht anders als die wechselnden Mitteilungen in dem vergitterten Schaukasten zu lesen. Unheimliche Wörter standen da, belästigt, bedroht, verletzt, vermisst … Zeugenaufruf, stand da. Die Polizei bittet um Mithilfe. Bleistiftmord. Sexualdelikt. Davon hatte sie zu Hause lieber nichts erzählt. Schwarzweiße Phantombilder wurden gezeigt, Ergreiferprämien verheißen. Mit einem angenehmen Schaudern hatte sich Mella oft ausgemalt, wie sie im Falle eines Falles als aufmerksame Augenzeugin glänzen würde.
Wenn sie später im Kaffeehaus aushelfen musste, schaute sie sich die Gäste immer genau an, und sobald ihr etwas Merkwürdiges auffiel, dachte sie sich eine möglichst dramatische Bedeutung dazu aus. Sie merkte sich Autonummern, wenn sich die Lenker im Geringsten verdächtig benahmen. Sie sperrte die Augen auf, bis sie brannten, und bekam mit der Zeit Übung darin, sich Beobachtungen wie Steckbriefe einzuprägen. Spätabends verschlang sie Detektivgeschichten. Hörte sie nachts ein ungewöhnliches Geräusch, schaute sie sofort auf die Uhr, um im Falle eines Falles zweckdienliche Hinweise geben zu können.
Wäre sie als Zeugin gefragt, würde sie mit ihrer Aussage Ermittlungen erhellen und maßgeblich zur Aufklärung beitragen. Täter zu überführen, Unschuldige zu entlasten und Opfern gerecht zu werden, das war es, was wirklich zählte, da kam es dann auf Zeitungsfotos oder Belohnungen gar nicht mehr an.
Aber all die Jahre war nichts Aufsehenerregendes passiert. Ihr Talent, Licht ins Dunkel zu bringen, lag lange Zeit brach.
Am 23. Juli 1988 um fünf Uhr früh war es dann endlich soweit: Mella Just wurde Zeugin. Aber sie war in einer miserablen Verfassung, übernächtigt, verkatert und durcheinander, ausgerechnet jetzt, als es ernst wurde. Wie so oft ging ihr durch den Kopf, was Robert sagen würde, pass auf, würde er sagen, wenn ein Herzenwunsch in Erfüllung geht, das ist keine Glücksgarantie, nicht selten wird ein Albtraum draus. Wie so oft hätte er den Nagel auf den Kopf getroffen.
Mella hatte seine Stimme noch im Ohr, als sie sich in ihrem alten Renault von Norden her der Friedensbrücke näherte. Sie kannte Robert seit fünfzehn Jahren, und es war das erste Mal, dass sie eine Nacht mit ihm verbracht hatte. Lange hatte es an ihr genagt, dass es mit ihnen beiden nichts geworden war. Aber jetzt hatte sie ja Carl. Kurz vor fünf war ihr Carl eingefallen. Wenn er sie, wie gewohnt, mit frischen Semmeln wecken wollte und nicht antraf, dann war mit einem nervtötenden Verhör zu rechnen. Sie musste schleunigst nach Hause.
Den Weg von Roberts Garconnière am Brigittaplatz über den Donaukanal in die Innenstadt kannte sie im Schlaf, und als sie ein Auto auf der Brücke stehen sah, wusste sie gleich, da stimmte etwas nicht. Auf der Friedensbrücke gab es drei Fahrspuren und einen breiten Gehsteig in jeder Fahrtrichtung, eine Straßenbahn- und eine Bushaltestelle, aber gewiss keinen Platz zum Halten oder gar Parken. Brücken mussten zügig überquert werden. Wenn sich irgendjemand nicht daran hielt, dann ging sie das natürlich überhaupt nichts an. Sie brauchte dringend eine Dusche. Wenn Carl einmal anfing mit besorgten Fragen, wurde er anstrengend. Mella wollte schnell heim.
So drosselte sie das Tempo nur wenig, als sie sich dem weißen Volvo näherte, prägte sich aber für alle Fälle die Autonummer ein. Beide Autotüren klafften wie ausgerenkte Glieder. Da tauchte eine Gestalt auf, da stand jemand auf dem Brückengeländer, wieso das denn, weiße Hose, lila Oberteil, Strohhut, registrierte ihr Gehirn mechanisch. Eine alberne Wette? Um fünf Uhr früh? Ihr Blick wanderte seitwärts, über die Schulter, erfasste im nächsten Moment nur mehr Hut und Lila und verwischtes Schwarz, Weiß war weg, ein Fallen, ein Sinken, was für eine Schnapsidee, hier herumzuturnen, dann glitt ihr ein Schatten über den Augenwinkel.
War da tatsächlich jemand von der Brücke gesprungen?
Ihr Nervensystem schlug Alarm, bevor sie die Bedeutung der Bilder verstand, Alarm dröhnte in ihrer Magengrube wie ein Orgelton.
Mella, es wird ernst.
Die Ampel vor der U-Bahn-Station schaltete auf Rot, eine Galgenfrist. Sollte sie als Zeugin wirklich ins Geschehen eingreifen? No risk no fun, sagte Robert, wenn er sie ermutigen wollte. Looking for trouble, sagte er, lieber Stress als Ödnis, oder, wenn sie mit Schritten liebäugelte, die er für gefahrenträchtig hielt. Wenn er sie warnen wollte.
Mella zögerte, ihr Körper handelte. Statt des gewohnten Heimwegs geradeaus wählten ihre Hände am Steuer die Linksabbiegespur – die einzige Chance, die Strömung mit dem Auto zu überholen.
Ihr Fuß gab Gas, ihr Hirn auch. Was geht´s mich an, dachte sie, Carl wird beleidigt sein, dachte sie, immer sein waidwundes Gesicht, und was ist, dachte sie, wenn der Sprung von der Brücke nur ein Jux war, oder wenn ich mir das alles eingebildet habe, wenn ich mich mit dem ganzen Theater furchtbar blamiere?
Der Uferweg war gegen die Straße hin mit Gittern abgeschottet worden, um Fußgänger am Überqueren der dreispurigen Rossauer Lände zu hindern. Erst bei der nächsten Ampel öffnete sich wieder ein Zugang zum Wasser.
Ich bin nicht nüchtern, dachte Mella, was ist, wenn die Polizei –, aber dann dachte sie an Do the Right Thing, einen Hollywood-Film mit –, der Name des Hauptdarstellers fiel ihr partout nicht ein, und dann dachte Mella an das Praktikum in der Intensivstation, sie dachte, dass sie ohne Führerschein vollkommen aufgeschmissen wäre, sie dachte an den Rettungsschwimmerkurs, an Papa und Mama, und in ihrem Körper orgelte es wie verrückt.
In diesem Kurs hatte sie gelernt, die ganze Länge des Beckens unter Wasser zu durchqueren und Sandsäcke zu bergen vom Grund. Es war stockfinster gewesen dort unten. Bei der Abschlussprüfung musste sie vollständig bekleidet ins Trainingsbecken springen und einen Kollegen abschleppen. Ein Ertrinkender kann gefährlich sein, hatte sie gelernt, womöglich wehrt er sich in Todesangst gegen einen Retter wie gegen einen Mörder.
Als Mella in Höhe Glasergasse bremste, wusste sie, was das Richtige war. Sie war hier nicht nur als Zeugin gefordert. Sie musste jetzt ins Wasser. Wenn sie es nicht tat, würde es keiner tun, und sie würde sich ihr Lebtag nicht mehr im Spiegel anschauen können.
Der Wagen war irgendwie zum Stillstand gekommen, sie schon längst über die Straße und die Treppe hinunter, die grüne Böschung hinunter gerannt, über Steine gerutscht und gestolpert, weg mit den Schuhen, da kam sie gerade recht.
Nur ein paar Meter vom Ufer entfernt trieb ein Fetzenbündel. Woher sollte man denn wissen, wie ein Ertrinkender aussah. Menschliche Körperteile waren nicht zu erkennen. Ein Haufen Lumpen hätte es sein können. Aber eindeutig lila. Besser, man machte sich lächerlich, als man ließ einen Menschen ertrinken.
Zwei Männer mit Angelruten und Kübeln kamen zum Ufer herunter.
„Da ist jemand im Wasser!”, schrie Mella. „Rufen Sie die Rettung!”
Sie hatte noch die eleganten Sachen vom Theaterabend an, mit dem engen Kleid ging natürlich kein Beintempo, also Striptease, ach verflixt, sie hatte am Vortag nicht darauf geachtet, die gute Unterwäsche anzuziehen, es war ja nicht damit zu rechnen gewesen, dass sie sich vor Zuschauern entkleiden würde, sie zögerte sekundenlang, wie peinlich, wie kleinlich, runter mit dem Kleid, und rein ins Wasser.
Das Bündel aus lila Stoff war aufgebläht wie ein Segel, darunter pendelten bleiche Glieder, reglos hing der Kopf, das Gesicht unter Wasser. Was, wenn ich umklammert werde, dachte Mella, wenn es ein Gerangel gibt und es zieht mich auch hinunter?
Nichts dergleichen geschah. Es war: eine Leiche berühren. Wie im Sezierkurs. Während Mella fachmännisch unter den Achseln der Frau hindurch deren Unterarme fasste, handelte sie glatt und fließend, wie in eine Schutzhülle eingeschweißt, taub für das Tosen der Katastrophe. An ihren Schlüsselbeinen fächelten lange rötliche Haare.
Nach Luft ringend, als sei sie selber am Ertrinken, erreichte sie mit ihrer Last die Steinhalde am Ufer. Die zwei Angler halfen, den Frauenkörper auf eine ebene Grasfläche zu betten. Mella kniete neben dem Oberkörper der Bewusstlosen, legte eine Hand auf ihre Stirn, verschloss ihre Nase mit zwei Fingern, streifte mit der anderen Hand Schleim und Schaum von ihren Lippen, schob ihr Kinn hoch, und begann mit der Mund-zu-Mund-Beatmung. Die Angler assistierten auf ihr Kommando abwechselnd bei der Herzmassage.
Als die Helfer eintrafen, zuerst fünf Feuerwehrmänner in voller Montur, dann endlich der Notarzt, wurde die Retterin zittrig. Man gab ihr eine Decke. Es hatte zu nieseln angefangen.
Die Frau aus dem Donaukanal war lang, sehnig, barfuß. Ihre weiße Hose war voller Schlamm, Schlingpflanzen hingen an ihren grauen Unterarmen, leuchtend grüne Ranken. Ihre Uhr war ein antikes Modell mit einem ovalen Zifferblatt. Siebzehn Minuten nach fünf. Der Sekundenzeiger rückte unbeirrbar weiter. Rot lackierte Fingernägel. Gestern hat sie sich noch um Maniküre gekümmert, dachte Mella. Das lila Hemd war an der Taille hochgerutscht. Sommersprossen. Gänsehaut. Über ihren Oberkörper beugte sich der Notarzt, der Beatmungsbeutel verbarg ihr Gesicht.
Das wird nichts mehr, dachte Mella. Muss es so trist enden. Alles umsonst, dachte sie und sammelte ihre Kleider ein.
Der Anführer der Feuerwehrleute stellte sich vor, Prokop, Gruppenkommandant, und nahm ihre Personalien auf. Just, Vorname Melanie, wohnhaft Wien, 5. Bezirk, Krongasse 9, Geburtsdatum, Telefonnummer.
„Die Frau ist von der Brücke gesprungen“, sagte Mella.
„Aha“, sagte Prokop.
„Ich hab sie herausgezogen.“
„Aha. Sonst noch was?“
Mella schaute den Mann in seiner Uniform verständnislos an.
„Na haben Sie sonst noch irgendwas gesehen? Oder gehört?“
Mella schüttelte langsam den Kopf.
„War vielleicht irgendjemand in der Nähe? Frau Just? Ich habe Sie was gefragt!“
„Ah, ach so, ahm …“
„War da jemand bei der Frau? Oder war sie allein?“
Mella nickte geistesabwesend. Sie überlegte, was sie Carl sagen sollte. Sie überprüfte, wieviel Zeit ihr noch blieb, bis das Kaffeehaus aufgesperrt werden musste. Sie grübelte, wie der Hauptdarsteller gestern im Burgtheater hieß, wie konnte sie das bloß vergessen, der Name lag ihr auf der Zunge! Sie dachte über die Nacht mit Robert nach.
„Frau Just? Frau Just! Sollen wir Sie nach Hause bringen?“
„Nein, nein, danke, geht schon. Geht schon. Danke vielmals.“
„Ist wirklich alles in Ordnung mit Ihnen?“
Mella zog in Zeitlupe ihre regennasse Abendgarderobe an. Dann trabte sie die Böschung hinauf, die roten Schuhe in der Hand, blieb stehen, wo war denn ihr Autoschlüssel, ging wieder zurück zum Wasser.
Sie hörte den Wind in den Pappeln, warum jetzt auf einmal so ein Wind! Es war kühl für Juli. Unter dem grauen Himmel leuchtete der Donaukanal grün. Mella starrte auf einen Hagebuttenstrauch, als hätte sie in ihrem Leben noch keinen gesehen. Die Häuser entlang der Brigittenauer Lände waren hellgelb, hellblau, hellgrün, alle waren sie genau gleich hoch. Mellas Blick fiel auf eine Rettungszille mit der Aufschrift Gemeinde Wien ein paar Meter stromabwärts. Ach, und da lag ja der Autoschlüssel, gut sichtbar, auf einem großen Uferstein. Sie ging in die Hocke und schaute zur Friedensbrücke hinauf.
Oben angekommen, überlegte Mella eine Weile, warum sie jetzt eigentlich wieder auf der Brücke stand, und wo sie ihr Auto abgestellt hatte. Jemand hatte den Schriftzug Devil an die Wand der U-Bahn-Station gesprayt, das L am Ende war zu einem Teufelsschwanz zugespitzt. Hinter einem geschwärzten Gitter fuhren die Waggons der U4 ein und wieder aus. Die schütter besetzten Abteile waren orange beleuchtet. Da sausten die Leute dahin und fühlten sich gut aufgehoben.
An der Ecke Glasergasse/Rossauer Lände fand Mella ihren Wagen, setzte sich hinein und fing an zu weinen. Wie das Gesicht der Frau aussah, wusste sie nicht. Was sie sich vorstellte, war eine Totenmaske.
Das böse Gesicht
Als Viktor Witwer wurde, war er erst Anfang vierzig. Ruths Gesicht war bis zum Schluss höhnisch geblieben. Ruhe, dachte er, der arme Viktor Mangold hat endlich Ruhe. Endlich keine Zores mehr. Ihre letzten Worte hatte er vergessen. Viktor erinnerte sich nur mehr an den Tonfall, anklagend, was sonst. Was hatte sie nur gesagt? Er kam nicht drauf.
Alles zu viel, dachte Viktor. Zu viel hineingestopft, herausgeplatzt, zurückgestopft, überfüllt, explodiert. Wie damals die Flasche mit Ruths selbstgemachtem Holundersaft. Wie stoßweises Würgen, wenn man was Schlechtes gegessen hat. Zum Kotzen.
Viktor kurbelte das Autofenster herunter. Ihm war so schlecht. Der Druck im Magen ließ auch nicht nach, als er vom Beifahrersitz aufstand und ein paar Schritte auf und ab ging. Er musste sich am Brückengeländer festhalten, so schwindlig war ihm. Ein Knoten schnürte ihm die Kehle zu. Er räusperte sich, versuchte aufzustoßen, nichts half. Wenn er sich nur übergeben könnte.
Er sah sich um, da war der Himmel eine graue Wand, schräg dagegen verkantet die grüne Wasserfläche. Schroffe Klippen säumten den Fluss, Pflastersteine türmten sich an seinen Rändern. Der Fluss war eine schmutzig grüne Platte. Warum bewegte sich das Wasser nicht.
Ach ja, die Friedensbrücke.
Stadtauswärts die Brigittenauer Lände mit dem Kiosk.
Stadteinwärts die Rossauer Lände, die weiße U-Bahn-Station, auch dort grüne Flecken, Grün war ja die Erkennungsfarbe der U4.
Auf der Straße orangefarbene Lichtstreifen von den Peitschenlampen. Die weißen Kugellampen entlang des Uferweges waren schon ausgeschaltet. Wieso das. Es war doch noch Nacht, jedenfalls im Westen, wo das Fernheizwerk mit dem goldenen Zwiebeldach stand.
Viktor fuhr herum.
Im Osten war der Himmel ein Porzellanteller von unbestimmter Farbe, darin ein Haarriss vom abnehmenden Mond.
Auf der Ostseite der Ufermauer stand Widerstand.
Auf der Westseite stand Ego.
Der Schwindel war so stark, dass Viktor sich für die paar Schritte zur Fahrerseite hinüber am Volvo abstützen musste. Bedächtig korrigierte er die Sitzstellung. Ruth bevorzugte eine sehr steile Position. Sie wollte immer ans Steuer, sie fuhr immer rasant. Ruth spielte mit dem Feuer. Er fürchtete ihre riskanten Überholmanöver, aber irgendwie fiel ihm das immer zu spät ein, immer erst, wenn sie schon den Motor aufheulen ließ. Beim Einsteigen dachte er nie an seine Angst, und sobald sie über ihn kam, lähmte sie ihn in Sekundenschnelle wie ein Gift, dann konnte er sich nicht mehr wehren.
Kaum saß Viktor wieder im Auto, fiel ihm auf, wie die riesigen Uferpappeln vom Wind geschüttelt wurden. Seltsam, dass man im Inneren des Wagens den Wind sogar stärker sausen hörte. Am Horizont blinkte ein rotes Licht, der Sender vom Kahlenberg, das Blinken war ein Pulsieren, ein schlechtes Zeichen, es pulsierte in Viktors Hals, drückte ihm auf die Gurgel, im gleichen Rhythmus schnarrte ein hässlicher Ton, ah, von der Fußgängerampel, die blieb ja endlos grün, immer der hässliche Ton.
Ruth machte das höhnische Gesicht, sobald Viktor in Not geriet. Wie hatte er sich angestrengt, die Not vor ihr zu verbergen, Jahre, Jahre. Sein Vorsatz war, so zu tun, als ob es ihm nichts ausmachte, wenn sie ihm was angetan hatte. Ihr keinesfalls den Triumph eines Treffers gönnen.
Sie hat ja ihre Techniken, ihn zu irritieren. Er steht ja dann als der Dumme da, und sie hat noch ein gutes Gefühl! Gegenwehr geht ja nicht. Also tun, als wäre nichts. Aber auch das vergisst er seltsamerweise immer wieder: dass Ruth ihn durchschaut. Sie kennt seine wunden Punkte. Ruth hat Menschen immer durchschaut. Und wenn das Klavier tausend Tasten hat, sie erkennt die kaputten mit tödlicher Sicherheit, sie drückt ohne Rücksicht, sie holt die schlimmsten Misstöne heraus.
Misstöne am laufenden Band. Hinter der kreischenden Ampel die windgebeutelten Pappeln, Geräusche wie ein kaputter Fernseher, ein Zischen und Schaben und Krächzen, seit wann gab es am Donaukanal Raben, ein Kreischen –
Wie die Reifen, als Ruth den Wagen mitten auf der Brücke scharf abgebremst und schräg zum Gehsteig verrissen hatte.
„Ruth! Hier kann man doch nicht stehenbleiben!“
„Doch, das kann man. Weil hier ist nämlich Endstation.“
Ruth schrie niemals im Streit. Sie zischte.
„Was soll der Humbug. Du rennst davon, springst ins Auto, was soll das. Ich muss doch – “
„War doch deine Idee, dass wir mitten in der Nacht unbedingt über den Turnverein diskutieren müssen.“
„Darum ging es doch gar nicht, ich habe doch von diesem Trainer geredet, und da steht es mir zu –“
„Ja, eben, du hast angefangen mit dem Lukas, genau wie gestern und vorgestern und ewig und ewig das Gleiche, es steht mir bis hierher!“
„Ich muss doch morgen früh in die Kanzlei, einer muss doch –“
„Und hör mir auf mit deiner Kanzlei. Das ist eh das einzige, was du kannst, weil du sonst –“
„Hör auf jetzt! Es reicht!“
„Ja, genau, es reicht. Ich mache jetzt Schluss, und zwar richtig!“
Als Ruth die Fahrertür aufstieß, hatte Viktor diesen lauten Wind gar nicht gehört, auch nicht das Tröten der Fußgängerampel, auch die Blinkzeichen vom Kahlenberg waren ihm entgangen. Irgendwann war ein Auto vorbeigefahren, dann wieder Stille. Rundherum alles still.
Die einzige Bewegung war Ruths Sprung auf das Brückengeländer, leichtfüßig wie bei einer Übung auf dem Schwebebalken.
Viktor war vorsichtig ausgestiegen.
„Ruth. Hör auf mit dem Humbug. Komm sofort da runter. Das ist wirklich – “
„Rühr mich ja nicht an. Da schau her, was du aus mir gemacht hast. Aus, Schluss, Ende.“
„Mein Gott, Ruth, das ist gefährlich! Komm sofort da runter! Ruth!“
Viktor erinnerte sich daran, wie er auf ihre weißen Füße gestarrt hatte, ihre nackten Füße, sie war schon barfuß ins Auto gesprungen, als der Streit in der Wohnung eskaliert war, als er sie geschüttelt hatte, weil sie Unerträgliches von sich gab, eine Giftspritze nach der anderen, der liebe Lukas, der tolle Lukas, dann war Blut geflossen, er wusste nicht, ob seines oder ihres, Schlappschwanz Arschloch neben dir verreck ich ja, sie hatte Tabletten geschluckt, eine nach der anderen, er wusste überhaupt nicht, was für Tabletten das waren, sie hörte nicht auf damit, und plötzlich ihre Füße auf diesem Brückengeländer.
„Rühr mich ja nicht an.“
Sie würde nicht springen. Sie wollte ihn nur wieder einmal provozieren, bis ihm nichts anderes übrig blieb, als –
Keine Ahnung, woher eigentlich dieses Bild kam: Ruth kopfüber kopfunter schwebend beim Aufprall Misstöne.
Klippen. Schiefer Turm. Schwarze Piste. Mit Ruth geriet man immer in Gefahr. Ständig Zores. Siebzehn Jahre lang hatte sie Viktor die Hölle heiß gemacht.
„Hör jetzt auf mit diesem Terror, Ruth. Hör auf!“
Er trat einen Schritt auf sie zu, ganz vorsichtig. Ihre Füße tänzelten rückwärts.
„Hör auf.“
„Nein.“
„Hör auf.“
„Sag bitte.“
Schritt auf sie zu, Schritt von ihm weg.
Sie schwankte.
Sie balancierte.
„Hör auf. Ruth!! Tu was ich dir sage!“
„Ich tun was du sagst? Haa haa haa. Du hast mir nichts zu sagen, aber wirklich nichts, überhaupt nichts. So ein kleines Arschloch, und will mir was sagen“, zischte sie, „du warst doch immer schon eine Null“, und lachte.
Viktor hatte plötzlich seine Beine nicht mehr bewegen können. Er hob den Blick von Ruths Füßen zu ihrem Gesicht, das sich seltsam verwandelte, es wurde größer, sodass es in den Proportionen gar nicht mehr zum Rumpf passte, ein Wasserkopf auf einem dünnen Stiel balancierte auf ihren Schultern, so passte nichts mehr zusammen, und der aufgeblasene Kopf wackelte greisenhaft, die verzerrten Gesichtszüge völlig aus dem Lot, eine Fratze blieb stecken, ein Lampion auf einem Stecken schwankte wild hin und her, in den Haaren zerrte der Wind.
Für einen Julitag war es ungewöhnlich windig und kühl. Die digitale Anzeige an der Außenfront der Vindobona Versicherung verkündete fünf Uhr neunzehn und sechzehn Grad Celsius. An der U-Bahn-Station trafen die Zeitungsverkäufer ein. Ein Jugendlicher schnorrte beim Kronenzeitung-Verkäufer eine Zigarette.
Ja, genau, er würde jetzt eine rauchen, kam Viktor in den Sinn wie ein rettender Einfall. Er stieg wieder aus, ohne Schwindel diesmal, stand frei zwischen Auto und Geländer, drehte sich schrittweise vom Westen zum Osten.
Flussabwärts Richtung Innenstadt war ein Aufruhr am Wasser, Leute, Blaulicht. Er konnte jetzt weiß Gott keinen Tumult brauchen.
Endlich Ruhe. Viktor inhalierte tief. Er brauchte Ruhe wie die Luft zum Atmen. Wenn einer lang unter Wasser gedrückt wird und dann endlich auftaucht, ist es wie ein Befreiungsschlag. Gierig wird er das lang Entbehrte einsaugen.
Viktor Mangold trat die Glut aus und setzte sich ans Steuer. Es ging auf sechs Uhr zu. An Schlaf war eh nicht zu denken, da konnte er ja gleich in die Kanzlei fahren und wie jeden Samstag in Ruhe Rückstände aufarbeiten. In den letzten Wochen hatten sich besonders viele komplizierte Akten angehäuft. Er musste arbeiten.
Wieder einmal hatte ihm Ruth etwas angetan, und jetzt konnte er sich endgültig nicht mehr wehren. Er hatte als Letztes ihr böses Gesicht gesehen, und das wurde er jetzt nicht mehr los.
Spiegel Wiege Jakobsleiter
„Robert Suchy. Sie können mir eine Nachricht hinterlassen. Ich kann nicht versprechen, dass ich zurückrufe. Tun Sie, was Sie nicht lassen können.”
Das war typisch Robert. Es reichte ihm nicht, sich zurückzuziehen. Nein, er musste deutlich zeigen, dass er sich versteckte. Einmal hatte er Mella zu fortgeschrittener Stunde anvertraut, dass er das Band am liebsten noch abweisender besprochen hätte: Ich habe gute Gründe, für Sie nicht erreichbar zu sein.
Mella wusste, wie er sich über so manches Gestammel auf seinem Band amüsierte. Es kam vor, dass er den Anrufer eine Zeitlang belauschte und sich dann mit einer windigen Rechtfertigung in die einseitige Konversation einschaltete. Obwohl dem Anrufer ja klar sein musste, dass er seine Rede einem unkontrollierbaren Zuhörer auslieferte, hatte Roberts Verhalten in Mellas Augen doch etwas Heimtückisches – Aushorchen und Überrumpeln. Ein boshafter Beobachter könnte sagen: typisch Psychiater.
Mella kannte dieses Spiel schon lange, aber es reizte sie immer noch, ihm Paroli zu bieten. Ihre Entgegnungsversion am Freitag, dem 22. Juli, lautete: „Ich könnte es lassen, aber ich will es tun. Ich hätte Lust, dich zu sehen. Mach einen Vorschlag ich bin dabei.“
Als sie aus der Sauna zurückkam, war seine Antwort schon da: „Mir ist auch so misanthropisch zumute. Weißt du was, wir schauen uns Heldenplatz an. Burgtheater, halb acht.“
Obwohl Robert anscheinend nicht zu erobern war, machte Mella sich immer schön, wenn sie ihn traf. Sie unterhielten sich oft, ohne einander anzusehen, so wie Männer das mit anderen Männern machen, rücklings an die Theke gelehnt, der Blick schweift durch das Revier, geredet wird nebenbei, der andere läuft ja nicht davon. Aber später, spät nachts kam oft eine Bemerkung, die ihr verriet, dass ihm nichts entging, was ihr Aussehen betraf.
Robert schaute genau hin, und wenn die Besichtigung Unerfreuliches zutage förderte, half er sich mit Sarkasmus. Das hatte auf Mella am Beginn des Medizinstudiums zuerst abstoßend gewirkt. Witze im Seziersaal schienen ihr völlig fehl am Platz.
Ausgerechnet an der Leiche eines jungen Mannes, der mitten im Geschlechtsverkehr an einer Hirnblutung gestorben war, gerieten die beiden das erste Mal aneinander.
„Der hat es eindeutig zu heftig getrieben, oder.“
Der Kursleiter hatte ihnen aufgetragen, die Leiche zu inspizieren und zu beschreiben, was sie sahen. Der schmächtige Student mit der schwarzgerahmten Brille beugte sich demonstrativ über das Genitale des Toten und ließ ein Grunzen hören: „Mm, ich würde sagen, auch die Dame hatte ein ungewöhnliches Erlebnis.“
Mella rollte die Augen. „Wie kommen Sie denn darauf?”, fauchte sie.
Mella hatte öfter Gefühlsausbrüche wie Stichflammen. Gegen plumpe Flirtversuche hatte sie sich früher oft mit giftiger Schärfe verwahrt. Als 34jährige nahm sie es aber nicht mehr so tragisch, wenn wieder einmal ein Augenpaar von ihrem Gesicht abrutschte und sich erst an ihrer Oberweite wieder fing. Robert war es, der ihr später einmal sagen sollte, es seien gerade die Gegensätze in ihrer Gestalt, die ihre aufreizende Wirkung auf Männer ausmachten. Sie bewegte sich flink wie ein Mädchen, die Leichtigkeit lag bei ihr in den Beinen, den dünnen Fesseln. Leicht flatterten auch ihre Worte. Aber da war eben auch dieser Busen. Manchmal kam es ihr so vor, als sei sein Gewicht eigens dazu gemacht, sie an die Schwerkraft zu erinnern. Unten in ihrer Brust gab es einen Resonanzraum, aus dem manchmal heisere Töne auftauchten, die sich für sie selbst fremd anhörten. Register umschalten gehe bei ihr verwirrend schnell, sagte Robert. Man merke das zum Beispiel ganz schön, sagte er, wenn sie sich am Telefon melde: „Melanie Just.“ Drei hüpfende Mädchentöne, und dann der Name mit dem U. Punkt. Umschalten gelang ihr auch gut nach Ausbrüchen, ob Zorn, Tränen oder Begeisterung, sie fing sich schnell und machte wieder Ordnung.
So konnte sie sich nach diesem rasch aufgeflackerten Wortwechsel rasch bremsen. Der vorlaute Kerl hatte ihr eigentlich überhaupt nichts getan. Er hatte sie ja nicht einmal richtig angeschaut.
Überraschenderweise zog er den Latexhandschuh ab und streckte ihr seine Hand entgegen.
„Robert. Manchmal ist mein Mundwerk größer als mein Hirn. Jedenfalls schneller, oder.“
Mella schälte sich auch aus ihrem Handschuh. Als sie einander die Hand gaben, legten sich Reste des Gleitpuders als feiner Film zwischen ihre Handflächen. Robert beugte sich zu Mellas Ohr hinüber, schob ihre Haare beiseite und flüsterte: „Nichts für ungut.”
Der Kursleiter schickte den beiden einen warnenden Blick.
„Ich heiße Melanie“, sagte sie leise.
Während sich die äußere Hülle des toten jungen Mannes unter dem Zugriff der Jungmediziner allmählich öffnete, sodass ans Tageslicht kam, was unter günstigeren Bedingungen noch jahrzehntelang im Dunkeln geblieben wäre, unterhielten sie sich weiter im Flüsterton.
„Melanie, hm, das passt irgendwie nicht zu dir“, sagte Robert. „Das klingt nach Gemüse. Nach einem langen dürren Hals, oder.“
Sie wusste von ihm zu diesem Zeitpunkt nur, dass er aus Vorarlberg stammte. Wenn er seine Sätze mit oder beendete, hieß das keinesfalls, dass er sich nach alternativen Sichtweisen erkundigte. Offenbar hatte er sich schnell ein Bild von ihr gemacht, obwohl er sie kaum anzusehen schien.
„Darf ich dich Mella nennen?“
Jetzt sah er ihr in die Augen, ganz kurz. Roberts Augen lagen im Schatten, von der graublauen Iris war nur der untere Halbkreis sichtbar. Sein Blick war sehr ruhig, prüfend, eine Spur lauernd.
„Mella ...“ Sie machte Kulleraugen schräg nach oben, bei dieser Beleuchtung waren ihre Augen wohl eher grün als braun, und wölbte ihre Oberlippe zu einem koketten Schmollen. „Mella ... okay? Mella. Gefällt mir.“
„Mella ist schön. Da denkt man an Saxophonmusik. Und an Pfirsiche. An Mirabellen, oder.“
Komm, wir gehen ein Eis essen, lag ihr auf der Zunge. Er hob aber schon die Hand in Hüfthöhe: „Uf Wiederluaga. Bis morgen.“
Während des Sezierkurses sahen sie einander täglich. Wenn er nicht kam, vermisste sie ihn. Sie arbeiteten am gleichen Tisch und redeten halblaut miteinander. So sollte es bleiben zwischen Mella und Robert: Ein nie abreißendes Gespräch, bei dem sie einander selten in die Augen schauten. Eine verträumte Geduld entwickelte sich zwischen ihnen, wie sie sich einstellt, wenn zwei miteinander Fadenabnehmen spielen: Figuren aus Wolle oder Garn, die Spiegel oder Wiege heißen, oder Jakobsleiter für Fortgeschrittene, werden zwischen den Fingern aufgespannt und dem Mitspieler hingehalten, damit der sie mit Schling- und Drehbewegungen abnimmt, und dann wieder ich, und dann wieder du, und so fort, eine feine Hand-Choreografie, bei der die Mitspieler eng verbunden sind, ohne einander zu berühren.
Sie sezierten jeden Tag und redeten, aber kaum waren sie gewaschen und umgezogen und hinaus an die frische Luft getreten, war der Zauber jedes Mal vorbei, als verflüchtige er sich wie der Formalingeruch des Pathologischen Instituts, der sie zuvor eingehüllt hatte. Eine Aufforderung zu einem Rendezvous kam von Robert nie.
Mella fasste sich einmal ein Herz und lud ihn mit gespielter Lässigkeit ins Kino ein.
„Nein, das geht nicht“, sagte er. „Ich bin doch mit Katharina zusammen.“
Ach. Ach so? Wieso hatte er ihr das nicht gesagt? Wieso hatte er sie manchmal sogar schon auf den Gedanken gebracht, er könne schwul sein, weil er nicht mit ihr ... wenn er dann doch mit einer Frau ...? Wer zum Teufel war Katharina? Wieso war er mit irgendwem außer Mella zusammen?
Nach dem Sezierkurs fingen beide ein Praktikum für Innere Medizin am Lainzer Krankenhaus an, zu Mellas Bedauern in unterschiedlichen Abteilungen. Drei Monate lang lauerte sie jeden Morgen um zehn nach sieben in der U-Bahn-Station Kennedyplatz, nachdem sie ihn einmal zufällig dort getroffen hatte, in der Hoffnung auf eine neue Begegnung.
Es ließ sich nicht machen. Was möglich war mit Robert, konnte ihr offenbar nur in den Schoß fallen.
Wenn sie es denn fallen ließ.
Dass sie ihn nach neun Jahren Trennung wiederfinden würde, damit hatte sie überhaupt nicht mehr gerechnet. Als sie das Medizinstudium aufgab, kurz vor dem Pathologie-Rigorosum, fielen natürlich alle Berührungspunkte an der Uni weg. Mit dem Kaffeehaus der Eltern war sie nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter dann jahrelang vollends ausgelastet. Von seiner Freizeitgestaltung hatte sie keine Ahnung. Und ihn direkt anzurufen wagte sie nicht.
Sie hatte ihn im Café Landtmann gesehen, draußen unter der gestreiften Markise. Von der Straßenbahn aus hatte sie ihn erkannt, von hinten, ohne sein Gesicht zu sehen, weil niemand so auf einem Sessel saß wie er. Sie kam tropfnass an, das kurze Stück vom Schottentor war sie durch den warmen Regen gerannt, am liebsten hätte sie ihn von hinten umschlungen.
Dass es von da an ging, sich ausdrücklich zu verabreden, hatte vielleicht damit zu tun, dass Mella Mitte 1985 noch verheiratet war. Da wähnte Robert sich vor ihrer Liebe in Sicherheit.
Seither gingen sie oft miteinander ins Burgtheater und trafen sich dann immer vorher im Landtmann. Wieder näherte sich Mella ihrem Freund von hinten, als sie am 22. Juli 1988 zum Treffpunkt kam. Roberts Körper, knabenhaft wie eh und je, fand in verqueren Stellungen, bei denen andere sich verrenkt hätten, zu entspannter Grazie. Er lehnte diagonal im Plastikgeflecht des Landtmannschen Freiluftsessels, das gestreifte Hemd weit geöffnet und nachlässig in die Jeans gestopft, alles wie gehabt, nur dass sich 1985, damals war er noch Spitalsarzt gewesen, tatsächlich bunt gemusterte Unterwäsche darunter abgezeichnet hatte, farbige Punkte und Striche waren es gewesen, die Adonis wieder in einen gewöhnlichen Sterblichen verwandelt hatten. Das damalige Krankenkassengestell hatte er durch eine randlose Brille ersetzt, und von seinen früher schulterlangen Haaren war nur noch ein schräg über die Augen fallender Vorhang geblieben, immer noch eine Bubenfrisur. Ständig war er mit den Händen in den Haaren, wenn er nicht gerade rauchte.
Während der Aufführung des Bernhard-Stückes war Robert ungewöhnlich still. Danach lud er Mella gleich in seine Wohnung ein und übersprang so etliche Stationen der gewohnten nächtlichen Touren. Es war ihr ganz recht, dass sie ihre Empörung nicht auf Restaurant-Lautstärke herunterbremsen musste. Kaum saßen sie in Roberts Käfer, legte sie los.
„Sag einmal, was hast du dir eigentlich dabei gedacht, mich in so ein idiotisches Stück zu schleppen?“
„Das Stück ist ein Kunstwerk“, entgegnete er.
„So ein Blödsinn. Eine einzige Schimpforgie ist das, von A bis Z, und dafür soll man noch zahlen, eine einzige endlose Anklage, alle Österreicher sind Nazis, alle Politiker sind Schweine, und da sitzen wir braven Theatergeher wie die Schafe und lassen uns brav auf den Kopf scheißen!“
„Alle Zuschauer sind Schafe, oder.“
„Und sowas ist noch dazu ein hochoffizielles Auftragsstück zum Gedenkjahr 88, und dann sitzen sie alle in den roten Samtsesseln und sagen brav: Jawohl, Herr Bernhard, dankeschön Herr Bernhard ...“ Sie unterbrach sich, weil sie Robert grinsen sah. Das machte sie nur noch wütender. „Ja, der Herr Doktor versteht das natürlich viel besser. Gleich wirst du mir irgendeine unbewusste Bedeutung aufdecken. Aber ich habe auch studiert, falls du das vergessen hast, und da waren immerhin fünf Semester Germanistik dabei, und ich habe auch brav aufgepasst in der Schule, und ich weiß, dass im März 38 wirklich Hunderttausende Österreicher Hurra geschrien haben, wie der Hitler gekommen ist.“
„Na also.“
„Aber was bitte soll das bringen, fünfzig Jahre später auf alles schimpfen, wo Österreich jetzt doch ganz anders ist. Das nenne ich ewig gestrig. Verlogen ist das. Menschenfeindlich! Unglaublich anmaßend!“
Robert strich sich die Haare aus der Stirn und sah Mella interessiert von der Seite an: „Du bist ja echt in Rage. So habe ich dich nicht mehr gesehen, seitdem du mir im Seziersaal damals den Kopf gewaschen hast. Du gehst dem Bernhard übrigens genauso auf den Leim wie Millionen Kronenzeitungleser. Es ist doch ein Theaterstück! Es ist doch eine Figur, die hier schimpft, nicht der Dichter selber.“
„Trotzdem, das geht einfach nicht, andere Menschen so niederzumachen. Was wäre zum Beispiel, wenn ich –“
„Genau: Was wäre, wenn du. Dass du dich jetzt so aufregst, das ist der Stau von den Beschimpfungen, die du dir sonst verkneifst, oder. Der Bernhard hat diese Staumauer ein bissl angestochen, und schon kriegst du einen Tobsuchtsanfall. Katharsis, oder.“
Schlagartig sah sie ein, dass er Recht hatte. Da er nicht ihr Ehemann war, machte diese Einsicht sie nicht noch zorniger, sondern stimmte sie beinahe heiter.
„Oje”, seufzte sie. „Da bemüht man sich jahrzehntelang, sich in andere hineinzuversetzen. Bei den ewigen Streitereien mit Werner habe ich doch dauernd nachgedacht, ob ich nicht selber auf dem falschen Dampfer bin, und dann kommt einer daher, der schimpft einfach. Ja, eh der Professor Schuster im Stück, nicht der Bernhard, ich hab´s kapiert. Aber trotzdem. Er tyrannisiert die ganze Familie, aber ein Täter ist er nicht. Alle anderen sind die Schuldigen. Nur er nicht.“
„Alle anderen haben es überlebt. Nur er nicht.“
„Ja, stimmt eigentlich. Seine Anklagen werden ja die ganze Zeit posthum zitiert, weil er sich ja umgebracht hat. Vielleicht war er doch auch ein Opfer.”
„Er hat sich beim Fenster hinausgestürzt. Als Selbstmörder war er Täter und Opfer zugleich.“
Robert fand einen Parkplatz in der Brigittagasse. Mit einer Handbewegung zu den Fassaden aus den Siebzigerjahren zitierte er aus dem Bernhard-Stück: „Die Architekten haben alles zerstört/ Mit ihrem Stumpfsinn/ Die Intellektuellen haben alles zerstört/ Mit ihrem Stumpfsinn/ Das Volk hat alles zerstört/ Mit seinem Stumpfsinn – ich glaube, dass man Bernhard wie Musik hören muss, oder. Dieser Rhythmus, diese Refrains, man fällt fast in Trance.“
„Wie bei den Litaneien in der Kirche.“
„Diese endlosen Wiederholungen ...“
Er unterbrach sich, um seine Wohnungstür aufzuschließen. Drinnen schlüpfte Mella aus den Schuhen und machte es sich auf dem graublauen Ohrensessel gemütlich. Ihre aufgebrachte Stimmung war von einer vagen Betrübnis abgelöst worden.
„Bei mir ist das mit dem Umbringen hängengeblieben: Die Leute sagen, sie bringen sich um und bringen sich um ... die Leute bringen sich immer gegenseitig um ... die Eheleute bringen sich immer gegenseitig um, fragt sich nur, wer zuerst umgebracht wird ... Was ist, Robert? Was hast du?“
Bei ihren letzten Worten hatte er sich mit einer eckigen Bewegung von ihr abgewandt. Er beschäftigte sich umständlich damit, zwei Gläser mit Jack Daniels und Eis zu füllen.
„Ich habe ja schon am Telefon gesagt, dass ich in einer misanthropischen Verfassung bin.“
Seine Stimme klang brüchig. Er legte Tom Waits auf und lehnte sich schräg in seinen Sessel, stand auf, um noch einen Whiskey einzuschenken, rauchte im Stehen, stand schweigend am Fenster, räusperte sich, schluckte.
„Was sagst du eigentlich zu deinen Patienten in so einem Fall? Spucken Sie´s aus, oder was?“
Obwohl sie seit drei Jahren regelmäßig miteinander ausgingen, hatte Robert Mella verschwiegen, dass es eine Frau in seinem Leben gab, die er heiraten wollte. Der zurückhaltende Robert, dem man immer nachlaufen musste, der sich Annäherungen so ausdauernd entziehen konnte, Robert, dem sie auf einer kurzen gemeinsamen Italienreise den Spitznamen capriolo timido gegeben hatte, was soviel heißt wie scheuer Rehbock, dieser Meister im Abstandhalten hatte, wie er ihr nun enthüllte, über mehr als vier Jahre nichts unversucht gelassen, um eine gewisse Brigitte, die er wohl hingebungsvoll anbetete, zur Scheidung zu bewegen. Brigitte war, nebenbei bemerkt, neun Jahre älter als er, also bereits Mitte vierzig, und Mutter von drei Kindern sowie Gattin eines steirischen Bauunternehmers namens Helmut. Der Ehemann hatte schon länger von Brigittes Verhältnis zu Robert gewusst. Nach monatelangem Gezerre hatte Brigitte zu Roberts Freude endlich eine klare Entscheidung getroffen und Helmut eröffnet, sie wolle ihn verlassen, sie wolle zu Robert, koste es, was es wolle; worauf Helmut sich mit dem Tapeziermesser zwei Schnittwunden am Handgelenk zufügte; worauf Brigitte ihn schluchzend ins Meidlinger Unfallkrankenhaus fuhr, die Kinder zur Oma brachte, an seinem Bett wachte und eine klare Entscheidung traf, sodass die Eheleute wieder zueinander fanden, statt einander umzubringen; worauf Robert auf seiner großen Liebe sitzenblieb.
„Wer bitte“, sagte Robert schwerfällig, „wer ist hier das Opfer und wer der Täter?“
„Vielleicht ist es ja so wie bei den Vampiren. Wer einmal gebissen worden ist, wird selbst zum Blutsauger.“
Robert trank schweigend.
„Mit diesen Menschen muss man behutsam umgehen“, las Mella aus dem Programmheft vor, „aber die lassen einen das gar nicht.“
Seine Augen hatten rote Ränder.
„Ach Robert“, sagte sie. „Ach Robert.“
Er goss sich noch ein Glas ein, trank es in einem Zug aus, zog sie an der Hand zum Bett, legte den Kopf in ihren Schoß und schlief auf der Stelle ein. Sie betrachtete ihn und stellte fest, dass seine Brust ganz unbehaart war, sie musste ihm wohl drei Hemdknöpfe geöffnet haben. Vielleicht auch vier. Während sie in eine liegende Stellung glitt, nahm sie am Rand ihres Bewusstseins wahr, wie sich nach drei Klingeltönen Roberts Anrufbeantworter einschaltete.
Wie du mir, so ich dir
Als Ruth kurz vor halb acht die Treppe herunterkam, wusste Viktor, dass der Abend verdorben war. Gerannt war er in seiner kurzen Mittagspause, um Burgtheaterkarten zu sichern, hatte einen Tisch im Scarabocchio reserviert, hatte sich abgehetzt, um sie von zu Hause abzuholen. Wie so oft hatte Viktor sich um Ruth bemüht, und wie so oft waren seine Bemühungen in die Hose gegangen.
„Ach Menschenskind, du mit deinem Hochkultur-Spleen“, war ihre einzige Reaktion.
„Thomas Bernhard hast du doch immer interessant gefunden.“
„Sowieso, den Bernhard schon, aber doch nicht dieses ganze bourgeoise Getue, nur dass man sich hinterher aufgeilen kann an dem schlimmen Bernhard, der das schöne Nesterl so beschmutzt. Aber wo die anderen Spießer hinrennen, da musst du natürlich auch hinrennen. Wahrscheinlich ist der Hofrat Neusiedler auch dort, mit Gattin, und der Dr. Schmelzer und der Dr. Bergmann, mit Gattin, die halbe Anwaltskammer und die Ärztekammer, und da darf der Dr. Mangold nicht fehlen. Und wenn die in die Donau springen, dann springst du hinterher. Ich sehe wirklich nicht ein, warum ich mir das antun soll. Oder habe ich schon wieder Strafe verdient?“
Ruth spielte Theater, wenn sie sich wie ein schuldbewusstes Kind benahm, das meinte sie nicht ernst, soviel hatte Viktor schon verstanden. Sie schob ihr Kinn mit einem Ruck nach vorne, das passte ja gar nicht zu dem unterwürfigen Getue. Ein Sticheln und Stochern war das, um ihn aus der Reserve zu locken. Früher hatte ihn Ruths herausfordernde Koketterie unfehlbar heiß gemacht, sie neckte und lockte und entwand sich und tänzelte wieder auf ihn zu und entzog sich wieder, die Rangelei stand im Dienst der Verführung. Später aber konnte er, wenn er sekkiert wurde, wie ein Tier hinter Gittern nur mehr ein mattes Fauchen zustandebringen. Seit sechs Jahren, seit seiner Operation, nicht einmal mehr das.
„Aber nein, so war das doch nicht gemeint“, sagte Viktor steif.
Wenn Ruth sich in ihre hohntriefenden Tiraden hineinsteigerte, wusste er nie, wie er parieren sollte. Ihm fiel einfach nichts Passendes ein. Er stand stumm wie ein Haubenstock, ihre Worte prasselten, und er konnte ihnen nichts entgegensetzen. Viele ihrer plötzlichen Vorwürfe konnte er nicht schnell genug einordnen. Wenn sie zu sarkastischen Beschimpfungen griff, verstand er oft deren Logik nicht. Und beschleunigen konnte sie, von Null auf Hundert in wenigen Sekunden, sodass er sich manchmal vorkam, als hätte ihm ein Wirbelsturm aus heiterem Himmel die Kleider vom Leib gefetzt.
„Ich wollte dir ... ich finde einfach ... ich dachte, wir sollten wieder einmal etwas gemeinsam unternehmen“, sagte er.
„Ach, der Herr langweilt sich und wünscht unterhalten zu werden.“
„Darum geht es doch nicht. Aber wenn du fast jeden Abend wegen dem Turnverein unterwegs bist, dann –“
„Ah, da schau her, von daher weht der Wind. Hätte ich mir ja denken können. Klar, das ist dir ein Dorn im Auge, wenn mir einmal was Spaß macht.“
Jetzt sah sie ihn endlich an, um die Wirkung ihrer Worte einzukassieren.
Aber der kritische Punkt war schon überschritten. Viktor steckte die Theaterkarten in die Brusttasche seiner schwarzen Jacke und wandte sich ab.
„Dann kann ich ja gehen“, sagte er.
„Jetzt sei nicht so ein Mimose. Meine Güte, du verstehst auch gar keinen Spaß“, lenkte Ruth ein. „Von mir aus gehe ich halt mit, wenn dir gar so viel dran liegt. Geh, hol doch inzwischen den Wagen, der steht in der Lichtentalergasse, einen näheren Parkplatz habe ich heute nicht gefunden. Ja? Ich brauche noch ein paar Minuten.“
Viktor schaute zu Boden.
„Vergiss es. Du hast ja sicher ein viel besseres Programm für heute Abend.“
„Jetzt mache ich genau das, was du willst, und dann passt es dir auch wieder nicht!“
„Egal. Vergiss es.“
Viktor musste sich zurückhalten, um nicht laut zu werden.
„Oooch. Jetzt hab´ ich mich schon sooo gefreut.“
„Humbug.“
Sie wollte ihn wieder einmal an der Nase herumführen. Viktor war gewappnet. Obwohl sie mit ihrem Schmollmund reizend aussah.
„Oh ja, wirklich wahr. Gefreut hab ich mich. Ehrenwort.“
„Im Ernst?“
„Jetzt sei doch nicht so stur. Ich hab doch vorher nur einen Witz gemacht. Irgendwie verstehst du keinen Spaß. Kaum freue ich mich auf was, schon musst du mir den Spaß verderben. Wieso sollen wir nicht ins Theater gehen? Das ist wenigstens einmal ein Lichtblick.“
„Du willst mich doch nur für dumm verkaufen“, sagte Viktor.
„Also von dir lasse ich mir die Freude nicht verderben”, zischte Ruth. „Ich, weißt du, ich will auch noch ein bissl leben!“
Sie verließ den Raum hocherhobenen Hauptes.
Den Spieß umdrehen, das konnte Ruth perfekt. Am Ende war immer sie die beleidigte Unschuld. Tagelang diese verdorbene Atmosphäre im Haus. Man wusste nicht, worum es ging. Man konnte nichts dagegen tun. Viktor kannte das ja von seiner Mutter. Jeder Schritt, jedes Wort, jeder Atemzug konnte verkehrt sein. Diese Frau wurde ja immer schlimmer. Diese Frau hatte ja nur im Sinn, einen anderen Menschen zu vernichten. Oder bildete er sich das ein? Tagelang diese komische Atmosphäre im Haus, der Wirbel kam immer gänzlich unberechenbar, und dann dauerte es und dauerte, bis wieder Ruhe war.