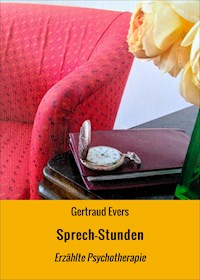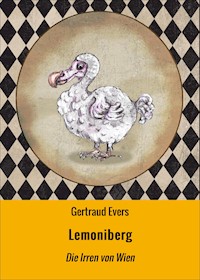
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Verrückt war sie schon immer, nach Nougat und Riesling, nach heftigen Gefühlen und dunklen Geheimnissen. Jetzt will sie die echten Verrückten verstehen. Als frischgebackene Ärztin beginnt Hanna Fließ 1982, in der Aufbruchstimmung der Psychiatriereform, ihre Arbeit am Lemoniberg – so heißt im Volksmund das Psychiatrische Krankenhaus am Rand von Wien, denn die goldene Kuppel der Anstaltskirche erinnert von Weitem an eine halbe Zitrone. Aus der Sicht der Anfängerin mit den zwei linken Händen entfaltet sich während ihres ersten Berufsjahres ein Bild der Psychiatrie von innen. Hannas romantische Ideale glänzen wie Gold, aber ihre Erfahrungen in der Stationsarbeit schmecken oft sauer. Und auf der Suche nach der großen Liebe landet sie immer wieder bei den falschen Männern. Mit einem Bein auf dem bürgerlichen Erfolgskurs, mit dem anderen in der freien Wildbahn, driftet sie in einen Spagat, der sie zu zerreißen droht. In einer verwunschenen Schrebergartenhütte am Rand der Anstalt findet sie in ihrer Not zum "Erkennungsdienst": Fünf wunderliche Gestalten, flüchtige Bekannte aus der Außenwelt, verwandeln sich für Hanna wie in einem Tagtraum in ein Team von inneren Helfern. Sie erwecken in ihr die Fähigkeiten, die sie braucht, um ihre Arbeit einigermaßen zu bewältigen und ein paar verflixte innere Knoten zu lösen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gertraud Evers
Lemoniberg
Die Irren von Wien
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Fehlstart
1 Ein schräges Schachbrett
2 Dilettanten und Mörder
3 Love In Vain
Tagebuch 5. Februar 1982
4 Das Schicksal mischt die Karten
5 Tun Sie sich nichts an
Tagebuch 16. Februar
6 Verirrte Zugvögel
Tagebuch 19. Februar
7 Es hat eh ein jeder seine Last
Tagebuch 21. Februar
8 Zwiebelparlament
Tagebuch 13. März
9 Rien ne va plus
Tagebuch 8. April
10 Wer lang fragt, geht lang irr
Tagebuch 14. April
11 Fremdsprachen
Tagebuch 17. April
12 Am Ort des Geschehens
Tagebuch 23. April
Tagebuch 24. April
13 „Nicht geschaffen für dieses Leben“
Tagebuch 15. Mai
14 Der Narren Ziel
Tagebuch 26. Mai
15 Glitschiges Terrain
Tagebuch 18. Juni
16 Die Zerfließende
Tagebuch 24. Juli
17 Am Gang
18 Verrückt
Tagebuch 13. August
19 Patientia
Tagebuch 17. August
20 Wir haben Pech
Tagebuch 21. August
21 Ich lieb dich nicht du liebst mich nicht
Tagebuch 22. August
22 Zurück zum Start
23 Eine wilde Saison
24 Martini rosato
25 Die Taube auf dem Dach
26 Tausend Rosen
Tagebuch 3. September
Tagebuch 5. September
27 Heimdrehen
Tagebuch 11. September
Brief 11./12. September
Tagebuch 16. September
28 Tischlein deck dich
Tagebuch 19. September
29 Bermudadreieck I
30 Bermudadreieck II
Tagebuch 1. Oktober
31 Abgängig
Tagebuch 5. Oktober
32 Ade
33 Mischwald
34 Derzeit freiwillig gestatteter Durchgang
35 Besser geht´s nicht
36 Erkennungsdienst
Tagebuch 7. Oktober
37 Exorzismus
Tagebuch 9. Oktober
38 Probanden
Tagebuch 17.Oktober
39 Beleidigt
Tagebuch 19. November
40 Feuer und Wasser
Tagebuch 14. Dezember
Tagebuch 15. Dezember
41 Artenvielfalt
42 Mea culpa
43 Everybody Has Won and All Must Have Prices
44 Man hat´s nicht leicht, aber leicht hat´s einen
Tagebuch 5. Jänner 1983
45 Nah am Wasser gebaut
Tagebuch 6. Jänner
46 Dodo Bird Verdict
Tagebuch 28. Jänner
47 Sachen gibt´s, die gibt´s gar nicht
Glossar: Medizinische Fachausdrücke
Glossar: Austriazismen
Impressum neobooks
Fehlstart
Es ist aus, bevor es richtig angefangen hat.
Ich schaue hinauf zur goldenen Kuppel. Heute ist Sonntag, ich habe frei, aber ich weiß einfach nicht wohin. Da ist mir das Irrenhaus auf einmal vorgekommen wie eine Zuflucht. Dabei habe ich hier im letzten halben Jahr so viel Angst aushalten müssen. Wie oft habe ich im Nachtdienst, wenn ich zu einem Notfall gerufen wurde, stumme Stoßgebete zur Kirche hinaufgeschickt. Da sitze ich nun, ganz oben am Lemoniberg, und bin am Tiefpunkt.
Aus der Nähe ist die Kuppel gar nicht golden, eher grünlich. Die Wiener sehen von Weitem keinen prachtvollen Jugendstilbau, sondern eine halbe Zitrone, deshalb nennen sie das Ensemble respektlos Lemoniberg. Ich aber schaue so flehentlich hinauf, als wohnte dort oben der Gott der Anstalt.
Ich kann nicht aufhören, an das Blut zu denken.
Wenn Leute vorbeikommen, um die Otto-Wagner-Kirche zu bewundern, senke ich schnell den Kopf. Auf dem Weg über die Serpentinen nach oben habe ich die ganze Zeit zu Boden geschaut und gehofft, dass ich niemandem begegne, der mich kennt. Ziemlich schwül ist es schon in aller Frühe, der Himmel bedeckt. Eine klagende Vogelstimme tutet unablässig wie eine kaputte Alarmanlage. Mir tut so der Schädel weh, sogar das trübe Licht ist mir zu grell, und dann nervt mich noch dieser Vogel mit seinem endlosen Lamento.
Von meinem Schlupfwinkel aus höre ich Leute reden, wahrscheinlich sitzen sie auf dieser Bank mit dem berühmten Ausblick über die ganze Stadt. Eine Frau schluchzt. Anscheinend ist sie ein Neuankömmling, ein Mann versucht sie zu beruhigen und erklärt ihr allerhand zum Aufenthalt in der Psychiatrie. Ein paar Wochen mehr oder weniger eingesperrt, sagt er, Alkoholverbot, nicht schön, aber jedenfalls besser als sterben.
Ich fröstle mitten im August. Sind das immer noch die Nachwehen von meinem Rausch am Freitag? Wie sich ein Kater anfühlt, das weiß ich natürlich, es war ja nicht die erste Sauftour mit Andreas und dem Höller. Aber diesmal habe ich den ganzen Tag danach nicht aufstehen können. Den ganzen Samstag bin ich im Bett gelegen, eine Mumie, mein Mund wie Schmirgelpapier, ich konnte mich kaum aufraffen, mir ein Glas Wasser zu holen.
Jetzt bist am Sand, hat der Höller in dieser Bar gesagt, es muss schon weit nach Mitternacht gewesen sein. Conny hat gar nichts mehr gesagt, nur geblutet.
Weit ist es mit mir gekommen. Ich bin das, denke ich, streiche über Rinde und Moos, am Boden hocke ich unter den Kiefern. Es riecht nach Harz. Pech, denke ich. Schwarzes Pech. Und Blödheit. Unverzeihlich. Und so was will Ärztin sein!
Auf dem Schotterweg zum obersten Pavillon taucht eine Gestalt im weißen Mantel auf, baumlang, schlenkernde Arme, unverkennbar Oberarzt Nobis. Das machen Sie doch mit links, hat er im ersten gemeinsamen Nachtdienst zu mir gesagt. Er kann ja nicht wissen, dass es daheim immer geheißen hat, die Hanna hat zwei linke Hände. Der Nobis, der ist ein Guter. Aber jetzt will ich ihm auf keinen Fall über den Weg laufen, womöglich spricht er mich auf die Nacht mit dem Suizid an. Ich verstecke mich hinter einem Hortensienstrauch wie ein Verbrecher auf der Flucht. Wie ein entwichener Patient. Ein Geräusch ganz in der Nähe schreckt mich auf, ein Flattern, da ist irgendein Tier im Busch! Auf einmal ist mein Gesichtsfeld verschwommen, als schielte ich, aber das tue ich nicht, ich habe sehr gute Augen. Obwohl sich das Tier ganz schwerfällig bewegt, kann ich es nicht richtig erkennen, das Bild flimmert, mir wird leicht schwindlig.
Der erste Blutstropfen unter Connys Auge wirkte künstlich wie Theaterschminke. Die Wunde sah unecht aus. Doch die rote Träne wurde zum Rinnsal, kroch über ihre Wange, tropfte zu Boden.
Ich schlinge die Arme um meine Knie und wippe wie die hospitalisierten Patienten, die schon jahrelang hier drin sind.
Wie konnte ich nur?! Wie um alles in der Welt konnte ich so etwas tun? Ich war das nicht, sage ich mir. Ich bin das nicht. Es war auch niemand anderer, aber ich war das nicht.
Was ich getan habe, das ist das Letzte. Das Allerletzte. Das ist schlimmer als die Sünden, die ich gebeichtet habe, als ich noch in die Kirche ging, daheim in Litschau. Selbstvorwürfe kreiseln in meinem Hirn ohne Ende, schlimmer noch als damals am Weihwasserbecken neben dem Beichtstuhl. Ich habe gesündigt, in Gedanken, Worten und Werken, aber ich sehe es ja ein, ich bereue es ja, ich bekenne es ja, der Lohn ist süße Vergebung, aber darin keimt schon wieder Schuld, die Sünde der Selbstgerechtigkeit, aber ich sehe es ja ein, ich gebe es ja zu, und schon wieder Überheblichkeit, weil ein kleiner Gedanke wispert, ich bin nicht wie die anderen, ich bin was Besseres, und schon wieder hinabgestoßen in den Abgrund, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt, und da hocke ich nun ganz unten und mache wimmernde Geräusche und wackle wie eine Verrückte.
Ich bin doch schon genug gestraft, denke ich wehleidig, es wird doch eh alles nichts, es wird nichts mit dem armen Felix Huld und mit der armen Milena Koller, es wird nichts mit Adrian, obwohl es so gut ausgeschaut hat am Anfang, und mit Leo wird es schon gar nichts, und Serge langweilt mich, mit dem wird es auch nichts. Mit Hermann, ach, keine Ahnung. Und Lilo macht sich eh die ganze Zeit nur über mich lustig, sie will lieber eine Freundin wie die Frau Doktor Tausendsassa, die alle so toll finden, mich übrigens eingeschlossen, ich bewundere sie und verachte sie zugleich, die ist nämlich wirklich überheblich, und schon wieder habe ich ein Urteil gefällt, das steht mir nicht zu, schon gar nicht nach diesem Ausbruch vorgestern, das Urteilen ist schon wieder die nächste Sünde, und das wird niemals aufhören.
Hier in der Psychiatrie bin ich jedenfalls ganz und gar fehl am Platz. Ich muss kündigen. Gleich morgen gehe ich zum Primarius Spinrad und sage ihm, dass ich hier nicht mehr arbeiten kann. Aus der Traum. Ich muss noch viel mehr an mir selbst arbeiten, werde ich sagen. Um verlorene Seelen zu retten, bin ich hier angetreten – na sicher, dafür bin ich ja genau die Richtige! Zum ersten Mal in meinem Leben streift mich der Gedanke, Schluss zu machen. Aber ich habe ja gar keine Ahnung wie. Ich habe eben überhaupt keine Ahnung. Genau wie Conny gesagt hat.
Ich kann nicht mehr.
Na dann sink halt zu Boden wie die Hysterikerinnen zu Freuds Zeiten, eine Hand am Busen, die andere an der Stirn, du bist so eine Drama Queen, du willst dich nur wieder interessant machen, sogar wenn gar keine Zuschauer da sind. Anderen geht es viel schlechter als dir. Mach nicht so ein Theater. An deiner Misere bist du ganz allein selber schuld.
1 Ein schräges Schachbrett
Von Weitem hatte ich die goldene Kuppel schon oft gesehen. Jedes Mal, wenn sich der Zug von Westen her dem Stadtrand von Wien näherte, machte ich mich am Fenster bereit, manchmal schon ab Eichgraben, spätestens ab Sanatorium Purkersdorf, um den Blick auf die Otto-Wagner-Kirche ja nicht zu verpassen. Nur kurz öffnete sich linkerhand eine unverbaute Schneise und gab die Sicht auf die bewaldeten Hügel der Baumgartner Höhe frei. Ganz oben, über den ordentlich aufgereihten Psychiatrie-Pavillons, erschien die leuchtende Halbkugel, ein gutes Omen, aber flüchtig wie ein Tagtraum, denn wenn ich nicht aufpasste, dann kam bereits die Station Hütteldorf und gleich darauf die Kennedybrücke, dann hatte ich es verpasst, das Leuchten.
Auch aus mittlerer Entfernung, während der Busfahrt an meinem ersten Arbeitstag, ließ sich die Kuppel nicht viel länger betrachten, wieder blitzte sie nur kurz auf zwischen Baumwipfeln, eine kontaktscheue Diva. Dabei hätte ich einen goldenen Leitstern gut gebrauchen können. In der Nacht zuvor hatte ich kaum geschlafen. Es war ein schneidend kalter Morgen, der Himmel wolkenlos, Kopfwehwetter. Eine Haltestelle Panikengasse fiel mir ins Auge, das passt, dachte ich. Danach zeigte sich auf einer kleinen Anhöhe die Niederösterreichische Jägerschule, Hirschgeweih an der Fassade, und dahinter: die goldene Kuppel.
An der Endstation der Buslinie 48A, Baumgartner Höhe, stieg ich aus. Weil ich viel zu früh dran war, studierte ich die Hinweistafeln am schmiedeeisernen Gittertor. Das Fotografieren innerhalb der Anstalt ist strengstens untersagt. Die Benützung des Anstaltsbereiches durch Kraftfahrzeuge erfolgt auf Gefahr des Benützers.
Der Pförtner wies mich zur Direktion, einem pompösen dreiflügeligen Verwaltungsgebäude mit Treppen und Säulen und Emporen. Auf dem Rasenstück davor stand eine Uhr, wuchtig wie ein Denkmal, flankiert von vier hohen Tannen, an denen Anfang Februar noch Lichterketten hingen, als wäre das ganze Jahr Weihnachten.
Nach einer kurzen Begrüßung durch den Direktor versammelte eine resolute ältere Ärztin uns Neulinge rund um die monumentale Uhr, um uns durch das Anstaltsgelände zu führen. Sie sei die Vera Stipsits, arbeite in der Psychotherapie-Abteilung bei Oberarzt Nobis und befinde sich seit drei Jahren in der Facharztausbildung. Die schaut nett aus, dachte ich, erleichtert darüber, dass ich mich nicht ganz allein zurechtfinden musste.
„Wir sind hier genau in der Mitte“, erklärte Dr. Stipsits. „Falls Sie sich verirren, können Sie sich immer an der Kirche orientieren, da haben Sie die Mittelachse, genau oberhalb der Direktion das Jugendstiltheater, darüber die Hauptküche, und ganz oben die Anstaltskirche.“
Wie die anderen frischgebackenen Ärzte legte ich den Kopf in den Nacken, als wären wir alle eine Gruppe folgsamer Touristen.
„Oder Sie fragen einfach einen Patienten nach dem Weg zur Trafik, den kennen sie alle, Zigaretten sind hier eine beliebte Währung. So finden Sie jedenfalls den Ausgang, und neben der Trafik sehen Sie den Friseur und das Lebensmittelgeschäft. In Zukunft soll da übrigens ein Patientencafé entstehen. Also herzlich willkommen im Psychiatrischen Krankenhaus Am Steinhof! Ach so, wollen Sie sich vielleicht gleich vorstellen?“
„Gabriel Fomin“, sagte ein untersetzter Mann mit einem schwarzen Zottelbart und deutete eine Verbeugung an.
„Ich!“ Ein Kollege mit lustigen Augen hob die Hand. „Ich bin Adrian. Adrian Hollunder, mit Doppel-L.“
Hatte er mir tatsächlich zugezwinkert?
„Ich darf dann weiter vorstellen“, sagte Vera Stipsits. „Das sind Frau Dr. Lieselotte Pelikan und Frau Dr. Hanna Fließ –“
„Lilo bitte!“, rief die Kollegin Pelikan ganz ungeniert.
„Also Lilo, okay, Hanna Fließ, und hier die Doktores Peter Simandl und Hermann Bittner.“
„Wieso heißt das hier eigentlich Steinhof“, fragte Hollunder, „wir sind doch auf der Baumgartner Höhe, oder?“
Ich wunderte mich, wie ungezwungen die Kollegen sich zu Wort meldeten. Die waren offenbar nicht so nervös wie ich.
„Früher hat es hier Steinbrüche gegeben“, erklärte Vera Stipsits, „und die Lager für die Steine wurden eben Steinhöfe genannt. Und damit es noch ein bissl verwirrender wird: Das Gebiet hier hat den Flurnamen Spiegelgrund. Aber jetzt reicht´s mit den Namen. Kommen Sie!“
Adrian Hollunder steuerte flink an meine Seite und fragte mich, woher ich komme. Aus dem Waldviertel, aha, und wo genau ich aufgewachsen sei, ah, an der tschechischen Grenze. Er stamme aus der Steiermark, fühle sich aber eigentlich wie ein echter Wiener. Das sei schön für ihn, antwortete ich. Er liebe die Wiener Kaffeehäuser! Ob man sich da einmal treffen könne? Er sei ja unglaublich gut aufgelegt in aller Frühe, sagte ich und schaute ihn von der Seite an. Unter seinem linken Auge saß ein winziges Muttermal.
„Der Laie stellt sich das Irrenhaus vielleicht wie ein Labyrinth vor“, sagte Vera Stipsits, „aber es hat eher eine Ähnlichkeit mit einem Schachbrett, jedenfalls von den Gebäuden her, die sind fast militärisch streng angeordnet, aber halt in Terrassenform, entsprechend dem ansteigenden Terrain, also eigentlich ein schräges Schachbrett.“
Ich bemühte mich, mit der Führerin Schritt zu halten, um keine ihrer Erläuterungen zu verpassen. Eine asphaltierte Straße führte in langgezogenen Serpentinen den Hügel hinauf, umgeben von parkähnlichen Grünflächen. Die schütteren Wiesen waren von Raureif überzogen, verdorrte Blätter trugen silbrige Borten, Maulwurfshügel glitzerten in der Morgensonne. Kiefern mit schwarzweiß gefurchten Stämmen ragten hoch, dazwischen standen dürre Sträucher und rostige Stangen zum Teppichklopfen. Es war ganz still, wir begegneten keiner Menschenseele. Einmal hörte ich ein Rascheln und sah aus den Augenwinkeln eine Bewegung im gefrorenen Laub, ein graubraunes Geschöpf, für einen Igel zu groß, für einen Hasen zu langsam.
„Gibt´s denn hier wilde Tiere?“, fragte ich die ortskundige Kollegin.
„Aber wo“, Dr. Stipsits schüttelte den Kopf. „Der Steinhof ist ein beliebtes Naherholungsgebiet“, sagte sie, und ich fragte mich, wie ernst sie das meinte.
Auf Schotterwegen gelangten wir zu den Pavillons, dreistöckigen rostroten Klinkergebäuden mit Flachdächern. Die hohen Fenster waren durch elegant geschwungene Sprossen unterteilt. Diese schönen Bögen seien nichts anderes als eine freundliche Verkleidung der darin eingebauten Metallgitter, erklärte Vera Stipsits. Über die gesamte Höhe des ersten Stockwerks zog sich bei den meisten Häusern eine vergitterte Veranda, die mich an die Raubvogel-Volière im Tiergarten Schönbrunn erinnerte. Die Pavillons lagen so in das Gefälle der Terrassen hineingeschmiegt, dass man beim Aufstieg jeweils die Rückseite der einzelnen Gebäude zu Gesicht bekam. Deren Hintertüren führten zu umzäunten Gärten. Erst nach der nächsten Wegbiegung erreichte man die Haupteingänge eine Etage höher. Die verglasten Eingangstüren, cremeweiß gestrichen, trugen goldene Messinggriffe und Gitter mit floralen Ornamenten. Über den Ordnungsnummern in graugrünen Jugendstilziffern waren zierliche verglaste Schutzdächer aufgespannt.
Ein Kollege nach dem anderen wurde an seinem künftigen Arbeitsplatz abgeliefert, jedem wünschte Dr. Stipsits einen guten Start, und das war bestimmt ernst gemeint. An der Tür des Pavillons, der als Drogenabteilung gekennzeichnet war, entdeckte ich eine Bedienungsanleitung, die in einer Klarsichthülle steckte. Lilo Pelikan blieb stehen und las vor: „Wie öffnet man diese Türe! Es findet sich ein weißer Druckschalter an der linken Seite! Drücken Sie diesen und gleichzeitig ziehen Sie an der Türe! Die Türe öffnet sich! Sie haben es geschafft!!! Die Türe will sich nicht öffnen: Drücken Sie die Türe nach innen, ruhig ein paar Mal, aber bitte mit Gefühl, warten Sie einige Sekunden! Drücken Sie den Druckschalter und gleichzeitig ziehen Sie an der Tür! Falls sich die Tür nicht öffnet, versuchen Sie das erneut! Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!!! Bei Störung rufen Sie bitte Telefonnummer 01/80 050 208.“ Die Anleitung war so angebracht, dass die Leserin immer wieder den Kopf verdrehen musste, da die verschnörkelten Gitterstreben Textteile verdeckten. Daneben klebte ein Fensterbild, das einen Nikolaus mit Bischofsstab und einen Krampus mit Rute zeigte.
„Anscheinend ist es ein Kunststück, hier hineinzukommen“, sagte ich. „Ich hätte eher geglaubt, es sei schwer, aus der Psychiatrie herauszukommen.“
„Das war ja wirklich so, jahrzehntelang“, sagte Dr. Stipsits. „Früher waren es bis zu dreitausend Patienten, schlimme Zustände, das waren noch ganz andere Zeiten. Seit seiner Gründung 1907 war das Krankenhaus immer wieder überfüllt, das war schlimm, aber wenn die Patientenzahlen zurückgegangen sind, war das auch schlimm, Hunger, Tuberkulose, Krieg, Deportation, Euthanasie. Ich sage nur Spiegelgrund. Siebenhundert ermordete Kinder. Zurzeit sind hier rund tausendfünfhundert Patienten untergebracht. Seit 1979 die Psychiatriereform eingeleitet worden ist, hat sich schon einiges geändert. Stichwort ambulante Betreuung. Psychosozialer Dienst. Spannende Zeiten. Aber leichter wird die Arbeit nicht, sage ich Ihnen. Eher im Gegenteil.“
Auf der nächsthöheren Terrasse entdeckte Lilo Pelikan einen Tennisplatz. Sektion Tennis für Bedienstete stand auf einem Schild am Gitterzaun. Im Gras daneben bemerkte ich ein paar violette Flecken. Veilchen im Februar?
„Da drüben rechts ist der Pavillon 23“, sagte Dr. Stipsits. „Den werden Sie im Nachtdienst mitbetreuen müssen. Geisteskranke Rechtsbrecher. Früher war das einmal eine Arbeitsanstalt für sogenannte asoziale Frauen. Dann ein paar Monate ein Konzentrationslager, dann ein Polizeigefängnis, und seit ein paar Jahren ist hier eben die Abteilung für forensische Psychiatrie.“
Den Pavillon umgab eine vier Meter hohe Mauer, auch sie, wie offenbar jeder Quadratzentimeter in diesem Areal, mit Ornamenten geschmückt. Ein paar Schritte weiter, am Waldrand, tauchten ein paar Schrebergartenhütten auf. An einem Kiefernstamm hing ein Plakat. Richtig verhalten! Kein Feuer anzünden! An der nächsten Wegbiegung kam die Kirche in Sicht.
„Das soll eine Kirche sein?“, fragte Lilo Pelikan. „Die Engel sind schon schön, aber sonst schaut das eher aus wie ein Gefängnis. Alcatraz für geisteskranke Rechtsbrecher.“
Aus der Nähe betrachtet ragte das Bauwerk tatsächlich überraschend hoch auf, martialisch wirkten die strengen horizontalen Goldstreifen in den Marmorwänden, und die Luken unter dem grüngoldenen Dach waren schmal wie Schießscharten.
„Von Weitem hat das wie ein Luftschloss ausgesehen“, sagte ich. „Aber von hier aus wirkt es eher wie eine Festung.“
„Unsere Anstaltskirche zum Hl. Leopold ist ja tatsächlich gepanzert, mit Platten aus Carrara-Marmor“, sagte Vera Stipsits. „Wenn Sie Zeit haben, schauen Sie sich einmal den Innenraum an. Der Architekt, also Otto Wagner, hat sich allerhand praktische Tricks einfallen lassen, um eventuelle Schwierigkeiten mit den Verrückten im Gottesdienst zu berücksichtigen. An den Weihwasserbecken hat er Tropfenspender angebracht, wegen der Infektionsgefahr. Der Fußboden ist schräg, damit er leichter gereinigt werden kann. Und Schönheit kann ja nicht schaden, hat er sich wahrscheinlich gedacht, die tut bestimmt auch den Irren gut.“
Vor dem rechten Seitenflügel der Kirche stand eine Bank. Ich wunderte mich darüber, dass sie nicht der Aussicht über die Stadt, sondern dem Bauwerk zugewandt war. Der Mann, der dort saß, konnte nichts anderes sehen als eine zugemauerte Tür, umkränzt von goldenen Verzierungen. Als wir an ihm vorbei Richtung Pavillon 29 gingen, drehte ich mich, ich wusste gar nicht, wieso, nach dem Mann um. Er hob den Arm und winkte mir zu, dabei verrutschte sein Schal und enthüllte einen weißen Stehkragen.
Im Pavillon angekommen, verabschiedete sich Lilo Pelikan im Treppenhaus und stieg zu ihrem künftigen Arbeitsplatz in den ersten Stock hinauf. An der Tür zur Akutstation im Erdgeschoß sagte Dr. Stipsits zu mir: „Ich bin die Vera, wenn du was brauchst … Du hast dich ja schon bei der Anmeldung für Psychotherapie interessiert, deswegen kommst du zum Primarius Spinrad, da kann ich dir nur gratulieren.“
2 Dilettanten und Mörder
Empfangen wurde ich nicht vom Primar, sondern vom Leiter des Pavillons, einem straffen Mittfünfziger mit Raubvogelgesicht, auf dessen Namensschild OA Dr. H. Lederer stand, und von einem Arzt, der nur wenig jünger sein konnte als sein Vorgesetzter. Sie saßen beim Frühstück im Schwesternzimmer.
„Da Sie ein sehr nettes Mädchen zu sein scheinen“, sagte der Oberarzt und wechselte einen Blick mit seinem grauhaarigen Kollegen, „sind Sie hier natürlich sehr herzlich willkommen.“
Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, dabei öffnete und schloss er seine Beine wie die Schenkel einer Schere. Mir war noch kein Platz angeboten worden. Ich schob die Hände in die Taschen meines frischen weißen Mantels, tastete links nach dem Stethoskop und rechts nach dem Reflexhammer und dem Stauschlauch.
„Sind Sie wirklich schon mit dem Studium fertig? Sie schauen so jung aus“, sagte Lederer.
„Was man von mir nicht behaupten kann“, sagte der zweite Arzt, „früh gefreit, spät berufen! Siegfried Reiher mein Name. Hier auf der Akutstation haben wir alle Hände voll zu tun, da können wir Ihren jugendlichen Schwung bestens gebrauchen, Frau Doktor …“, er beugte sich vor und las mein Namensschild, „Fleiß, ah, Fließ.“
Beim Lächeln vertieften sich die Kerben in seinen Wangen. Er hatte was von einem Dressman.
„Jetzt trinken Sie als Erstes in Ruhe einen Kaffee mit uns“, sagte er, „damit wir uns ein bissl kennenlernen.“
Reihers Kopf mit bauschig geföhnter Frisur und Pilotenbrille wirkte zu groß im Verhältnis zu seiner schmächtigen Gestalt. Er hielt mir eine Packung Benson&Hedges hin.
„Und wann lerne ich die Patienten kennen?“, fragte ich.
„Gemach, gemach, um elf machen wir Modenschau“, Reiher grinste. „Visite, meine ich. Wird dann eh anstrengend genug, wir haben gerade einen Belag von über vierzig Patienten. Jetzt setzen Sie sich hin, seien Sie nicht so ungemütlich.“
Kaum hatte ich meine Zigarette angezündet, wurde ich von der Eckbank verscheucht. Eine rundliche Krankenschwester, die den Ärzten beim Geschirrabtrocknen den Rücken zugewandt hatte, drehte sich um und sagte zu Dr. Reiher: „Das war eigentlich bis jetzt immer mein Platz. Obwohl ich eh nie Zeit zum Kaffeetrinken habe.“
Ich sprang erschrocken auf.
„Na geh, Elfriede, die neue Frau Kollegin weiß es halt noch nicht“, sagte Dr. Reiher.
Schwester Elfriede musterte mich von oben bis unten. „Die haben sich in der Kleiderkammer mit der Größe vertan“, sagte sie, weiterhin an Reiher gewandt. „Der Dienstmantel von der Frau Doktor ist ja viel zu eng“, und daraufhin zu mir: „Sie brauchen nicht glauben, dass das schön ausschaut.“
Ich zog den Kopf ein. Verstohlen öffnete ich die Druckknöpfe. Reiher trug seinen Mantel auch offen über der Alltagskleidung, sein roter Gürtel war mir schon ins Auge gefallen.
Zu den Ärzten gesellte sich bald der Psychologe Josef Unterberger. Sogleich lud er mich in sein Zimmer ein.
„Komm, wir quatschen ein bissl. Du musst aufpassen, weißt du“, sagte er mit gedämpfter Stimme.
Ich sei eine von den Mitleidigen, das sehe er auf den ersten Blick. Durch allzu viel Engagement könne man es sich aber mit dem Pflegepersonal verscherzen, die Gefahr sei das Helfersyndrom, man werde ausgenutzt und überfordert, und dann sehe man keinen anderen Ausweg mehr, als am Ende alles zu verweigern. Beim Primar Spinrad könne man viel lernen. Früher habe es Gruppentreffen beim Primar gegeben, in seiner Wohnung, schwärmte Unterberger, für Ärzte, Psychologen und Studenten, zweimal pro Woche, und einmal im Monat habe der Primar einen blühenden Psychotiker vorgestellt. Er sei der Joe, sagte Unterberger leise und strich mit allen fünf Fingern durch seinen Bart, wenn ich etwas brauche, seine Tür sei immer offen.
„Komm“, sagte Joe, „nur keine Angst.“
Er fasste mich am Ellbogen und führte mich auf den langen gefliesten Korridor hinaus, um mich mit einigen der Patienten bekanntzumachen. Ein mongoloider junger Mann kam auf mich zu und zeigte mir stolz ein Blatt, das er mit Großbuchstaben vollgeschrieben hatte.
„Hansi“, sagte er und deutete auf seine Brust.
Ein ausgemergelter Patient namens Erich Reiser redete auf zwei Frauen ein. Die eine schüttelte den Kopf und sagte „Geh hör auf“, die andere fauchte ihn an. „Du verstehst doch nie was!“
Reiser ging auf mich zu. „Ich brauche jemand, der mich versteht“, sagte er.
Hansi begann zu weinen, weil die beiden Frauen über sein Schriftstück lachten, trottete dann zu Schwester Elfriede, die am Gang die Aufsicht führte, und schmiegte sich an ihren Busen.
„Den hab´ ich gern“, sagte die Schwester und strich ihm über den Kopf.
Ein düsterer Mann mit einem harten Akzent sagte zu mir: „Dass finden zu mir, Ding der Unmöglichkeit.“
Neben der Patiententoilette zappelte ein dürrer alter Mann herum und warf immer wieder wild seinen Kopf zurück, mit einer Miene, als hätte er in eine Zitrone gebissen.
„Pfleger Harry!“, kreischte eine Frauenstimme, „Pfleger! Pfleger Harry!“
Ein junger Krankenpfleger mit Hasenzähnen kam aus der Küche. Er trug ein Tablett mit Plastikgeschirr. Ein weißes Tuch, Bettzeug oder Nachthemd, hatte er wie einen großen Latz umgebunden, hinauf bis zum Hals und über beide Arme. Um mich zu begrüßen, wedelte er mit dem freien Arm, das Leintuch flatterte gespenstisch. Er müsse eine bettlägerige Patientin ausspeisen, sagte er, die sei unruhig, die könne nicht warten.
Ich trat etwas zur Seite, weil ein weißhaariger Mann direkt auf mich zuging. Wer ihm entgegenkam, schien ihn nicht zu interessieren, er schaute nur auf den Boden, als habe er dort etwas verloren. Der Psychologe an meiner Seite ging ungerührt weiter. Kurz vor dem Zusammenstoß stoppte der Patient abrupt und verbeugte sich mehrmals. Er trug ein Plastiksackerl mit der Aufschrift Billa fördert moderne Kunst. Joe Unterberger nahm keine Notiz von ihm. Für ihn ist das anscheinend normal, dachte ich, der Mensch gewöhnt sich anscheinend an alles. Auf meine Frage, wie der Mann heiße, sagte Unterberger schmunzelnd, er werde von allen nur Herr Billa genannt.
„Diese Mörder!“, ertönte eine Frauenstimme. „Man wird ja ignoriert. Man wird ja brutal abgewürgt. Diese Sadisten! Dilettanten und Mörder!“
Das sei Beate Schutting, sagte Unterberger leise und verzog dabei den Mund seitlich in meine Richtung. Man müsse sich hüten, diese Patientin anzusprechen, die werde man nicht wieder los.
„Ein Verbrechen ist das“, zeterte Frau Schutting. „Was für ein Horror! Und heutzutage? Immer das Gleiche! Der Patient selbst findet den Grund. Und die Ärzte? Nichts als Scharlatane. Mörder!“
Trotz Unterbergers Warnung blieb ich stehen und lauschte gebannt. Die zornige Frau saß steil aufgerichtet neben der Ausgangstür, sie trug einen dunkelblauen Hosenanzug und schimpfte pausenlos, anscheinend ohne sich um Zuhörer zu scheren. Ich nickte ihr zu. Frau Schutting balancierte reglos eine Zigarettenspitze in der steif erhobenen Hand, nur ihre Augen zuckten kurz seitwärts, prüfend, so kam es mir vor, als wolle die Patientin mich mit diesem Blick testen, während sie weiter ihren vorwurfsvollen Monolog herunterratterte.
„Sie können doch gar nichts. Sie sind doch unfähig. Dilettanten. Zauberlehrlinge. Seelenmörder! Schleichts euch! Mich umbringen lassen, von denen? Ha! Was geht´s mich an. Ich habe alles gesagt. Mit solchen Mördern habe ich nichts zu tun!“
Pfleger Harry bat mich, eine verwirrte alte Patientin im Wachsaal zu untersuchen. Ihr sei schon wieder schlecht, und der Internist werde erst nächste Woche erwartet.
„Grüß Gott, ich bin die Frau Doktor Fließ. Und Sie sind Frau …?“
„Promona“, sagte die Frau und lächelte.
„Also, Frau Promoner, was für Beschwerden haben Sie denn?“
„Promona“, sagte die Alte. Sie lächelte listig.
„Ja, das ist Ihr Name. Also was kann ich für Sie tun? Haben Sie irgendwo Schmerzen?“
„Promona.“
„Sie sagt nie was anderes“, schaltete sich Pfleger Harry ein. „Wir wissen nicht einmal, wie sie heißt. Sie ist im Trillerpark aufgegriffen worden, ziemlich verwahrlost. Hat anscheinend im Freien übernachtet. Wir haben gehofft, dass sich vielleicht Angehörige melden. Sie macht immer wieder so ein Gesicht, wie wenn ihr schlecht wäre, und mit der Hand macht sie so Kreise am Kopf und am Magen.“
Ich prüfte Puls und Blutdruck, tastete den Bauch der Patientin ab, alles unauffällig. Ich murmelte ein paar beruhigende Floskeln, sonst fiel mir nichts mehr ein. Dann wurde ich zur Visite gerufen und folgte eilig dem Tross der Weißgekleideten, der vom Schwesternzimmer über den Gang zum Tagraum und zum Wachsaal pilgerte.
Die meisten Patienten blieben stumm, es redete vor allem der Oberarzt. Er ließ sich von der Stationsschwester Helga kurz berichten, wie sich die Patienten so machten, und ordnete hie und da eine andere Dosierung der Medikamente an. Um Frau Schutting machte er einen Bogen, aber sie fuchtelte mit ihrer Zigarettenspitze in seine Richtung und setzte ihre Rede mit erhöhter Lautstärke fort.
„Ich bin doch kein Hamsterrad!“, rief sie. „Wiederholungseffekt. Therapie vorbei, abgehakt, wie damals, wie früher. Kennt man ja schon. Dann wieder Depression. Nicht wissen, was wie warum. Dann noch einmal Therapie. Das ist ja der Albtraum. Man wird in ein Schema hineinmanövriert. Solche Armutschkerln. Solche Dilettanten! Ewige Zeiten Horror. Falsch gedacht. Sie sind das Hamsterrad. Was für ein Image. Arrogante Wurschtln. Sie können doch gar nichts! Was geht’s mich an!“
Da verstummte selbst der Oberarzt, zuckte die Achseln und zog mit seiner Entourage an der Patientin vorbei wie auf der Flucht. Eine junge Patientin im Schlafrock kam aus dem Tagraum und drängte sich in Dr. Reihers Nähe.
„Bitte, Herr Doktor“, jammerte sie, „bitte bitte bitte Herr Doktor!“
Der Arzt schüttelte den Kopf, fasste die Frau an den Schultern, drehte sie um und schob sie in den Tagraum zurück.
„Gemach, gemach“, sagte er. „Alles zu seiner Zeit, nicht wahr.“
Schließlich landete die Visite im Wachsaal bei den bettlägerigen Patienten. Einen alten Mann hörte ich schon von Weitem keuchen, er brachte kein Wort heraus, zupfte hektisch an seiner Bettdecke. Herr Aschenbrenner, Pneumonie und Lungenödem, sagte Dr. Reiher. Ich erkundigte mich nach dem Behandlungsansatz.
„Je einfacher, desto besser“, sagte Reiher. „Das ist viel Gefühlssache, nicht wahr. Manchmal muss man sie einfach in Ruhe sterben lassen.“
Plötzlich Aufruhr auf dem Gang, flackerndes Blaulicht vor der Glastür, zwei Polizisten eskortierten einen schmächtigen Mann, der sich verstört umsah. Er trug weder Mantel noch Schal, nur einen zerknitterten dunklen Anzug. Bruno Bürger, 48 Jahre alt, sei in der vergangenen Nacht am Westbahnhof aufgegriffen worden. Selbst- und Fremdgefährdung. Der Amtsarzt habe die Zwangseinweisung angeordnet.
„Hopp hopp, Frau Doktor, Ihre erste Aufnahme“, sagte der Oberarzt. „Die Diagnose ist ja wohl offensichtlich.“
Während sich Schwester Helga und Pfleger Harry um die Formalitäten kümmerten, kam eine sehr dicke Frau auf mich zu.
„Das ist ein schöner Rock mit Schmetterlingen“, sagte sie und beugte sich vor, als wolle sie den Stoff anfassen.
„Entschuldigung“, murmelte ich und flüchtete auf die Personaltoilette.
3 Love In Vain
Der neue Patient wurde ins Ärztezimmer gebracht. Ich hatte mir aufgeschrieben, worauf bei einem Aufnahmegespräch zu achten war, und hatte auf der Toilette hastig meine Notizen überflogen. Mit einem Händedruck begrüßte ich den Mann und stellte mich vor. Er wühlte in den Taschen seiner schlotternden Jacke und hielt mir seinen Reisepass hin.
„Bruno Bürger“, las ich vor, „geboren am 23.11.1934. Aha. Das sind Sie also.“
„Das sind Sie, ha! Alles falsch. Alles umsonst.“
Ich erlaubte ihm zu rauchen. Ich war so aufgeregt, dass ich ebenfalls eine Zigarette brauchen konnte. Weil der magere Mann in seinem dünnen Anzug zu frieren schien, bat ich Pfleger Harry, der mich begleitet hatte, ihm einen Tee zu bringen.
Bruno Bürger schaute auf seine Knie hinunter und murmelte ausländisch klingende Wörter, mit denen ich nichts anfangen konnte. „Warszawa Wschodnia. Lodz Widzew, Warszawa Wschod. Krakow, Jan Kiepura …“
„Herr Bürger. Das verstehe ich leider nicht. Was ist denn überhaupt passiert? Sie waren also am Westbahnhof – “
„Die Züge“, unterbrach er mich, „die Züge. Vom Westbahnhof nach Osten. Die Züge nach Polen. Die Züge nach Russland. Der letzte Nachtzug nach Prag heißt Phönix. Ein schlechtes Zeichen.“
„Ein schlechtes Zeichen?“
„Da stimmt doch was nicht!“, rief Bürger. „Die Triebwagen halten mit der Nase zur Wand! Dann im Rückwärtsgang aus dem Bahnhof hinaus! Das geht doch alles in die falsche Richtung! Alles verkehrt!“
Die halbe Nacht im Freien, überlegte ich, eine frostige Februarnacht, und auf der Polizeistation in der Rossauer Kaserne hatte der Mann bestimmt nicht geschlafen. Ich fand es verständlich, dass er auch im geheizten Zimmer noch fröstelnd die Arme um sich schlang. Aber was sollte es bedeuten, dass er sie immer wieder ausbreitete wie ein Prediger? Die Handflächen präsentierte er, als trügen sie Wundmale. Dabei rauchte er pausenlos.
Harry hatte ein Häferl mit Hagebuttentee auf den Tisch gestellt. Diese Einfahrt der Züge sei doch normal, sagte er beiläufig, Wien West sei doch ein Kopfbahnhof.
„Es ist trotzdem falsch“, regte sich Bürger auf. Seine linke Hand presste er an die Schläfe, in der rechten, dicht an seiner Lippe, zitterte die Glut. „Es geht um die Zugvögel! Die Zugvögel, die sind in die falsche Richtung geflogen, wochenlang! Ein einziges Chaos! Die Lisbeth versteht das nicht. Muss immer meckern. Du kannst nicht schon wieder den Unterricht ausfallen lassen! Du riskierst ein Disziplinarverfahren! Naturgeschichte-Unterricht. Als ob das noch was ändern könnte.“
„Sie haben also als Lehrer gearbeitet und –“
„Ein roter Abend. Und blau. Der Zug ist abgefahren. Der letzte Zug. Das dröhnt so bei der Abfahrt. Die dummen Leute können sich nicht trennen, die picken an den Waggons wie Insekten, die müssen abgeschüttelt werden. Was soll man da machen? Lächerliche Menschenkinder. Flüchtlinge, wollen noch mit ins Boot. Der Zug ist ein Irrläufer. Alles falsch.“
„Herr Bürger –“
„Mit dem Fahrplan stimmt doch was nicht. Man muss schnell umsteigen, höchste Zeit, die Putzkübel sind ja rot und blau, der Anschluss wird verpasst, die Uhr ist eine Weltkugel, ein Zeiger rot, ein Zeiger blau, fahrplanmäßig 23.07 Schwechat Fluch, nein Schwechat Flughafen Zugvogelflughafen Fluchtvogel Fluchthafen nur noch ein Fluchtzug Kálmán Imre Budapest Gleis 7 –“
„Herr Bürger.“ Ich verstand nur Bahnhof. „Herr Bürger.“ Ich sah ratlos zu Harry hinüber. Mir fiel nichts Besseres ein, als ganz normal nach den Koordinaten der Realität zu fragen. Wann er den Westbahnhof betreten habe. Gegen elf in der Nacht. Von wo er gekommen sei. Von daheim. Wo er sich aufgehalten habe.
„In der unteren Halle haben sie ein Blumengeschäft. Da steht Kaufen Sie Ihrer Frau Blumen, bevor es ein anderer tut, ha! Eine Polizeiwache haben sie da auch, direkt daneben eine Statue, die Kaiserin Elisabeth, so heißt meine Frau, was für ein Hohn. Ein schlechtes Zeichen.“
„Und was hatten Sie eigentlich vor am Westbahnhof? Wollten Sie irgendwohin fahren?“
„Irgendwohin“, Bürger hustete, „es geht doch alles in die falsche Richtung. Wo ich hin will, das hat der Bärtige auch gefragt. Wieder orange, wieder Zigarette.“
„Moment, wer –“
„Macht mich nach. Der Gleisarbeiter. Billige Kopie. Wohin ist die falsche Frage. Die legen mich auf den Ort fest. Nein nein nein, es gilt Zeit vor Ort. Die Jahreszeit für die Zugvögel. Alles in die falsche Richtung, verkehrt und vergeblich. Man muss Zigaretten kaufen, Kopfweh vom Nikotinmangel, da hilft kein Togal, schlafen heißt nicht rauchen, ich darf nicht mehr schlafen, der Bärtige mit so einer orangenen Uniform hat sich die Zigarette angezündet, im gleichen Augenblick wie ich, ein schlechtes Zeichen. Die sind wieder hinter mir her, weil ich sie durchschaut habe.“
Harry erwähnte, den Polizisten zufolge habe Herr Bürger darauf beharrt, er müsse den ungarischen ICE markieren, planmäßige Abfahrt 23.25 Uhr. Ja, markieren. Bürger habe sich mit ausgebreiteten Armen und Beinen an die Front der Lokomotive gepresst.
„Herr Bürger, wollten Sie … wollten Sie sich womöglich was antun?“ Wenigstens die fragliche Suizidalität musste ich abklären, danach würde der Oberarzt bestimmt fragen.
„Die wollten mir was antun! Bruno Bürger ICE Gleis 7 umlegen, das kam aus dem Lautsprecher! Die Durchsage war Zugführer, sagen sie jetzt, das ist gelogen, Bruno Bürger, das bin ich, die meinen mich, die beschatten mich, die wollen den ICE verkehrt losfahren lassen, die wollen mich umlegen, ich muss es jetzt verhindern läuft alles verkehrt läuft alles im Arsch alles falsch!“
Bürger legte den Kopf in den Nacken und musterte angestrengt die Zimmerdecke, die rechte Hand mit der roten Glut über die Augen gewölbt, als müsse er sie gegen grelles Licht beschatten, die linke an der Schläfe. Er schüttelte ausgiebig den Kopf.
„Keiner versteht den Fahrplan. Die Zeit vergeht.“ Wieder breitete er die Arme aus und brummte: „When the train left the station …”
„Die Stones“, sagte Harry. „Love in Vain“.
Bürger starrte ihn an. „Vorsicht bei der Abfahrt“, sagte er finster.
Harry kannte den Song offenbar gut. “The blue light was my baby and the red light was my mind”, sagte er.
„Vorsicht, du Überbiss“, knurrte Bruno Bürger. Er wurde laut. „Du könntest auch unter die Räder kommen!“
Harry stand auf und holte den Oberarzt.
„Sie sind also der Zugführer“, sagt Bürger jovial zu Oberarzt Lederer, während Harry eine Spritze aufzog. „Na dann zeigen Sie, was Sie können.“
Tagebuch 5. Februar 1982
Meine erste Aufnahme war das reinste Desaster. Ein sympathischer Mann, aber total abgedriftet in seine eigene Welt. Er hat mir so leidgetan. Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Keine Ahnung, was zu tun ist. Paranoide Schizophrenie, hat der Oberarzt gesagt, Blickdiagnose. Zack, Haldol gespritzt, der Mann muss schlafen. Kein Zufall, dass der Lederer mit Vornamen Hartmut heißt.
Bei dem Patienten habe ich an den Onkel Rudi denken müssen, obwohl mir der überhaupt nicht leidgetan hat. Er war eh nur zu Weihnachten bei uns eingeladen, aber hinterher hat die Mama immer über ihren Bruder geschimpft, das war das letzte Mal, das tu ich mir nicht mehr an, der ist ja nicht ganz zimmerrein. Der Onkel Rudi hat sich regelmäßig danebenbenommen, aber anders als dieser Patient, der Rudi hat geredet wie ein Wasserfall, schlüpfrige Witze erzählt, mit seinen tollen Autos geprahlt, der war immer ein großer Angeber vor dem Herrn, und dann hieß es auf einmal, der ist manisch-depressiv, der ist ein armer Irrer, aber man hat nie gemerkt, dass er der Mama leidgetan hätte. Meine Schwestern haben sich über ihn lustig gemacht. „Steinhof, Steinhof, mach´s Türl auf, der Rudi kommt im Dauerlauf“, den Spruch hat Regina aufgebracht. „Er legt sich gleich ins erste Bett und schreit, ich bin der größte Depp.“ Ich hatte auch kein Mitleid mit ihm. Ich konnte ihn einfach nicht leiden.
Weil ich mit dem neuen Job so nervös bin und in meinem Taubenschlag nicht schlafen kann, bin ich mitten in der Nacht zu Andreas in die Ungargasse gefahren. Du bist ein Baby, sagt er, du bist so ein Nerverl. Er lacht mich aus, aber er beruhigt mich auch irgendwie, er ist lieb zu mir, sogar der Sex ist besser, seit wir uns getrennt haben. Er schaut besser aus, nicht mehr so aufgedunsen wie in den harten Trinkphasen, da war immer dieser trübe Schleier auf seinem Gesicht. Mit zusammengebundenen Haaren gefällt er mir besser, sonst hängt seine Mähne nur so herunter, und diesen speckigen Hut von seinem Großvater hat er dauernd aufgehabt, sogar im Bett. Jetzt will er sich vielleicht in einer Möbelwerkstatt bewerben. Dort könnte er doch Kontakte zu Antiquitätenhändlern kriegen! Mit den Wohnungsräumungen kann er kaum die Miete bezahlen. Ich rede ihm zu, hoffe so sehr, dass er die gute Phase nutzt. Gestern haben wir uns um Mitternacht Spaghetti gemacht und dann im Bett gegessen.Was bei dir so alles zusammenkommt, hat er gesagt. Und: Gute Nacht, du seltsames Wesen.
Mit Ferdinand und Paula im Jazzland. Ferdinand sturzbesoffen. Vielleicht ist er im Franz-Joseph-Spital auch so eingetaucht ins Leid wie ich. Er will Pathologe werden. Seine ewigen Clownerien. Ärger über Paula, es ist so vorhersehbar, was sie von sich geben wird, bei jedem Thema, ich könnte Wetten darüber abschließen, sie langweilt mich so sehr. Sie ist eben statisch, sagt Andreas. Einmal hat er mir im Vollrausch von ihrem Busen vorgeschwärmt. Sie hat ja wirklich eine gute Figur, dazu die hennaroten Haare und das Moschusparfüm. Eine wunderschöne statische Statue. Nichts fällt ihr ein, aber tratschen muss sie, über alle möglichen Leute, hinten herum. Aggressiv und dumm streitet sie mit Andreas herum, weil er Fellini nicht für den absoluten Weltmeister hält, sondern auch Bergman und Jacques Tati gut findet. Sie plappert doch bloß nach, was Ferdinand predigt. Wenn ich was gegen sie sage, mache ich das leise, mit sanfter Stimme, als müsste ich sie beruhigen, dabei bin ich es, die beruhigt werden muss. Wir haben Ferdinand gern, also müssen wir Paula in Kauf nehmen. Ich habe sie damals im Kaffeehaus in Litschau schon nicht gemocht und kann sie immer noch nicht leiden.
4 Das Schicksal mischt die Karten
Im Jänner, drei Wochen vor dem Antritt meiner ersten Arbeitsstelle, hatte ich mich von Andreas getrennt. Sieben Jahre waren wir ein Paar gewesen, sieben Jahre, die zugleich fett und mager gewesen waren. Ich hatte oft darüber nachgedacht, mir eine eigene Wohnung zu suchen, aber irgendwie war der Gedanke immer wieder in den Hintergrund gerutscht, Vorlesungen, Praktika, Prüfungen, Lernen Lernen Lernen, ich hatte den Kopf einfach nicht freigehabt. Oder hatte es nicht gewagt. Fast dreißig, und noch nie allein gelebt, das beschämte mich wie eine unerledigte Aufgabe.
Als jüngste von drei Schwestern war ich niemals allein gewesen. Die Eltern hatten beide viel außer Haus zu tun gehabt, aber meine Schwestern waren immer da gewesen. Ein paar Monate nach meiner Geburt hatte die Mama wieder in der Litschauer Stadtapotheke zu arbeiten angefangen, als Papas Angestellte, und als ich in die Schule gekommen war, hatte sie eine eigene Apotheke im benachbarten Heidenreichstein übernommen. Regina und Martina hatten mich spüren lassen, wie lästig sie es fanden, auf mich aufpassen zu müssen. Aber sie waren immer da gewesen. Und am Wochenende, wenn die Eltern Jagdausflüge gemacht hatten, hatten wir bei der Rosa-Oma in Hörmanns übernachten dürfen, das war am schönsten.
Als ich mit achtzehn von Litschau zum Medizinstudium nach Wien ging, hatte ich mich gleich am ersten Tag an der Uni einer quirligen Salzburgerin namens Corinna angeschlossen. Eine Stunde in der Warteschlange vor dem Immatrikulationsschalter hatte uns gereicht, einander so sympathisch zu finden, dass Corinna meinte, wir könnten doch einfach zusammenziehen, in der Eigentumswohnung, die ihre Eltern gekauft hatten. Corinna studierte Geografie und Sport auf Lehrfach. Sie fand sich viel schneller als ich in der neuen Umgebung zurecht, ruckzuck war sie Mitglied in einem universitären Basketballverein, trat einer Aktivistengruppe der Antiatomkraftbewegung bei und versuchte, auch mich dafür zu gewinnen. Wieder wurde ich für eine Weile an die Hand genommen, über die Gestaltung der Wohnung hatten natürlich Corinna und ihre Eltern längst entschieden, und wie zur Schulzeit bestand meine Verantwortung ausschließlich darin, meinen Alltag so zu organisieren, dass ich mein Lernpensum schaffte. Geld war kein Problem, der Papa schickte jeden Monat einen Scheck, nicht gerade großzügig, aber verlässlich, stets versehen mit der Widmung Promotion. Ich war versorgt und geborgen, und da ich keine Erfahrung im Alleinsein hatte, stellte ich es mir weiterhin beängstigend vor, als sei ich für immer das schutzbedürftige Nesthäkchen.
Dann war Andreas in mein Leben getreten oder vielmehr über mein Leben hereingebrochen. Wieder wurde mir die Unterkunft ohne eigene Anstrengung auf dem Silbertablett serviert, ausgesucht, eingerichtet und bezahlt von den Eltern meines Gefährten. Im Gegenzug wurde erwartet, dass Andreas in der Tischlerei der Eltern mitarbeitete, auf Abruf, sobald sie ihn brauchten. Was immer wir zu zweit geplant hatten, wurde dadurch oft über den Haufen geworfen.
Aber gemeinsam planen war ohnehin schwierig mit dem unsteten Mann. War er da, dann war er sehr da, füllte den Raum und die Zeit und mein Fassungsvermögen bis zum Rand. War er nicht da, dann war er sehr abwesend, für viele Stunden, ganze Nächte, ganze Wochenenden, und das Einzige, worauf ich mich verlassen konnte, war, dass er irgendwann zurückkehren würde, erschöpft, oft verdreckt, manchmal mit Schürfwunden oder blauen Flecken, abgefüllt bis zum Rand, in einer Wolke von Rauch und Alkoholdunst, mit violett verkrusteten Lippen und Augen voll Schwermut. Er kam zurück, um in den Schlaf zu versinken wie in eine Gruft. Obwohl ich während dieser Saufexzesse Stunden, Tage und Nächte ohne ihn in der Wohnung hockte, war ich dennoch nicht wirklich allein, denn mein Gemüt war von Andreas besetzt, von Angst und Wut und Sehnsucht, es war ein ewiges Warten.
Und immer wieder die Anrufe seiner Mutter, fuchsteufelswild, wenn ihr Buberl wieder einmal verschollen war, ich musste mir die schrillen Vorwürfe anhören, die Andreas galten. „Ich schnapp´ über!“, kreischte Frau Schirmer. Ich hatte sie gehasst, meine Ex-Schwiegermutter in spe, kühl hatte ich mir ihre Tiraden angehört, aber am Ende doch immer ihre Verzweiflung gespürt, wenn sie sagte: „Ich habe ja niemand, mit dem ich reden kann.“
So ähnlich ging es mir jetzt eigentlich auch, denn obwohl sich die Freunde aus der ehemaligen Litschauer Kaffeehausrunde, die wie ich nach Wien gezogen waren, recht häufig trafen, kam es mir nicht in den Sinn, einem von ihnen meine Sorgen anzuvertrauen. Und von meiner Familie war schon gar keine Hilfe zu erwarten. Erst nach fast zwei Jahren hatte ich Andreas nach Litschau mitgenommen. Die reservierte Höflichkeit, mit der er dort empfangen wurde, war in offene Ablehnung umgeschlagen, als er sich bei der Feier zum 60. Geburtstag meines Vaters volltrunken danebenbenommen hatte. Ich hatte mich zutiefst geschämt, aber einfach im Boden zu versinken erlaubte ich mir nicht, denn ich fühlte mich verpflichtet, meinen Liebsten zu verteidigen, was auch immer er angestellt hatte, wer auch immer ihn angriff, und wenn es mein eigener Vater war.
„Wenn du dich nicht von ihm trennst, sind wir geschiedene Leute“, hatte der Papa gedroht. Von da an hatte ich meinen Eltern alles verheimlicht, was sich in meiner Partnerschaft abspielte. Weil in meiner Familie ohnehin niemand auf die Idee kam, mich in Wien zu besuchen, fiel nicht weiter auf, dass ich immer noch mit diesem unmöglichen Mann zusammenlebte.
Ich war von Andreas eingehüllt, durchdrungen, beinahe zugeschüttet gewesen, aber dennoch empfing ich manchmal, immer wieder, immer öfter, auf einer eigenen Wellenlänge aus meinem Innenraum ein Summen, knapp unterhalb der Hörschwelle, eine Vibration, deren Botschaft ich ahnte, aber nicht hören wollte: Es könnte genauso gut auch anders sein.
Wie nach einem langen Anlauf, Scheu vor dem Absprung, Zögern, Rückschritt und neuerlichem Anlauf war im Jänner dann auf einmal alles ganz leicht gegangen. Drei oder vier im Kurier annoncierte Wohnungen hatte ich mir angeschaut, keine hatte mir gefallen. Da erzählte der Höller eines Abends im Gasthaus Reinthaler wieder einmal von seinen Geldsorgen, er sei jetzt endgültig blank, schon zwei Monate im Rückstand mit der Miete für sein Atelier, er müsse raus, zumindest vorübergehend, seine neue Freundin Conny habe ihm angeboten, zu ihr auf den Brunnenmarkt zu ziehen.
„Weißt was“, hatte ich gesagt, „ich strecke dir das Geld vor. Ich will eh … also ich könnte die Wohnung doch übernehmen, und die Miete natürlich, vorübergehend. Ich ziehe jetzt einfach in dein Atelier, solange du … Ich finde den Taubenschlag da oben eh schon immer toll, und wenn du … also, wenn sich die Verhältnisse bei dir ändern sollten …“
Der Höller war begeistert gewesen. Das sei total in Ordnung und sauber und ehrlich, hatte er mit seiner Reibeisenstimme gesagt. „Scheiß auf die Zukunft! So machen wir das!“, hatte er gerufen. „Sei du du!“
Als hätte sich auf einmal eine verborgene Tür gezeigt und sogleich aufgetan, war alles leicht und geschmeidig gegangen. Wir brauchten nur einen halben Tag, um meine wenige Habseligkeiten von der Ungargasse in die Lustkandlgasse zu bringen, alle halfen zusammen, Andreas, Ferdinand, sogar Paula, der Höller natürlich, und die zupackende neue Conny, sie schwitzten und schnauften, 96 Stufen rauf und runter, zum Glück besaß ich ja praktisch keine Möbel, nur eine Matratze, einen dunkelbraunen Lederfauteuil und eine Kleiderstange vom Flohmarkt. Ich selbst musste nur mein Cello tragen. Meine Bücher wurden auf dem Boden neben dem Bett aufgestapelt, sogar der Hieronymus-Bosch-Druck Garten der Lüste, der mich seit der Matura überallhin begleitet hatte, war bereits wieder aufgehängt. Als dann die Schlepperei geschafft war, hockten wir zusammen, machten eine Flasche Ribiselwein auf, zündeten eine Kerze an, Ferdinand hatte die Gitarre dabei und sang I´m a Fool to Want You. Seine Stimme klang wie die von Van Morrison.
Dann waren sie alle weg, und ich war wirklich ganz allein.
Gleich am nächsten Tag hatte ich mein zukünftiges Stammcafé entdeckt. Am 1. Februar sollte mein Arbeitsverhältnis mit der Stadt Wien beginnen, und in den zwei Wochen bis dahin wollte ich das morgendliche Ausschlafen noch so richtig auskosten. So war es fast Mittag, als ich loszog, um meine neue Umgebung zu erkunden. Seit dem frühen Morgen hatte es geschneit. Gegenüber, vor dem Sanatorium Hera, war der Gehsteig schon freigeschaufelt worden. An der Ecke vor der Weinviertler Bäckerei blieb ich stehen und hielt mein Gesicht in die wirbelnden Flocken. Links, rechts, geradeaus? Den Weg durch den neunten Bezirk Richtung Innenstadt kannte ich schon von den Vorlesungen im Anatomischen Institut. Auf der Währingerstraße stadtauswärts hätte ich mich nach Einkaufsmöglichkeiten umschauen können, aber stattdessen, ich wusste gar nicht wieso, stapfte ich hinüber zur Volksoper, überquerte den lärmenden Währinger Gürtel, ging durch die Schulgasse, bog in die Canongasse ein und landete direkt beim Café Schopenhauer.
So nahe am Getöse des sechsspurigen Gürtels hatte ich kein klassisches Altwiener Kaffeehaus erwartet. Am Rand eines struppigen Beserlparks nahm es das gesamte Erdgeschoß eines dreistöckigen Gründerzeitbaus ein. Links und rechts vom Windfang erstreckten sich zwei Reihen hoher Bogenfenster. Gelbe Lichtstreifen fielen auf den Gehsteig und lockten mich ins Warme.
Drinnen wiederholte sich die symmetrische Trapezform des Gebäudes. Ein langer Tisch mit Zeitungen bildete ein Scharnier in der Mitte. Linkerhand ging es zur Theke, wo sich eine beleuchtete Vitrine mit Mehlspeisen drehte, daneben standen grün bespannte Billard- und Carambole-Tische zwischen den Sitzecken. Rechterhand reihten sich kleine quadratische Kartentische aneinander.
Weitläufig wie eine Halle war das Lokal, ein Eindruck, der durch goldgerahmte Spiegel an den Wänden noch verstärkt wurde. Von der Kirschholztäfelung ging ein honigfarbener Schimmer aus, die Sitzpolster waren mit gelbrot gestreiftem Samt bespannt, Kugelleuchten spendeten warmes Licht.
Ich öffnete die Speisekarte, in der ein gutes Dutzend Kaffeespezialitäten angeboten wurde. Unter einigen romantischen Schwarzweißfotos aus der Historie des Kaffeehauses stand ein Zitat von Arthur Schopenhauer.
Das Schicksal mischt die Karten. Wir spielen.
Ich rieb mir die steifgefrorenen Hände.
„Grüß Gott, gnä´ Frau“, sagte der Ober, der lautlos an meinem Tisch erschienen war. „Darf´s vielleicht was zum Aufwärmen sein? Empfehlen tät´ ich einen Fiaker, kennen Sie sicher, ein großer Mokka im Glas mit viel Zucker und einem Stamperl Sliwowitz oder Rum.“
„Mit Rum“, sagte ich, aufs Angenehmste überrumpelt.
Eine weißhaarige Dame in der benachbarten Sitznische nickte mir zu. „Ja, der Herr Ludwig“, sagte sie. „Er ist schon oft grantig, aber er weiß ganz genau, was seinen Gästen guttut.“
5 Tun Sie sich nichts an
„Sie stechen schlecht, Schwester“, sagte Jan Wolny zu mir. Der stämmige junge Mann zupfte nervös an seinem Ohrring, seine langen schwarzen Haare fielen ihm wirr ins Gesicht. Die morgendliche Blutabnahme bereitete mir auch nach zwei Wochen noch Schwierigkeiten. Während ich mich bemühte, eine bessere Vene zu finden, sang der Patient laut Hello Dolly und ließ seine Oberschenkel in einem hektischen Rhythmus auf und ab wippen.
„Du musst schon stillhalten, Herr Wolny“, mahnte Pfleger Anton, „sonst kann die Frau Doktor nicht arbeiten.“
„Das kann die doch eh nicht, ich lass mich von der nicht mehr stechen!“ Wolny riss sich los, den festgezurrten Stauschlauch noch am Oberarm, rannte hinaus auf den Korridor und hämmerte seinen Rhythmus mit der Faust an die Wand.
„Der Winnetou muss immer ein Theater machen“, sagte Anton, ein erfahrener Pfleger mit der Statur eines Gewichthebers, und fing den Patienten ohne Aufregung wieder ein. Wöchentliche Blutabnahmen seien nun einmal vom Oberarzt angeordnet, wegen der Neuroleptika, Blutbild und Leberwerte müssten kontrolliert werden, erklärte er und fixierte Wolny in einer Art Umarmung, sodass ich die Nadel zu einem neuen Versuch ansetzen konnte.
„Auweh!“, heulte der junge Mann. „Das merk ich mir!“
„Ah, da ist ja der Herr Oberarzt“, sagte Pfleger Anton. „Sie kommen gerade recht. Könnten Sie der jungen Kollegin vielleicht ein bissl unter die Arme greifen, der Herr Wolny hat ja wirklich schlechte Venen.“
„Also damit habe ich jetzt gar keine Freude, gleich habe ich einen dringenden Termin“, wand sich Oberarzt Lederer. „Sie wissen aber schon, dass so eine Leistung bei mir in der Ordination fünfhundert Schilling kostet“, sagte er zu mir. Beim dritten Versuch fand er einen Zugang, doch das Rinnsal versiegte, bevor das Röhrchen zur Hälfte gefüllt war.
„Hören Sie auf, das tut weh!“, maulte Wolny.
Lederer ignorierte den Patienten und legte mir die Hand auf den Arm. „Als Arzt müssen Sie in Zukunft schon härter werden“, sagte er. „Andererseits, so einer jungen Dame steht natürlich auch die Unsicherheit gut.“ Er wusch sich die Hände, als ob nun alles zur Zufriedenheit erledigt sei. Man müsse in so einem schwierigen Fall, sagte er, eben mit den Vorbefunden auskommen.
„Aber es hat doch geheißen, wöchentliche Kontrolle wegen dem weißen Blutbild und wegen der Leber, deswegen haben wir uns doch jetzt alle miteinander so geplagt“, protestierte ich.
„Sind Sie vielleicht aggressiv, Frau Doktor?“ Jan Wolny grinste.
„Nein!“, schnappte ich. „Ich bin nur nervös!“
„Das gefällt mir jetzt aber, wie Sie das so freimütig gesagt haben.“ Wolny stand auf, machte einen artigen Diener, als wolle er mich zum Tanzen auffordern, fasste schwungvoll meine Hand und deutete einen Handkuss an.
„Jetzt reicht´s, Winnetou“, sagte der Pfleger. „Was dir sonst noch alles einfällt, kannst dir aufheben fürs Hausparlament.“
Ich bückte mich, um ein paar Blutspritzer vom Linoleum zu wischen.
„Nein nein, das machen schon die Putzfrauen“, sagte Pfleger Anton. „Tun Sie sich nichts an, so ist das halt am Anfang. Sie sollten einmal den Dr. Reiher sehen, wie der wild herumsticht.“
Tagebuch 16. Februar
Es ist so widerlich, ewig die Fehler beim Stechen, entweder daneben, oder die Vene platzt, irgendwas ist immer. Ich konzentriere mich immer noch nicht genug, bin immer noch zu hastig unter dem Blick des Pflegepersonals, besonders wenn Schwester Elfriede dabei ist, ich suche immer noch nicht in Ruhe die beste Vene. Gut stauen wäre wichtig, Zeit lassen und auf mein eigenes Auge und mein Gefühl vertrauen. Mir ist dann gleich der ganze Tag verpatzt. Angst beherrscht mich, Angst vor der Verantwortung, Angst, etwas nicht zu können, Angst, jemandem zu schaden. Jeden Morgen schicke ich Stoßgebete, lass es gutgehen bitte. Und wenn ich dann einen Fehler nach dem anderen mache, möchte ich am liebsten weinen und mich verkriechen und womöglich noch bedauert werden für das, was ich den Patienten antue. Mein anbiederndes Gehabe soll alles wieder zudecken, Patienten und Schwestern gegenüber. Es ist mir furchtbar wichtig, was die anderen über mich denken. Ich fühle mich als ungeschicktester Arzt aller Zeiten. Aber wenn ich mir Zeit lasse und mich bemühe, müsste es doch gehen. Unsere Mutter hat immer gesagt, was du wirklich lernen willst, das kannst du lernen. Üben üben üben. Ich habe doch auch Cello spielen gelernt und Maschine schreiben und Stricken, sogar Autofahren, ich werde schon noch ein Gespür für Venen entwickeln.
Wieder Unterschlupf bei Andreas gesucht. Er geht Zigaretten holen, ich schlafe ein, wache auf um halb drei, er ist nicht da. Erinnerungen an durchgeheulte Nächte. Er kommt niedergeschlagen wieder, natürlich angesoffen, er läuft vor seinen Problemen davon, Streit mit den Eltern, Erpressungsversuch des Vaters, Andreas hat seinen Pass eingesteckt, droht mit Wegfahren. Er will vielleicht im Herbst studieren, aber er meint, er muss sich vorher noch in die Tischlerei stürzen. Ich gehe wieder einmal in Saft aus Wut auf seine Eltern, die ihn als billige Arbeitskraft ausnutzen, dann steckt ihm seine Mutter wieder einen Tausender zu, so hält sie ihn an der Kandare. Das ist wie eine Schallplatte mit einem Sprung, immer an der gleichen Stelle bleibt sie hängen. Wahrscheinlich schämt er sich und hat mir deswegen früher nichts von familiären Problemen erzählt. Gestern habe ich ihn neben mir im Dunkeln leise weinen gehört. Schlechtes Gewissen. Habe die ganze Zeit nur an mich gedacht, und er wird zerrissen, weil er nirgends Nein sagen kann. Er ist wie gelähmt, lässt sich treiben, es geht ihm sauschlecht. Hätte ihm so gern geholfen, von ganzem Herzen, all die Jahre, auch das habe ich nicht geschafft.
6 Verirrte Zugvögel
Am ersten Tag die erste Neuaufnahme, nach einer Woche der erste Selbstmordversuch auf 29A, nach zehn Tagen der Auftrag, demnächst das sogenannte Hausparlament zu leiten, ein paar Tage später die Nachtdiensteinteilung für März, und nach zwei Wochen die erste Chefvisite.
„Hoher Besuch“, hieß es im Schwesternzimmer. Endlich lernte ich den Primar Spinrad kennen, von dem Vera Stipsits so ehrfürchtig gesprochen hatte. Er war ein langer, linkischer Mensch mit einem länglichen Schädel, die hohe Stirn von Falten plissiert. Seine Augen hielt er halb geschlossen, als sei ihm das Tageslicht zu grell, und seine Stimme erinnerte mich an einen Opa, der kleine Kinder besänftigt. Oder an eine Oma. Er begrüßte alle Anwesenden mit einem würdevollen Händedruck.
Ich sollte die Patienten vorstellen, die ich aufgenommen hatte. Am Bett von Bruno Bürger, meiner ersten Neuaufnahme, schilderte ich die Umstände, die zu seiner Zwangseinweisung geführt hatten, und berichtete, er habe auf der Station drei Tage lang fast ununterbrochen geschlafen, danach sei er ansprechbar und wie ausgewechselt gewesen, habe sich in täglichen Gesprächen von seinen fixen Ideen über die Zugvögel distanziert, spreche also offenbar gut auf die Medikation an, ein differenzierter Mann, Lehrer für Biologie und Physik. Keine psychiatrische Vorgeschichte. Seine Krise sei wahrscheinlich dadurch ausgelöst worden, dass seine Frau Lisbeth, 18 Jahre jünger als er, Anfang des Jahres aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen sei, wobei sie weiterhin an der gleichen Schule arbeite wie er. Keine Kinder. Er leide unter Trennungsschmerz und schweren Schuldgefühlen. Aktuell sei das Auffälligste an ihm das Ausmaß seines Zigarettenkonsums. Er ersuche um seine baldige Entlassung, abgesehen von diesem Ausrutscher am Westbahnhof halte er sich eigentlich für ganz normal.
„Tja, wieder so ein Schicksal“, seufzte Oberarzt Lederer. „Er muss ja geisteskrank sein, sonst wäre er nicht in der Psychiatrie gelandet. Wieso hat Ihre Frau Sie eigentlich sitzenlassen“, wandte er sich abrupt an den Patienten, der sich wie auf Kommando erhob, von einem Bein auf das andere trat und mit einem tiefen Atemzug zur Antwort ansetzte. Lederer kam ihm zuvor. „Na ja, sie wird schon ihre Gründe gehabt haben. Sie sind jetzt wie alt, fast fünfzig? Und Ihre Frau, also Exfrau, halb so alt wie Sie, eine ehemalige Schülerin vielleicht? Hm, Herr … äh, Berger, ja? Ich höre nichts? Sie müssen schon mit uns reden, sonst können wir Ihnen nicht helfen. Im höheren Alter läuft es vielleicht nicht mehr so wie einst im Mai, oder, Herr Berger? Und die jugendliche Gattin hat ein paar unerfüllte Wünsche und einen jugendlichen Kollegen, oder?“
„Bürger. Er heißt Bruno Bürger“, warf ich ein.
Zum Primar, der nachdenklich seine gefalteten Hände ans Kinn gelegt hatte, sagte Lederer: „Unsere neue Frau Doktor hier hat das alles ausführlichst exploriert.“
Spinrad nickte. Ich vermied den Blickkontakt zu meinem Patienten. Hatte ich ihn mit ihrer detaillierten Präsentation irgendwie verraten? Bürger hob die Schultern, öffnete ein paarmal den Mund, aber es kam nichts heraus. Wie ein armer Sünder stand er vor den Experten in Weiß.
„Und Sie sehen ja“, fuhr Lederer fort, „von Entlassung kann noch lange nicht die Rede sein. Der Patient ist doch noch sehr wackelig.“
„Man muss natürlich die psychosozialen Faktoren … die psychodynamische Konstellation mit anankastischen Zügen …“, sagte Dr. Reiher mit Seitenblick zum Primar.
Spinrad nickte versonnen. „Das mit den Zugvögeln ist interessant“, sagte er zum Patienten. „Was hat es denn damit auf sich?“
Bruno Bürger zögerte, der Primar wartete. Als Oberarzt Lederer die Frage seines Vorgesetzten ungeduldig wiederholte, bremste dieser ihn mit einer wedelnden Handbewegung.
„Zugvögel Anfang Februar, das ist natürlich Blödsinn“, sagte Bürger. „Mitten im Winter kommen die normalerweise noch nicht aus dem Süden zurück. Die wissen ja instinktiv, wohin sie gehören. Also kommt drauf an, ob sie Langstreckenzieher oder Kurzstreckenzieher sind.“
„Aha?“
„Kurzstreckenzieher fliegen nicht mehr als zweitausend Kilometer in ihr Winterquartier. Stare. Oder Kiebitze. Sie können sich entscheiden, wann sie zurückkommen. Wenn die Tiere feststellen, dass ihre Entscheidung falsch war, zum Beispiel weil sie auf eine Kaltfront stoßen, unterbrechen sie ihre Reise und warten ab. Bei den Langstreckenziehern ist das anders, da entscheidet das genetische Programm. Quasi Schicksal.“
„Aha?“
„Meisen. Trauerschnäpper. Nach der Rückkehr konkurrieren sie um die Nistplätze. Wenn die Trauerschnäpper zu spät heimkehren, dann sind schon alle Nistplätze besetzt, und dann – “
„Das ist ja alles schön und gut“, unterbrach Lederer. Er hatte sich auf dem benachbarten Krankenbett niedergelassen. Seine Schenkel klappten auf und zu. „Aber wir –“
„Ja, Herr Bürger?“ Spinrad trat einen Schritt näher an den Patienten heran.
„Die Jahreszeiten, die Zugvögel, die Züge … Mir kam auf einmal alles verkehrt vor.“
„Mhm. So verkehrt wie der Auszug Ihrer Frau“, sagte Spinrad. Der Patient nickte.
„Heuer war tatsächlich ein ungewöhnlich milder Winter“, sagte ich, „da kann es –“
„Na und?“, fiel mir der Oberarzt ins Wort.
„Da kann es, glaub ich, schon vorkommen, dass Zugvögel quasi in die falsche Richtung fliegen, weil sie glauben, dass schon Frühling –“
„Na und? Wollen Sie vielleicht behaupten, das ist dann keine Schizophrenie?“
„Nein, also, na ja, ich weiß nicht …“ Ich merkte, wie meine Wangen heiß wurden. „Ich habe nur neulich ein Bild im Profil gesehen, von einem Storch, verfrühte Rückkehr, hieß es im Text. Der hat sich sein Nest auf einem Strommast gebaut. Könnte es nicht sein, dass der Herr Bürger so eine verkehrte Flugbahn tatsächlich –“
„Wir haben hier wahnhafte Gewissheit, Ausschluss des Zufalls, Paranoia, gar keine Frage!“ Lederers olivfarbener Teint kam mir auf einmal dunkler vor.