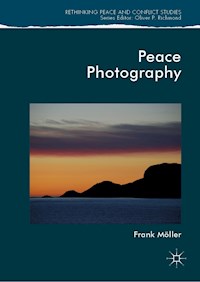26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Joseph Caspar Witsch, seine Autoren und der Literaturbetrieb der frühen Bundesrepublik Mit Charisma und Geschäftssinn versammelte Verlagsgründer Joseph Caspar Witsch gleich nach der Verlagsgründung bedeutende Autoren der Vor- und Nachkriegszeit unter dem Dach von Kiepenheuer & Witsch. Frank Möller präsentiert nun nach seiner ersten biographischen Studie (»Das Buch Witsch«) eine faszinierende Nahsicht auf viele dieser Autoren und ihre Werke, auf die Beziehungen, die Witsch zu ihnen unterhielt – sowie einen spannenden Blick hinter die Kulissen des Literaturbetriebs von 1949 bis 1967. Mehr als 600 Bücher veröffentlichte der Verlag Kiepenheuer & Witsch in den 18 Jahren unter Witschs Ägide – ein bemerkenswert breites und innovatives Programm aus Belletristik, Sach- und Fachbüchern. Früh gewann Witsch wichtige Exilanten wie Joseph Roth, René Schickele oder Erich Maria Remarque für seinen Verlag und verschaffte dem Publikum mit Saul Bellow, J.D. Salinger, Georges Simenon u.v.a. Zugang zu lang entbehrter fremdsprachiger Literatur. Auch auf junge deutsche Autoren von Heinrich Böll über Rolf Dieter Brinkmann bis Nicolas Born setzte Witsch – und mied dabei eigensinnig jeden Kontakt zur Gruppe 47. Mit seinen gesellschaftspolitischen Sach- und Fachbüchern von Wolfgang Leonhard über Ralph Giordano bis Hans-Ulrich Wehler nahm Witsch nicht zuletzt starken Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung. Als erfolgreicher Unternehmer hatte Witsch aber auch die Veränderungen im Buchmarkt im Blick und startete verlagsübergreifende Initiativen, von denen die Gründung des dtv nur ein Ergebnis ist. Und so ist »Dem Glücksrad in die Speichen greifen« nicht nur ein farbiges Porträt der Anfänge von Kiepenheuer & Witsch, sondern auch eine aufregende Zeitreise durch die Verlags-, Kultur- und Gesellschaftsgeschichte der frühen Bundesrepublik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1057
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Porträt Joseph Caspar Witsch von Hannes Jähn, Witsch zum sechzigsten Geburtstag am 17. Juli 1966 zugedacht.
Inhalt
TitelMottoAuf Dschungelpfaden – Einleitung1. »Von Bestsellern und anderen Büchern« – Das fremdsprachige LiteraturprogrammFavoriten des Verlegers: Henry James, Jean Giono, Saul Bellow, Czesław Miłosz, Kelvin Lindemann, Nathalie Sarraute, Bernard Malamud, Jerome D. Salinger, Soma Morgenstern – Georges Simenon und die Maigret-Krimis – Brendan Behans Irland – Patrick Whites Australien – Marek Hłasko: der »junge Wilde« und die Mühen eines Verlegers – ein besonderes Verhältnis: K & W und Ignazio Silone – »Türöffner« für lateinamerikanische Literatur in Deutschland: João Guimarães Rosas Epos »Grande Sertão«2. »Hoffentlich kommt er nicht wieder …« – Die Literatur der ExilantenJoseph Roth: die Wiederentdeckung – Hermann Kesten: Bindeglied von Joseph Roth und René Schickele zu J. C. Witsch – Kesten und Witsch: ein spannungsreiches Verhältnis – Fritz Landshoff und Felix Guggenheim als Vermittler von Erich Maria Remarque und Vicki Baum – »Der Funke Leben«: Tabubruch KZ-Roman – »Zeit zu leben und Zeit zu sterben«: die geleugnete Zensur und das Schweigen Remarques – unverzeihlich: die versäumte Wiedereinbürgerung Remarques – effizient wie ein Kampfhahn: Felix Guggenheim – Vicki Baum und der Versuch einer Imagekorrektur – Annemarie Selinkos »Désirée« als Erfolgsgarant3. »Das Wort ›zersetzend‹ steht längst wieder an erster Stelle« – Die Literatur der »Inneren Emigration«Erich Kästner: Witschs »liebster Andersdenkender« – Kästners »Lesestoff, Zündstoff, Brennstoff« als beunruhigende Gratulatio für seinen Verleger – christliche Bücherverbrennung am Düsseldorfer Rheinufer – Ricarda Huch: die Geschichte einer Verehrung und Überschätzung – Wilhelm Emrich: Herausgeber mit NS-Vergangenheit4. Ein Verlag »in den Zeitströmungen« – Die deutschen Nachkriegsautoren von Böll bis BrinkmannSympathie und Geschäftssinn: J. C. Witsch und Heinrich Böll – Kölner Literaturpreis für einen gewendeten Nazi statt für Böll – der »grantige Gerhard Zwerenz« – Heinz von Cramer setzt sich durch – Ressentiments auf Kosten des eigenen Programms: Witsch und die »Gruppe 47« – Neujustierung durch Wellershoffs »literarischen Kindergarten« – Nathalie Sarraute als Fixpunkt – Spurensuche in Kronenburg (Eifel): Hermann Görings Malerdorf als Geburtsstätte der »Kölner Schule des Neuen Realismus« – Rolf Dieter Brinkmann als Hoffnungsträger und Problemfall5. Ambitionen, Irrwege und späte Erfolge – Das Wissenschaftsprogramm»Dokumente des Europäischen Rationalismus« und ein folgenreicher Streit mit Max Bense – René König und die empirische Sozialforschung – ein vergeblicher Versuch mit Dolf Sternberger – Alexander Rüstow, Wolfgang Frickhöffer, Hans Otto Wesemann und die »Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft« – NWB und Studien-Bibliothek: Dieter Wellershoffs erfolgreiche Wissenschaftsreihen – Gérard Gäfgen, Carl Friedrich Graumann, Jürgen Habermas, Eberhard Lämmert und Hans-Ulrich Wehler als Herausgeber6. »Zur Bildung gehört Wissen!« – Das SachbuchprogrammCarola Stern und das politische Buch – Arnulf Baring, Gerd Ruge, Günther Nollau und Zbigniew K. Brzezinski in der Reihe »Information« – Peter Benders »Offensive Entspannung« und der Kurswechsel in der Deutschlandpolitik – Anthony Edens Memoiren und die »verdammte deutsche Journaille« – Winfried Martinis »Unkerei gegen die Bundesrepublik« und Fritz René Allemanns Verlagsflucht – »Lieber freß ich tote Ratten!«: der »Warren-Report« als Verlagscoup und Prestigeduell mit Berend von Nottbeck und Bertelsmann7. »Dem Glücksrad in die Speichen greifen …«Hinweis – Der Geschäftskosmos WitschGesellschafter und ihre Interessen – Einstieg ins Kunstbuchgeschäft mit dem Phaidon Verlag – abseits des Kerngeschäfts: der Bühnenvertrieb – »Collection Theater« und »Hörspielbuch« – der Konflikt um die Buchgemeinschaften – Bücher der Neunzehn: eine Initiative der Verleger – Streit zwischen Fischer und Suhrkamp – auf Anregung Witschs: der Deutsche Taschenbuch Verlag – Leo Kirch sticht Witsch aus: die Deutsche Verlags- und Fernsehgesellschaft – Gremienarbeit im Börsenverein – »Schutz der Jugend« vor Sex und Erotik, aber nicht vor Landser-Heften und verlogenen Generalsmemoiren – als Gründer dabei: von der GELU zur VG Wort – der Verleger als Buchhändler8. »Nein, nein, das ist ganz falsch …« – Vom »Stammtisch« und von anderen Schau- und SendeplätzenJ. C. Witsch auf allen Sendern – Radio im besten Sinne: »Der Stammtisch« – »2 x Buch und Buchhandel im Rundfunk«: eine Dokumentation9. Der Patriarch – Von Aufstieg, Kampf und Eigensinn»Sherpas« auf dem Weg nach oben: Gustav Kiepenheuer, Fritz Breuer, Alexandra von Miquel, Charlotte Ehlers, Fritz H. Landshoff – Verlag Landshoff & Witsch: Ein Experiment scheitert – der Bruch mit Landshoff: Versuch einer Klärung – Witsch und Gerling: keine anderen Götter neben mir – Hans Rößner: der Mann mit NS-Vergangenheit zwischen Piper und Witsch – S. Fischer und K & W: Ein neuer deutscher Großverlag soll entstehen – kreatives Chaos und strenges Regiment – die Liebe zum Schönen – Pflanzen, Garten und Natur – Familienfragen – Krankheit und TodDie Nachfolge – Ein Gespräch mit Reinhold Neven Du MontAbkürzungenAnmerkungenLiteraturverzeichnisArchiveZeitzeugengesprächeBildnachweisBuchAutorImpressum»Der Verleger muß, wie die Helden Trojas, auf der Mauer stehen, seine Feinde schmähen und seine Freunde lieben. Er muß beides kräftig und ohne Vorbehalte tun. Seine Freunde trösten ihn, wenn es ihm not tut, und seine Feinde sorgen dafür, daß er im Gespräch bleibt, er und seine Bücher.«
Joseph Caspar Witsch, Über den merkwürdigen Charakter des literarischen Verlegers (1958)
»Er war der letzte große deutsche Verleger, der alles das noch einmal in sich einschloß, was Verleger wie Kurt Wolff, Reinhard Piper, Ernst Rowohlt, Samuel Fischer, Gustav Kiepenheuer auf ihre Weise gewesen waren: Nicht nur Bücherverscheuerer, sondern Büchermacher, Autorenkomplicen, Leute mit Ideen und Zivilcourage, die man auch als Personen erkennen, bewundern und beneiden konnte. […] Witsch war ein Anachronismus, den gabs ja eigentlich schon nicht mehr, aber Witsch hat sich davon nicht bange machen lassen, den gabs trotzdem.«
Jörg Schröder, Siegfried (1972)
»Er ist zu frueh gestorben, weil er glaubte alles auf einmal tun, erleben und geniessen zu muessen. Es ist allerdings wahr, man stirbt auch, wenn man gar keinen dieser Fehler begeht.«
Auf Dschungelpfaden
Einleitung
Es war ein schmales, in blaues Leinen gebundenes Büchlein, das mir Helge Malchow, seit 2002 Verleger von Kiepenheuer & Witsch, mit auf den Weg gegeben hatte. Der Band war anlässlich des fünfzigsten Jahrestages des Verlages herausgekommen. Er enthielt einen chronologischen Abriss der Verlagsgeschichte und ein Gesamtverzeichnis der anfangs unter dem Namen Verlag Gustav Kiepenheuer und ab 1951 unter Kiepenheuer & Witsch erschienenen Bücher. Ich begann zu blättern. Eine auf den ersten Blick schwer zu überblickende Fülle. Namen, die mir vertraut waren: Joseph Roth, Vicki Baum, Heinrich Böll, Nathalie Sarraute, Fritz René Allemann, René König, Wolfgang Leonhard; andere, die mir wenig oder gar nichts sagten: Kay Cicellis, Vittorio G. Rossi, Hal Koch, Kurt Blaukopf, Leopold Zahn. Eine Gruppe von Nachkriegsautoren, die ich zu finden erwartet hatte, fehlte dagegen: Ingeborg Bachmann, Günter Eich, Günter Grass, Uwe Johnson, Peter Handke, Martin Walser oder auch die rheinischen Sprachartisten Albrecht Fabri und Jürgen Becker. Warum hatte Witsch sie nicht in seinen Verlag locken können?
Wer in den Dschungel geht, greift zur Machete, um sich seinen Weg zu bahnen. Wer erstmals den literarischen Dschungel eines Verlages durchstreift, bedient sich meist feinerer Werkzeuge. Ich erstellte drei Listen, grob unterteilt nach »Belletristik«, »Fachbüchern« und »Sachbüchern«, und bekam eine erste Ahnung davon, dass ich dem ansteigenden Dschungelpfad wohl folgen musste, um irgendwann eine Anhöhe zu erreichen und von dort klarere Strukturen erkennen zu können: Witschs Bücherland.
Die Belletristik. Ein Machetenhieb trennt Deutschsprachiges von Fremdsprachigem. Vielleicht etwas brachial, weil dadurch auch gemeinsame Traditionen, Motive und Stilmerkmale getrennt werden, aus Gründen der Übersichtlichkeit aber hilfreich. Witsch hat gezielt nach fremdsprachiger Literatur, die während des Nationalsozialismus kaum verfügbar war, gesucht, nach US-Amerikanern, Franzosen, Italienern, Osteuropäern, am Ende sogar nach Lateinamerikanern, als andere deutsche Verleger in deren üppig wuchernder Fantasie noch eher das Investitionsrisiko als eine Chance sehen mochten.
Ebenso wie der fremdsprachigen Literatur galt Witschs Interesse der Literatur der deutschsprachigen Exilanten, deren Bücher daheim gebrannt hatten. Der 1939 mit nicht einmal 45 Jahren in Paris gestorbene Joseph Roth steht hier ganz oben, desgleichen Erich Maria Remarque. Die Rezeptionsgeschichte ihrer Werke macht deutlich, wie stark nationale wenn nicht nationalsozialistische Überzeugungen in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten in der zur Demokratie gezwungenen ehemaligen »Volksgemeinschaft« noch präsent waren. Witsch zensierte Remarques Roman »Zeit zu leben und Zeit zu sterben« und leugnete die Eingriffe stur und wider besseres Wissen, nachdem man im Ausland darauf aufmerksam geworden war. Und Remarque? Warum hat er die Verfälschung seines Romans hingenommen? Bemerkenswert: Reinhold Neven Du Mont, Witschs Schwiegersohn und nach dessen Tod sein Nachfolger als Verlagsleiter, ließ die politisch motivierten Eingriffe später revidieren.
Eine besondere Sympathie Witschs genossen ein Autor und eine Autorin, die der sogenannten Inneren Emigration zuzurechnen sind. Als »liebsten Andersdenkenden« schätzte Witsch Erich Kästner, eine Anspielung auf die politischen Differenzen zwischen dem eher links orientierten Autor, der mit den Wiederaufrüstungsgegnern sympathisierte, und dem in Adenauers Fahrwasser schippernden Verleger. Erheblich geringer war dagegen die politische Distanz zwischen Witsch und der von ihm hoch verehrten Ricarda Huch. Witsch mühte sich über Jahrzehnte darum, das Werk der Historikerin und Dichterin nach dem Krieg wieder verfügbar zu machen. Als sich der Erfolg seiner Bemühungen schließlich abzeichnete, hatten sich die Texte der Grande Dame längst überlebt und Witsch selbst blieb bloß noch kurze Zeit zu leben. Der erste Band einer umfangreichen Gesamtausgabe erschien 1966, im Jahr vor seinem Tod.
Lässt man den Blick auf der Suche nach jüngeren Autoren der deutschsprachigen Literatur weiter kreisen, muss man lange suchen. Sie springen nicht unmittelbar ins Auge – mit einer Ausnahme: Heinrich Böll. Witsch hat es bedauert, den Kölner nicht als Erster entdeckt zu haben. Aber als er auf ihn aufmerksam gemacht wurde und Böll einen neuen Verlag suchte, ergriff er die Gelegenheit. Eine Freundschaft sei daraus entstanden, so Witsch. Doch es war wohl eher ein Zweckbündnis zum beiderseitigen Nutzen.
Und außer Böll? Der »grantige« Gerhard Zwerenz wird von Witsch nach seiner Flucht aus der DDR an den Verlag gebunden und intensiv betreut. Gedankt hat er es seinem Verleger nicht. Von Heinz von Cramers kurzer Liaison mit dem Verlag blieben zwei wenig bedeutende Bücher zurück. Außerdem aber ein bemerkenswerter Briefwechsel und ein Novum der Literaturgeschichte Nachkriegsdeutschlands: Der Verleger distanzierte sich auf der Umschlagklappe vom Buch seines Autors. Danach war auch von Cramer weg.
Um noch weitere jungdeutsche Hoffnungsträger im Programm von Kiepenheuer & Witsch auszumachen, muss man jetzt schon sehr weit schauen. Der Blick gleitet über den Dschungel hinaus, lässt Böll hinter sich und findet schließlich erneut Halt in einer Naturlandschaft, der der Vulkanismus seinen Stempel aufgedrückt hat. Im äußersten Westen der Republik, in der Eifel, sitzen an einem warmen Sommertag im Juni 1964 mehr als ein Dutzend junge Dichter im Rund eines idyllisch anmutenden Innenhofes; unter ihnen Rudolf Jürgen Bartsch, Rolf Dieter Brinkmann, Tankred Dorst, Günter Herburger, Dieter Kühn, Hermann Moers, Renate Rasp, Günter Seuren. Einer liest vor, die anderen lauschen gespannt oder dösen apathisch in der Sonne. Der Verleger Witsch ist zugegen, seine Lektorin für fremdsprachige Literatur Alexandra von Miquel, der Werbeleiter und spätere März-Verleger Jörg Schröder und auch Heinrich Böll. Organisiert hatte das Treffen Dieter Wellershoff, dem der Verleger nach seiner Anstellung als Wissenschaftslektor kurze Zeit später noch das Lektorat für die junge deutsche Literatur anvertraut hatte. Und Wellershoff erwies sich als kluger Systematiker und Stratege, gewann neue Autoren und weckte unter dem Label »Kölner Schule des Neuen Realismus« das Interesse der Feuilletons. Irritierend: Diejenigen, die durch die am französischen Nouveau Roman orientierte Schule der Wirklichkeit auf den Grund gehen wollten, zelebrierten ihre Suche nach dieser Wirklichkeit ausgerechnet in einem Anwesen, in dem sich ein Vierteljahrhundert zuvor noch Goebbels, Göring und Himmler die Klinke in die Hand gegeben hatten.
Zu halten vermochte der Verlag die hoffnungsvolle Autorenschar nicht. Als Wellershoff begann, eigenen literarischen Ambitionen nachzugehen, und sich damit zum Konkurrenten im gemeinsamen Verlag entwickelte, suchten sie ihr Glück anderswo. Und damit war es für längere Zeit vorbei mit dem kurzen Aufschwung der jüngeren deutschen Literatur im Verlag Kiepenheuer & Witsch.
Die wissenschaftliche Fachliteratur. Mehr, als man heute denken mag, gab es davon im Programm von Kiepenheuer & Witsch. Sie grob zu sortieren, war bei der Sichtung von der Anhöhe aus ganz einfach. Da gab es einen Bereich mit Wissenschaftstexten, die vor dem Einstieg Dieter Wellershoffs als wissenschaftlicher Lektor Ende der 1950er Jahre ins Programm gekommen waren. Und es gab ein wesentlich ausgedehnteres Gebiet, in dem sich Bücher stapelten, die unter Wellershoffs Leitung erschienen waren. Anfangs hatte sich Witsch bemüht, renommierte Professoren als Betreuer eigener Reihen zu gewinnen, unter ihnen René König, Dolf Sternberger und Alexander Rüstow. Doch die Professoren hatten sich als überbeschäftigte und allzu unstete Kandidaten für herausgeberische Arbeiten erwiesen. Wellershoff dagegen hatte auf jüngere Wissenschaftler gesetzt, die erst am Beginn ihrer Laufbahn standen. Er gewann Jürgen Habermas, Hans-Ulrich Wehler, Gérard Gäfgen, Carl Friedrich Graumann sowie Eberhard Lämmert als Betreuer eigener Fachbereiche und brachte unter ihrer Herausgeberschaft einen neuen Buchtyp auf den Markt der Republik, der seine Wurzeln in den Hochschulen der USA hatte: den Wissenschaftsreader. Viele dieser Bücher wurden außerordentlich erfolgreich – bis schließlich die Verbreitung von Fotokopierern in den 1970er Jahren das Ende des Wissenschaftsbooms bei Kiepenheuer & Witsch einläutete.
Das Sachbuchprogramm. Sein Umfang ist mehr als doppelt so groß wie der des Wissenschaftsprogramms. Es entsprach Witschs Bildungsverständnis, seiner Leserschaft naturwissenschaftliches, philologisches, philosophisches, anthropologisches, medizinisches und psychologisches Basiswissen über die Welt und über den Menschen zur Verfügung zu stellen. Über die Erfolge einzelner Titel kann man heute nur staunen. Nicht nur »Mathematik für alle«, ein mehr als 700 Seiten starker Wälzer des Briten Lancelot Hogben, avancierte bei Kiepenheuer & Witsch zum Bestseller.
Klare und fortschrittliche Konturen erhielt der politische Teil des Sachbuchprogramms ab Beginn der 1960er Jahre durch Carola Stern. Die für den zu Bertelsmann abgewanderten Deutschbalten Berend von Nottbeck als Lektorin angeheuerte ehemalige Kommunistin vollzog einen Bruch mit der antikommunistischen Entlarvungsliteratur der 1950er Jahre, ohne dabei allerdings ost-west-politische Fragestellungen zu vernachlässigen. Bücher, die unter ihrem Lektorat erschienen und Autoren wie Fritz René Allemann, Arnulf Baring, Gerd Ruge, Günther Nollau, Zbigniew K. Brzezinski oder Peter Bender vereinten, fußten allerdings bereits auf der Einsicht, dass sich die Welt für lange Zeit auf die Existenz zweier verfeindeter Blöcke würde einstellen müssen und dass an eine Wiedervereinigung beider deutscher Staaten vorerst nicht zu denken war. Witsch akzeptierte die deutliche Akzentverschiebung in seinem Programm.
Bücher, Bücher, Bücher – mehr als 600 waren es unter Witschs Ägide. Und selbst wenn man sie kategorisiert, einsortiert, bewertet hat, ist man immer noch ein ganzes Stück davon entfernt, Verlag und Verleger in wesentlichen Zügen erfasst zu haben. Joseph Caspar Witsch war umtriebig wie kaum ein Zweiter seiner Kollegen in den anderen Verlagen der Republik. Leidenschaftliche Kämpfe trug er nicht nur um Autoren und deren Manuskripte aus. Witsch hatte auch die Veränderungen des Buchmarktes im Blick, mischte sich ein, als Vorsitzender von Gremien des Börsenvereins wie durch eigene Initiativen.
Kehren wir also vom Gipfel des Bücherbergs zurück in die karge Ebene, wo die strategischen Konflikte ausgefochten werden, wo man sich neuen Marktentwicklungen stellen und sie im eigenen Sinne nutzen oder beeinflussen muss.
Noch vor wenigen Jahren wurde um das Für und Wider von Hörbüchern gestritten. Eine neue Konkurrenz für das Buch? Eine sinnvolle Ergänzung? Heute lockt diese Frage niemanden mehr hinter dem Ofen hervor. Aktueller ist die Diskussion darüber, wie es Verlage mit E-Books halten sollten. Sie als bloße digitale Kopien der papierenen Vorlagen auffassen? Oder als eigenständiges Medium weiterentwickeln? Und wie begegnet man dem Online-Riesen Amazon? Konfrontation oder Kooperation? Zu Witschs Zeiten war das Schreckgespenst des stationären Buchhandels der Bertelsmann Lesering. Die Bertelsmänner pflegten im Rahmen einer aggressiven Marketingstrategie, ihre mobilen Bücherverkaufsstellen in unmittelbarer Nähe von Buchhandlungen zu parken und so unmittelbar vor Ort Geschäfte mit preisreduzierten Club-Ausgaben zu machen. Der Buchhandel tobte aus nachvollziehbaren Gründen. Und die Verlage? Konfrontation oder Kooperation? Letztlich mochten sie es sich mit beiden Seiten nicht verderben und gerieten deshalb wiederholt ins Fadenkreuz der Kritik des Handels. Briefe mit Boykottdrohungen machten die Runde. Witsch erkannte vor diesem Hintergrund früher als andere, dass Verlage Wege suchen müssen, sich die Vorteile eigenständiger Vertriebsgemeinschaften zunutze zu machen, um den Weg zum Leser zu finden. So entstanden zunächst die Bücher der Neunzehn als eigenständige Buchgemeinschaft der Verlage und später der Deutsche Taschenbuch Verlag – beide von Witsch inspiriert und durchgesetzt. Dass er auch frühzeitig die Bedeutung des Fernsehens für die Vermarktung von Verlagsobjekten erkannte und die Gründung einer Verlags- und Fernsehgesellschaft anstieß, ist ein weiteres Indiz für seinen bemerkenswerten Weitblick über den Tellerrand des eigenen Buchverlags hinaus.
Hat man sich erst in die Geschichte einer Gründergestalt wie Joseph Caspar Witsch vertieft, fällt es schwer, unberührt von seiner Persönlichkeit zu bleiben. Seine resolute Art, die Energie, mit der er die Projekte vorantrieb, haben etwas Faszinierendes. Hört man ihn in alten Rundfunksendungen, besticht die Eloquenz seines Vortrags, verblüffen seine Endlossätze, die irgendwann, wenn kaum mehr jemand damit rechnet, doch noch ihr passendes Ende finden.
Umso krasser fallen die Mängel auf. Witsch war kein Mann, der Ambivalenzen aushielt. Als Kalter Krieger kannte er bloß Rot und Schwarz, keine Schattierungen. Dass sein Kampf gegen die DDR, gegen die kommunistische Ideologie, gegen die »Feinde im Innern« mit dazu beitrug, das innenpolitische Klima der Republik zu vergiften, weil es all jene unter Kommunismusverdacht stellte, die der Politik des autoritären Adenauer-Staats mit Argwohn begegneten, dafür hatte Witsch keinen Blick. Und während andere Verleger geschäftstüchtig genug waren, regelmäßig die Treffen der »Gruppe 47« zu besuchen, um dort mit aufstrebenden Autorinnen und Autoren Verträge anzubahnen, blieb der Kölner Verleger den Treffen aus purem politischem Ressentiment gegenüber dem »linken« Friedensfreund Hans Werner Richter fern. Dem Programm des Verlages merkt man diese teilweise Abkopplung vom literarischen Geschehen bis in die 1960er Jahre deutlich an.
Und dennoch hat der Verlag unter Witschs Leitung ein überaus bemerkenswertes literarisches Programm zusammengebracht. Eine ganze Reihe dieser Bücher findet sich heute noch bei Kiepenheuer & Witsch, zum Teil auch in neuen Übersetzungen, wie beispielsweise die Werke Saul Bellows oder Jerome D. Salingers. Wiederum andere haben den Weg in andere Verlage gefunden oder werden aktuell nicht mehr verlegt, sind aber noch in Antiquariaten oder Büchereien zu bekommen. Insofern würde es mich freuen, wenn dieses Buch auch zu Neu- oder Wiederentdeckungen anregen würde.
Zuletzt noch einige Sätze zu den Umständen, unter denen dieses Buch entstand. Der »ganze« Witsch passte nicht zwischen zwei Buchdeckel, es bedurfte deren vier. Das Buch Witsch, der erste Band, erschien 2014 und liefert die Vorgeschichte zu diesem Buch: Witschs Jahre in der Weimarer Republik, seinen Aufstieg unter den Nationalsozialisten zum obersten Volksbibliothekar Thüringens, das Ende aller Kompromissmöglichkeiten unter den Bedingungen sowjetischer Besatzung im Osten Deutschlands, die Flucht in den Westen und den Aufbau seines Verlages. In puncto Literatur stehen im ersten Band jene Bücher im Mittelpunkt, die sich in unterschiedlicher Weise mit dem Thema Nationalsozialismus beschäftigten, und darüber hinaus die umfangreiche antikommunistische Literatur der frühen Jahre.
Man muss Das Buch Witsch nicht gelesen haben, um jetzt mit Dem Glücksrad in die Speichen greifen einzusteigen. Beide Bücher ergänzen einander zwar, weswegen es in diesem Buch auch hin und wieder Rückverweise auf einzelne Kapitel des ersten Bandes gibt. Beide Bände können aber auch unabhängig voneinander gelesen werden.
Das gesamte Projekt der Biografie Joseph Caspar Witschs hat unter dem Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln vom 3. März 2009 gelitten. Eine ganze Reihe von Dokumenten aus dem dort eingelagerten Archiv des Verlags Kiepenheuer & Witsch konnten nicht mehr gesichtet werden. Das betrifft vor allem Dokumente der Jahre 1963 bis zu Witschs Tod im Frühjahr 1967. Wo es mir möglich war, habe ich für den genannten Zeitraum auf Überlieferungen in anderen Archiven zurückgegriffen. Das gilt beispielsweise für den Briefwechsel Witschs mit Manès Sperber, der im Österreichischen Literaturarchiv in Wien einsehbar ist.
Festzuhalten ist auch, dass die biografische Erzählung eines Lebens nicht dieses Leben selbst ist. Jede Biografie über eine nicht mehr lebende Person ist nichts anderes als ein Konstrukt aus Papieren, die diese Person zurückgelassen hat oder die andere über diese Person verfasst haben. Hinzu kommen möglicherweise noch Objekte, die etwas über die Person aussagen können, oder Erinnerungen Dritter. Auch Dem Glücksrad in die Speichen greifen ist daher nichts anderes als eine Collage, gewonnen aus nachgelassenen Beständen und zusammengefügt von einem Autor, dessen Wertmaßstäbe und Interessen ebenfalls in seine Rekonstruktionsarbeit eingeflossen sind. Wichtig war es mir, das Leben des Joseph Caspar Witsch in die Zeit-, Kultur- und Mentalitätsgeschichte der ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte einzubetten, also zu zeigen, wie der Verleger von diesem breiten Geschichtsstrom geprägt wurde, wie er aber auch gleichzeitig Einfluss auf die politischen, kultur- und geistesgeschichtlichen Strömungen seiner Zeit nahm.
Und noch etwas: Eine Biografie ist keine Hagiografie. Heilige mögen Glaubenswelten aller Art bevölkern, im tatsächlichen Leben existieren sie nicht. Auch das Leben Joseph Caspar Witschs ist keine Heiligenvita. Dazu gibt es zu viel Disparates und Widersprüchliches darin. In einem abschließenden Kapitel habe ich versucht, der komplexen Persönlichkeit des »Patriarchen« – denn ein solcher war er – gerecht zu werden. Eine knappe Episode vom Ende seines Lebens mag einen winzigen Vorgeschmack darauf geben: Im Dezember 1966 wurde Joseph Caspar Witsch das Verdienstkreuz Erster Klasse für seine Leistungen angetragen. Eigentlich eine schöne Nachricht, die dem Verleger durchaus hätte schmeicheln können. Doch noch kurz vor seinem Tod lehnte Witsch die ihm zugedachte Auszeichnung verärgert ab. Er hatte erfahren, dass einem Fußballtrainer namens Josef Herberger wenige Tage zuvor das Große Bundesverdienstkreuz zuerkannt worden war. Es rangierte höher als die ihm selbst offerierte Auszeichnung. Hinter der – so Witsch – »analphabetischen Fußballanbeterei« mochte sich der selbstbewusste Streiter für die Buchkultur aber unter gar keinen Umständen einsortieren lassen.
1.»Von Bestsellern und anderen Büchern«
Das fremdsprachige Literaturprogramm
Favoriten des Verlegers: Henry James, Jean Giono, Saul Bellow, Czesław Miłosz, Kelvin Lindemann, Nathalie Sarraute, Bernard Malamud, Jerome D. Salinger, Soma Morgenstern – Georges Simenon und die Maigret-Krimis – Brendan Behans Irland – Patrick Whites Australien – Marek Hłasko: der »junge Wilde« und die Mühen eines Verlegers – ein besonderes Verhältnis: K & W und Ignazio Silone – »Türöffner« für lateinamerikanische Literatur in Deutschland: João Guimarães Rosas Epos »Grande Sertão«
Im Frühjahr 1949, Joseph Caspar Witsch war gerade mal ein Jahr als Verleger tätig, schrieb er vom damaligen Verlagsstandort Hagen einen Brief an Erich Thier; beide kannten sich aus Leipzig, wo Thier als Leiter der Deutschen Büchereischule gewirkt hatte. Witsch sprudelte vor Unternehmungsgeist: »In diesen Wochen werden fertig: Drei Franzosen (Peisson Edgars Reise und Seeadler und Aymé Der schöne Wahn), Werner von Grünau Indianersommer, ein Buch von Pandit Nehru, der erste Band der Rationalismus-Reihe mit einer ganz ausgezeichneten längeren Abhandlung von Bense über ›Die Existenz des Geistes und des Herzens bei Blaise Pascal‹, Materialien zu einer Existenzphilosophie des klassischen Rationalismus, und ein Joseph Roth-Gedächtnisbuch. Für den Herbst sind vorgesehen: ein ganz hervorragendes Werk von Theodor Geiger, der seit 1933 Soziologe in Aarhus ist, Klassengesellschaft im Schmelztiegel; das Buch geht jetzt in Druck; ein Buch von Ernst von Schenk Mit den Augen eines Europäers; noch zwei Franzosen; […] eine Biographie über Grundtvig; mehrere Jugendbücher und drei weitere Nummern der Rationalismus-Reihe; eine Biographie von Christine von Schweden; ein Band Gogol; ein Band Henry James und eine vollständige Ausgabe von Gullivers Reisen. Ich kokettiere noch mit einer vollständigen Ausgabe des Kapitals.«Hinweis
Auch wenn längst nicht alles von dem zustande kam, was Witsch im Stakkato aufgereiht hatte, so unterstreicht die Palette aus der Zeit des Verlagsaufbruchs doch bereits den Anspruch des Verlegers, sein Unternehmen inhaltlich wie formal möglichst breit aufzustellen. Nimmt man die rund 600 Titel in den Blick, die zwischen 1948 und 1967 bei Kiepenheuer & Witsch und den beiden Nebenverlagen, dem Verlag für Politik und Wirtschaft sowie dem Phaidon Verlag, erschienen sind, dann gewinnt man am ehesten eine Übersicht, wenn man die veröffentlichten Titel zumindest grob drei »klassischen« Programmsegmenten zuordnet: der Belletristik, die knapp die Hälfte aller Titel ausmachte, dem Sachbuch mit knapp 230 Titeln und der wissenschaftlichen Fachliteratur mit etwas mehr als 100 Titeln.Hinweis Auf die Frage, welcher der drei Bereiche das Erscheinungsbild von Kiepenheuer & Witsch am nachhaltigsten geprägt hat, muss man die Belletristik nennen; dies allein schon deshalb, weil eine ganze Reihe der damit verbundenen Autorinnen und Autoren bis heute im Bewusstsein geblieben und im Verlagsprogramm auch über die Ära Witsch hinaus weiterhin präsent sind. Man denke an Saul Bellow, Heinrich Böll, Erich Maria Remarque, Joseph Roth oder Nathalie Sarraute, um nur einige zu erwähnen.
Der Erfolg dieser wie auch anderer Autoren ist für Außenstehende am ehesten in Bücherlisten ablesbar, wie sie zum Beispiel »Der Spiegel« in Zusammenarbeit mit dem »Buchreport« erstellt, wie sie das »Zentrale Verzeichnis Antiquarischer Bücher« für gebrauchte Titel online vorlegt oder das »Manager Magazin« für Literatur aus dem Wirtschaftssektor ermittelt. Derlei Bestsellerlisten existieren in Deutschland seit den 1920er Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sie durch »Die Zeit« mit ihrem »Seller-Teller« und durch den »Spiegel« erst zu Beginn der 1960er Jahre wiederbelebt. In einer Ausgabe der literarischen Hauszeitschrift des Verlags Kiepenheuer & Witsch, »Die Kiepe«, aus dem Jahr 1964 hat Joseph Caspar Witsch die wachsende Bedeutung solcher Bestsellerlisten für den Büchermarkt zum Anlass einer sanften Kritik genommen. Zu einem Parforceritt gegen die Bestselleritis stand ihm 1964 nicht der Sinn, weil Hausautor Heinrich Böll die Belletristik-Parade im »Spiegel« mit seinen »Ansichten eines Clowns« aktuell vor Luchterhands Günter Grass mit den »Hundejahren« anführte. Aber Witsch hatte eine Idee – quasi zur Erweiterung: »Die Gefahr, daß die Vielfalt, von der die Literatur lebt, auf eine Auswahl von 6 oder 10 Titeln reduziert wird, wäre geringer«, sinnierte er, »wenn jeder Bestsellerliste eine zweite Liste mit empfehlenswerten literarischen Titeln, die keine Spitzenauflagen erreichten, beigegeben wäre.«Hinweis Und natürlich hatte er eine solche mit zehn eigenen Verlagsprodukten der Jahre 1954 bis 1963 gleich parat. Jedem dieser Bücher maß er »literarische Bedeutung« zu, denn »jedes hat ein Moment des Ungewöhnlichen, Unverwechselbaren, jedes dieser zehn Bücher ist Literatur der Zeit«.Hinweis
Es lohnt sich, bei der Auflistung zu verweilen, weil die genannten Einzeltitel die Konturen des literarischen Kosmos abstecken, den Witsch für seinen Verlag entworfen hat. Die Zusammenstellung sagt also auch einiges über die literarischen Präferenzen des Verlegers aus. Es ist aber noch aus einem weiteren Grund lohnenswert. Manche der genannten Titel sind heute noch verfügbar, einige wurden in wechselnden Verlagen wieder aufgelegt, andere aber sind zu Unrecht vergessen. Die Beschäftigung mit Witschs persönlicher Bestenliste ist so gesehen auch als eine Einladung zur Wiederentdeckung einzelner Autoren und ihrer Werke zu verstehen. Zumindest sollte sie Neugier wecken.
Favorit 1: Henry James – feinnerviges Verständnis für die Abgründe der Psyche.
Für das Jahr 1954 hatte Witsch als erstes Buch »Prinzessin Casamassima« von Henry James aufgeführt. Es war nach »Bildnis einer Dame« – 1950 noch aus dem Lizenzpool Gustav Kiepenheuers übernommen – der zweite große Roman des 1843 in New York geborenen und später nach England übergesiedelten Autors, den Witsch herausbrachte. Das über 600-seitige Werk spielt im London des späten 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht nicht die titelgebende Frauengestalt, sondern ein junger Buchbinder namens Hyacinth Robinson – ein »englischer Hanno Buddenbrook«, wie »Die Zeit« 1955 titelte.Hinweis Robinson schließt sich aus moralischen Überlegungen einem revolutionären Zirkel an, verliebt sich in die mit einem Italiener verheiratete Christina Casamassima und begeht am Ende vor der geplanten Ausführung eines Attentats auf einen britischen Adligen Selbstmord. Witschs Wiederentdeckung des amerikanischen Autors für den deutschen Markt war mehr als verdienstvoll; zwischen 1950 und 1966 erschienen acht Romane, ein Band mit Erzählungen sowie die einbändigen »Notebooks« bei Kiepenheuer & Witsch.Hinweis Hans Hennecke, der eigentliche Initiator der deutschen James-Ausgabe und Übersetzer der »Casamassima«, ordnete James in der »Kiepe« unter den nordamerikanischen Romanciers des 19. Jahrhunderts treffend als ersten »konsequente[n] Psychologen […] neben Dostojewskij und Marcel Proust«Hinweis ein, vergaß dabei aber zumindest noch Flaubert oder auch Stendhal und dessen 1830 angesiedeltes Epos »Rot und Schwarz« – eines der Lieblingsbücher Witschs – in den Vergleich mit einzubeziehen. Henry James, der in seinem Werk immer wieder die Differenz zwischen der amerikanischen und der europäischen Kultur thematisiert, hatte mit Robinsons Geschichte einen komplexen Überblick über die Gesellschaft seiner Zeit mit individualpsychologischen Studien seiner Protagonisten verbunden. Für ihn sei »das tiefe Dilemma des enttäuschten und reuigen Verschwörers ein Kapitel aus dem verworrenen Buch des Lebens, in dem die entscheidende Rolle eben nicht das ›Soziale‹, sondern das Drama einer Intelligenz [einnehme], die sich in eine bestimmte soziale Konstellation der Zeit verstrickt«,Hinweis hieß es in der »Gegenwart«. Vom »feinnervigen Verständnis für die Abgründe im psychischen Bereich – lange vor Freud, Joyce und Proust« schrieb die »Deutsche Zeitung«.Hinweis
Als zweiten Titel nannte Witsch für das Jahr 1955 Jean Gionos Roman »Der Husar auf dem Dach«,Hinweis eine Abenteuer- und Liebesgeschichte, die der Autor in den 1830er Jahren in der Haute Provence angesiedelt hatte, in einer Zeit, als dort eine Choleraepidemie wütete. Der Autor Michael Kleeberg hat den Reiz, den der 1951 in Frankreich erschienene Roman auch heute noch auszuüben vermag, eingefangen und beschrieben: »Die entsetzliche Cholera-Epidemie, die in dem Buch die Provence verheert und den Husaren, Angelo Pardi, den ein Lynchmob als vermeintlichen Brunnenvergifter ermorden will, auf die Dächer von Manosque treibt, wird mit Krankheitssymptomen beschworen, die in keinem Medizinlexikon dieser Welt zu finden sind, wie dem berühmten ›Milchreis‹, den jeder Sterbende kiloweise erbricht. Kluge Interpreten haben diese überdimensionierte, todbringende Cholera als Sinnbild für den Krieg oder das Böse interpretiert, aber selbst ein simpler Leser, der sie einfach als das nimmt, was sie ist, kommt auf seine Kosten. Jedenfalls ist dieser Epidemie eine der schönsten, keuschen Liebesgeschichten der modernen Literatur zu verdanken.«Hinweis
Favorit 2: Grenzenlose Wertschätzung brachte Witsch den Romanen Gionos entgegen. »Der Husar auf dem Dach« in der Lizenzausgabe des Rowohlt Verlags aus dem Jahr 1955.
Witschs Wertschätzung für die Bücher Gionos, der abgeschieden in der Provence lebte, war grenzenlos. Alle Welt wisse, dass er »in Giono vernarrt« sei, ließ er die Leser der »Kiepe« in einer Laudatio auf den Autor 1963 wissen und warb für einen neuen Band Erzählungen – »Der Schotte« – mit einer kleinen, persönlichen Geschichte: »Jean Giono hat mir diese Erzählung, höchst generös wie er ist, zu meinem 50. Geburtstag geschenkt. Sie wurde auf seinen Wunsch hin übersetzt und in einem Exemplar für mich gedruckt. Ich habe die Erzählung in den Jahren seitdem oft gelesen, und ich habe es bedauert, daß ich allein Nutznießer dieser köstlichen Novelle sein sollte. Ich war mir bewußt, daß ich, indem ich mir die Erlaubnis zur Auflage holte, fast in den Verdacht kommen müßte, ein Geschenk seiner Einmaligkeit zu berauben; aber dann schien mir wieder, daß der Geiz, auch in literarischen Angelegenheiten, ein Laster ist und daß man nicht allein behalten dürfte, was für viele ein reines Vergnügen sein könnte. Ich entschloß mich weiterzuverschenken, was mir allein zugedacht war und was ich lange genug allein behalten hatte. Damit war der Dichter einverstanden.«Hinweis
Giono galt lange Zeit als eine umstrittene Figur der Literatur- und der Zeitgeschichte. In der ersten Phase seines Schreibens hatte er Bücher verfasst, die – darin dem Norweger Hamsun ähnlich – äußerst erdverbunden waren, in Naturschilderungen schwelgten und das einfache Leben der Bauern und Hirten priesen. In seiner Heimat Frankreich fielen diese Bücher wegen ihres Provinzialismus durch. Der 1895 geborene Sohn eines italienischen Schuhmachers und einer südfranzösischen Büglerin galt nicht mehr als ein besserer Heimatdichter. Im Deutschland der 1930er Jahre waren seine Bücher dagegen äußerst populär.Hinweis Nach dem Krieg wurde Giono in Frankreich der Kollaboration mit den Deutschen verdächtigt und saß deshalb einige Monate im Gefängnis. Als Autor vollzog er mit Kriegsende eine Wende in seinem Schaffen und wandte sich nun Stoffen zu, in deren Mittelpunkt nicht mehr die Natur, sondern der Mensch mit seinen vielschichtigen Stärken und Schwächen stand. In Frankreich wurde das honoriert; Giono heimste Literaturpreise ein und wurde in die renommierte Académie Goncourt gewählt. In Deutschland versuchte nach 1945 zuerst der Verlag Klett-Cotta, die heimische Leserschaft mit den Büchern »Der Husar auf dem Dach«, »Ein König allein« und »Angelo Pardi« für den »neuen« Giono zu begeistern. Der Erfolg war mäßig, die Verkaufsauflagen blieben unter mageren 1500 Exemplaren, und Klett-Cotta verlor das Interesse an dem Franzosen. Im Sommer 1955 verhandelte Witsch nach einem Besuch bei Giono in Manosque mit dessen französischem Verlag Gallimard, der – so Witsch – »offensichtlich eine völlig verdrehte Vorstellung von dem Ganzen hatte«,Hinweis und einigte sich mit Klett-Cotta über die Abnahme der noch nicht verkauften Bücher und bereits gedruckter Rohbogen. Im Herbst 1955 widmete er Giono zur Buchmesse eine achtseitige Sonderausgabe der »Kiepe«; kein zweiter Autor wurde in der Hauszeitschrift jemals wieder in dieser Weise gewürdigt. Den einführenden zweiseitigen Beitrag »Für Jean Giono« verfasste Witsch selbst. »Über die Grösse eines Schriftstellers und über die Torheiten eines Verlegers« hatte er ihn untertitelt, und mit den »Torheiten« war der eigene Versuch gemeint, einen Autor, der eigentlich bereits durchgefallen war, neu am Markt zu etablieren. Gionos Werke zählten »zu dem Bedeutendsten […], was die neue Literatur in Europa überhaupt hervorgebracht hat«, postulierte Witsch und schwärmte von der »mächtigen poetischen Kraft« seiner Bücher, »die aber durch scharfe intellektuelle Einschübe bereichert und intensiviert worden« sei. Von der Lektüre dieser Bücher gehe »eine ähnlich faszinierende Wirkung aus wie von ROUGEETNOIR von Stendhal«Hinweis – ein Vergleich, der aus Witschs Mund einer Erhebung in den literarischen Adelsstand gleichkam.
In der »Kiepe« hat Witsch eine ganze Reihe von Literaturkritikern und Autoren über Giono zu Wort kommen lassen, darunter Karl Korn (»FAZ«), Walter Lennig, Paul Hühnerfeld (»Die Zeit«) und Rolf Schroers. Bereits zuvor hatte er in Briefen an Multiplikatoren und Autoren um Unterstützung für sein Publikationsvorhaben geworben. Er ging darin auch auf die politischen Vorbehalte gegenüber Giono ein und erledigte sie salopp im Geist des Kalten Krieges. An Heinrich Böll schrieb er: »Jahrelang ging das Gerücht, daß Giono mit den Deutschen cooperiert habe. Abgesehen davon, daß Gionos Bücher schon lange vor 1933 in Deutschland verlegt worden sind, abgesehen davon, daß Giono auch während des Dritten Reiches, sogar während des Krieges, die Beziehungen zu alten deutschen Freunden aufrechtzuerhalten versucht hat, ist an dem Vorwurf der Collaboration kein Wort wahr. Giono hat sich als Mitglied der französischen Widerstandsbewegung in der letzten Etappe des Krieges gegen gewisse sinnlose Terrorismen gewandt. Französische Kommunisten haben dann nach 1945 daraus den Vorwurf der Collaboration gegen Giono erhoben, wie auch gegen viele andere, die nicht bereit waren, ihre Diktatur anzuerkennen.«Hinweis
In einem Schreiben an den in Genf lebenden Kritiker und Schriftsteller Werner Helwig, der sich skeptisch gegenüber der politischen Gesinnung Gionos geäußert hatte, wurde Witsch noch deutlicher: »Sie hören in Paris, gleich mit wem Sie sprechen, einschließlich Montherlant, einen einstimmigen Hymnus auf Giono, und der schärfste Vorwurf, den ich gegen ihn gehört habe, war der daß er ein unverbesserlicher und radikaler Pazifist sei […]. Er kämpfte seinerzeit dagegen, daß x-beliebige, armselige Obergefreite irgendwelchen Attentaten zum Opfer fielen; diese Obergefreiten seien in seinen Augen genau so unschuldig und genau so Opfer des Hitlerismus wie die Franzosen selbst, wenn schon Attentate, dann sollten sie auf verantwortliche Personen ausgeübt werden, usw., usw. Sie wissen selber, wie viele integre Leute nach der Befreiung Frankreichs durch die Kommunisten umgebracht worden sind, sozusagen prophylaktisch, und Giono stand auch auf dieser Liste.«Hinweis Immerhin bewirkte Witsch mit seiner beherzten Fürsprache, dass Helwig drei Giono-Rezensionen noch einmal zurückbeorderte, »um einige mittelscharfe Worte in mittel-milde zu verwandeln«, obwohl er nach wie vor argwöhnte, Gionos »politische Weste« sei »nicht ganz so fleckenlos, wie es sein deutscher Verleger« wünsche.Hinweis Witsch war zufrieden und konnte einräumen: »Nun gut, ich glaube zwar immer noch an die Fleckenlosigkeit – fleckenlos, was Charakter und Willen angeht, vielleicht ein paar Eintrübungen per Narretei und Irrealismus. […] Wichtig ist jedoch, daß dieser neue Giono ein außergewöhnlicher Schriftsteller geworden ist und daß es nicht viele davon in der gegenwärtigen europäischen Literatur gibt.«Hinweis
1955 bescherte Witsch dem deutschen Publikum gleich vier Giono-Bände auf einen Streich: »Angelo Pardi«, »Der Husar auf dem Dach«, »Die Polnische Mühle« und »Ein König allein«; ein Jahr später folgte die Aufarbeitung einer realen Kriminalgeschichte: »Der Fall Dominici«; 1957 und 1959 erschienen die Romane »Die starken Seelen« und »Das unbändige Glück«, und 1963 kam der bereits erwähnte Band mit zwei Erzählungen: »Der Schotte« und »Faust im Dorf«. 1989 legte der Verlag den »Husaren« noch einmal in einer Neuübersetzung auf,Hinweis 1995 wurde er in einer aufwendigen Produktion verfilmt; Juliette Binoche war in der weiblichen Hauptrolle der Pauline de Théus zu sehen, Gérard Depardieu in der des Polizeikommissars von Manosque.
Favorit 3: »Dieser Roman ist zu groß – er entzieht sich der Rezension«, befand Heinrich Böll über Saul Bellows »Die Abenteuer des Augie March«. Den Schutzumschlag des Bandes gestaltete Wolf D. Zimmermann.
Als dritten Titel hatte Witsch für das Jahr 1956 »Die Abenteuer des Augie March« von Saul Bellow und damit ein außergewöhnliches Schwergewicht der US-amerikanischen Literatur genannt.Hinweis Bellow, 1915 in Kanada, in einem Vorort Montreals, als Sohn einer aus St. Petersburg emigrierten Familie geboren und in Chicago aufgewachsen, zählte in den 1950er/60er Jahren zu jenem Kreis der »New York Jewish Intellectuals«, aus dem auch der Kongress für kulturelle Freiheit (← Band 1, Kapitel 12) Aktivisten und Inspiration empfing.Hinweis Im Frühjahr 1960 war er im Rahmen eines Deutschlandbesuchs auch Gast einer »Kongress«-Veranstaltung.Hinweis Das deutsche Lesepublikum an Bellow heranzuführen, sollte auf Witschs Wunsch Heinrich Böll übernehmen. Er hatte ihn daher kurzfristig gebeten, »Augie March« in der »Kiepe« vorzustellen. Böll muss sich durch die Bitte in seiner atlantischen Inselidylle gestört gefühlt haben und begann seinen Beitrag: »Hier in Irland telegraphisch aufgefordert, innerhalb eines Nachmittags drei Schreibmaschinenseiten über Bellows Abenteuer des Augie March zu schreiben, gerate ich in vollkommene Verlegenheit.« Im weiteren Verlauf seiner Besprechung erkannte er: »Dieser Roman ist zu groß – er entzieht sich der Rezension, weil er soviel Leben enthält: Kämpfe und Niederlagen in den Slums von Chikago, Kämpfe und Niederlagen in Hotels, die für Millionäre reserviert sind; Schmutz und Betrug, eine grandiose Absage an die Hygiene, und die merkwürdigen Sehnsüchte dieses Augie March, der den Weg des geringsten Widerstands geht, aus einer Art existenzieller Liebenswürdigkeit – und den harten, zielbewußten, brutalen Bruder Simon, der Dollars macht, während der schwachsinnige George in einem Heim Besen bindet; diese großartige Oma Lausch, eine Emigrantin aus Odessa, die in der Normierung eines Altersheims langsam dahinstirbt, wie ein Adler im Käfig.«Hinweis
Für die Rezeption zeitgenössischer US-amerikanischer Literatur in Deutschland von Autoren wie Bernard Malamud, Jerome D. Salinger oder William Faulkner wirkte diese Mischung aus prallem Leben, exotischen Schauplätzen und mitunter an filmische Schnitttechniken erinnernden Konstruktionsprinzipien geradezu befreiend. »Nach zwölf Jahren Pathos im Alltag […] zog man ungeschminktes Leben in der Literatur einem transzendierenden Zugriff vor«, bemerkt Martin Meyer über den neuen Trend. »Umgangssprache im parataktischen Stil unterstrich das Unprätentiöse, szenische Darstellungen überließen moralisierenden Erzählerkommentaren keinen Raum. Der Leser durfte urteilen – eine Wohltat nach zwölf Jahren vorgefertigter Denk- und mundgerechter Sprachschablonen.«Hinweis
Im Jahr 2009 bestätigte sich zum wiederholten Mal, dass Witsch mit dem Kauf der Bellow-Lizenz den richtigen Riecher gehabt hatte.Hinweis Kiepenheuer & Witsch brachte seine drei bekanntesten Romane »Augie March«, »Herzog« und »Humboldts Vermächtnis« in überarbeiteten beziehungsweise in neuen Übersetzungen heraus. Bellows deutsche Lektorin Bärbel Flad, die zuvor bereits Übertragungen von Gabriel García Márquez, Don DeLillo und Jean Marie Gustave Le Clézio lektoriert hatte, fand in einem Verlagsspecial über Saul Bellow präzisere Worte zum Inhalt der Geschichte als Böll: »Augie, 1915 geboren, im selben Jahr wie Saul Bellow, wächst mit seinen Brüdern ohne Vater in großer Armut an der South Side Chicagos bei seiner fast blinden Mutter auf. Um die Erziehung der Kinder bemüht sich die Untermieterin Oma Lausch, die vor ihrer Emigration noch den Glanz des zaristischen Russlands kennengelernt hat. Während der ältere Bruder Simon sich anstrengt, aus diesem ärmlichen Milieu herauszukommen, lässt sich Augie eher treiben. Er arbeitet als Faktotum für neureiche jüdische Familien, sieht, wie man reich wird und dann während der Depression das Geld wieder verliert. Er studiert ein bisschen, wird fast kriminell, arbeitet für die Gewerkschaften – ein oft naiver, optimistischer Beobachter einer brodelnden Stadt und ihrer Bewohner. Mit seiner großen Liebe Thea geht Augie nach Mexiko, wo Thea mit einem gezähmten Adler Leguane jagen will, die teuer an Zoos verkauft werden sollen. Der Adler ist aber so zahm, dass er sich vor den Leguanen fürchtet, und Augie genügt letztlich auch nicht den an ihn gestellten Erwartungen. Die Liebe zerbricht. Nach einer großen Krise findet Augie Stella, die er zu Beginn des 2. Weltkriegs in New York heiratet, bevor er als Marinesoldat nach Afrika eingeschifft wird. Auf der Überfahrt wird das Schiff torpediert, er überlebt knapp und unter absurden Umständen in einem Rettungsboot. Die Nachkriegsjahre verbringt Augie mit Stella in Paris. Erfolgreich im boomenden Schwarzhandel tätig, ist er wieder optimistisch auf der Suche nach einem neuem Lebensinhalt.«Hinweis
Dass literarische Übersetzungen nach einigen Jahrzehnten der Überarbeitung bedürfen, ist nicht außergewöhnlich. Böll hatte in seiner strapaziösen Nachmittagsarbeit bereits darauf hingewiesen, es sei »eine außerordentliche Leistung [gewesen], die Übersetzung dieses Buches gewagt zu haben, eine Arbeit, die Alexander Koval nur übernehmen konnte, da er auf eine persönliche Weise sich in die Bilder- und Stilwelt Bellows versetzen und nur dadurch dessen großartige, mit Slang wie mit Hefe durchsetzte Sprache übertragen konnte«.Hinweis Er selbst war an der Übersetzungsleistung nicht ganz unbeteiligt gewesen, wie aus einem Brief Witschs hervorgeht. »The Adventures of Augie March« sei »nach der Meinung eines jeden, der es mit Verstand gelesen hatte, vollkommen unübersetzbar«, hatte Witsch dem Kritiker und Redakteur der »Welt«, Willy Haas, noch im Sommer 1959 mitgeteilt. Der Verlag habe »drei Jahre« für die Übersetzung benötigt und Koval »viele[r] Assistenzen, unter anderen der von Böll«Hinweis bedurft. Haas hatte sich bereits zuvor zu einem anderen Buch Bellows, zu »Henderson the Rain King«, geäußert und dieses »für vollkommen unübersetzbar«Hinweis erklärt. Witsch hatte in diesem Fall auf die Fertigkeiten Herbert A. Frenzels gesetzt, dem Herausgeber der »Daten deutscher Dichtung« offensichtlich aber zu viel zugetraut, wie einem Schreiben der Auslandslektorin des Verlags Alexandra von Miquel vom April 1960 zu entnehmen ist. »Die deutsche Fassung wird jetzt hier von unserem Lektorat ein zweites Mal durchgesehen und stilistisch korrigiert«, schrieb sie im April 1960 an Bellow. »Wir hatten leider, aber das haben Sie uns schon aufgrund Ihres persönlichen Eindrucks von Dr. Frenzel prophezeit, noch sehr viel Arbeit damit.«Hinweis Die weiteren Übersetzungen der Werke Bellows übertrug Witsch dem Journalisten und Schriftsteller Walter Hasenclever (1910–1992)Hinweis, der von Oktober 1957 bis Ende 1959 das Berliner Büro des Kongresses für kulturelle Freiheit geleitet hatteHinweis, den Verlag hin und wieder mit Informationen über Neuerscheinungen des US-amerikanischen Buchmarkts versorgte und zur Zufriedenheit Witschs als AußenlektorHinweis arbeitete. Ob er dem US-amerikanischen Autor damit einen Gefallen getan hatte, ist fraglich. 1982 befand Marcel Reich-Ranicki in der »FAZ«: »Die Übersetzungen fast aller Bücher Saul Bellows stammen von Walter Hasenclever. Und es muss endlich offen gesagt werden: Sie sind schlecht. Und es macht die Sache nicht besser, dass die deutsche literarische Öffentlichkeit es unterlassen hat, gegen diese kontinuierliche Entstellung der Prosa des großen Amerikaners rechtzeitig zu protestieren.«Hinweis 2009 war die Kritik dann voll des Lobes für die Neuübersetzungen von »Augie March« durch Henning Ahrens, von »Humboldts Vermächtnis« durch Eike Schönfeld und von »Herzog« in der Überarbeitung von Bärbel Flad.Hinweis Bellow konnte in Deutschland zum zweiten Mal entdeckt werden.
Das vierte Buch, das Witsch für das Jahr 1957 genannt hatte, stammt von demselben Autor, mit dessen Band »Verführtes Denken« der Verlag 1953 bereits einen späteren Klassiker der antikommunistischen Essayistik über das Verhalten der Intelligenz im kommunistischen Staat vorgelegt hatte: Czesław Miłosz. Im November 1954 hatte Miłosz dem Verlag seinen gerade im Entstehen begriffenen, autobiografisch inspirierten Roman »Tal der Issa«Hinweis angeboten. »The novel does not have anything to do with politics«, teilte Miłosz Witsch mit und wies auf absehbare Übersetzungsprobleme hin: »It is maybe difficult to translate because of a great simplicity of style and a number of details pertaining to the life of a village.«Hinweis Witsch war dennoch erfreut über die Offerte, akzeptierte dankbar allein aufgrund des Exposés und versprach, einen literarischen Übersetzer zu suchen, der den atmosphärischen Besonderheiten des Buches gerecht werden könne. Miłosz’ Entwicklungsroman spielt im polnisch-litauischen Grenzraum, in einer Urlandschaft, über die die Zeit hinweggegangen ist. In ihr verlebt Thomas Dilbin, das Alter Ego des Autors, seine Kindheit im Gutshaus seiner Großeltern. Es ist eine geheimnisvolle Welt, in der der Aberglaube wuchert, Dämonen das Tal der Issa bevölkern und ein strenger Katholizismus die Menschen in Fesseln hält. Miłosz lässt diese Welt in einem bedächtigen, breiten Erzählstrom fließen, in einem »epischen Phlegma des Ostens«,Hinweis wie Siegfried Lenz angemerkt hat; Walter Widmer sprach von »unerhört kunstvoll durcheinandergewoben[en]«Hinweis Handlungsschichten. Die literarische Kritik reagierte auf das Erscheinen des »Tals der Issa« durchweg positiv, mitunter euphorisch. Lediglich aus dem publizistischen Umfeld der katholischen Büchereien Österreichs kamen Warnungen: »Sittlich unsauber, religiös bedenklich«Hinweis fanden die »Bücherei-Nachrichten« aus Salzburg Miłosz’ Roman; und die Schrifttumsstelle des Katholischen Jugendwerks Österreichs monierte »krasse Stellen« – gemeint war ein sogenannter Hostienfrevel – und empfahl den Bibliothekaren abschließend kurz und knapp: »abzulehnen«.Hinweis
Favorit 4: Czesław Miłosz entführt die Leser mit dem »Tal der Issa« in eine geheimnisvolle Welt, in der noch der Aberglaube wuchert. Die Umschlaggestaltung besorgte Martin Kausche.
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, wurde in den Rezensionen auch die Übersetzung sehr lobend hervorgehoben. Witsch hatte Maryla Reifenberg mit der Aufgabe betraut, die Frau des früheren Redakteurs der »Frankfurter Zeitung« und Mitherausgebers der »FAZ«, Benno ReifenbergHinweis. In dessen Blatt schwärmte Helene Henze, selbst Übersetzerin von Jane Austen, in poetischen Tönen davon, der Roman habe »in Maryla Reifenberg eine Uebersetzerin gefunden, die in seinem Sprachwesen von Geburt heimisch ist und in beiden Sprachen lebt und schreibt. Liebevoll, mit dichterischer Sensibilität trägt sie ins Deutsche hinüber, worin man das Originale errät: den ruhigen Fluß, das schlicht Genaue, das Unsagbares einfließen lässt; das Wort, das sich dem auslaufenden Satz noch hinzufügt, wie mit nachträglichem Pinselstrich ein Bild vollendend. So wahrt die Uebertragung einen leisen fremdartigen Ton. Zuweilen klingt es, als hörte man einen Baltendeutschen sprechen.«Hinweis Von einer »ausgezeichneten Übersetzung«Hinweis, von einem »sorgfältig aus dem Polnischen übertragene[n] Roman«Hinweis und von einer Übersetzung, die sich »offensichtlich sehr genau an die polnische Fassung« halte und »sich doch wie ein deutsches Originalwerk« leseHinweis, war anderswo die Rede.
Doch gerade wenn Rezensenten von Übersetzungsleistungen fabulieren – deren Qualität sie mangels eigener Kenntnisse der Originalsprache oft gar nicht beurteilen können –, lohnt ein Blick hinter die Kulissen des Literaturbetriebs. In diesem Fall ist er möglich. Witsch hatte den übersetzten Text von Maryla Reifenberg zunächst an Sabine Brandt weitergereicht, die nicht nur zeitweise das Kölner Büro des Kongresses für die Freiheit der Kultur betreute, sondern für den Verlag auch lektorierte. Sie erinnert sich noch heute an das »Tal der Issa«: »Und ich habe gesagt, ›Herr Dr. Witsch, da sind Sätze drin, die kann ich nicht verstehen. Ich müsste jemanden fragen.‹ Ich habe die meisten Sachen vergessen, aber einen Satz nicht, der hieß ›Onkel Oskar war umfangreicher als sein Körper‹. Ich sagte: ›Wie soll ich das denn in einen vernünftigen deutschen Satz bringen, ich weiß gar nicht, was er meint. Ich kann mir was denken, aber hat er sich das auch gedacht?‹ Und dann hat Witsch gesagt: ›Sie dürfen die Frau [Reifenberg] aber nicht fragen.‹ Die Frau stammte aus Polen, und deshalb hatte er ihr die Übersetzung anvertraut, und sicherlich konnte sie ganz hervorragend Polnisch, aber Deutsch wohl nicht so hervorragend. Und ich durfte sie nicht fragen, damit sie nicht herauskriegte, dass er mir ihre Übersetzung zur Überarbeitung gegeben hatte. […] Ich glaube, vier Monate habe ich daran gesessen, denn ich musste sehr oft auf meinem Bleistift kauen, um einen Satz zu verstehen und ihn in eine vernünftige deutsche Form zu bringen.«Hinweis
Witsch war mit dem Ehepaar Reifenberg befreundet und hielt trotz der negativen Erfahrung an Maryla Reifenberg als Übersetzerin fest. Doch die Geschichte wiederholte sich. Im September 1960 – Czesław Miłosz wartete gespannt auf die deutsche Übersetzung seiner zwei Jahre zuvor im Original erschienenen Essaysammlung über die Identität Mitteleuropas »West- und Östliches Gelände«Hinweis – musste Witsch dem Autor zu seinem »großen Bedauern« mitteilen, »die Übersetzung von Frau Reifenberg [müsse] durchgehend, also Seite für Seite, überarbeitet werden«. Es sei »eine sehr umständlich zu lesende deutsche Version entstanden […], die auch grammatikalisch, im Ausdruck und in der Anordnung der Sätze nicht sehr gelungen ist«.Hinweis Der Erscheinungstermin wurde verschoben, und Sabine Brandt bekam erneut eine Rohübersetzung auf den Tisch.
Die internen handwerklichen Probleme mit der Übersetzung des »Tals der Issa« gelangten nicht an die Öffentlichkeit. 1999 brachte die viel gepriesene, von Hans Magnus Enzensberger herausgegebene »Andere Bibliothek« den Band erneut heraus – in der alten Übersetzung. 2002 zog der Suhrkamp Verlag mit einem Taschenbuch auf derselben Grundlage nach.
Als fünftes Buch des Jahres 1958 hatte Witsch »Ein Abend in Kopenhagen« von Kelvin Lindemann genannt. Das war etwas geschummelt, denn Lindemanns Roman war in der Übersetzung von Herbert A. Frenzel bereits 1955 bei Kiepenheuer & Witsch herausgekommen; damals in einer Auflage von 4000 Exemplaren.Hinweis Bei dem 1958 erschienenen Buch handelte es sich um eine gemeinsam mit der Büchergilde Gutenberg produzierte Neuausgabe,Hinweis die durch mehr als 50 Illustrationen des renommierten Dresdener Malers und Zeichners Gunter BöhmerHinweis zusätzlich aufgewertet worden war. Witsch hatte den »Abend in Kopenhagen« mit Lindemann im Dezember 1955 in Köln vorgestellt. »Ich hoffe immer noch sehr zuversichtlich«, hatte er nach Vorliegen der ersten Rezensionen im Januar 1956 geschrieben, »daß wir Ihr Buch mit Hilfe dieser vielen guten Besprechungen aus dem bloß freundlichen Dahermarschieren in einen langsamen Trab bringen können.«Hinweis Das Buch, das Autor und Verleger in Köln zusammengeführt hatte, war zuerst in Dänemark unter dem Pseudonym Alexis Hareng erschienen. »Die gesamte Weltliteratur wurde der Autorenschaft verdächtigt – nur auf einen Landsmann tippte man nicht«,Hinweis amüsierte sich der Literaturkritiker Paul Hühnerfeld in Witschs »Kiepe« über das Versteckspiel und lieferte anschließend einen präzisen Abriss von Inhalt und Stellenwert des gut 200 Seiten umfassenden Romans: »Ein Abend des Jahres 1853 in Kopenhagen: drei Menschen treffen sich zu einer kleinen Geburtstagsfeier: die über 80 Jahre alte Geheimrätin Hermione Schnell, die Gutsbesitzerin van der Hooglant (nicht wesentlich jünger) und der Professor der Zoologie Iselin, das Geburtstagskind, das gerade an diesem Tag sein 60. Lebensjahr vollendet hat. Drei Menschen, die auf viele Weise miteinander verbunden sind (wie sich erst am Ende des Romans herausstellt) und die nun nichts anderes tun, als sich – einen Abend lang – Geschichten zu erzählen. Das aber sind ganz verzwickte Geschichten: während man sie liest und sich den Figuren, von denen sie handeln […], ganz hingeben möchte, spürt man, daß all diese Geschichten in Wirklichkeit nicht um ihrer selbst willen erzählt werden […]: sie werden vielmehr erzählt, um der eigenen Existenz der drei Erzähler jetzt, am Abend des Lebens, auf die Spur zu kommen. In all ihrer Dramatik, ihrem pointenreichen Ablauf stehen die Geschichten für das Sein selbst […]. Welch ein Roman!«Hinweis Neben Hühnerfeld ließ Witsch in der »Kiepe« auch Lindemann selbst zu Wort kommen, der sich zum Thema »Literatur und Unterhaltung« äußerte und seinen Roman selbstbewusst der »Unterhaltung« zuordnete: »Wenn Ihnen also irgend jemand sagt, daß das Buch […] ein Stück transzendentaler symbolistischer Literatur ist, das auf der Ehrfurcht gebietenden europäischen Tradition basiert – dann glauben Sie das ja nicht!«Hinweis
Favorit 5: Kelvin Lindemanns »Abend in Kopenhagen« mit Zeichnungen des Dresdener Malers Gunter Böhmer.
Die Liaison zwischen Kelvin Lindemann und dem Verlag Kiepenheuer & Witsch war nicht von allzu langer Dauer. 1962 erschien noch der Roman »Nachtfalter und Lampion«Hinweis – dabei blieb es. Lindemann und Witsch konnten sich auf keinen gemeinsamen Kurs bei weiteren Veröffentlichungen verständigen. Lindemann hatte die Vorstellung, leicht verkäufliche Ware in Deutschland direkt über eine Buchgemeinschaft anzubieten und mit Kurzgeschichten in Illustrierten weiteres Geld zu machen, außerdem verfolgte er gemeinsame Projekte mit dem Kindler Verlag. Witsch lehnte das natürlich ab und erläuterte Lindemann seine Position in einem einfühlsamen Schreiben.Hinweis Gegenüber Herbert A. Frenzel bekannte er auch seine Zweifel an der Erfolgsträchtigkeit von »Nachtfalter und Lampion«, eines lediglich »geschickt gemachte[n] Romänchen«,Hinweis wie er schrieb, und wünschte sich, dass »Lindemann an einem modernen Stoff seine Künste zeigen« würde, erwog aber auch bereits, »ihn laufen [zu] lassen, wohin er laufen will«.Hinweis So blieb es dabei, dass aus Lindemanns Feder einzig der »Abend in Kopenhagen« seinen Platz in Witschs Literatur-Olymp behaupten konnte.
Favorit 6: Ein Nouveau Roman für Deutschland – Nathalie Sarrautes »Martereau«. Den Umschlag gestaltete Hannes Jähn.
Die bislang von Witsch aufgeführten Werke zählen zu den traditionellen, »klassischen« Romanen in der Erzähltradition von Balzac, Flaubert, Tolstoi und anderen. Das sechste Buch, das er in seine Literaturliste aufnahm, bedeutete einen Bruch mit dieser Tradition. Es handelt sich um Nathalie Sarrautes Roman »Martereau«Hinweis. Das 1953 bei Gallimard verlegte Werk stand am Anfang der von Frankreich ausgehenden literarischen Neuerungsbewegung des Nouveau Roman, der als wichtigste Protagonisten neben Sarraute Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Robert Pinget und Claude Simon angehörten. Ihnen gemeinsam ist die Konzentration auf den Prozess der reinen Wahrnehmung einer Sache oder eines Handlungsablaufs, die chronologische Erzählform ist aufgelöst, der Erzähler selbst verweigert sich der Position des Allwissenden und Wertenden. Dem Leser selbst bleiben Sinngebung und Wertung überlassen. Entsprechend war auch »Martereau« konstruiert. Alle Personen dieses Romans sind namenlos – mit Ausnahme des um seine materielle Existenz kämpfenden, schwer arbeitenden Martereau. Als Gegenwelt zu ihrer Hauptfigur entwarf Sarraute eine bourgeoise Kaufmannsfamilie, in der der Erzähler, ein lungenkranker junger Mann, auf Heilung wartet und übersensibel – in inneren Monologen – die Personen seiner Umgebung und die banale Stumpfheit des ihn umgebenden Milieus registriert. Witsch stellte den 1959 erschienenen Roman in der »Kiepe« vor und zitierte dazu die Literaturkritikerin und Übersetzerin Sigrid von Massenbach: »Wir kennen den Schauplatz, auch die Personen sind uns vertraut. Es sind ›an sich‹ noch die gleichen Figuren des psychologischen Bürgerlichen Romans. Allerdings haben sich Prämisse und ›Schreibweise‹ grundlegend verändert. Die Personen sind ›da‹, ohne jeden Kommentar, sie werden nicht erklärt, sie werden in keinerlei Atmosphäre oder Umwelt eingefügt. Einzig durch den Gebrauch ihrer Gemeinplätze, durch den Hang zu bestimmten stereotypen Vorstellungen und Bildern werden sie charakterisiert. Die Personen schaffen sich selbst ihre Umwelt in der Abfolge ihrer höchst komplizierten und mit mathematischer Genauigkeit wiedergegebenen Reaktionen. Es gibt keine Rätsel und keine Geheimnisse. Die Darstellung wird zum Akt der Enthüllung, der sich in sukzessiver und immer weiter verengender Einkreisung vollzieht.«Hinweis
Sarrautes Roman war 1953 in Frankreich nur auf ein geringes Echo gestoßen. Sechs Jahre später in Deutschland war das nicht viel anders, zu ungewohnt erschien die spröde, distanzierte Art der Darstellung. Witsch hielt dennoch an der Autorin fest, brachte 1960 »Das Planetarium« heraus, ließ 1962 das »Porträt eines Unbekannten« und 1963, als Auftakt einer zusammen mit Manès Sperber initiierten Essayreihe, Reflexionen über den Roman »Zeitalter des Argwohns« folgen.Hinweis Zu Beginn der 1960er Jahre gab es auch Initiativen, Sarraute in Deutschland bekannter zu machen. Die französischen Kulturinstitute von Saarbrücken, Mainz und Frankfurt, die TH Stuttgart, an der Witschs Freund Max Bense lehrte, und die Universität Freiburg luden sie zu Lesungen ein.Hinweis 1964 wurde Sarraute in Salzburg der Internationale Literaturpreis für ihren Roman »Les fruits d’or« verliehen – nach heftigen Kontroversen zwischen den verschiedenen Länderdelegationen, zwischen Traditionalisten und Neuerern.Hinweis Noch im selben Jahr erschienen »Die goldenen Früchte«Hinweis bei Kiepenheuer & Witsch wie auch die bis dahin vorliegenden Romane Sarrautes in der Übersetzung von Elmar Tophoven.
Von Nathalie Sarraute und dem Nouveau Roman ließe sich der Faden durch Witschs Verlagsprogramm weiter spinnen – hin zu der von Dieter Wellershoff Mitte der 1960er Jahre begründeten »Kölner Schule des Neuen Realismus«. Aber dazu später mehr (→ Kapitel 4).
Als siebtes Buch nannte Witsch für das Jahr 1960 Bernard Malamuds Roman »Der Gehilfe«.Hinweis Malamud – 1914 in Brooklyn geboren – ist derselben Autorengeneration zuzurechnen wie der 1915 geborene Saul Bellow. Beide zählen zur Gruppe der amerikanisch-jüdischen Autoren, und ihre von Witsch aufgeführten Romane sind in den jüdischen Communities New Yorks beziehungsweise Chicagos angesiedelt. Beide bezogen Stipendien der Ford Foundation zur Förderung ihrer literarischen Arbeiten und prägten durch ihre Mitarbeit an der »Partisan Review« und dem »New Yorker« die literarische Entwicklung der 1950er Jahre in den USA entscheidend mit. Beide wurden mit dem »National Book Award« ausgezeichnet, dem renommiertesten Literaturpreis der USA – Bellow 1954 für »Die Abenteuer des Augie March« und Malamud 1959 für seinen Kurzgeschichtenband »The Magic Barrel«, in deutscher Übersetzung 1962 »Das Zauberfaß und andere Geschichten«.
Favorit 7: Bernard Malamud und seine Legende von »Schuld und Sühne« aus Brooklyn: »Der Gehilfe«.
»Der Gehilfe« spielt im ärmlichen Kleinbürgermilieu Brooklyns. Dort lebt der Krämer Morris Bober, der mit seinem Laden die eigene Familie so eben über Wasser halten kann. Eines Abends wird er überfallen und verletzt. Einer der Täter – der aus Italien stammende Frank Alpine – kehrt kurz nach der Tat zu Bobers Laden zurück, um wiedergutzumachen, was er angerichtet hat. Er wird zu Bobers »Gehilfen«, verrät ihn aber weiterhin durch kleine Diebstähle, wird schließlich geläutert, heiratet Bobers Tochter und führt nach dem Tod des Krämers dessen Laden weiter. Eine »Legende von Schuld und Sühne« (»Neue Zürcher Zeitung«) mochten viele in dem Roman sehen, Parallelen zu Joseph Roths »Hiob« wurden gezogen,Hinweis und die »unpathetische, geradezu trockene Erzählweise, der nüchterne Realismus«Hinweis erfuhr großes Lob. Ein ernst zu nehmender Einwand wurde allerdings von Marcel Reich-Ranicki vorgebracht. Als Kritiker der »Zeit« wies er als Einziger darauf hin, dass der Hauptperson des Romans, dem Landstreicher und »Gehilfen« Frank Alpine, doch allzu aufdringlich das »Stigma der Schreibtischkonstruktion« anhafte: »Überspitzt möchte man sagen: Malamud ist überzeugend, solange er in der Nachfolge Flauberts schreibt, er enthüllt hingegen seine Grenzen, wenn er versucht, an Dostojewskij anzuknüpfen.«Hinweis
Dass sich das düster-traurige Buch vom »Gehilfen« auch als Filmvorlage eignete, bewies 1978 der Sender Freies Berlin. In seiner Fernsehspielproduktion führte Ludwig Cremer Regie, den Frank Alpine spielte Marius Müller-Westernhagen und die Kameraführung übernahm Michael Ballhaus, der spätere Kameramann Martin Scorseses. Für Kiepenheuer & Witsch bildete »Der Gehilfe« den Auftakt zur Übertragung weiterer Werke Bernard Malamuds ins Deutsche: 1962 erschien der bereits erwähnte Erzählungsband »Das Zauberfaß«, 1964 folgte der Roman »Ein neues Leben«.Hinweis Nach Witschs Tod wurden die Übersetzungen der Werke fortgeführt.
Theodor Heuss besuchte den Stand von Kiepenheuer & Witsch regelmäßig auf der Frankfurter Buchmesse. Hier im Jahr 1961. An der Bücherwand ist unter anderem Malamuds »Der Gehilfe« ausgestellt.
Bekannter noch als Bellow und Malamud wurde in Deutschland ein weiterer US-amerikanischer Autor mit jüdischen Wurzeln, dessen überschaubares Werk Witsch seinem Verlag gesichert hat: Jerome D. Salinger, Autor des 1951 in den USA zum Kultbuch aufgestiegenen »A Catcher in the Rye«. Salinger hatte es zunächst schwer, im deutschsprachigen Raum überhaupt Fuß zu fassen. Der »Mann im Roggen«, wie er zunächst in deutscher Übersetzung hieß, war erstmals 1954 vom Diana Verlag in einer Übersetzung von Irene Muehlon herausgebracht wordenHinweis und trotz des überwältigenden Erfolgs in den USA nahezu unbeachtet geblieben. Zu ungewohnt erschien der Jargon, in dem der junge Holden Caulfield über sich und sein Leben nach seiner Flucht aus dem College monologisierte; »jedes zehnte Wort ist ein Fluch«, registrierte zum Beispiel Hermann Hesse konsterniert in einer Besprechung.Hinweis Auch ein 1959 erschienener Band mit Kurzgeschichten hatte keine Resonanz im deutschsprachigen Raum gefunden.Hinweis Witsch ging das Risiko ein, einen dritten Versuch zu starten, Salinger und die deutschen Leser zusammenzubringen. »A Catcher in the Rye« erneut herauszugeben, erschien ihm allerdings erst nach gründlicher Vorbereitung sinnvoll. Zunächst änderte er den deutschen Titel. Nach ersten Überlegungen sollte das Werk »Das Kind im Roggen«Hinweis heißen, später wurde der verrätselt anmutende und näher an das Original heranrückende »Fänger im Roggen« daraus. Außerdem ließ Witsch die allzu hölzerne und sittsam-verdruckste Übersetzung des Diana Verlags durch Heinrich Böll überarbeiten.
Das war noch nicht alles; Witsch mochte Handel und Leser nicht unvorbereitet an Salingers Hauptwerk heranführen und bot daher als neue Probe seiner Erzählkunst zunächst einen Band mit vier Kurzgeschichten an. Der Verlag hatte vier aus den rund 30 vom Autor vorliegenden Geschichten ausgesucht, die – ähnlich wie der »Fänger« – ebenfalls um die Lebens- und Empfindungswelt kindlicher und jugendlicher Einzelgänger und stiller Rebellen kreisten. Der Band »Kurz vor dem Krieg gegen die Eskimos«Hinweis erschien 1961, und Witsch nannte die Geschichten als achten Band in seiner persönlichen Favoritenliste. Dieser fand zwar keinen reißenden Absatz: »[V]on 5000 gedruckten Exemplaren bis Weihnachten 2200 Stück verkauft«,Hinweis meldete der Verleger am Ende des ersten Erscheinungsjahres der »FAZ«. Aber die von Annemarie und Heinrich Böll sowie von Elisabeth Schnack übertragenen Geschichten erfüllten ihren Zweck, den deutschen Markt für Salinger aufnahmebereiter zu machen. 1962 erschien auch »Der Fänger im Roggen« und wurde zu einer Erfolgsgeschichte. Die von Heinrich Böll besorgte Überarbeitung war allerdings alles andere als geglückt. Die Germanistin und Diplomatin Irene Hinrichsen registrierte in einer Kritik der Übertragungen englischsprachiger Erzählprosa durch Annemarie und Heinrich Böll »grobe Nachlässigkeiten, teilweise sogar sinnentstellende Fehler«Hinweis bei der Übersetzung des »Fängers« und sah, bezogen auf die Übersetzung Irene Muehlons, Bölls »Korrekturaufgabe nur ungenügend«Hinweis erfüllt. Der Literaturkritiker Reinhard Helling griff dies später in mehreren Beiträgen auf und machte deutlich, dass Böll, wie schon Irene Muehlon, lediglich eine in London erschienene Ausgabe des Buches vorgelegen habe, die an rund 800 Stellen vom US-Original abwich und »durch diverse Kürzungen, zensierte Flüche, verdrehte Namen und nicht transportierte Kursivsetzungen verfälscht«Hinweis