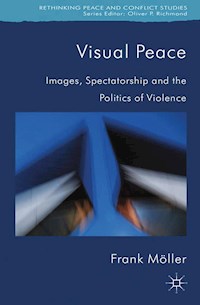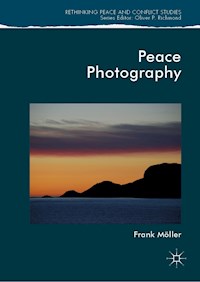26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wer war Joseph Caspar Witsch? Eine Spurensuche Dies ist die Geschichte eines der innovativsten Verleger der frühen Bundesrepublik, in der es um Autoren, kulturellen und politischen Einfluss sowie um wirtschaftlichen Erfolg geht. Aber der Lebensweg des J.C. Witsch ist viel mehr als das – es ist eine schwindelerregende Reise durch die historischen Abgründe des 20. Jahrhunderts.Geboren und aufgewachsen in Köln geriet der junge Bibliothekar J.C. Witsch früh in Konflikt mit dem aufkommenden Nazi-Regime, stieg aber noch 1936 zum obersten »Volksbibliothekar« Thüringens auf. Zurückgekehrt von seinem Kriegseinsatz in Italien führte er seine Ämter sogleich unter der sowjetischen Besatzungsmacht in Jena weiter, floh dann nach heftigen Auseinandersetzungen um ein neues Büchereigesetz und über seine Rolle in der NS-Zeit nach Westdeutschland, wo 1951 in Köln die ersten Bücher unter dem Verlagsnamen Kiepenheuer & Witsch erschienen. Er wird sofort zum Verleger großer belletristischer Autoren der Vor- und Nachkriegszeit (Heinrich Böll, Czewslaw Milosz, Joseph Roth, Erich Maria Remarque, Saul Bellow, J.D. Salinger, Vicki Baum, Ignazio Silone u.v.a.), war aber zugleich einer der einflussreichsten Netzwerker des Kalten Krieges gegen den Kommunismus. In diesem Zusammenhang publizierte er viele Klassiker der Kommunismuskritik wie Wolfgang Leonhards »Die Revolution entlässt ihre Kinder«, gründete einen Nebenverlag, der weitgehend vom Ministerium für gesamtdeutsche Fragen finanziert wurde und war der Kölner Statthalter des »Kongresses für kulturelle Freiheit«, dessen europäische Zentrale in Paris von der CIA gesteuert und finanziert wurde.Zugleich war er ein großer Kenner der Weltliteratur, ein Entdecker und Verführer, ein inspirierender öffentlicher Intellektueller und ein erfolgreicher Unternehmer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1342
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
© Photograph. Sammlung/SK Stifung Kultur – August Sander Archiv, Köln VG Bild-Kunst, Bonn
Inhalt
TitelAnmerkungenVorwortAm Nasenring durchs 20. Jahrhundert1. Schul-, Lehr- und Wanderjahre2. Von Köln nach Stralsund3. Jena als Chance und Risiko4. Zwischen Anpassung und Eigensinn5. »Warum noch diese Quälerei …?«6. »Herr Dr. Witsch, warum haben Sie …?«7. Unsichere Jahre unter sowjetischer Besatzung8. Von Jena nach Hagen9. Zwischen Hagen, Köln und Weimar10. Mit amerikanischer Aufbauhilfe11. Antikommunismus als Verlagsprogramm und Dienstleistung12. Kampf um die Köpfe13. Kulturkampf am Rhein14. »Hier herrscht eine grosse Kongressunlust …«15. »Die skrupellosen Gaunerstücke eines bundesdeutschen Verlegers«16. »Aus der Verrufung kommt unsere Generation nie mehr heraus …«17. »Natürlich passt den Leuten die ganze Richtung nicht …«18. The Making-ofAbkürzungenLiteraturverzeichnisArchiveZeitzeugengesprächeDankBuchAutorImpressumAnmerkungen
Bei den zitierten Textstellen wurde auf Textkorrekturen weitestgehend, bei der Wiedergabe fremdsprachiger Zitate auf Übersetzungen vollständig verzichtet. Zu den Gründen dafür finden sich einige Anmerkungen im Schlusskapitel. Korrigiert wurden jedoch einfache Tippfehler in Dokumenten, ohne dass darauf gesondert hingewiesen würde. Kursiv gesetzte, gesperrte oder unterstrichene Passagen in Zitaten wurden entsprechend der Originalfassung übernommen, ohne dass darauf noch einmal extra hingewiesen wurde.
Vorwort
von Helge Malchow
Der Verlag Kiepenheuer & Witsch existiert 2014 seit 65 Jahren, seit seiner Gründung und der Lizenzerteilung durch die britischen Besatzungsbehörden um die Jahreswende 1948/49 gehört er zu den bedeutenden und maßgeblichen deutschsprachigen Publikumsverlagen. Mit einer Reihe weiterer deutschsprachiger Buchverlage prägt Kiepenheuer & Witsch seit den Anfängen der Bundesrepublik 1949 nachhaltig die literarische Kultur des Landes, nimmt mit seinen politischen und gesellschaftspolitischen Sachbüchern Einfluss auf die öffentlichen Meinungsbildungsprozesse und hat sich darüber hinaus von Beginn an einen Namen als Verlag für erfolgreiche Unterhaltungsliteratur erworben.
Dabei ist neben aller ständigen Erneuerung und Weiterentwicklung die Kontinuität der Programmarbeit über mehr als sechs Jahrzehnte auffällig. Viele der großen Autoren der früheren Jahre von Erich Maria Remarque bis zu Heinrich Böll, von J. D. Salinger bis zu Saul Bellow, von Joseph Roth bis zu Vicki Baum, von Ignazio Silone bis zu Dieter Wellershoff, Carola Stern, Wolfgang Leonhard oder Ralph Giordano, sind bis heute fest mit dem Haus verbunden und immer wieder mit neuen Ausgaben und – bei ausländischen Autoren – mit Neuübersetzungen präsent.
Überhaupt sind alle bedeutenden Autoren des Verlages über Jahrzehnte »Hausautoren«, seien es Gabriel García Márquez oder Uwe Timm, Peter Härtling oder Don DeLillo, David Foster Wallace, Günter Wallraff oder Alice Schwarzer, John Banville, Julian Barnes oder Nick Hornby. Dies gilt auch für die vielen deutschsprachigen und ausländischen Schriftsteller, die in den letzten Jahren Autoren des Verlags geworden sind und die zusammen mit den »Klassikern« heute das Verlagsprogramm prägen.
Diese starke Bindung ist nicht zuletzt das Ergebnis einer langjährigen Kontinuität der verlegerischen Leitung des Hauses, die seit 1949 erst zweimal gewechselt hat. Vor allem aber geht dies mit Sicherheit auf die überragende Leistung des Verlagsgründers Joseph Caspar Witsch zurück, der in der für Verlagsverhältnisse nur kurzen Zeit von 18 Jahren ein bis heute tragfähiges Fundament für seinen Nachfolger Reinhold Neven Du Mont (seit 1967) und die heutige Verlagsleitung (seit 2002) geschaffen hat.
Mit seinen vielen Facetten als Verleger, als öffentliche Person, als kulturelle Instanz, als Autoren-Verführer und -Entdecker, als Ideenproduzent, gewiefter Branchenpolitiker, Meinungsmacher und Unternehmensgründer steht er auf einer Ebene mit anderen prägenden Verlegerpersönlichkeiten der Nachkriegszeit wie Heinrich Maria Ledig-Rowohlt, Peter Suhrkamp, Siegfried Unseld, Gottfried Berman-Fischer oder Klaus Piper.
Umso erstaunlicher ist es, dass über den Lebensweg Joseph Caspar Witschs im Vergleich zu den genannten Gründerfiguren des bundesdeutschen Verlagswesens wenig bekannt war und ist. Auch innerhalb des eigenen Verlags ist außer einer Auswahl von Briefwechseln mit Autoren 1977, zehn Jahre nach seinem Tod, bis zum heutigen Tag keine autobiografische oder biografische Darstellung erschienen. Dies hat möglicherweise damit zu tun, dass der Verlag Kiepenheuer & Witsch eine Neugründung war und das Unternehmen in keiner klaren Kontinuität zu einem Vorgängerunternehmen vor der nationalsozialistischen Machtergreifung stand. Die Verbindung zum großen Gustav Kiepenheuer Verlag der Weimarer Republik – mit Autoren wie Bertolt Brecht, Gottfried Benn, Joseph Roth oder Lion Feuchtwanger – bestand zwar über einen neuen Gesellschaftervertrag mit Gustav Kiepenheuer, war aber mehr als kompliziert und wurde noch komplizierter durch die Tatsache, dass von Beginn an parallel zu Kiepenheuer & Witsch der Leipziger Gustav Kiepenheuer Verlag in der DDR existierte.
Eher jedoch hat diese auffällige Lücke mit dem beruflich-politischen Lebensweg J. C. Witschs vor der Verlagsgründung in Köln zu tun, vor allem mit seiner Funktion als oberster »Volksbibliothekar« Thüringens während der NS-Zeit und zuletzt dann als thüringischer Landesleiter für das Bibliothekswesen in der sowjetisch besetzten Zone. Buchverleger wurde J. C. Witsch erst in seinem »zweiten« Leben, das gleichwohl ohne sein »erstes« Leben als hochrangiger Kulturverantwortlicher unter den Bedingungen totalitärer Regime des Nationalsozialismus und der SBZ nicht denkbar gewesen wäre. Hier lag vieles im Dunkeln und Ungefähren, zu dessen Aufklärung J. C. Witsch selbst wie viele Mitglieder der belasteten kulturellen und politischen Eliten der frühen Bundesrepublik nicht entscheidend beigetragen hat. Stattdessen kursierten während seiner Lebenszeit und danach Gerüchte, die in verschiedenen Varianten auch in den Medien kolportiert wurden und sich auf mehrere Themenkomplexe bezogen: auf J. C. Witschs Rolle und seine Aktivitäten im Nationalsozialismus, auf die Modalitäten und Konflikte der Verlagsgründung im Zusammenhang mit seinem Partner Gustav Kiepenheuer und dem Konflikt mit dessen Witwe Noa Kiepenheuer, auf die Verlagerung des Unternehmens nach Westdeutschland und auf seine Rolle in den antikommunistischen Kampforganisationen des Kalten Krieges wie dem – von der CIA finanzierten – »Kongress für kulturelle Freiheit«.
Es gab also viele Gründe für eine umfassende und sorgfältige Biografie und eine zusammenhängende Darstellung der so erfolgreichen ersten Verlagsperiode bis zum Tod von Joseph Caspar Witsch im Jahr 1967.
Und so war es ein großes Glück, dass ich im Jahr 2006 den Kölner Historiker und Journalisten Frank Möller für ein solches Projekt gewinnen konnte, der neben seinen Fähigkeiten als Zeitgeschichtler und Autor auch selbst auf verlegerische Erfahrungen in einem Buchverlag – dem Kölner Volksblatt-Verlag – zurückgreifen konnte und sich dieser Aufgabe mit großer Kompetenz und Sensibilität stellte.
Die Ergebnisse seiner profunden Recherchearbeiten gingen weit über die Erwartungen an das Projekt hinaus, weil sich das Leben J. C. Witschs als eine hochdramatische Reise durch die historischen Abgründe des 20. Jahrhunderts offenbarte. Das Buch wurde so zu einer modellhaften Studie über das Verhältnis von Buchkultur und politischer Macht unter den Bedingungen des Nationalsozialismus, des sowjetischen Herrschaftssystems in Ostdeutschland und in den Jahren der Ära Adenauer in Westdeutschland. Es liest sich wie ein spannender historischer Roman.
Die Forschungs- und Schreibarbeit erstreckte sich am Ende über sieben Jahre und führte zu einer solchen Fülle von Fakten, Entdeckungen und Einbettungen in das historische Geschehen, dass der geplante Umfang des Buchs nicht zu halten war und wir uns zu einer Zweiteilung des Projekts entschlossen haben, die sich organisch aus dem Lebensweg J. C. Witschs ergibt. In einem zweiten Teil, der 2015 erscheinen wird, steht das Verlagsprogramm der Ära Witsch im Mittelpunkt. Damit werden auch die Beziehungen, die der Verleger zu seinen wichtigsten Autoren unterhielt, sowie die unternehmerischen Erfolge und die publizistischen Aktivitäten, die seine Arbeit stetig begleiteten, zum Thema.
Ich danke Frank Möller für seine Sorgfalt und seine Hingabe. Eine Pointe dieser Genauigkeit ist, dass das Urteil über die prekären Verstrickungen J. C. Witschs in die Propaganda- und Bildungspolitik des NS-Regimes oder in die intellektuell wie politisch fragwürdige Schwarz-Weiß-Logik des Kalten Kriegs nach der Lektüre dieses Buches schwerer, nicht leichter fällt. Vor den Augen des Lesers entsteht vielmehr das Bild eines Menschen voller Widersprüche, auch mit blinden Flecken in der Selbstwahrnehmung. Zugleich aber zeigt das Bild, das bis heute nachwirkt, einen Mann voller Leidenschaft und Hingabe für die Geschichte und Gegenwart der Literatur.
Ich danke Stephanie Kratz für ihre sorgfältige Lektoratsarbeit und Lutz Dursthoff für die so hilfreiche Begleitung des Projekts und seine Ratschläge.
Helge Malchow
Köln, Januar 2014
Am Nasenring durchs 20. Jahrhundert
Einleitung
»Es ist nicht leicht, eine Biographie zu schreiben.« Die Worte seines Autors Marek Hłasko, Joseph Caspar Witsch zum 60. Geburtstag zugedacht, hatte ich überlesen, als ich damit begann, mich in das Leben des Gründers von Kiepenheuer & Witsch einzuarbeiten. Das war einerseits gut, denn hätte ich sie ernst genommen und weiter darüber nachgedacht, wäre dieses Buch wahrscheinlich nicht entstanden. Es war andererseits weniger gut, denn mitunter hatte ich in den sieben Jahren, die mich die Lebensgeschichte des Bibliothekars, Verlegers, Kommunistenfressers, Rheinländers J. C. Witsch in Anspruch nahm, das Gefühl, als zöge mich jemand wie am Nasenring durch die Arena des so gewalttätigen 20. Jahrhunderts der Extreme. Witsch ließ nicht los, und ich folgte ihm – manchmal widerwillig, manchmal auch mit Begeisterung. Auf jeden Fall immer mit gespannter Aufmerksamkeit, denn das Leben Witschs sollte sich als ein Parcours mit hohen Hürden und einer schier unglaublichen Fülle an Überraschungen, Wendungen, Konflikten und offenen Fragen erweisen.
Das begann bereits mit Irritationen über das Datum der Verlagsgründung. Witsch produzierte 1948 Bücher in der britischen Besatzungszone im westfälischen Hagen, bevor er überhaupt eine Lizenz dafür hatte, darunter Kafkas Nachlassband kürzerer Prosa »Beim Bau der chinesischen Mauer«, dessen Rechte er nicht einmal besaß. Sein Verlag residierte damals mit wenigen Getreuen im Rohbau eines Hallenbades. Witsch wartete auf Gustav Kiepenheuer, die Verlegerikone der 1920er Jahre. Der West-Verlag war ihr gemeinsames Kind, im Geheimen ausgeheckt in Weimar. Doch Kiepenheuer, längst nur noch ein Schatten vergangener Tage, starb, bevor er anreisen konnte. Es folgte ein Kampf um seinen Namen, ausgetragen zwischen Kiepenheuers Witwe Noa und dem »Jung«verleger Witsch. Unterstellungen kursierten: Witsch habe sich den Verlag unrechtmäßig unter den Nagel gerissen. Hatte er?
Der Nasenring begann zu schmerzen. Er zog mich auf der Suche nach Antworten zurück in die Vergangenheit. Witsch und der Nationalsozialismus. Als knapp 30-Jähriger legt Joseph Caspar seit 1936 eine Bilderbuchkarriere hin, wird oberster Volksbibliothekar Thüringens und Leiter der renommierten, später so genannten Ernst-Abbe-Bücherei in Jena. Er ist schnell, ehrgeizig, blitzgescheit, modernisiert das Volksbüchereiwesen im Eiltempo, schafft sich Freunde und Feinde. Wie weit ist er gegangen unter den Nazis? Was geschah mit den Büchern, die auf den »Schwarzen Listen« standen? Wie weit nutzte er seine Möglichkeiten zwischen Widerstand und Anpassung? Seine eigenen Veröffentlichungen seien rein fachbezogen gewesen und weitgehend frei von nationalsozialistischen Formeln, lobt ihn rückblickend ein Weggefährte. »Dr. Witsch hat während der Jahre 1936–45 den ihm unterstellten 1500 Thüringer Volks- und Jugendbüchereien das Nazigift planmässig durch seine Bücherlisten zugeführt«, schreibt ein anderer. Was stimmt?
Einige Zeitgenossen und spätere Beobachter seiner Karriere meinen, Witsch sei ein Opportunist gewesen, habe sein Fähnlein um des eigenen Vorteils willen in den Wind gehängt. Dafür gibt es einfache Indizien: die Mitgliedschaft in der NSDAP unter den Nazis, die Mitgliedschaft in der SED unter den Sowjets – beide später von ihm heftig bestritten –, in Hagen dann die Mitgliedschaft in der SPD und später, als Kurt Schumacher den parteipolitischen Kampf um Mehrheiten gegen Adenauer verloren hatte, die entschiedene Parteinahme für die Politik des »Alten« und seiner zwielichtigen Satelliten von Globke und Oberländer bis Strauß. Statt abschließender Antworten also nur neue Fragen und weitere Suchbewegungen zurück auf dem Zeitstrahl.
Im Mai 1933 brennen vor der Alten Universität in Köln Bücher und Zeitschriften, wie fast überall in deutschen Universitätsstädten. Der Akademikernachwuchs möchte Schluss machen mit dem »undeutschen Geist« und ein Brandzeichen setzen. In den Flammen geht auch Witschs Studie über »Berufs- und Lebensschicksale weiblicher Angestellter in der Schönen Literatur« auf, die heute noch recht fortschrittlich anmutet. Witsch verliert im selben Jahr seinen Posten als Bibliothekar im Zuge der »Gleichschaltung«. Die Gestapo ist jetzt auf ihn aufmerksam geworden. Er soll zusammen mit seinem Bruder Jakob Flugblätter gegen die Nazis verteilt und Verfolgte in einer Mühle versteckt haben. Der Bruder wird für zwei Jahre inhaftiert, geprügelt und erleidet dauerhafte Schäden. Joseph Caspar kann sich ins Abseits retten, bis sich die erste Raserei gelegt hat, findet dann eine Beschäftigung in Stralsund an der Ostsee, weitab vom Schuss.
Kann man vor dem Hintergrund solcher Erfahrungen selbst zum Nazi werden? Finden sich auf diese Frage womöglich Antworten in der weiter zurückliegenden Vergangenheit? In der Weimarer Republik? In der Zeit des Ersten Weltkriegs? Alte Fotografien tauchen auf: Witsch im Russenkittel mit Klampfe und beim Reigen-Tanz. Er ist Mitglied in einer der zahllosen Gruppen der Jugendbewegung, wandert, ist auf Fahrten, genießt die Natur und die Freiheit, trifft Romano Guardini, den späteren Mitinitiator der »Akademie für politische Bildung« in Tutzing. Damals lernt er seine spätere Frau kennen, Elisabeth Deux. Sie stammt aus einer angesehenen, traditionsreichen Kölner Familie und ist ebenfalls ungewöhnlich attraktiv. Bibliothekarin auch sie. Beide teilen die Liebe für Schönes, sammeln alte Möbelstücke, Bücher – vor allem Bücher. Und beide stehen der SAP nahe, Willy Brandts politischer Heimat während der 1930er Jahre. Von hier an werden die Reisespuren in die Vergangenheit dünner.
Ein weiterer Ruck am Nasenring. »Du weißt jetzt genug«, scheint mir der Meister sagen zu wollen. »Lass dich nicht zu sehr von meiner Jugendzeit ablenken. Du hast noch einiges vor dir.«
Die 1950er und 60er Jahre: Jetzt gabelt sich die Geschichte. Es gibt den Verleger kommunismuskritischer und antikommunistischer Polittexte Witsch, und es gibt den literarischen Verleger Witsch. Kein Widerspruch. Beide Verlegerseelen sind dem Gedanken der Bildung durch Aufklärung über das Medium Buch verpflichtet. Witsch I setzt auf Titel wie »Berliner Kreml«, »Die Pankower Sowjetrepublik« und »Der perfekte Sklavenstaat«. Witsch II bringt William Faulkner, Gustave Flaubert, Julien Green, Ricarda Huch, Blaise Pascal, Georges Simenon, hat mit Saul Bellow, Heinrich Böll, Czesław Miłosz und Patrick White bald vier künftige Nobelpreisträger in seiner »Kiepe« und entdeckt – früher als andere – die brasilianische Literatur. Witsch I wird zum Hausverleger des Ministeriums für gesamtdeutsche Fragen unter Jakob Kaiser (CDU), landet mit Wolfgang Leonhards »Die Revolution entlässt ihre Kinder« einen unerwarteten Welterfolg und verlegt das antikommunistische Periodikum »SBZ-Archiv«. Motto: »Besinnt euch auf eure Kraft – der Westen ist stärker!« Als »Deutschland Archiv« existiert es bis heute. Daneben wirkt er als Spiritus Rector in der Kölner Filiale des antikommunistischen »Kongresses für kulturelle Freiheit«, der die ganze westliche Welt umspannt. 1966, ein Jahr vor Witschs Tod, wird die Finanzierung des Kongresses durch die CIA ruchbar. Hatte Witsch davon gewusst? Seine Mitstreiter – Manès Sperber, Nicolas Nabokov, Carlo Schmid und viele andere, die sonst das Licht der Öffentlichkeit nicht eben gescheut haben – ducken sich schamhaft weg, als Aufklärung und Transparenz gefragt sind. Und Witsch? Der hatte schon 1964 verärgert hingeworfen, weil ihn alte Gerüchte über sein Verhalten während der NS-Zeit eingeholt hatten, dieses Mal von vermeintlichen Freunden aus der Spitze des »Kongresses« lanciert.
Und Witsch II? Er gewinnt Joseph Roth, Vicki Baum, Erich Maria Remarque als Autoren – die Exilanten, die sich vor dem mordgierigen deutschen Mob und seinen frei gewählten und ermächtigten Führern ins Ausland retten konnten. Er kann sie dauerhaft binden, weil ein anderer hilft, der sie gut kennt: der legendäre Querido-Verleger Fritz H. Landshoff, der den Nazis von Amsterdam aus ein Schnippchen schlagen konnte und überlebt hat. Witsch will Landshoff als Partner, verstößt ihn aber bald. Ein böser Verdacht: Wurde Landshoff in dem Moment von Witsch fallen gelassen, als er seine Autoren dem Verlag zugeführt und Witsch sein Netzwerk übernommen hatte? Wieder eine Irritation. Wieder Fragen. Weiteres Suchen. Und noch jemand ergänzt in diesen Jahren die Autorenriege – ein armer Schlucker, dessen Manuskripte niemand haben will, weil er vom Krieg schreibt, von dem niemand mehr hören will, und der nichts so dringend braucht wie Bares. Witsch gewährt ihm reichliche Vorschüsse, wider alle ökonomische Vernunft – und bindet den Unbekannten namens Heinrich Böll dauerhaft an seinen Verlag.
Spätestens hier wird sich mancher fragen: Und das alles in einem Leben von nur 60 Jahren? Die Verblüffung darüber stellte sich auch bei mir ein, je mehr ich mich in Archivakten festlas und je mehr Menschen ich befragte, die Witsch gekannt, mit ihm gearbeitet und ihn erlebt hatten. So unterschiedlich die Einschätzungen auch ausfielen: Joseph Caspar Witsch hat kaum jemanden kaltgelassen. Ein Vorteil für den Biografen – und ein Nachteil dazu, denn das Manuskript wuchs und wuchs und sprengte bald den Umfang dessen, was sinnvollerweise zwischen zwei Buchdeckel zu bringen ist. Kürzen um jeden Preis also? Das wäre schade gewesen. Und so wird es – analog zu Witsch I und Witsch II – auch zwei Bücher geben.
Das vorliegende behandelt Witschs Phase der Selbstfindung in den 1920er Jahren, die Konfrontation mit dem Nationalsozialismus, die Karriere als Bibliothekar im NS-System sowie das Leben und Überleben unter sowjetischer Besatzung in Thüringen; außerdem die konfliktträchtige Verlagsgründung nach der Flucht in den Westen, die antikommunistischen Aktivitäten und den Umgang des Verlegers mit der eigenen Geschichte im Nationalsozialismus.
Ein zweiter Band wird der Verlagsgeschichte im engeren Sinne nachspüren, wird wesentliche Aspekte der literarischen und wissenschaftlichen Produktion herausstellen und die verlagsübergreifenden Initiativen nachzeichnen, von denen die Gründung des Deutschen Taschenbuch Verlags nur ein Ergebnis ist. Er wird zu ergründen versuchen, warum Witsch bei allen Erfolgen ein »einsamer Wolf« an der Spitze seiner Unternehmungen blieb, und den Wegen des Patriarchen auch in seinem privaten Umfeld nachgehen.
»Es ist nicht leicht, eine Biographie zu schreiben.« Vor allem dann nicht, wenn sie so viele Fragen aufwirft wie die des Joseph Caspar Witsch – das gilt für dieses Buch ebenso wie für das noch folgende. Die Verlockung, Schubladen aufzuziehen und das Objekt des Interesses darin für alle Zeiten verstauen zu wollen, ist groß. Schubladen, die Aufschriften tragen wie »Großer Verleger«, »Rigider Antikommunist«, »Gewissenloser Geschäftsmann« oder »Opportunistischer Mitläufer«. Witsch passt aber in keine dieser Schubladen. Irgendetwas schaut immer raus, wenn man sie zu schließen versucht. Insofern versteht sich »Das Buch Witsch« auch eher als eine von Neugier getriebene Annäherung an eine Person als eine abschließende Be- oder gar Verurteilung. Wer dies mit Standpunktlosigkeit verwechselt, denkt zu kurz.
Wer das Buch erstmals durchblättert, sollte sich nicht von den zahlreichen Anmerkungen abschrecken lassen. Man kann sie getrost übergehen und sich die Lektüre dadurch erleichtern. Wer sich indes der Philologie verschrieben hat, der findet dort vielleicht den ein oder anderen nützlichen Hinweis auf anschlussfähige Untersuchungen, zumindest aber den notwendigen Beleg der zitierten Stellen & Quellen.
Und last but not least: Es ist ratsam, »Das Buch Witsch« von hinten anzugehen. Im letzten Kapitel finden sich einige Details zu dessen Zustandekommen, die verstehen helfen, warum das Buch so und nicht anders geschrieben wurde. Außerdem finden sich dort einige Hinweise darauf, wie es weitergeht, was noch folgen wird.
Den Nasenring aber, den mag künftig ein anderer tragen. Allzu gram bin ich Joseph Caspar Witsch indes nicht, dass er mich hierhin und dorthin führte, dass er mir den Nasenring für einige Jahre zugemutet hat. Zumal er manches Mal einen ganz guten Riecher dafür besaß, mich durch beherztes Ziehen in die eine oder andere Richtung zu lotsen; genügend Freiheit, eigene Wege und Abwege zu wählen, blieb dabei immer noch. Den besten Instinkt bewies er an einem denkwürdigen Dienstag des Jahres 2009. Der 3. März war ein wolkenloser Tag mit strahlend blauem Himmel. Witsch lotste mich hinter meinen Schreibtisch in den bieder-beschaulichen Kölner Stadtteil Klettenberg. Da hatte er selbst von 1949 bis 1954 mit seiner Familie gewohnt, einen Steinwurf nur von meiner eigenen Wohnung entfernt. Er ersparte es mir so, den Tag im Kölner Stadtarchiv bei der Sichtung der Verlagsakten zuzubringen. Den Einsturz des städtischen »Gedächtnisses« an diesem Dienstag, in dem ich monatelang geforscht hatte, erlebte ich somit aus sicherer Distanz. Mir erschien das alles unwirklich – das fehlende Gebäude, in dem ich noch vor Kurzem gesessen hatte und in den kommenden Tagen wieder hatte arbeiten wollen, die aufgeklappten benachbarten Wohnhäuser, denen jetzt schützende Wände fehlten; der junge Mann, der in seiner Wohnung im vierten Stock telefonierte und dabei für alle von außen sichtbar war; die nervös blickenden, Wirres redenden oder verbissen schweigenden Verantwortlichen der Stadt und ihrer Verkehrsbetriebe, die keine Verantwortung übernehmen wollten; das viele Papier, das ich mit Vorsicht, fast mit Ehrfurcht behandelt hatte und das nun unter Tonnen von Schutt lag. Die Stadt hatte es geschafft, ihre tausend Jahre zurückreichenden Geschichtszeugnisse, die durch die Sorgsamkeit und Weitsicht früherer Archivare bis zum 3. März 2009 alle Kriege und Katastrophen unbeschadet überstanden hatten, im Krater einer ebenso banalen wie überflüssigen U-Bahn-Baustelle zu versenken. Die Akten des Verlags Kiepenheuer & Witsch waren damit weg; auch die von Dieter Wellershoff, Lektor, Herausgeber, Autor des Verlags; auch die von Hannes Jähn, Gestalter wunderbarer Umschläge zahlreicher KiWi-Bücher; auch die von Gerhard Ludwig, Bahnhofsbuchhändler und Veranstalter der »Mittwochgespräche«, bei denen Witsch für die Freiheit der Literatur gefochten hatte; und zum Teil auch die von Witschs Paradepferd Heinrich Böll. Der rücksichtslose Zug am Nasenring während der ersten zwei Jahre erwies sich nun nachträglich als Vorteil. Die meisten Akten waren bereits gesichtet und Tausende Kopien gefertigt. Die Arbeit konnte also weitergehen, musste weitergehen, trotz zweier Toter und eines Selbstmords infolge des Einsturzes und trotz des Schocks über den größten Kulturverlust Europas seit dem Zweiten Weltkrieg.
Ich habe mich oft gefragt, wie wohl Witsch auf den Einsturz reagiert hätte, der etwa 35000 von ihm geschriebene und an ihn versandte Briefe unter Beton, Dreck und Wasser geschreddert hat. Der Publizist und langjährige Regierungssprecher der sozialliberalen Koalition der 1970er und 80er Jahre Klaus Bölling hat dem Verleger mal eine »militante Abneigung gegen die vielfältigen Erscheinungen des Provinzialismus in der deutschen Politik« zugeschrieben. Witsch wäre wohl mit Furor über die geballte Inkompetenz und Feigheit in Politik, Verwaltung und Verkehrsbetrieben der Domstadt – seiner Stadt – hergefallen. Und er hätte recht damit gehabt.
1. Schul-, Lehr- und Wanderjahre
1906–1925
Kindheit in Köln – Internatsjahr im Badischen – Ausbildung zum Volksbibliothekar – Wandervogel und »Quickborner« zwischen Erlebnis- und Gesinnungsgemeinschaft – »Nach eigener Bestimmung vor eigener Verantwortung mit innerer Wahrhaftigkeit« – Klappholttal/Sylt – Erste Liebe: Elisabeth Maria Deux
© Privatbesitz (beide Fotos)
Ein 15-jähriger Preuße – Kaspar Josef Witsch.
Eine zerknitterte Ausweiskarte mit deutlichen Gebrauchsspuren, ausgestellt am 10. April 1922 auf Kaspar Josef Witsch, zählt zu den ersten noch erhaltenen Dokumenten aus der Jugendzeit des späteren Bibliothekars und Verlegers. Der 15-Jährige wird als Preuße geführt. Das katholische Köln zählte damals als Teil der Rheinprovinz noch zur protestantischen Großmacht Preußen, eine Folge der Beschlüsse des Wiener Kongresses von 1815, die eine neue europäische Nachkriegsordnung begründet hatten. Als Josef Witsch seine Ausweiskarte erhielt, waren im Rheinland infolge des verlorenen Ersten Weltkriegs noch alliierte Truppen stationiert und Witsch somit »Einwohner des besetzten Gebietes«, wie der dreisprachige Aufdruck am Kopf des Papiers vermerkt.
Das Lichtbild auf dem Dokument zeigt Witsch als Schüler. Es wurde aus einer etwas größeren Aufnahme herausgeschnitten, die vermutlich in einem Fotoatelier oder draußen unter Atelierbedingungen entstanden ist.Hinweis Der junge Witsch blickt kühl in die Kamera, als wollte er sein Gegenüber taxieren, selbstbewusst und ohne Scheu. In den noch weichen, kindlichen Zügen deuten sich bereits einige äußere Merkmale der kommenden Lebensjahre an: der energische Zug um den Mund, die markanten großen Ohren, die hohen Wangenknochen und die schmalen Augen, die dem Erwachsenen später leicht asiatisch anmutende Züge verleihen werden. Als »rheinischen Hunnentyp« beschreibt Witschs älteste Tochter, Annette, ihren Vater liebevoll-ironisch.Hinweis
Was offenbart der Ausweis noch? Den Tag der Geburt zum Beispiel. Witsch erblickte am Dienstag, den 17. Juli 1906, das Licht der Welt, im selben Jahr wie Wolfgang Koeppen, René König, Hannah Arendt oder Herbert Wehner – mit allen vieren wird er später als Verleger Kontakte pflegen.
Witschs elterliche Wohnung lag im rechtsrheinischen Köln-Kalk, in der Kantstraße 13. Der Stadtteil, der heute als sozialer Brennpunkt gilt und seit dem Niedergang seiner Industrien einen zähen Strukturwandel durchlebt, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch ein selbstständiger, wohlhabender Industriestandort. Josef Witschs Eltern führten hier ein eigenes Gewerbe. »Meine Eltern sind der selbständige Dachdeckermeister und Inhaber eines Baugeschäftes Christian Witsch und Lisa Witsch, geb. Gassen. […] Von 5 Kindern bin ich das zweitälteste«, textete Witsch 1934 für einen Lebenslauf.Hinweis
Das Gewerbe ernährte die Familie und schuf die Voraussetzung, den Kindern die Ausbildung zu sichern. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs scheint ihr Leben in geregelten Bahnen verlaufen zu sein. Wie mag die Familie Witsch dann den Ausbruch des Krieges aufgenommen haben? War sie »patriotisch« gestimmt, eher gleichgültig oder zählte sie zur kleinen Minderheit der Kriegsgegner? Wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, wie sich der Kriegsausbruch in der Gedankenwelt des im Sommer 1914 gerade acht Jahre alt gewordenen Schülers niedergeschlagen hat und welche Prägungen damit verbunden gewesen sein mögen. Aber es ist legitim, hier ein wenig zu spekulieren. Hilfsweise lassen sich die Eindrücke eines Jungen heranziehen, der den Kriegsausbruch ähnlich wie Witsch erlebt haben könnte und, ausgestattet mit einer scharfen Beobachtungsgabe, seine damalige Weltsicht gut 20 Jahre später zu Papier gebracht hat. Ebenso wie den jungen Joseph Caspar WitschHinweis überraschte der Kriegsbeginn auch ihn, den damals siebenjährigen Sebastian Haffner, in den Sommerferien und traf ihn nach eigenen Worten »wie mit einem Paukenschlag«.Hinweis Der spätere Jurist und als Publizist zu Bekanntheit gelangte Haffner erlebte eine Zeit, in der plötzlich Begriffe auftauchten, deren Bedeutung er sich zunächst umständlich erklären lassen musste: »›Ultimatum‹, ›Mobilmachung‹, ›Allianz‹, ›die Entente‹. Ein Major […] bekam plötzlich einen ›Orden‹, auch so ein neues Wort, und reiste Hals über Kopf ab. Auch einer der Söhne unseres Wirts wurde eingezogen. Alle liefen ein Stück hinterher, als er im Jagdwagen zur Bahn fuhr, und riefen ›Sei tapfer!‹, ›Bleib heil und gesund!‹, ›Komm bald wieder!‹. Einer rief: ›Hau die Serben!‹«Hinweis
In der Reichshauptstadt Berlin, wo die bürgerliche Familie Haffner lebte, dürften die Kriegsjahre von einem Jungen im Alter von sieben bis elf Jahren nicht grundsätzlich anders erlebt worden sein als im rheinischen Köln. Sie waren »unwirklich wie ein Spiel. Es gab keine Fliegerangriffe und keine Bomben. Verwundete gab es, aber nur von fern, mit malerischen Verbänden.«Hinweis
An der »Heimatfront« machte sich zu Beginn des Jahres 1915 aber auch bereits die Umstellung auf die Kriegswirtschaft in einer spürbaren Verknappung von Nahrungsmitteln bemerkbar. Lebensmittelkarten begannen den Alltag zu bestimmen, vor den Geschäften bildeten sich lange Schlangen, und die Qualität der ohnehin knappen Waren nahm spürbar ab. Es kam sogar zu Hungerrevolten in den großen Städten. Und einen Höhepunkt erreichte die Versorgungskrise im sogenannten Steckrübenwinter der Jahreswende von 1916 auf 1917, als Rüben für einige Zeit nahezu die gesamte Lebensmittelpalette ersetzen mussten. Die Welt der Jungen konnte diese harte Realität jedoch nur bedingt beeinträchtigen. Sebastian Haffner schreibt: »Was es an wirklichen Härten und fühlbaren Unannehmlichkeiten gab, zählte wenig. Schlechtes Essen – nun ja. Später auch zu wenig Essen, klappernde Holzsohlen an den Schuhen, gewendete Anzüge, Knochen- und Kirschkernsammlungen in der Schule, und, seltsamerweise, häufiges Kranksein. Aber ich muß gestehen, daß mir das alles keinen tiefen Eindruck machte.«
Sebastian Haffner erlebte den Krieg in seiner Kindheit also durchaus nicht als jene »Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts«Hinweis, als den ihn der US-amerikanische Diplomat und Historiker George Frost Kennan auf eine ebenso griffige wie häufig zitierte Formel gebracht hat, sondern viel eher als ein »großes, aufregend-begeisterndes Spiel der Nationen, das tiefere Unterhaltung und lustvollere Emotionen beschert als irgendetwas, was der Frieden zu bieten hat«.Hinweis So wendete der junge Haffner die Regeln des Spiels, in dem Erfolge nach Punkten gemessen werden, auf die Meldungen vom Kriegsgeschehen an: »Ich war ein eifriger Leser der Heeresberichte, die ich nach einer Art ›umrechnete‹, nach wiederum sehr geheimnisvollen, irrationalen Regeln, in denen beispielsweise zehn gefangene Russen einen gefangenen Franzosen oder Engländer wert waren, oder 50 Flugzeuge einen Panzerkreuzer.«Hinweis
Haffner erinnert sich auch, dass der Abbruch der Ferien »das Ärgste« gewesen sei, das ihm »der ganze Krieg persönlich antat«.Hinweis Und spätestens hier enden die möglichen Parallelen in der Verarbeitung des Kriegsgeschehens der beiden Jungen. Denn anders als für Haffner bleibt der Erste Weltkrieg für Witsch kein abstrakt-fernes Geschehen, sondern zeitigt unmittelbare Folgen für die Familie. Wir wissen, dass Witschs Vater bereits kurz nach Ausbruch des Krieges eingezogen wurde. Von Köln aus gelangte er nach Nord-Frankreich bis in die Nähe von Soissons in der Picardie.Hinweis Von dort kehrte er nicht mehr zurück. »Mein Vater war schon 1915 in Frankreich gefallen«, notierte Witsch 1934 in seinem Lebenslauf knapp die familiäre Katastrophe, »und das väterliche Geschäft ging, bis dahin recht und schlecht von meiner Mutter weitergeführt, in Konkurs«.Hinweis
Den frühen Tod des Vaters erlitt Witsch im Alter von gerade einmal acht Jahren, und es ist schwer vorstellbar, dass das Kriegsgeschehen dem Kölner Jungen – anders als dem Berliner – anschließend noch »wie ein Spiel« erschienen sein könnte. Er selbst hat sich zu dem Verlust in späteren Jahren öffentlich nie geäußert. Es scheint eher so, als hätte er diese Erfahrung in sich verkapselt. Und auch weitere persönliche Eindrücke über die Zeit des Ersten Weltkriegs und die Zwischenkriegszeit finden sich selten. Ein einziges Mal spricht er später einen Aspekt an, der von der im Ersten Weltkrieg aufgewachsenen Jugendgeneration als besonders irritierend empfunden worden sein muss. In einer Gesprächsrunde des WDR aus dem Jahr 1961 geht Witsch auf den Verlust des Vertrauens in die bis zum Ende des Krieges unangefochtenen Autoritäten ein: »Wenn man als Kind […] gesehen hat, dass gestern ›Heil Dir im Siegerkranz‹ [gesungen wurde, F. M.] – und […] plötzlich: Dieselben Lehrer, dieselben Autoritäten, dieselben Personen, die auf uns einwirkten, demonstrierten uns ihre eigene Unsicherheit. Sie wussten überhaupt gar nicht, was nun an diese Stelle [treten sollte, F. M.]. Das haben wir doch gemerkt, unsere Instanzen, die waren in sich nicht mehr so fest, wie sie allen Generationen vor uns fest erschienen sein müssen. Und dass das so war, hat später eine ganze Menge, ich glaube, verhängnisvoller Folgen gehabt.«Hinweis Witsch hat es bei der Andeutung von Folgen belassen, anders als zum Beispiel Haffner, der in der Hinsicht sehr viel klarer formuliert.
Nach dem Tod des Vaters konnte Witsch, trotz wachsender Probleme für die Familie nach dem Verlust des Betriebs, seine Ausbildung zunächst fortsetzen. »Von Ostern 1912 bis Ostern 1917«, hält er in einem Lebenslauf fest, »besuchte ich die Volksschule in Köln-Kalk, von Ostern 1917 bis 1920 die ›städtische mittlere Knabenschule II‹ in Köln.«Hinweis Ein katholischer Geistlicher vermittelte dem Heranwachsenden nach dem Abschluss der mittleren Knabenschule ein Stipendium für die weitere Ausbildung. Witsch sollte an einem Internat in Süddeutschland das Abitur machen, um anschließend eine geistliche Laufbahn einzuschlagen.Hinweis In der genannten Rundfunksendung hat er sich mit einem ironischen Augenzwinkern zu diesem Kapitel geäußert: »Meine Quarta lag in Bruchsal in Baden, in einem Internat der Väter des Heiligen Vinzenz Pallotti. Der hatte einen Spruch, den ich morgens, mittags und abends auswendig lernen musste, der lautete: ›Caritas Christi urget me‹, ›Die Liebe Christi dränget mich‹. Und jeden Morgen um sechs wurde man geweckt […] mit einem Ausruf ›Benedicamus domino‹. Und um sechs Uhr […] mussten Sie dann sagen ›Deo gracias‹. Das war eine ungeheure Leistung. Und dann, das Magnificat betend, gingen wir die Treppe herunter, um eine Milchsuppe einzunehmen. […] Und das Gymnasium hieß Großherzogliches Gymnasium.«Hinweis
Die Episode im Badischen währte gerade mal ein Jahr. Dann musste Witsch die Schule verlassen, um – wie sein Bruder Kristian schreibt – »seiner Mutter zur Seite zu stehen«.Hinweis Er kehrte zur Arbeitssuche nach Köln zurück und trat, nach eigenen Worten, »im Juni 1921 in die Städt. Verwaltung der Stadt Köln ein, nachdem ich 3 Monate bei einem Notar als Schreiber gearbeitet hatte. Bis zum 15. Mai 1928 war ich in den verschiedensten Verwaltungszweigen tätig als Anwärter für die mittlere Beamtenlaufbahn.«Hinweis Aus dieser Phase seiner Ausbildung ist noch ein Halbjahrszeugnis der Kaufmännischen Fortbildungsschulen der Stadt KölnHinweis überliefert – heute würde man von Berufsschule sprechen –, das Witsch gute Leistungen in allen Fächern attestiert.
© Privatbesitz
J. C. Witsch im weißen Kittel links. Die Aufnahme entstand vermutlich während seiner Ausbildung in Leipzig.
Anschließend arbeitete er zielstrebig auf einen Abschluss als Volksbibliothekar hin. Vom 15. Mai 1928 bis zum März 1929 gehörte er als einziger männlicher Schüler unter 13 Schülerinnen dem ersten Lehrgang der neu eröffneten Westdeutschen Volksbüchereischule Köln an, unter ihnen auch seine spätere Frau, Lisbeth Deux.Hinweis Von März 1929 bis April 1930 sammelte er praktische Erfahrungen als Volontär an den Leipziger Bücherhallen. Zwischenzeitlich legte er im März 1929 noch die mittlere Reifeprüfung als Externer am Kölner Kaiser-Wilhelm-Gymnasium ab. »Damit«, so Witsch mit einem Schuss Selbstironie, »hatte meine etwas zu abwechslungsreiche Schulbildung einen zusammenfassenden Abschluss gefunden.«Hinweis Anfang der 1930er Jahre beendete er schließlich auch seine Lehre erfolgreich. Am 20. April 1931 bestand er in Leipzig die Prüfung für den Dienst an volkstümlichen Büchereien mit der Hauptnote 2.Hinweis
Nun sind Schule und Lehre für einen jungen Mann natürlich nicht alles. Womit hat sich Joseph Caspar Witsch während der 1920er und zu Beginn der 1930er Jahre sonst noch beschäftigt? Wohin hat er sich orientiert, was prägte ihn? Hinweise darauf sind rar, aber es gibt sie. 1957 korrespondierte Witsch mit dem Naturphilosophen und frühen Naturschützer Freiherr Felix von Hornstein, für den er große Wertschätzung hegte. In einem Schreiben vom 29. Mai ging er auf dessen 1951 erschienenes Buch »Wald und Mensch«Hinweis ein, in dem von Hornstein die Waldgeschichte des Alpenvorlandes abhandelt, und spricht seine eigene frühe Naturbegeisterung an: »[W]ir haben die schönsten Jahre unserer Jugend eben innerhalb der Jugendbewegung, innerhalb der Freien Deutschen und des Wandervogels, in der Anbetung der Natur verbracht, und dann sehr schnell doch versucht, der Schwärmerei einen realen Unterbau zu geben, und irgendwo ist dieser große Schwarm beständig geblieben bei einigen von uns.«Hinweis
Es findet sich noch ein zweiter Hinweis in den umfangreichen Korrespondenzen Witschs auf seine jugendbewegte Zeit. Im November 1961 erhielt er zwei Kostproben eines fränkischen Weines aus Randersacker von einem Würzburger Buchhändler. Er bedankte sich dafür und schrieb: »Die Boxbeutel gefüllt mit Mainwein, gleich wo immer ich ihn trank, erinnern mich aber auch an die 20iger Jahre. Ich war häufig in Burg Rot[h]enfels wo wir als Quickborner eine Burg hatten und kenne Mainberg, Würzburg, Aschaffenburg, eigentlich das ganze Maintal und den Spessart mit allen Köstlichkeiten, von denen so viele zerstört worden sind, genauer als das Rheintal, ja fast genauer als hier meine engere Heimat.«Hinweis
»Freie Deutsche Jugend« (gemeint ist die Freideutsche Jugend), Wandervogel und Quickborner – die Organisationen, die Witsch in den beiden Schreiben nennt, führen tief hinein in die facettenreiche Geschichte jener Jugendbewegung, die sich zum Ende des 19. Jahrhunderts aus der Bewegung des Wandervogel entwickelt hat.Hinweis Im Kern waren Wandervogel und Jugendbewegung zivilisationskritische Reflexe auf die mit der industriellen Revolution eingeleitete Phase der Hochindustrialisierung während der Zeit des Kaiserreichs. Ihre Anhängerschaft rekrutierte sich größtenteils aus Schülern und Studenten, die den gebildeten bürgerlichen Schichten entstammten.Hinweis Es gehört zu den Charakteristika dieser frühen Jugendbewegung, dass deren zahllose Gruppierungen in den allermeisten Fällen von Jugendlichen selbst initiiert und geführt wurden. Der Fundus an gesellschaftskritischen Motiven, aus denen sie hervorgingen – Kritik an der Herrschaft der Technik, der Verdinglichung der menschlichen Existenz und dem Verlust »höherer Werte« –, zählte dabei allerdings auch zum Standardrepertoire der meisten Erzieher ebendieser Jugend. Den zentralen Anliegen der Jugendbewegung zuzurechnen ist die von Witsch angesprochene »Anbetung der Natur«. Diese Idealisierung von Natur und Naturerfahrung ist wiederum nicht zu trennen von der Bedeutung des Gemeinschaftserlebnisses in homogenen Gruppen sowie vom Rückgriff auf zahlreiche, häufig der Romantik entlehnte kulturelle Traditionen.
Lange Zeit bildeten große gemeinsame Fahrten, die in der Regel in den Sommerferien stattfanden, das Zentrum jugendbewegten Engagements. Hinzu kamen Wanderfahrten oder gemeinsame Lager an den Wochenenden oder in den kürzeren Ferienabschnitten. In der Rückschau haben sich zahlreiche unmittelbar am Geschehen Beteiligte zu dieser Phase ihres Lebens geäußert, oft mit einem leicht ironischen Unterton.Hinweis Zu diesen einst »Jugendbewegten« zählt auch eine der späteren Autorinnen Witschs, die politische Publizistin Margarete Buber-Neumann. In ihrem autobiografischen Bericht »Von Potsdam nach Moskau« hat sie das Lebensgefühl der Freideutschen Jugend, wie es bis etwa 1915 Bestand hatte, anschaulich beschrieben:
»Man versuchte vor allem, sich in Gebaren, Sprache und Aussehen von allen anderen Menschen zu unterscheiden. Selbstverständlich duzte man sich, schüttelte sich bei jeder Begrüßung, nach tiefem Blick in die Augen, mit solchem Nachdruck die Hände, daß die Gelenke krachten, und ließ nach Möglichkeit alle bürgerlichen Höflichkeitsformen beiseite. Man zog laut singend durch die Straßen, tanzte auf den Plätzen und übernachtete im Walde oder in Scheunen. Auch einen eigenen Jargon hatte man sich zugelegt. […] Besaßen wir eine Art Kollektivbibel, die sich aus den Werken der Löns, Blüher, Walter Flex und Max Jungnickel zusammensetzte, so übernahm der ›Zupfgeigenhansel‹ des Heidelbergers Hans Breuer die Rolle des offiziellen Gesangbuches.«Hinweis
Die von Buber-Neumann skizzierte Bewegung verstand sich selbst als unpolitisch, verband sie doch jegliche Politik mit der Welt der Erwachsenen, von der sie sich gerade abzugrenzen versuchte. Wenn Witsch ihre »Schwärmerei« anspricht, dann zielt das genau auf diese politisch abseitsstehende, mit viel Enthusiasmus und naiver Zukunftsgläubigkeit gepaarte Ausrichtung, die 1913 bei einem Treffen der Bewegung auf dem Hohen Meißner nahe Kassel in die später immer wieder zitierte Formel gegossen wurde: »Die Freideutsche Jugend will nach eigener Bestimmung vor eigener Verantwortung mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten.«Hinweis
Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zerfall der überlieferten Ordnung innerhalb des Deutschen Reiches gewannen die Ideen der Jugendbewegung zunächst an Einfluss: »An den Stätten der Bildung, in der Verwaltung, in den Familien und im Arbeitsleben lockerten sich überkommene autoritäre Gefüge. Der Selbstbestimmung der Jugend wurde breiter Raum gewährt. In allen Bereichen der Erziehung, der Künste und der gesellschaftlichen Organisation brach eine Zeit der Experimente, aber auch dauerhafter Formen an«, schreibt der Osteuropaforscher Hans Raupach, der von 1919 bis 1932 selbst verschiedenen Jugendorganisationen angehört hatte.Hinweis Doch was recht hoffnungsvoll als vielgestaltiger Ansatz zu einem gesellschaftlichen Reformprozess begann, ging bald in eine Phase der Politisierung und Ideologisierung über. Nicht nur die Leitfiguren, die Jugendlichen insgesamt gerieten spätestens nach dem Zusammenbruch des Wilhelminischen Kaiserreichs im November 1918 in den Sog der Politik. Das Ringen um den Charakter des neuen Staates, das von Machtkämpfen zwischen den politischen Extremen und von Versuchen begleitet wurde, die sozialdemokratische Regierung zu delegitimieren und zu destabilisieren, fand seinen Niederschlag nun auch in zahlreichen Gesprächsgruppen der Bewegung, in dem Kontrahenten der verschiedenen Richtungen und politischen Glaubensbekenntnisse aufeinandertrafen. Nach zahlreichen Zerwürfnissen, Spaltungen und Wiedervereinigungen trat die Jugendbewegung nun in eine zweite Phase ein – in die der bündischen Jugend. Walter Laqueur hat anlässlich des Fichtelgebirgstreffens zahlreicher Bünde im August 1923 ein recht treffendes Bild dafür gefunden, die Übergangssituation und den sich ausbreitenden neuen Geist anschaulich zu machen: »Einige Gruppen, die dort auftraten, waren im gut deutschen Soldatenjargon nur als ›Sauhaufen‹ zu bezeichnen – sie bewegten sich so gemütlich und ungeordnet wie die alten Wandervögel auf ihren Fahrten. Andere aber, und diese waren bereits in der Mehrheit, marschierten im Gleichschritt ein, militärisch diszipliniert. […] Die individualistische (›zivile‹) Periode der Bewegung neigte sich ihrem Ende zu.«Hinweis
An die Stelle der individualistischen Periode trat nun der Versuch, kollektiv Einfluss auf die Erneuerung der Gesellschaft zu nehmen. Die Vorbilder dazu fand man allerdings nicht in westlichen Demokratiemodellen oder neuen Lebensformen der Moderne, sondern in den Inhalten und Strukturen der eigenen Organisationen. Dabei verbanden sich mittelalterliche Ordensideale und die daran gekoppelten Vorstellungen von einer elitären, auf Auslese gegründeten Gemeinschaft mit dem Gedanken des selbstlosen Dienstes im Sinne eines größeren Ganzen. Die Popularität und Verbreitung dieser im Kern demokratiefeindlichen Ansätze sind kaum verwunderlich, waren doch die meisten Bünde selbst keine demokratisch organisierten Zusammenschlüsse, sondern vielmehr auf einem strengen Prinzip von Führung und Gefolgschaft aufgebaut, das nun das Muster für die meist wenig präzisen Vorstellungen von staatlichen und gesellschaftlichen Reformen abgeben sollte. Verteidiger der Demokratie fanden sich in den 1920er Jahren unter den bündischen Jugendlichen und ihren Führern nur wenige. Viele waren antikapitalistisch und antiwestlich eingestellt. Der Westen – das war Amerika mit seiner Kultur, die als verachtete »Massenkultur« abqualifiziert wurde; es waren aber auch die Siegermächte des Ersten Weltkriegs, die den Deutschen einen als »Schanddiktat von Versailles« bezeichneten Friedensvertrag aufoktroyiert hatten. In derlei Anschauungen waren sich die meisten Mitglieder der zersplitterten Bünde und Gruppen einig. Und während das Misstrauen gegenüber den Einrichtungen von Demokratie und Republik wuchs, fanden nationalrevolutionäre Ideen bei vielen wachsenden Anklang. Dabei vermischten sich weltanschauliche Vorstellungen in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre noch recht willkürlich. Viele träumten davon, an der Schaffung eines gleichermaßen sozialistischen wie national ausgerichteten Deutschland mitwirken zu können. Den aufkommenden Nationalsozialismus mit seinen Massenorganisationen wie der Hitlerjugend lehnten die allermeisten Bündischen dabei aber zunächst ab. Das Auftreten der Nationalsozialisten erschien ihnen zu primitiv, zu einseitig machtorientiert und zu weit weg von den Grundsätzen, die 1913 in der Meißnerformel fixiert worden waren. Außerdem stand die parteipolitische Bindung der HJ dem Selbstverständnis der Jugendbewegung entgegen.
Betrachtet man rückblickend die Versuche der Bündischen, sich in die reale Politik der Weimarer Republik einzumischen, dann müssen sie zwangsläufig recht absonderlich erscheinen. Wo eine Auseinandersetzung mit realen politischen Strukturen notwendig gewesen wäre, blieb die Jugendbewegung abstrakten Utopien von einem kommenden Reich verhaftet, in dem die reale Staatsform der Weimarer Republik zugunsten einer organisch-ständischen Gesellschaftsordnung aufgehoben sein sollte. Sie wich damit ins Unverbindliche aus. »Im ganzen vermochte die Jugendbewegung ihre Anliegen nie zur politischen Formel zu konkretisieren«, resümiert denn auch Karl Dietrich Bracher. »Sie blieb mit ihrem gestaltlosen Konglomerat von sozialistischen und liberalistischen, nationalistischen und weltbürgerlichen, militaristischen und pazifistischen, christlichen und antichristlichen Gedanken doch eigentlich außerhalb der wirkenden politischen Kräfte der Zeit.«Hinweis 1933 war es dann für eine aktive Einmischung endgültig zu spät. Mit Druck durch Schikanen und Prügel und durch die Abwerbung bündischer Führer gelang es den Nationalsozialisten, weite Teile der Jugendbewegung in die eigenen Reihen zu überführen.
Nach diesem skizzenhaften Schwenk durch die Geschichte der JugendbewegungHinweis zurück zu Joseph Caspar Witsch. Lässt sich Genaueres darüber sagen, wann er zu der Bewegung gestoßen ist, welche Entwicklungsphasen er darin erlebte und von welchen er beeinflusst wurde? Da bietet sich zunächst Witschs eigener Hinweis auf seinen Kontakt zu den »Quickbornern« während der 1920er Jahre als erste Spur an. Es ist durchaus nicht ohne Ironie, wenn er sich ausgerechnet durch den guten Mainwein an diese Jugendorganisation erinnert fühlt, entstand der Bund Quickborn (»lebendige Quelle«) doch um 1909/1910 in Schlesien aus katholischen Schülerzirkeln, die sich aus tiefer Überzeugung der strengen Abstinenz verschrieben hatten.Hinweis Die Gründungsgeschichte des Quickborn ist eng mit den Namen dreier schlesischer Priester verbunden: Bernhard Strehler, Clemens Neumann und Hermann Hoffmann. Das Triumvirat prägte die geistliche Ausrichtung der Organisation und bemühte sich in den Anfangsjahren darum, deren Zentrum von der Peripherie in den geografischen Mittelpunkt des Deutschen Reichs zu verlagern. Dabei stießen sie auf eine nordwestlich von Würzburg, malerisch am Rande des Maintals auf einem Buntsandsteinfelsen positionierte Höhenburg. Weil sie zum Teil verfallen war, war sie auch günstig zu erwerben. Diese Burg Rothenfels wurde ab 1919 zum organisatorischen und geistigen Mittelpunkt des Quickborn ausgebaut, mit eigenen Wirtschaftsbetrieben, mit Verlag sowie Versandbuchhandel.
Es ist gut vorstellbar, dass Witschs Kontakt zu der katholischen Jugendorganisation während seiner Zeit im gleichfalls katholischen Internat in Bruchsal zustande gekommen ist, also bereits 1920/1921. Burg Rothenfels liegt nur rund 110 Kilometer Luftlinie von Bruchsal entfernt, für Witsch also in durchaus erreichbarer Nähe. Es ist ebenso vorstellbar, dass er hier an Tagungen zu Ostern oder zu Pfingsten teilgenommen hat oder während der Sommerwochen zugegen war, wenn sich auf der Burg Hunderte, manchmal auch über tausend junge Menschen trafen. »Die Älteren veranstalteten religiöse, pädagogische und künstlerische Werkwochen und leisteten eine umfassende liturgische Arbeit […]; und für die Jüngeren gab es neben der religiösen Bildung Sing- und Musizierkreise, Laienspiel und Sport, Gemeinschaft und Lagererlebnis.«Hinweis
Geistlicher und auch geistiger Mentor des Quickborn wurde nach dem Bezug der Burg der katholische Theologe Romano Guardini,Hinweis von 1927 bis 1933 Mitglied der Bundesleitung und von 1927 bis zur Konfiszierung durch die Nationalsozialisten im Jahr 1939 auch Leiter der Burg Rothenfels. Zusammen mit dem Architekten Rudolf Schwarz, dem späteren Generalplaner des Wiederaufbaus der Stadt Köln nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte er ab 1924 in deutlicher Abkehr von mittelalterlicher Burgenromantik den ehemaligen Rittersaal und die Burgkapelle neu gestaltet – im strengen Stil des Bauhauses.Hinweis In Texten und Briefen an die Jugendlichen hatte Guardini immer wieder die Notwendigkeit der Selbstfindung und den Ausgleich von Autorität und Freiheit in einem »schöpferischen Gehorsam« des Gewissens in den Mittelpunkt gestellt; der zweite deutsche Quickborntag auf Burg Rothenfels im August 1920 war ganz auf diese Themenstellung ausgerichtet. Trotz der klaren Verankerung in der katholischen Glaubenslehre war der Quickborn für viele Jugendliche, die ihn durchliefen, ein Experimentierfeld zur Selbstfindung und zur Übernahme von Eigenverantwortung im Dienste einer emphatisch verkündeten, nur vage umrissenen »Lebenserneuerung auf allen Gebieten«, die als Waffe gegen die Übel der zeitgenössischen Zivilisation verstanden wurde.Hinweis Dass dabei sehr Disparates zusammenkam, ist weniger verwunderlich als vielmehr typisch für die zahlreichen Zweige der Jugendbewegung der 1920er Jahre. Walter Dirks, der spätere Herausgeber der »Frankfurter Hefte« und – zusammen mit Theodor W. Adorno – der »Frankfurter Beiträge zur Soziologie«, wirkte im Quickborn zum Beispiel im Sinne einer Verschmelzung von Christentum und Sozialismus. Aus heutiger Sicht befremdlich erscheinen müssen dem Betrachter dagegen einige der auf Burg Rothenfels gepflegten germanisierenden Rituale: »Man begrüßte sich mit Heil-Rufen, schrieb die Monatsnamen mit ›germanischen‹ Bezeichnungen (›Hornung‹, ›Lenzing‹) und veranstaltete Thing-Treffen im Halsgraben. Die Anredeform war nicht ›Du‹, sondern das antiquierte ›Ihr‹«Hinweis, merkt Wolfgang Pehnt dazu in seiner Arbeit über Rudolf Schwarz an. Eng verbunden mit dem Rückgriff auf germanische Formeln und Riten ist auch die im strengen hierarchischen Ordnungsgefüge des Quickborn wurzelnde Beschwörung charismatischer Führerfiguren. »Unser Innerstes verlangt nach Führung, um seinen Weg nicht zu verfehlen«, schreibt Anton Thill vom Kölner Priesterseminar 1923 in den »Schildgenossen«.Hinweis Und als 1930 im »Quickborn« die »Leibesbildung« der Jungen beschworen wird, heißt es: »Uns bedeutet die Leibesübung die selbstverständliche Durchbildung des ›Tempels des Heiligen Geistes‹ zu einem wahrhaften Tempel aus der Schlamperei der Bequemlichkeit heraus. […] Träume und Ideen sind schön, doch zwischen ihnen und ihrer Fleischwerdung liegt der Pfad ernster Arbeit; die Jungenschaft will ihn gehen, die Führer voraus.«Hinweis
© Privatbesitz
Auf der Rückseite der Fotografie ist handschriftlich vermerkt: »Schlesienfahrt 1924«. Die Gruppe präsentiert sich in zeittypischer »Bewegungskluft«. Die Wimpel an dem Maibaum im Hintergrund sind leider zu stark verdeckt, als dass sich daraus Hinweise auf die Identität der Gruppe ableiten ließen.
Germanische Rituale und Grußformeln, die Beschwörung charismatischer Führerfiguren, Persönlichkeitsformung und Abhärtung durch Körperbildung, die Verheißung eigener Größe in einer »neuen Zeit« – dieses mit viel Pathos unterlegte Konglomerat aus regressiven Ideen einerseits und unbestimmten Zukunftsverheißungen andererseits klingt für heutige Leser mit Blick auf den Nationalsozialismus nur allzu vertraut. Natürlich ist all das, was in den beiden Zitaten aus dem Schrifttum des Quickborn zum Ausdruck kommt, nicht sui generis »nationalsozialistisch«. Entscheidend ist aber, dass hier bereits vieles an ideologischen Versatzstücken, Riten und Versprechungen bereitlag, was später von den Nationalsozialisten bloß noch aufgegriffen, neu zusammengesetzt und mit ihren politischen Zielsetzungen verbunden werden musste. »Wir waren jung und begriffen nicht, daß man begann, mit einer falsch verstandenen, romantisierten altdeutschen Tradition Schindluder zu treiben«, schreibt Margarete Buber-Neumann in ihrem kritischen Rückblick auf ihre Jahre beim Wandervogel.Hinweis
© Privatbesitz
Gemeinsam auf Fahrt. J. C. Witsch unten rechts im Bild, Sommer 1925.
© Privatbesitz
Witsch links im Bild, mit drei Freunden in fantasievoller Aufmachung an einem offenbar warmen Sommertag auf einer Wiese, Sommer 1925.
Wir wissen nicht, von welchen Formen und Inhalten sich Joseph Caspar Witsch bei seinen Kontakten mit dem Jugendbund Quickborn besonders angezogen fühlte. Wir können auch nicht die konkreten Anlässe benennen, zu denen er sich auf Burg Rothenfels aufhielt. Aber aufgrund seiner eigenen Äußerungen und der damaligen Eingebundenheit in das katholische Erziehungsmilieu ist davon auszugehen, dass er diese geistige Schule als Jugendlicher durchlaufen hat. Dabei waren Rothenfels und der Quickborn nicht die einzigen Orte der Jugendbewegung, mit denen er in den 1920er Jahren in Verbindung kam. Weitere Hinweise liefert ein Fotoalbum, das sich im Besitz von Gabriele, der jüngsten der vier Töchter Joseph Caspar Witschs, befindet. Es weist 26 Fotografien und die Reproduktion einer ursprünglich kolorierten Zeichnung auf. Die weitaus meisten Fotografien, vermutlich aus den Jahren 1924 und 1925, weisen eindeutig auf »jugendbewegte« Situationen und Szenen in ländlicher Umgebung hin. Keines der Fotos scheint jedoch im Zusammenhang mit dem Jugendbund Quickborn entstanden zu sein.Hinweis
Auf einigen Fotografien des Albums ist der junge Joseph Caspar Witsch eindeutig auszumachen.
Weitere Fotografien des Albums – hier ohne Abbildung – zeigen ein zweigeschossiges Natursteingebäude. Handschriftliche Vermerke weisen die Örtlichkeit als »Burg Schönrath« aus und nennen den Sommer 1925 als Zeitraum des Aufenthalts. Die Niederungsburg, ein ehemaliger Rittersitz, der im 13. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt worden ist, befindet sich in Nordrhein-Westfalen im Bergischen Land.Hinweis Sie gehört heute zur Stadt Lohmar und ist nicht allzu weit von Köln entfernt, etwa 25 Kilometer Luftlinie in südöstlicher Richtung. Es ist also recht wahrscheinlich, dass Witsch, zusammen mit einigen Freunden aus dem Wandervogel oder aus einer anderen Gruppierung der Jugendbewegung, das nahe Ziel im Bergischen öfter besucht hat. Per Bus ließ sich das damals wie heute beliebte Naherholungsgebiet leicht erreichen.
Es gibt noch zwei weitere Fotografien in dem Album, auf denen Witsch zu sehen ist. Auf der einen sitzt er oben rechts im Gebälk eines Dachbodens, der der Aufbewahrung von Stroh dient, vermutlich eine Scheune. Es muss offenbleiben, wo es aufgenommen wurde.
© Privatbesitz
In der Scheune, Sommer 1925.
Auf der anderen befindet er sich, mit einem weißen Kittelhemd bekleidet, unten links von der Mitte.
Lässt man die Bildfolgen noch einmal Revue passieren, dann sticht etwas ins Auge. Witsch ist auf all diesen Fotografien jeweils deutlich auszumachen – aufgrund seiner Größe, seiner markanten Statur und wegen der teils auffällig hellen Oberbekleidung. Außer auf dem letzten Gruppenfoto befindet er sich jedoch nie im Mittelpunkt des Geschehens – mehr noch: Er rückt jeweils deutlich an den Rand. Mit dabei und doch abseits – ist dieses Schema Zufall oder nicht? Drückt es eine innere Distanz zu den Gruppen aus? Spiegelt sich darin auch eine Lebensphase, die man als solche der Selbstfindung bezeichnen könnte? Möglicherweise. Auf eines zumindest scheint es recht sicher hinzudeuten: Witsch hat in der Jugendbewegung wohl keine herausgehobene Rolle gespielt. Sonst hätte er sich anders inszeniert. Dafür spricht auch, dass in den einschlägigen Jugendarchiven kaum Spuren von ihm zu finden sind.Hinweis
© Privatbesitz
Joseph Caspar Witsch in der Gruppe, ohne Zeit- und Ortsangaben.
Noch ein paar Sätze zu einem letzten Bild in dem Fotoalbum. Es fällt insofern aus dem Rahmen, als es sich dabei um keine Fotografie, sondern um eine Zeichnung handelt. Zwei junge Menschen sitzen auf einer Bank dicht beisammen. Die junge Frau hält eine Laute, hat die Augen brav niedergeschlagen, um ihren Mund spielt ein wissendes Lächeln; der junge Mann blickt aus den Augenwinkeln interessiert und etwas spitzbübisch-erwartungsvoll zu ihr herüber. Zu ihren Füßen liegen Rucksäcke. Am rechten unteren Rand der Reproduktion ist noch ein Bildtitel so eben erkennbar: »Wandervögel«. Der junge Mann trägt ganz eindeutig die Gesichtszüge von Joseph Caspar Witsch. Und die junge Frau? Könnte es Elisabeth Maria Deux, genannt Lisbeth, sein, seine spätere Ehefrau? Es deutet einiges darauf hin, denn auch hier gibt es Ähnlichkeiten in den Gesichtszügen und bei der Haartracht mit einem Jugendfoto, die auffallend sind. Wären Witsch und Deux also schon 1924/25 miteinander befreundet gewesen? Das scheint fast sicher zu sein, denn die Zeichnung ist datiert. Unter der Signatur F. Jüttner findet sich eine »24«. Demnach hätten sich Joseph Caspar Witsch und die ebenfalls aus Köln stammende Elisabeth Deux bereits in der ersten Hälfte der 1920er Jahre – vermutlich in der Jugendbewegung – kennengelernt und nicht erst in der zweiten Hälfte während ihrer gemeinsamen Ausbildung zu Bibliothekaren.
Die Schrift, die um das Bild verläuft und neben dem Bild im Album steht, geht zurück auf das Volkslied »Wie schön blüht uns der Maien« aus der Sammlung von Liedtexten, die Clemens Brentano und Achim von Arnim von 1805 bis 1808 veröffentlichten. Es zählte auch zu den von der Jugendbewegung wiederentdeckten Liedern der Romantik. Der Originaltext der ersten Strophe lautet: »Wie schön blüht uns der Mayen, / Der Sommer fährt dahin, / Mir ist ein schön Jungfräuelein / Gefallen in meinen Sinn.«Hinweis Was macht nun Witsch daraus? Er verballhornt übermütig den Text: »Wie schön blüthe uns der Maien / Der Sooommer fuhr dahin!!!«, liest man neben der Reproduktion. Und um das Bild herum: »Wie schön blüht uns iimmer der Maien / Der Soommer [skizzierter »Klapperstorch«] fährt dahin (folgt ohnhin) / Wirst an [»Osterhase« als Synonym für Ostern] schon – Jungfräulein / gefallen in mein Sinn«.
© Privatbesitz
»Wie schön blüthe [sic] uns der Maien …«.
© Privatbesitz
Studioaufnahme von Elisabeth Maria Deux, undatiert.
Ein übermütiger Jugendscherz – allerdings einer mit einer gewissen prophetischen Gabe.
Eine letzte Frage noch, die an die Zeichnung zu richten ist: Von wem stammt sie, und unter welchen Umständen kam sie zustande? Der Zeichner ist eindeutig zu identifizieren: F[ranz] Jüttner, 1865 geboren, 1926 – also bald nach Anfertigung der Zeichnung – gestorben. Jüttner ist vor allem als Karikaturist in Erinnerung geblieben. In der Satirezeitschrift »Kladderadatsch« der 1880er und 90er Jahre finden sich zahlreiche politische, antiklerikale und gesellschaftskritische Karikaturen aus seiner Feder, ebenso in den »Lustigen Blättern«. In den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts schuf Jüttner auch zahlreiche Illustrationen zu Märchen- oder Kinderbüchern.Hinweis 1932 lieferte er Umschlag- und Textzeichnungen zu einer Publikation über die »Wanderarmenfrage«.Hinweis Und während des Ersten Weltkriegs illustrierte er nationalpatriotische Publikationen.Hinweis Damit erschöpfen sich aber auch die Informationen. Wann und wo Jüttner und Witsch zusammengetroffen sind, bleibt ungeklärt.Hinweis
Außer den bislang genannten Spuren, denen nachgegangen wurde, um zu verorten, an welchen Organisationen der Jugendbewegung Witsch wann und wo teilhatte, gibt es noch eine vorerst letzte. Sie führt auf die Insel Sylt. Nach Angaben von Annette Witsch hat sich ihr Vater in seiner Jugendzeit dort mehrfach in einem Ferienlager im Norden der Insel aufgehalten. Das erscheint plausibel, weil sich während der 1950er und 60er Jahre eine tiefere Verbundenheit Witschs zu der Nordseeinsel nachweisen lässt, die durch die frühen Aufenthalte dort erklärbar wird. Als Verleger verbrachte Witsch später dort sehr häufig seinen Familienurlaub und erwog zeitweise auch, ein Haus oder eine Wohnung auf der Insel zu kaufen. In den 1920er Jahren gab es auf Sylt eine wichtige Anlaufstelle für jugendbewegte Menschen. 1919 hatte hier die »Arbeitsgemeinschaft der Freideutschen Jugend« mit Sitz in Hamburg das Ferienlager Klappholttal gegründet und zu Pfingsten 1920 eingeweiht.Hinweis In der Anfangszeit diente es der Freideutschen Jugend als Erholungsstätte für Kriegsheimkehrer aus den eigenen Reihen. 1920 wurde hier zudem ein Kindererholungsheim errichtet. Im April 1920 beschrieb Knud Ahlborn, der langjährige Leiter Klappholttals, den Standort an der Nordwestküste Sylts und entwarf ein Bild von der künftigen Nutzung: »Und nun denkt euch die unvergleichlich großartige nordische Insellandschaft: hohe schneeweiße Dünen, die im wilden Gezack ein weites Heidetal umgeben, und dann ein paar Schritte nach Westen, und ihr blickt auf das ruhelos stoßende Meer, das seine Brandung donnernd auf den breiten, weißen Strand schleudert. […] Und nun denkt euch freideutsche Menschen, Burschen und Mädel, denkt euch die Spiele und Tänze am Strand in der Sonne, die abendlichen Lieder am Wrackholzfeuer, die stillen Lesestunden im einsamen Dünental, Streifzüge fern und nah, die Freuden des Sonnen-, Wind- und Wasserbadens, Bootfahrens, Wattenlaufens, und es wird euch gewiß, wäret ihr auch am anderen Ende Deutschlands, zu unserem freideutschen Ferienlager mächtig hinziehen.«Hinweis
Die Verheißung von wilder, einsamer Natur, von sportlichen und kulturellen Entfaltungsmöglichkeiten und von Lagerfeuerromantik – alles klassische Topoi der Jugendbewegung – dürften ihre Wirkung kaum verfehlt haben. Wann die Botschaft Witsch erreichte, ist unklar. Wie häufig er in Klappholttal zu Besuch war, ist auch ungewiss. Es muss aber ein Ort gewesen sein, der ihm gutgetan hat, sonst wäre er später nicht so häufig wieder auf die Insel zurückgekehrt.
Was lässt sich über die jugendbewegte Phase im Leben Joseph Caspar Witschs und die mit ihr verbundenen Prägungen als gesichert oder zumindest als plausibel annehmen und festhalten?
Da ist zunächst die besondere Bedeutung der Natur und des Naturerlebnisses. Witsch hat diesen Aspekt selbst in seinem Schreiben an Freiherr Felix von Hornstein angesprochen. Und viele der Bilder zeigen ihn auch in kleineren oder größeren Gruppen in der Natur, vermutlich also in Freizeiten oder auf einer der naturnahen Wanderfahrten, die zu den zentralen Erlebnisbereichen der Jugendbewegung zählten. »Frei ist der Vogel und frei ist das Lied und frei ist der Bursch, der die Welt durchzieht!«, heißt es dazu in einem der frühen Dokumente der Jugendbewegung mit der zeittypischen Emphase, und weiter: »Solch Hinausziehen in die schöne Natur, über Berg und Tal, das heißt Reisen, und solch Reisen ist köstlich!«Hinweis Witsch ist in seinem weiteren Leben bei dieser naiven Naturverbundenheit des Wandervogel nicht stehen geblieben, sie war ihm aber ein wichtiger Impuls, der offensichtlich zu vertiefender Beschäftigung Anregung gab. Denn in dem bereits zitierten Schreiben an Felix von Hornstein heißt es auch: »Ich bin ein leidenschaftlicher Freund der Botanik und bedaure eigentlich jeden Tag einmal, daß ich nicht, statt Philologie und Literatur[,] Botanik studiert habe.«Hinweis Und in einem späteren Schreiben an seinen Doktorvater, Prof. Dr. Robert Heiß, macht Witsch sich 1960 Gedanken über die Bedrohung der Natur, wenn er schreibt: »Die Zerstörung der Natur ist ein Prozess, der sich ohne Zweifel in einer unheimlichen Progression vollzieht, wenn Du bedenkst, daß ich, als ich noch zu Deinen Füßen saß, oft noch nach dem Kolleg an den Rhein zum Schwimmen ging, heute wäre das ein lebensgefährliches Unternehmen und würde sicher in einer totalen Vergiftung enden. […] So ist es mit dem Wald, so ist es mit der Luft …«Hinweis
Nicht leicht zu bestimmen ist, wie weit und von welchen explizit politischen Inhalten der Jugendbewegung Witsch erreicht wurde. Dazu fehlen eigene Äußerungen. Man kann sich aber vielleicht über ein Begriffspaar der Selbstverortung des jungen Witsch annähern, das Peter Schröder in einer ideengeschichtlichen Studie über die Leitbegriffe der Jugendbewegung eingeführt hat. Schröder unterscheidet darin in Anlehnung an Felix Raabe zwischen der Erlebnisgemeinschaft und der Gesinnungsgemeinschaft der Jugendbewegung. Demnach war die »eigentliche Erlebnisgeneration, die den Bünden ihr Leben und ihren besonderen Charakter verlieh, […] weit davon entfernt, sich um geistige oder gesellschaftlich-politische Anliegen zu kümmern. […] Erst die Älteren […] nahmen vor diesem Erlebnishintergrund Stellung zu den drängenden Fragen der Weimarer Zeit.«Hinweis
Der junge Witsch dürfte in diesem Sinne eher der Erlebnis- als der Gesinnungsgemeinschaft zuzurechnen sein. Seine Politisierung mag zwar in der Jugendbewegung begonnen haben, konkrete Ausprägungen erfuhr sie aber erst später, mit Beginn der 1930er Jahre. Darauf deutet auch sein Bekenntnis gegenüber Felix von Hornstein hin, die schönsten Jahre in der Jugendbewegung »in der Anbetung der Natur verbracht, und dann sehr schnell doch versucht [zu haben], der Schwärmerei einen realen Unterbau zu geben«.Hinweis
Eine spannende Frage bleibt am Ende dieses Auftaktkapitels: Welche Handlungs- und Orientierungsmaßstäbe könnte der junge Joseph Caspar Witsch aus der Erlebnis- und Gefühlsgemeinschaft der Jugendbewegung mit auf den weiteren Lebensweg genommen haben? Dazu erste Überlegungen anzustellen scheint deshalb sinnvoll, weil man zu den Eigenarten, die den Bibliothekar und Verleger später auszeichnen, zum Verhältnis, das er gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern pflegt, zu der Art, wie er seine Geschäfte führt, sowie zu seinem Umgang mit Parteien und anderen Institutionen möglicherweise erst dann einen verstehenden Zugang erlangt, wenn man die Sozialisationsetappe der 1920er Jahre in seinem Leben ernst nimmt und nicht bloß als eine zu vernachlässigende Vor-Geschichte begreift. Rufen wir uns daher noch einmal das programmatische Bekenntnis ins Gedächtnis, mit dem die Jugendbewegung 1913 bei ihrem Ersten Freideutschen Jugendtag auf dem Hohen Meißner ihre richtungweisende Lebensphilosophie formulierte: »Die Freideutsche Jugend will nach eigener Bestimmung vor eigener Verantwortung mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie unter allen Umständen geschlossen ein.«Hinweis
Lässt man das zeittypische Pathos einmal außer Acht, dann sind mit der Aufzählung drei wesentliche Leitplanken für die Lebensführung benannt. Die »eigene Bestimmung« bedeutet Abgrenzung gegen alle Versuche der Vereinnahmung und rekurriert auf die individuelle Potenz, die in jedem Einzelnen steckt und zur Entfaltung gebracht werden soll. »Vor eigener Verantwortung« betont das Lebenskonzept einer Eigenverantwortlichkeit, die nicht delegierbar ist. Und die Forderung nach »Wahrhaftigkeit« zielt nach innen, ist an das eigene Gewissen gekoppelt und steht als Prinzip gegen den Selbstbetrug.
Neben diese drei »inneren« Prinzipien tritt ein weiteres viertes, das gerade für die männlichen Jugendlichen der bündischen Zeit von besonderer Wichtigkeit war und auf ihren Fahrten regelrecht eingeübt wurde. Deren Stil, schreibt Karl Seidelmann, sei beherrscht gewesen von »harter körperlicher Leistung und spartanischer Einfachheit«.Hinweis Dieses Moment der Härte gegen sich selbst, verbunden mit einem geradezu instrumentellen Verhältnis gegenüber dem eigenen Körper, dessen Grenzen ausgetestet werden, gilt es ebenfalls in Erinnerung zu behalten.
Ein fünftes Prinzip betrifft das Verhältnis zwischen den einfachen Mitgliedern eines Bundes und ihrem Leiter oder Führer. »Die Ordnung, die sich bildete, war weder demokratisch noch diktatorisch, am ehesten ließe sie sich mit hierarchisch bezeichnen«,Hinweis schreibt Dietmar Lauermann, einer der Aktivisten des Bundes »Graues Corps«, und meint damit nicht nur die Ordnung seines eigenen Bundes. Und Alfred Schmid, Gründer des Corps, stellt rückblickend fest: »Bund und Führer bedürfen keiner Rechtfertigung oder Erklärung; sie bestehen katexochen als ein Bestandteil des Heilplanes der Welt.«Hinweis