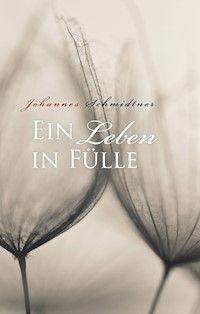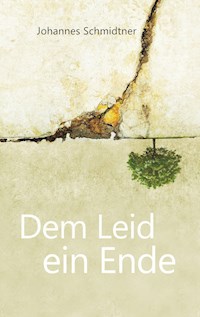
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das, was sich durch Identifikation zu Leid verdichtet hat, ist nicht von Dauer, da Gewordenes keine Existenz besitzt. Geh zurück an jenen Ort, der du warst, bevor du wurdest, und das Leidlose - die Präsenz - wird offenbar. "Dem Leid ein Ende" beschreibt das Ende einer hochgeladenen, imaginären Welt, aus Vorstellungen, Interpretationen und Missverständnissen. Einsicht und Klarheit, Vernunft und reine Empfindung, warten darauf entdeckt zu werden!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Nicht-Wissen
Was bin ich?
Dieb im Verborgenen
Ortswechsel im Innern
Dem Leid ein Ende
Vernunft und Intuition
Kostbare Kinderseele
Prolog
Das, was du bist, das ist!
Das, was du bist, das ist!
Das, was ist – das alltägliche Dasein mit seinen Höhen und Tiefen –, das ist. Von hier aus sucht das spirituell Strebsame nach einer Verbesserung der Situation, so als gäbe es einen Weg von hier nach dort, vom Erdendasein ins Himmelreich. Es, das Gewordene, sucht das Seiende, möchte es sein, doch schafft es nicht. Denn das Seiende lässt sich weder finden noch lässt es sich vom Gewordenen sein. Sein lässt sich nun mal nicht werden, sondern offenbart sich, wenn das Gewordene im Rückzugsmodus seine Heimreise antritt und in dessen Folge implodiert.
Für den Verstand klingt das entweder verständlich oder unverständlich, je nachdem. Das innere Erforschen dieser Sätze, das Erlauschen der Wörter hingegen ist jenseits von Verständnis und Unverständnis. Es ist eine sanfte Begegnung mit dem Geschriebenen, die Erfassen möglich werden lässt. Nichtdenkendes Erfassen bedingt tatenlos das Unmögliche.
Was tut er nicht alles, der Mensch, um sich zu finden? Er sucht und strebt nach etwas, das er werden möchte, weil er angeblich ganz was anderes ist, als er ist – glaubt er! Das, was ist, reicht ihm nicht; er möchte mehr werden, anders, befreit, glücklich, erleuchtet. Das, was ist, passt einfach nicht und außerdem kann es nicht so sein, so scheint es ihm! Die Vorstellung, rein geistig zu sein; transparent und heilig statt körperlich, ist schön, aber nicht immer die spürbare Wirklichkeit.
Diese fühlt sich seltsamerweise oft anders an als göttlich. So lebt er in der Hoffnung, eines Tages den alltäglichen Wahnsinn überwinden zu können, damit sich das Empfinden seiner Sinnlosigkeit erträglicher gestaltet.
Warum nicht ganz unvollkommen, ganz unheilig und fehlerhaft sein, wenn es schon so gespürt wird? Sich nichts vormachen, die eigene Begrenztheit vollumfänglich in sich annehmen, egal wie sie sich anfühlt, das wäre göttlicher als jede Vorstellung von einer innewohnenden Heiligkeit, die erhofft, aber nicht gelebt wird. Warum denn nicht einfach nur das sein und dort sein, was gerade ist, damit Ordnung wirksam werden kann?
Werden wird Sein nie erreichen, das sollte unbedingt irgendwann tief einsickern und eine Erschütterung auslösen. Und genau an diesem Ort des Aufrüttelns kehrt sich etwas um und Sein wird Werden verschlingen – durch Erforschen und Erlauschen –, und zwar genau an diesem Ort der Unzulänglichkeit. Sein wird Werden verblassen lassen, aber Werden kann Sein nicht werden, welche Strategie auch immer das vollbringen will!
Das Suchende kann nichts finden, aber es kann diesen wunderbaren Vorgang des Verblassens in Gang setzen, und das ist phantastisch. Aus diesem Blickwinkel heraus ist die Suche der Weg und das Ziel zugleich. Wenn der Weg, die Suche, bereits das Ziel ist, so könnte doch das Drängende endlich stehen bleiben. Jetzt zum Beispiel!
Dort wo Sie stehen, wo auch immer das ist, holt Sie etwas ab, saugt Sie etwas weg, löst Sie etwas auf. Dazu bitte ich Sie nun, Ihren Forschergeist zu aktivieren.
Das in den folgenden Kapiteln Geschriebene fordert einen frischen und freien Geist, keinen lerneifrigen Verstandesmechanismus, den benutzt man für Alltägliches. Dort erfüllt er seinen guten Zweck. Jetzt ist erforschen und erlauschen erforderlich, damit durch Ihr eigenes Sein Ihr eigenes Werden sachte aufweicht und sich im erahnenden Lesen verflüchtigt.
Johannes Schmidtner
Das, was du bist, das ist!
Nicht-Wissen
Es freut mich, Sie zu dieser sehr speziellen Wanderung begrüßen zu dürfen, die nicht von hier nach irgendwo, sondern von hier nach hier führt. Lassen Sie sich bitte nicht vom steilen Anstieg der ersten beiden Kapitel einschüchtern. Genießen Sie lieber die langsam einsetzende Höhenluft, sie wird Ihren Blick weiten.
Wir nähern uns zuerst einem unbekannten Gebiet, dem Nicht-Wissen. Es zu erforschen verleiht das Elixier der Klarheit, das Wissen und Weisheit zu unterscheiden vermag. Wenn Sie soweit sind, kann es losgehen!
Nichts zu werden, nichts zu wissen, nichts zu sein, ist ein guter Ort!
Dieses Kapitel beginnt mit einem Satz, der vielleicht fremdartig klingt, aber letztendlich nur für dasjenige unverständlich ist, das diesen inneren Raum des Nicht-Wissens meidet wie die Katze das Wasser.
Vielleicht haben sie schon einmal eine Katze am Fluss beobachtet, die unbedingt den Fisch haben möchte, der da im Wasser schwimmt, aber nicht weiß, wie sie ihn herausbekommt, ohne ihr dickes Fell oder ihre Pfoten nass zu machen. So ähnlich verhält es sich mit dem Wunsch nach Weisheit, die scheinbar im Verborgenen liegt und nicht so leicht zu fassen ist. Der Hunger danach ist groß, doch sobald das angestrebte Ziel in greifbare Nähe rückt, beginnt die Angst vor dem Nasswerden – vor Unannehmlichkeiten. So wird der »Fisch« zwar im Auge behalten, aber die damit verbundene Nicht-Wissen-Wasser-Berührung tunlichst vermieden.
Dann, nach geraumer Zeit der Anstrengung, wird von dannen gezogen, so desinteressiert, als hätte es diesen Fisch im Wasser niemals gegeben.
So machen es jedenfalls die Katzen. Sie scheuen das Wasser, wie der Wissende das Nicht-Wissen scheut. Den Sprung ins Wasser zu wagen, den freien Fall, das Unsichere dem Sicheren vorzuziehen, kostet Mut. Doch Fische fängt man nun eben nicht im Trockenen, da werden schon mal die Pfoten nass.
Natürlich haben die meisten Menschen ihre »dicken Felle« lieber im Trockenen – das ist verständlich –, aber der freie Fall ins Nicht-Wissen fordert nun einmal mehr, als am Ufer der Bequemlichkeit hin und her zu wandern!
Der freie Fall, so fühlt sich Nicht-Wissen-Forschung an, ist wie das Untertauchen und Eintauchen in eine persönlichkeitsfremde Welt. Das genau ist sie; der Persönlichkeit fremd! Sie forschen und fallen, aber nicht von oben nach unten, sondern von außen nach innen und obendrein noch, ohne anzukommen. Ob Sie das nun wunderbar oder seltsam finden, bleibt Ihnen überlassen. Jedenfalls ist es ein ganz, ganz dicker Fisch, das kann ich Ihnen versprechen!
Nun, vielleicht möchten Sie zuerst dieses Wort »Nicht-Wissen« genauer erklärt bekommen, dieses nicht greifbare, unverständliche Wort. Normalerweise versucht der Verstand, sobald er etwas nicht begreift, sofort Boden unter den Füßen zu bekommen, und sucht nach Erklärung und Zuordnung. Am liebsten wäre ihm als Synonym natürlich das Wort Weisheit, das er zuvor auch kurz zu lesen bekam. Das Wort klingt wunderbar und lässt sich sehr gut in bekannte Systeme einordnen. Doch einordnen, definieren, festhalten ist alles andere als Nicht-Wissen-Forschung.
Keine Sorge, lassen Sie den vielleicht gerade aktiv werdenden Verstandes-Schubladen-Mechanismus einfach arbeiten, somit ist das Strebsame in Ihnen schon mal beschäftigt, und Sie nutzen – ja, Sie meine ich –, Sie nutzen die Gunst der Stunde, die Abwesenheit des Denkenden.
Das Eine liest und sucht, während das Andere zugleich in das Gelesene hineinlauscht und das eigenartige Wort Nicht-Wissen aufleuchten lässt. Glauben Sie nicht, das sei zu schwer! Glauben Sie nicht dem Zweifel in sich, für diesen ist es tatsächlich nicht nur schwer, sondern unmöglich. Für Sie aber – ja, Sie meine ich noch mal –, für Sie ist das ein Kinderspiel, denn Sie lauschen lediglich in Ihr Zuhause, dorthinein, wo Strebsames niemals einfließen kann.
Achtung, aufgepasst! Jetzt wird es holprig und steil!
Das persönliche Wissen lebt von Informationen und erschafft sich, zusammen mit dem Wissenden, eine eigene Welt, eine Identität, auf der Basis von Wissen und Erfahrung. Ohne die Abspeicherung und Aufrechterhaltung des Gelernten würde alles irgendwann wieder verloren gehen. Der Wissende würde sein Wissen und somit sich selbst – als identifizierte Person – verlieren, ein katastrophales Ereignis. So scheint es jedenfalls, wenn das geschieht.
Deshalb wird er alles tun, um genau das zu verhindern, und verlässt sich voll und ganz auf das Gelernte, das als Vergangenheit abgespeichert wurde – mental und emotional.
Das Nicht-Wissen weiß nichts, auch erschafft es sich nicht. Es ist unspektakulär und auf dieser Ebene inexistent. Es gibt somit keinen Wissenden, sondern lediglich das Nicht-Wissende, das anwesend ist ohne angesammeltes Wissen. Da keine Informationen angesammelt wurden, können sie auch nicht verloren gehen. Es weiß, dass es nichts weiß, nichts hat, was aufrechterhalten werden müsste oder könnte.
Und doch ist es da. Es ist da als menschliches Da-Sein.
Diesem Menschen ist bewusst, dass er Wissen und Informationen braucht, um seinen Alltag zu bewältigen, und zugleich ist ihm auch bewusst, Nicht-Wissen sein zu können, ohne damit im Konflikt zwischen Denken und Nicht-Denken zu stehen. Er behindert den Wandel von Wissen zu Nicht-Wissen nicht, denn seine Furchtlosigkeit überwiegt.
Somit öffnet sich der Raum, der Nicht-Wissen zulässt, genauso wie Erinnerungsvermögen zugelassen wird. Einzig allein der Kontrolleur, der Macher, der Stratege und Hüter des Gelernten tritt in den Hintergrund, damit Nicht-Wissen in den Vordergrund treten kann.
In diesem Buch wird Ihnen kein neues Wissen vermittelt, sondern altes Wissen infrage gestellt, um damit Nicht-Wissen zu entzünden. Denn Nicht-Wissen kann nicht vermittelt werden, es entzündet sich aus sich selbst heraus; nicht durch einen Knalleffekt, sondern als sanftes Erglühen. Wenn das geschieht, ändern sich die Sicht, das innere Schauen, Denken und Fühlen.
Verwurzelt in das Neue und entwurzelt aus dem Alten tritt ein Da-Sein ins Leben, das Vergangenes und Zukünftiges auf der Drehscheibe der Gegenwart zu präsentieren vermag. Es präsentiert sich unmittelbar durch und im Menschen, mit klaren Gedanken und reinen Empfindungen, die das ungetrübte JETZT spiegeln.
Kurz durchatmen! Es geht gleich weiter!
Der Unwissende nähert sich dem Wissen, um darin aufzugehen. Der Wissende nähert sich dem Nicht-Wissen, um darin unterzugehen. Nicht-Wissen bedeutet nicht, nichts zu wissen, sondern nichts und niemand zu sein. Nicht die Gedanken sind das Werkzeug, das Wissen hervorbringt, es ist der gedankenlose Raum, in dem sich die Gedanken entzünden.
Wissen gibt es in Kombination mit einem Wissenden, der Wissen zuerst aufnimmt, um es später abzurufen. Nicht-Wissen kann nicht aufgenommen, gelernt und auch nicht abgerufen werden. Es steht unmittelbar zur Verfügung – oder auch nicht – und wird als Funke eines Augenblicks gezündet. Ein vollkommen anderer Vorgang des Denkens, eine vollkommen andere Art, zu leben und zu sein.
Das Füllhorn des Nicht-Wissens ist unabhängig. Es hängt an keinen Erinnerungen fest und lässt sich nicht an Gelerntes koppeln. Somit besitzt es keine Vergangenheit und keine Vorstellung von der Zukunft.
Das Füllhorn ist leer und füllt sich in dem Augenblick, in dem Nicht-Wissen aufgerufen wird, unmittelbar. Es lässt sich nicht diktieren, forcieren, unter Druck setzen und willentlich kontrollieren. Es ist zeitgleich einerseits leer und andererseits voll, und kein Wissender besitzt die Macht darüber. Alle Lebensgewohnheiten wie Sicherheit, Stabilität, Zuverlässigkeit und abrufbares Denken gehören nicht zum Repertoire von Nicht-Wissen. Es verfügt über andere Möglichkeiten, die dem Wissen verborgen sind, das linear denkt und somit konträr zum Nicht-Wissen steht, das jenseits der Linearität existiert.
Sie fragen mich an dieser Stelle, ob das Ganze womöglich etwas mit Intuition zu tun haben könnte? Eine berechtigte Frage, aber leider muss ich Sie enttäuschen. Es hat damit gar nichts zu tun, überhaupt nichts. Das könnte bitter für Sie sein, ich weiß.
Trotzdem, bleiben Sie dran, nah am Ufer und laufen Sie deshalb nicht gleich fort. Intuition ist etwas Wunderbares, wir werden zu gegebener Zeit darauf zurückkommen. Jetzt aber bleiben wir auf der nicht-linearen Spur.
Lineares Denken gründet auf erworbenem Wissen, Erfahrungen und Erinnerungen. Nicht-Wissen ist jenseits davon. Was bedeutet das? Nicht viel, wenn Sie darüber nachdenken, deshalb versuchen wir es mit einem Stopp: »Halt, liebes Denken, bis hierher und nicht weiter. Du hast mich weit gebracht, sehr weit, leider auch weit weg vom Nicht-Wissen. Darum halte jetzt still. Ich wandere ohne dich weiter.«
Flüstern Sie sich diese Sätze einfach selbst ins Ohr und halten Sie dabei den Denkapparat im Stand-by-Modus, in passiver Aktivität. Er weiß doch auch nur das, was zuvor einprogrammiert wurde. Wir wollen aber neue Gedanken, eigene Gedanken, aus dem Nicht-Wissen erglühte Gedanken. Nicht mehr das Vermutliche aus fremder Schöpfung, sondern frisches Nicht-Wissen.
Weisen Sie einfach alles Bekannte zurück. Nicht dies, nicht das. Wer weiß schon was?
Wer weiß schon was, habe ich als Entspannung für jene Wanderer angefügt, denen der Kopf oder die Schuhsohlen langsam zu rauchen beginnen und die sich einbilden, dumm zu sein, blöd, naiver als andere. Für diejenigen habe ich geschrieben: Wer weiß schon was?
Und diesen Satz meine ich ernst.
Niemand weiß etwas endgültig, da Wissen relativ ist und die Wahrheit sowieso. Und wenn der Kopf raucht, ist das ein gutes Zeichen. Das bedeutet Leerlauf im Gehirn und somit Platz für Neues – gratuliere!
Wissen ändert sich ständig, und jedes Mal haftet man an den neuesten Errungenschaften, den neuesten Erkenntnissen, der neuesten Wissenschaft, die immer mehr Wissen schafft und später altes Wissen wieder abschafft, das zuvor hochgelobt wurde.
Wer will denn da immer was wissen, noch mehr wissen und glaubt, danach noch schlauer zu sein? Wer denn, wenn nicht der Wächter, der Schlaumeier, der Behüter des Gelernten und Erworbenen, der sich einbildet, ein Ich zu sein, ein Jemand, ein ganz besonders intelligenter Mensch.
Da behütet er seinen angeblichen Wissensschatz, sitzt auf seiner Schatzkiste, stopft fremde Informationen hinein und holt sie zu gegebener Zeit wieder hervor, so als wären sie sein Eigen.
Hat er vielleicht vergessen, es zuvor gelernt zu haben von jemandem, der es zuvor ebenfalls von jemandem gelernt hat? Und derjenige davor, glaubt der vielleicht, er hätte es als Erster entdeckt, nur weil es noch in keinem Buch oder im Internet stand?
Es gibt nichts Neues unter der Sonne, sagte einst ein weiser Mann.
Wie wahr!
Es gibt nichts Neues unter der Sonne des Wissens, nur unter der Sonne des Nicht-Wissens. Dieses Neue stellt nur niemand fest, weil Nicht-Wissen nicht festgestellt wird, sondern ist.
Verwirrung entsteht, sobald Wissen ins Land der Weisheit hinüberschaut und sagt: »Oh, dort drüben ist ein anderes Land als hier, da möchte ich auch mal hin!« Sein Blick sieht nicht, dass es bereits mitten im Nicht-Wissen-Land lebt, da es nur ein Land gibt, wäre es nicht durch Denken in Grenzen zerstückelt. Das imaginäre Land des Wissens sucht nach Nicht-Wissen irgendwo außerhalb von sich selbst.
Wenn jemand auf der Erde wohnt – so wie Sie zum Beispiel – und würde an die Grenze seines Landes gehen und sagen: »Guck mal, da drüben ist unser Nachbarland, ein besonderes Land. Da ist es wärmer, es sind weniger Steuern zu bezahlen und die Menschen sind viel netter als hier.« Dann macht er das, was seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden gemacht wird, nämlich Abgrenzung und Unterschied – Grenzziehung.
Nun stellen Sie sich vor, Sie steigen in ein Raumschiff, das so weit hinausfliegt, bis später nur noch die blaue Erdkugel mit bräunlichen Flecken darauf zu sehen ist. Dann sehen Sie keine Länder und Grenzen mehr, sondern nur noch eine große Kugel mit Wasser und Erdteilen.
Wo sind die einzelnen Länder geblieben?
Einfach verschwunden!
Mit dem Blick auf die Gesamtheit löst sich so manches auf, einfach so, als wäre es nie gewesen. Der neue Blick schafft eine neue Welt und ein neues Bewusstsein. Das gewordene Wissen würde sehen, dass es nicht getrennt von der Ganzheit ist. Das Gefühl des Getrenntseins würde sich in ein Bewusstsein von Ganzheit transformieren und sich dabei auflösen. Die begrenzte Denkweise wäre in globales Sehen eingemündet.
Ländergrenzen gibt es nun mal und Nachbarländer auch, dass gehört zur Organisation des menschlichen Lebens und erfüllt seinen Zweck. Genauso wie große Erfindungen den Alltag prägen und ihren Respekt verdienen. Freuen Sie sich nicht auch so wie ich, wenn Ihr Zahnarzt eine schmerzfreie Behandlung durchführt, weil es ein Mittel dafür gibt? Oder Ihnen Strom für unzählige Funktionen zur Verfügung steht? Lernen und Wissen machen diese Dinge möglich, und deshalb ist Wissen nützlich und wichtig.
Es ist wichtig zu wissen, welche Gesetze es in einem Land gibt, um sich daran halten zu können, und dass es ein Nachbarland gibt, wo andere Gesetze gelten. Auch ist es gut zu wissen, wie man Maschinen bedient oder verschiedene Sprachen spricht, all das will gelernt sein.
Nun spare ich mir die unzähligen Beispiele über die Nützlichkeit von Wissen, da meine Botschaft klar sein sollte: Normal sein bedeutet, fundiert zu bleiben und mit einem geistig gesunden Menschenverstand die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Dabei ist Wissen das Ein und Alles, wenn es vernünftig eingesetzt wird.
Der Umgang mit dem Wissen ist das Problem, nicht das Wissen an sich. Ich weiß es und du nicht. Wir wissen es ganz genau, die anderen wissen es nicht. Wer hat recht?
Auf jeden Fall ICH und WIR!
Verurteilungen, Kriege und Kämpfe in der Familie und der Gesellschaft – rund um die Uhr – um etwas, das als Wahrheit angenommen wird, zu verteidigen. Die Fixierung, die Einzementierung irgendwelcher Informationen haben höchsten Wirklichkeitsanspruch. Darauf wird herumgeritten und gestritten, bis man überzeugt wurde oder klein beigibt oder es sich als Falschmeldung entpuppt.
Informationen erzeugen Ängste, Hoffnungen und Trauer, so lange bis sich herausstellt, dass es ganz anders ist. Wer gibt einem die Sicherheit, dass es stimmt, was der- oder diejenige sagt? Eben niemand!
Es gibt keine Wahrheit und keine Wirklichkeit, da alles relativ ist. Nur weil es dogmatisch zementiert wird, bekommt es den Stempel von Beständigkeit und Wahrheit. Was heute stimmt, hat sich morgen bereits verändert oder übermorgen oder irgendwann.
Recht und Macht haben zu wollen sind zwei gewaltige, unheilvolle Faktoren. Sie schaffen eine konfliktträchtige Welt aufgrund von Unwahrheiten, Unklarheiten und Unvollständigkeiten. Dies findet nicht irgendwo im Staat oder den Religionen statt. Es findet in jedem einzelnen Kopf statt – täglich, stündlich, sekündlich –, sofern dieser Wahn-Sinn noch nicht ausgemerzt ist.
Eine kleinkarierte, enge Welt hat sich da im Gehirn breitgemacht. Ein geistiger Welten-Raumflug würde Abhilfe schaffen, aber: Wer lässt sich darauf ein? Das würde ja bedeuten, die alte, liebgewonnene Welt infrage zu stellen. Das ist nicht immer so angenehm, wie es scheint. Das bereitet sicherlich auch »nasse Pfoten«. Doch der Flug lohnt sich!
»Ich weiß, dass ich nichts weiß«, sagte einst ein weiser Mann, ein Nicht-Wissen-Mann!
Wieso sagte er das, obwohl er sicher viel mehr Einblick hatte als alle um ihn herum?
Wenn er sagte »Ich weiß nichts«, war seine Botschaft doch nicht, dass er deswegen dumm wäre. Er wollte damit vielleicht ausdrücken, dass im Verhältnis zu dem, was an Erkenntnis möglich wäre, nur ein kleiner Bruchteil davon durch Wissen erfahrbar wird.
Das Empfinden von geistiger Beschränkung machte ihn vielleicht hellhörig-lauschend nach Weisheit und Fülle.
Stellen Sie sich vor, Sie reisen unentwegt durchs Universum und schauen unentwegt eine grenzenlose Perspektive. Das ist nicht einfach, wenn man zuvor mit der Anziehungskraft der Erde vertraut und der Blick konditioniert war.
Der freie Fall ins Nicht-Wissen verlangt Vertrauen und Hingabe an die neue Situation, die fremdartig erscheint. Die Erde von oben zu sehen und das Denken von außerhalb zu erleben, hat den gleichen magischen Effekt. Sie kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Sie staunen ständig als ein staunender Nicht-Wissender, und die Befindlichkeit des schwerelosen Staunens stellt sich ein. So wie der Astronaut schnell die Schwerkraft vergisst, sobald er sie nicht mehr spürt, werden Sie Ihre schweren Gedanken vergessen, aber nicht Ihre Fähigkeit des Denkens. Dieser winzige Unterschied, dieses kleine Rädchen, dreht ein großes, großes Rad.
Das neue Denken ist schwerelos, unmittelbar, blitzschnell und präzise. Es lässt sich nicht im Gehirn einspeichern oder eingrenzen und schafft somit auch keine Grenzen. Unberechenbar durchbricht es die eingewobenen Denkmuster und legt die Fähigkeit frei, Unmögliches möglich werden zu lassen.
Nicht-Wissen kommt geflogen wie ein Vögelchen und, husch, ist es wieder weg. Doch sobald der Vogel als Wissen gefangen wird, in einen dogmatischen Käfig gesperrt, angebetet und verehrt wird, kann er nicht mehr kommen und gehen. Sein Klang verstummt und sein Weisheitsgesang bleibt aus.
Wie unterscheidet sich Wissen von Nicht-Wissen und Nicht-Wissen von nichts mehr wissen?
Wer nichts mehr weiß, kann sich selbst nicht mehr organisieren und versorgen und stirbt letztendlich an diesem krankhaften Verfall. Das ist die tragische Entwicklung der Demenz. Sie verdient große Anteilnahme und die Würdigung dieser Menschen und ihrer Betreuer. Diese Krankheit meine ich nicht, wenn ich über Nicht-Wissen schreibe.
Der Übergang vom Wissen zum Nicht-Wissen beunruhigt sehr, da die Gewohnheit auf Vergangenes zurückgreifen möchte, statt darauf zu vertrauen, den passenden Gedanken zum passenden Zeitpunkt zu erhalten oder auch mal nicht. Der Wissens-Wächter wagt es nicht, einen »Vogel« entkommen zu lassen, der nur angeblich wieder zurückkommt.
Findet kein Festhalten der Gedanken statt, kein Einsperren der »Vögel«, werden aus einer Möglichkeit tausend Möglichkeiten, bringt ein »Vögelchen« von seinem Ausflug vielleicht tausend »Vögel« mit nach Hause.
Ein weiser Mann sagte einst: »Wenn du einen Stein wegräumst, werde ich tausend Steine für dich wegräumen.« Er hätte auch sagen können: Wenn du einen Vogel fliegen lässt, werde ich dir tausend Vögel zurückbringen.
Da gibt es aber diesen Angst-Wächter, der sich fragt: Wer gibt mir die Sicherheit, dass dieser »Deal« klappt?
Dieser ichzentrierte Widerstand des Wächters hat Angst vor nassen Pfoten, Angst, etwas zu verlieren, Wissen zu verlieren. So wird ihm ein kleiner Stein zum Felsen und die Tür des Vogelkäfigs wird zugeschweißt.
Ungewissheit und Unberechenbarkeit sind ein fürchterlicher Zustand für jemanden, dem Sicherheit über alles geht, dem trockene Pfoten lieber sind als nasse. Somit werden Vögel in Käfigen gehalten, Gedanken ein Leben lang aufbewahrt, und der freie Flug der Vogelschar in sich bleibt aus. Und nur wegen einer Sicherheit, die es so, wie sie angenommen wird, sowieso nicht gibt.
Die alten Wissensschätze müssen ja nicht sofort in den Müll geworfen werden. Auf Altes bauen und dem Neuen vertrauen, das wäre eine gute Kombination.
Das vogelfreie Nicht-Wissen und das bestehende Wissen müssen nicht gleich Gegner sein, sie können durchaus nebeneinander agieren, wenigstens zu Anfang, damit Vertrauen entsteht.
Entspannen wir uns mal kurz, lagern Sie die Beine hoch und lassen Sie Ihren Blick in die Weite schweifen.
Wissen Sie, liebe Wanderin, lieber Wanderer, das Denken funktioniert ohne Denkenden nach wie vor, sogar besser als je zuvor, doch hat es seine Wurzeln nicht im Gelernten, sondern im Ungelernten.
Der »innere Wächter« versucht allerdings alles, um das Erworbene zu bewahren, so ist sein Auftrag. Das ist weder gut noch schlecht, sondern nur das, was es ist. Es kann sein, wie es mag, wir bleiben dran – Sie und ich – und kommen somit dem Nicht-Wissen immer näher, das nicht erworben, sondern durch Ahnung aufgesogen wird.
Das, was du bist, das ist, und wenn das, was du bist, mitunter auch Nicht-Wissen ist, kann es nicht festgehalten werden – es muss ahnend fließen.
Wollen Sie neues Denken, neues Fühlen, neues Handeln, dann lassen Sie Ihre Gedanken im Füllhorn der Weisheit entstehen und nicht aus den Erinnerungen der Vergangenheit. Sehen Sie die Welt mit neuen Augen, mit unmittelbarem Wissen!
Hören Sie bereits die Vögel zwitschern, ahnen Sie, wo wir uns hinbewegen?
Das wäre wunderbar!
Das, was du bist, das ist!
Was bin ich?
Der steile Anstieg des ersten Kapitels ist geschafft. Das ist gut, so können wir uns in der frischen Höhenluft als Nächstes einer zentralen Frage widmen. Dazu werden wir eine geraume Zeit auf diesem weitläufigen Plateau verbringen und sowohl dessen Aussicht als auch die Einsicht dort genießen.
Wer oder was bin ich?
Sind Sie Mutter oder Vater und zugleich noch Tochter oder Sohn Ihrer Eltern?
Sind Sie Mann oder Frau, Freund oder Freundin und vielleicht noch Schwester oder Bruder? Vielleicht aber auch noch zusätzlich Arbeitskollege oder noch verzwickter, sogar ein Seitensprung?
Wenn Sie all das nicht sind, sind sie eventuell jemand, den niemand mag, ein Außenseiter oder jemand, den alle mögen, was auch immer!
Nun, ich könnte diesen Beispielen noch Hunderte folgen lassen und irgendwann wären Sie auf jeden Fall betroffen, in Ihrer Rolle getroffen, in der Sie im Normalfall funktionieren sollten.
Was da nicht alles von einem erwartet wird, wer da nicht alles von Ihnen enttäuscht wurde und welche Schuldgefühle Sie dabei wohl so entwickeln konnten. Großartig sollte man sein – groß und artig! Wer sind Sie eigentlich?
Eigentlich, wenn Sie nicht derjenige oder diejenige wären, die Sie da geworden sind. Haben Sie sich diese Frage schon einmal gestellt?
Ich hoffe schon.
Einerseits sind da diese Rollen, im Grunde das Gewordene. Aber andererseits ist da noch jemand oder etwas in Ihnen, von dem Sie vielleicht glauben, es wirklich zu sein oder wenigstens werden zu wollen?
Jetzt steigen Sie bitte nicht sofort auf das religiösmystische Pferd und reiten mir über alle illusionären Hügel davon. Ich meine doch nur dieses gewisse Etwas, ohne Namen, ohne Vorstellung, das ganz bestimmte Gefühl von Menschsein: individuell, einzigartig und zugleich ein Teil von etwas ganz Großem – sonst nichts, nur das.
Das ist doch nichts Besonderes, außer dass es im Laufe der vielen »Rollenspiele« immer mehr in Vergessenheit geriet und somit eigenartigerweise scheinbar doch das ganz Besondere geworden ist.
Dasjenige, das man ist, aber nicht sein kann, weil man ja etwas anderes geworden ist, als man wollte. Verrückt, ja, sogar ziemlich ver-rückt!
Da ist etwas weggerückt, fortgerückt, weit weg geraten und doch »näher als Hände und Füße«, sagte einst ein sehr, sehr weiser Mann.
Ja, dieses gewisse Etwas, das Sie sind, gibt es! Ich bin davon weder überzeugt, noch glaube ich daran und würde es auch niemals als absolute Richtigkeit verteidigen. Ich sage nur, ja, das gibt es – und zwar, weil es Sie und mich gibt, ganz einfach.
Das, was ist, das ist. Und da es uns beide nun einmal gibt, muss es auch etwas Existenzielles geben.
Dies sollen aber nicht nur Worte sein, die Ihr Verstand akzeptiert oder ablehnt, es ist notwendig, an diesen existenziellen Ort zu gehen, innerlich, jetzt. Außerdem führen wir beide ja einen Dialog auf unserer Wanderung, wie Sie vielleicht mittlerweile bemerkt haben oder spätestens jetzt erfahren.
Glauben Sie nicht, ich könnte Sie nicht hören, nur weil lesen nicht hörbar ist. Sie lesen ja nicht nur, Sie empfinden dabei, und dieses Empfinden hat einen Klang – Ihren Klang.
Aber lassen Sie uns nun fortfahren, bohren wir gemeinsam ein tiefes Loch ins Unmögliche!
Es stellt sich an dieser Stelle doch die Frage, ob es Sie und mich überhaupt geben könnte ohne etwas Existenzielles dahinter, davor, darüber oder darunter. Oder wie sollte es im Umkehrschluss eine Existenz geben, ohne dass es uns beide gibt?
Wenn wir schon anwesend sind – und so weggerückt können wir gar nicht sein, um das nicht zu spüren –, dann existiert doch umso mehr dasjenige, das wir als Lebendigkeit sind. Und wenn beides nicht mehr voneinander getrennt wird, die Person und das Lebendige, ist das, was ist, genau das, was wir sind.
Es ist wichtig, sich einmal darüber klarzuwerden, ob man tatsächlich existiert. Nicht durch den Verstand, der das sofort abhakt und es glaubt zu wissen. Nein, Sie sollen es erst dann abhaken, nachdem Sie das mit »Leib und Seele« erforscht haben.
Also, etwas in mir kann feststellen, dass ich atme. Mein Herz klopft und ich schreibe gerade. Somit stellt etwas fest: Ich lebe, es gibt da etwas Lebendiges, das pulsiert.