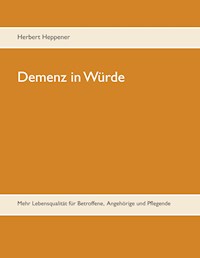
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Eine Demenzerkrankung ist eine enorme psychische Belastung für alle Beteiligten und kann für Angehörige und Pflegende zur Zerreißprobe werden. Eine vielfach ungenutzte Chance der Entlastung liegt in der Kommunikation. Indem Angehörige und Pflegende ihre Kommunikation dem Verlauf der Erkrankung anpassen, können Sie die Würde ihres demenzkranken Gegenübers ebenso wie ihre eigene erhalten und sich so der Macht der Demenz wirkungsvoll entgegenstellen. Entdecken Sie mit diesem Ratgeber, wie ein Abschied in Würde, für alle Beteiligten, gelingen kann. Zahlreiche praktische Beispiele zeigen, wie Sie sich mit der entsprechenden Kommunikation für die unausweichliche Reise ins Vergessen rüsten können und einen Weg finden, um bis zuletzt miteinander in Beziehung zu bleiben. Als der Autor im familiären Umfeld mit einer Demenzerkrankung in Berührung kam, erlebte er, was passiert, wenn Kommunikation nicht mehr funktioniert und wie viel Leid und Schmerz dadurch ausgelöst werden kann. Deshalb entschied er sich, genau das Buch über Demenz zu schreiben, das auf dem Markt fehlt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Klaus und in Erinnerung an Henning
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Teil 1: medizinische Grundlagen
2.1
Demenz – Was ist das?
2.1.1 Demenz ist ein Sammelbegriff
2.1.2 Alzheimer-Demenz
2.1.3 Lewy-Körper-Demenz
2.1.4 Vaskuläre Demenz
2.1.5 Frontotemporale Demenz
2.1.6 Weitere, seltene Demenzformen
2.2
Demenz – Risikofaktoren
2.2.1 Lebenswandel
2.2.2 Mentale Haltung
2.2.3 Alter
2.3
Häufigkeit der Demenz und Entwicklung
2.4
Phasen der Demenz
2.4.1 Kognitive Beeinträchtigung
2.4.2 Frühstadium; leichte Demenz
2.4.3 Mittleres Stadium; mittelschwere Demenz
2.4.4 Spätes Stadium; schwere Demenz
2.5
Zusammenfassung medizinische Grundlagen
Teil 2: Kommunikation
3.1
Kommunikation – Was ist das?
3.1.1 Verständigung
3.1.2 Verständigung untereinander
3.1.3 Zwischenmenschlicher Verkehr
3.1.4 Sprache und Zeichen
3.2
Kommunikation ist ein Konzert
3.3
Kommunikation ist mehr als Technik
3.3.1 Beziehung durch Respekt
3.3.2 Erfolg durch Klarheit
Teil 3: Kommunikation in der Demenz
4.1
Würde – eine Verständnisklärung
4.1.1 Was ist die Würde eines Menschen?
4.1.2 Unantastbarkeit der Würde – für wen?
4.1.3 Demenz – in Würde
4.2
Würdevoll kommunizieren in den Phasen der Demenz
4.2.1 Würdevolle Kommunikation in der Demenz: allgemeine Grundlagen
4.2.1.1
Beobachten statt bewerten
4.2.1.2
Fragen statt sagen
4.2.1.3
Unterstützen statt tun
4.2.1.4
Qualität statt Quantität
4.2.1.5
Spiel statt Ernst
4.2.1.6
Orientierungshilfen im Alltag
4.2.1.7
Lesen
4.2.1.8
Erinnerungen
4.2.1.9
Rituale
4.2.1.10
Perfektion?
4.2.2 Würdevolle Kommunikation im Frühstadium; leichte Demenz
4.2.2.1
Beobachten, selber tun und Ansagen machen
4.2.2.2
Reduzieren und strukturieren
4.2.2.3
Vielfalt der Eindrücke verringern
4.2.2.4
Loslassen und akzeptieren
4.2.2.5
Erholung
4.2.3 Würdevolle Kommunikation im mittleren Stadium; mittelschwere Demenz
4.2.3.1
Bestätigen statt korrigieren
4.2.3.2
Mitschwingen statt gegenhalten
4.2.3.3
Einleben im Pflegeheim
4.2.3.4
Wohlbefinden durch emotionale Verbundenheit
4.2.4 Würdevolle Kommunikation im späten Stadium; schwere Demenz
4.2.4.1
Verstummen
4.2.4.2
Abschied nehmen
Schlussgedanken
1 Einleitung
Dieses Buch ist aus meiner ganz persönlichen Erfahrung entstanden. Im Umgang mit meinem demenzerkrankten Schwiegervater habe ich mich zunehmend unsicher und unwohl gefühlt, weil meinem Schwiegervater sein Leben entglitt und ich seine Veränderung nicht einordnen konnte.
Nur langsam wurde uns, seiner Frau, seinen Kindern, Schwieger- und Enkelkindern bewusst, dass schleichende Veränderungen in seiner Kommunikation, in seiner Bewegung und in seiner Persönlichkeit stattgefunden hatten, die nicht mehr als Vergesslichkeit oder Unachtsamkeit abgetan werden konnten. Dinge verschwanden, um dann später wieder auf unerklärliche Weise an einem anderen Ort aufzutauchen. Namen waren plötzlich im Gespräch nicht mehr abrufbar, um irgendwann in einem anderen Zusammenhang doch wieder verfügbar zu sein – dann aber situativ unpassend. Fremde Menschen trieben ihr Unwesen im Haus, Diebe! Und lange vertraute Abläufe wie Anziehen und Ausziehen, Frühstückstischdecken oder den Fernseher einschalten entpuppten sich langsam als unsteuerbare Prozesse.
Die differenzierten Gespräche mit ihm vor seiner Erkrankung hatte ich immer als bereichernd empfunden und ausserordentlich geschätzt. Aber solche Gespräche tiefgreifender Qualität waren zunehmend unmöglich und verlagerten sich von der Gegenwart in die Vergangenheit. Ich war irritiert und er war es auch.
Als Lehrer und Schulleiter war ich gewohnt, mich kommunikativ auf unterschiedlichste Personen und Situationen einzustellen, Gespräche zu führen, zu vermitteln, zu steuern und Konsens herbeizuführen. Im Zusammensein mit meinem Schwiegervater wollte mir das nicht gelingen.
Seine Standpunkte wurden wirr, seine Stimmung mal ängstlich, mal ärgerlich, dann wieder heiter und froh, um kurz danach fast depressiv zu sein. Er fühlte sich verfolgt und beobachtet, kontrolliert. Und diese emotionale Achterbahn überlagerte seine kommunikativen Kompetenzen, die sich ebenfalls zusehends reduzierten. Argumente und Logik zielten ins Leere.
Mein Dagegenhalten, Richtigstellen, Korrigieren und mit Nachdruck Verdeutlichen stürzten meinen Schwiegervater nur tiefer in seinen instabilen Gefühlszustand. «Das ist seine Wirklichkeit. Es nutzt nichts, wenn Sie dagegenhalten.», waren die Hinweise der Fachpersonen, die ich für mich nicht umzusetzen wusste. In der Folge hörte ich auf, mich mit ihm zu unterhalten, leider – denn es irritierte ihn noch mehr, wir hatten uns doch immer gut verstanden und gemocht. Mein Rückzug machte ihn unsicher und liess mein schlechtes Gewissen wachsen.
Heute tut es mir sehr leid, dass ich meinen Schwiegervater so schweigend verlassen habe und erkenne, dass wir beide unter dem Einfluss seiner Demenz viel verloren haben, was wir uns vielleicht hätten bewahren können – das Gespräch und die menschliche Nähe im Hier und Jetzt.
Die Zahl der demenziell erkrankten Menschen ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen und in der Zukunft ist mit einem weiteren Anstieg der Krankheitsfälle zu rechnen. Derzeit leben in Deutschland circa 1,6 Millionen Menschen mit Demenz (www.deutsche-alzheimer.de), so dass fast jeder in der eigenen Familie oder spätestens im Bekannten- und Freundeskreis einem Menschen mit einer Demenzerkrankung begegnet oder mit betroffenen Angehörigen in Kontakt kommt. Die Auswirkungen einer demenziellen Erkrankung auf den Alltag sind enorm – nicht nur für die betroffenen Patienten, sondern auch für deren Angehörige und das soziale Umfeld. Vor dem Hintergrund der wachsenden Anzahl der Erkrankungen wird Demenz zunehmend zu einer gesellschaftlichen Aufgabe und Herausforderung.
Mit diesem Buch möchte ich dazu beitragen, dass Angehörige, Freunde und Bekannte sowie Pflegepersonal – vielleicht sogar die Gesellschaft insgesamt – erkennen, dass es Möglichkeiten gibt, mit demenziell erkrankten Menschen im Kontakt zu bleiben. Ich möchte zu mehr Gelassenheit und Entspannung im Umgang mit Demenzpatienten beitragen, den Betroffenen zuliebe und zum Wohle und Erhalt der Ressourcen pflegender Angehöriger und Fachpersonen. Ich möchte, dass demenziell erkrankte Menschen und die sie umgebenden Personen in einem würdevollen Miteinander leben können. Ich möchte meiner eigenen Sprachlosigkeit entgegentreten und einen Weg respektvoller und klarer Kommunikation aufzeigen, der mich und vielleicht Sie alle, liebe Leserinnen und Leser, sicherer werden lässt in unserem Alltag mit dementen Angehörigen und Sie entlastet.
Dieses Buch ist in drei Teile unterteilt, einen medizinischen, einen kommunikationstheoretischen und einen praktischen Teil. Im medizinischen Teil werden Sie mit Grundlagen zur Demenz vertraut gemacht. Das soll Ihnen helfen, sich im Gespräch mit Medizinern besser orientieren zu können und Klarheit in der Abgrenzung von Krankheitsbildern verschaffen. Die biochemischen Prozesse, die die Veränderungen der Persönlichkeit hervorrufen und zum Verlust von Fähigkeiten und Fertigkeiten führen, werden erläutert und in mögliche, typische Phasenverläufe der Demenzerkrankung unterteilt. Die Ausführungen sollen dazu beitragen, dass der Abbauprozess als willkürlich und nicht vom Patienten steuerbar erkannt wird und die damit einhergehenden Auswirkungen auf den Lebensalltag und die Persönlichkeit der Betroffenen als zufällig und unvorhersagbar akzeptiert werden können. Die Darstellung der Entwicklungsphasen der Demenz soll deutlich machen, dass zunehmende körperliche Defizite und Ausfälle die Folge der ursächlich hirnorganischen Erkrankung sind, die zunächst Stimmungsschwankungen und Persönlichkeitsveränderungen hervorrufen.
Im zweiten Teil geht es um Kommunikation. Mit dem dort vermittelten Wissen gelingt es Ihnen, die Komplexität von Kommunikation zu verstehen und Quellen für Missverständnisse zu erkennen. Die grundlegenden Informationen zur Kommunikation werden sich als gewinnbringender Qualitätsschlüssel im Zusammenleben von Betroffenen und deren Angehörigen und Pflegekräften erweisen.
Im dritten oder praktischen Teil wird das Wissen aus den medizinischen und kommunikationstheoretischen Darstellungen zusammengeführt und in Beziehung zur Begleitung von Demenzpatienten im Alltag gesetzt. Diese Ausführungen sollen dazu beitragen, dass sowohl Sie als pflegende Angehörige oder Pflegefachpersonen als auch die Demenzpatienten selbst ein würdevolles Miteinander im Alltag erleben. Der dritte Teil befasst sich mit der praktischen Umsetzung von entlastender Kommunikation mit demenziell erkrankten Menschen. Die Ausführungen in diesem Kapitel werden Formen und Beispiele von Kommunikation zeigen, die zur emotionalen Entlastung und psychischen Stabilisierung der Demenzerkrankten beitragen und dadurch auch zu einer Stärkung der pflegenden Angehörigen sowie des Fachpersonals führen. Im Vordergrund stehen hier Aspekte einer klaren und respektvollen Kommunikation, bei der sich mit fortschreitender Erkrankung die komplexe mündliche Kommunikation entlang der noch vorhandenen Kapazitäten des Patienten zugunsten nonverbaler Kommunikation abbaut ohne an Würde in der Beziehung und Zuneigung zum Patienten zu verlieren.
Sie werden feststellen, dass ich in den meisten Fällen zugunsten der einfacheren Lesbarkeit die männliche Form verwende. Selbstverständlich spreche ich dabei immer alle Geschlechter an.
Ich wünsche mir, dass es mit Hilfe dieses Buches gelingt, zu einer emotionalen Entlastung sowohl auf Seiten der Demenzpatienten als auch auf der Seite ihrer Angehörigen und des Pflegepersonals beizutragen. Ich möchte, dass alle Beteiligten für eine würdevolle Reise ins Vergessen gestärkt sind.
Herbert Heppener
2 Teil 1: medizinische Grundlagen
2.1 Demenz – Was ist das?
Demenz ist eine Erkrankung des Gehirns. Mit fortschreitender Entwicklung der Krankheit verlieren die Betroffenen zunehmend ihr Gedächtnis, die Fähigkeit logische Denkverknüpfungen zu machen oder sich räumlich oder zeitlich in ihrem Alltag zu orientieren. Über diese geistigen Beeinträchtigungen hinaus entwickeln sich später auch motorische Defizite. Den Patienten fällt es zunehmend schwer, ihre Bewegungen sauber und zielgerichtet zu steuern. Die Sprachproduktion verlangsamt sich, Gestik und Mimik nehmen ab und bleiben später vielleicht sogar ganz aus. Dieser kontinuierliche Verlust von Fähigkeiten und Fertigkeiten geht einher mit einer massiven Persönlichkeitsveränderung und starken Stimmungsschwankungen, die das Zusammenleben mit demenziell erkrankten Menschen nicht selten zu einer grossen Herausforderung werden lassen.
Aber was genau passiert im Gehirn, wenn sich eine Demenz entwickelt und ausbreitet? Gibt es Faktoren, die den Ausbruch einer Demenz begünstigen? Kann man einer Demenzerkrankung vorbeugen? Wie verläuft eine demenzielle Erkrankung? Diesen Fragen gehen die folgenden Ausführungen nach.
2.1.1 Demenz ist ein Sammelbegriff
Der Begriff ‘Demenz’ entstammt dem Lateinischen (Demens) und bedeutet so viel wie ‘ohne Geist’. Mit dieser Benennung ist der Kern dieser Erkrankung treffend umschrieben – die Betroffenen verlieren zunehmend ihre geistigen Fähigkeiten, das Gehirn verliert stetig an Leistung und Fähigkeit.
Die Medizin kennt unterschiedliche Formen demenzieller Erkrankungen: es gibt die Alzheimer-Demenz, die Lewy-Körper-Demenz, die vaskuläre Demenzerkrankung und die frontotemporale Demenz. Bei allen diesen Formen büssen die Betroffenen schrittweise ihre geistigen Fähigkeiten ein. Sie verlieren ihr Gedächtnis, das Denkvermögen, die Sprache und ihre Fähigkeit, sich zu bewegen. Diese Veränderungen gehen häufig auch mit der Veränderung der Persönlichkeitsstruktur einher.
Der Unterschied zwischen diesen vier Erscheinungsformen der Demenz liegt in ihren Ursachen, ihrem Krankheitsverlauf und der Häufigkeit ihres Auftretens. Im ICD10, dem internationalen Klassifizierungssystem von Krankheiten und Gesundheitsproblemen der WHO (Weltgesundheitsorganisation), ist die Demenz im Kapitel V (Psychische Störungen und Verhaltensstörungen) erfasst (www.icd-code.de).
Die nachfolgenden Ausführungen geben einen orientierenden Überblick über die Formen der Demenz, ihrer Ursachen und ihrer Häufigkeit im Spektrum der demenziellen Erkrankungen.
2.1.2 Alzheimer-Demenz
Der Name ‘Alzheimer’ geht auf den Arzt Alois Alzheimer zurück, der 1906 erstmals typische Ablagerungen in den Gehirnen seiner Patienten beschrieb, die an einer zunehmenden Verschlechterung ihrer Hirnleistungen gelitten hatten. Die Alzheimer-Demenz wird häufig auch als Morbus (Krankheit) Alzheimer, Alzheimer’sche Krankheit oder als Demenz vom Typ Alzheimer bezeichnet. Die Alzheimer-Demenz ist mit ungefähr 70 % die am häufigsten vorkommende Demenzform im Spektrum der Hirnleistungserkrankungen.
In einem Gehirn, das an Alzheimer-Demenz erkrankt, findet eine Ablagerung von Eiweissbestandteilen statt. Eiweiss (Protein) wird zum Aufbau und bei der Reparatur von Zellen benötigt. Die Proteine werden für diesen Prozess aufgespalten, deren nützlichen Bestandteile werden für den Zellaufbau und deren Reparatur verwendet. Die Proteinbestandteile, die nicht für die Zellpflege verwendet werden, werden vom Körper abgebaut und ausgeschieden. Derweil ein gesundes Gehirn in der Lage ist, die entstehenden Reststoffe abzubauen, gelingt dieser Abbauprozess in einem erkrankten Gehirn aus bislang unbekannten Gründen nicht mehr. Es entstehen Ansammlungen dieser Reststoffe, die auch als ‘Oligomere’ bezeichnet werden. Sie verklumpen zu unauflöslichen Ablagerungen, die sich zwischen die Nervenzellen des Gehirns anheften. Diese Klumpen werden auch als ‘Plaques’ bezeichnet. Die Ablagerungen heften sich von aussen an die Zellen. Zum einen gehen dadurch die Verbindungen zwischen den Zellen verloren, was den Informationsfluss im Gehirn erschwert. Zum anderen werden die Zellen des Gehirns nicht mehr ausreichend mit Protein versorgt, das für die Bildung und Erneuerung der Zellen notwendig ist. Die Zellen sterben ab. Die Leistungsfähigkeit des Gehirns schwindet stetig. Die Alzheimer-Demenz ist nicht heilbar. Die Symptome der Erkrankung sind nur in Teilen medikamentös behandelbar.
Da es sich bei der Alzheimer-Demenz um eine Hirnleistungsschwäche handelt, die auf einer nachlassenden Versorgung der Hirnzellen mit Protein beruht, rät die Forschung zu einer eiweissreichen Ernährung. Zudem geht man heute davon aus, dass geistige, körperliche und soziale Aktivitäten der Alzheimer-Demenz vorbeugen und ihren Verlauf positiv beeinflussen.
2.1.3 Lewy-Körper-Demenz
Die Lewy-Körper-Demenz ist die zweithäufigste Form der Demenzerkrankung und wird auch als Lewy-Körperchen-Demenz oder Lewy-Body-Demenz (LBD) bezeichnet. Sie tritt bei etwa 20 Prozent der Demenzpatienten auf. Die Lewy-Körper-Demenz ist nach dem Neurologen Friedrich H. Lewy benannt. Lewy konnte in den Gehirnen von Patienten, die an Parkinson erkrankt waren, unnormale Proteineinschlüsse in den Nervenzellen nachweisen. Die betroffenen Patienten hatten fortwährende und ansteigende Defizite in der Aufmerksamkeit. Zudem berichteten die Patienten von wiederholten Sinnestäuschungen und Wahrnehmungsstörungen und zeigten motorische Besonderheiten, wie sie für die Parkinsonerkrankung typisch sind. Auch wenn die Lewy-Körper-Demenz besonders im Bereich der Motorik grosse Ähnlichkeiten zur Parkinsonerkrankung aufweist, ist bislang noch nicht bekannt, ob es sich es sich bei der Lewy-Body-Demenz und der Parkinsonerkrankung um ein und dieselbe Krankheit handelt, die in zwei unterschiedlichen Varianten verläuft. Bekannt ist, dass bei beiden Ablagerungen in den Nervenzellen stattfinden. Allerdings sind die betroffenen Hirnareale jeweils unterschiedlich. Wie bei der Alzheimer-Demenz ist das Fortschreiten der Lewy-Körper-Demenz nicht aufzuhalten.
Medikamente können nur die Symptome lindern und den Verlauf im günstigsten Fall bremsen. Geistiges, körperliches und soziales Engagement haben auch hier einen positiven Einfluss auf den Verlauf der Krankheit.
2.1.4 Vaskuläre Demenz
Bei der vaskulären Demenz sterben Hirnzellen ab, weil das Gehirn nicht mehr ausreichend durchblutet wird. Die vaskuläre Demenz hat also ihre Ursache in der Erkrankung der Gefässe und / oder des Herzens. Ablagerungen in den Gefässen können zu einer Reduktion des Blutflusses führen. Eine Erkrankung des Herzens kann zu einer geringeren Herzleistung führen, was den Blutkreislauf negativ beeinflusst. In beiden Fällen können Zellen aufgrund der mangelnden Blutversorgung absterben. Betrifft das Zellsterben auch die Hirnzellen, spricht man von einer vaskulären Demenz. Die vaskuläre Demenz zeigt sich zunächst weniger im Abbau des Gedächtnisses. Im Vordergrund der vaskulären Demenzsymptomatik stehen einer Verlangsamung des Sprechflusses und eine Verkürzung der Aufmerksamkeitsspanne. Betroffenen Patienten fällt es zunehmend schwer, ihre Handlungen zu planen und auszuführen, was an der zunehmenden Einschränkung von Denkprozessen liegt. Zudem verlangsamt sich der Gang und das Gangbild verändert sich. Da diese Veränderungen den Patienten selbst nicht unbemerkt bleiben, leiden die betroffenen Menschen unter Stimmungsschwankungen. Das führt mittelfristig auch zu einer Veränderung der Persönlichkeit.
Da es sich bei der vaskulären Demenz um die Folge einer Herz-Kreislauferkrankung handelt, beugt alles, was dem Kreislauf und dem Herzen guttut, auch der vaskulären Demenz vor. Bluthochdruck, Diabetes und Herzerkrankungen kann durch ausreichend Bewegung und eine gesunde Lebensweise vorgebeugt werden. Im Falle einer vaskulären Demenzerkrankung können Hirnschädigungen, die bereits entstanden sind, zwar nicht mehr rückgängig gemacht werden, aber die Therapie von Bluthochdruck und die Behandlung von Herzerkrankungen sowie viel Bewegung und ein gesunder Lebenswandel können den Verlauf der Krankheit verzögern. Zur Behandlung der Stimmungsschwankungen und zur Stabilisierung der Gedächtnisleistung stehen Medikamente zur Verfügung.
2.1.5 Frontotemporale Demenz
Die Frontotemporale Demenz, die auch als Morbus Pick oder Pick’sche Krankheit bezeichnet wird, ist eine der seltenen Formen der Demenz. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass Hirngewebe zerstört wird. Davon betroffen sind die Stirn- und Schläfenlappen. Patienten, die an der frontotemporalen Demenz erkranken, zeigen erste Symptome im Alter von ungefähr 50 bis 60 Jahren. Sie fallen dadurch auf, dass sich ihr Verhalten verändert. Patienten mit einer frontotemporalen Demenz neigen zu Verwahrlosung, sie vernachlässigen ihre Körperhygiene oder verflachen in ihren sozialen Umgangsformen. Manche Patienten werden zunehmend apathisch. Andere neigen zu überzogener Euphorie und übertriebener Aktivität. Eine Heilung ist nach heutigem Stand der Kenntnis nicht möglich.
Medikamente zur Therapie der frontotemporalen Demenz sind nicht verfügbar. Die nichtmedikamentöse Therapie der betroffenen Patienten, die sich auf Bewegung, soziale Interaktion und Verhaltenstraining bezieht, erweist sich als schwierig, da die Bereitschaft zur Kooperation und Teilnahme stark vom sich entwickelnden Verhalten der Patienten abhängt.
2.1.6 Weitere, seltene Demenzformen
Neben den oben aufgeführten vier Demenzvarianten, die insgesamt ungefähr 95 Prozent aller Demenzerkrankungen ausmachen, leiden die verbleibenden 5 Prozent der Demenzerkrankten an den Formen einer Demenz infolge einer Creutzfeld-Jakob-Erkrankung, dem Korsakow-Syndrom, das durch exzessiven Alkoholmissbrauch verursacht wird, und einer Demenz, die als sekundäre Folge im Rahmen einer Parkinsonerkrankung entstehen kann.
Neben der medikamentösen Behandlung, die je nach Demenzform unterschiedlich sein kann, kommen auch nichtmedikamentöse Therapieformen zum Einsatz, die alle darauf abzielen, die soziale, sprachliche und mentale Aktivität der Betroffenen zu erhöhen, um gemeinsam mit der Medikamentengabe den Verlauf der Erkrankung zu verzögern. Eine Heilung ist nicht möglich. Als nichtmedikamentöse Therapien stehen in Abhängigkeit von der Kooperationsbereitschaft und Verfassung der Patienten Gedächtnistraining, Kunsttherapie, Ergotherapie, Logotherapie, Krankengymnastik, Musiktherapie, tiergestützte Therapieformen oder auch Biographiearbeit im Einzel- oder Kombinationseinsatz zur Verfügung.
2.2 Demenz – Risikofaktoren
In der Literatur wird eine Fülle von Risikofaktoren aufgeführt, die das Entstehen einer Demenz begünstigen können. Diese Auflistungen ergänzen sich teilweise, wiederlegen sich oder zeigen inhaltliche Überschneidungen, die das Verständnis erschweren.
Die nachfolgenden Ausführungen sind ein Versuch, eine strukturierte Darstellung der Risikofaktoren für Demenz aufzuzeigen.





























