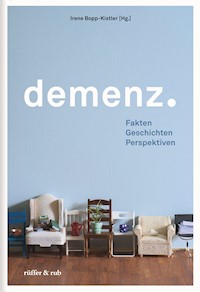
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rüffer & Rub
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ärztin: Wie geht es Ihnen? Patient: Ich bin im Durcheinandertal. Ärztin: Wie poetisch Sie das ausdrücken. Patient: Wissen Sie, was ich anspreche? Ärztin: Sie meinen den Roman »Durcheinandertal« von Friedrich Dürrenmatt. Patient: Schön, dass Sie den kennen. Sie sehen, ich bin weder dürr noch matt. Die Volkskrankheit Demenz verunsichert zutiefst. Die regelmäßigen Meldungen von neuen, endlich wirksamen Medikamenten wecken Hoffnungen auf den medizinischen Durchbruch – doch nach wie vor gibt es keinen Wirk- stoff, der diese Krankheit heilen kann. Es ist deshalb wichtig, den vielen direkt und indirekt Betroffenen auf fundierter Basis zu zeigen, was tatsächlich hilft. Im vorliegenden Buch »demenz.« nennen namhafte Expert:innen die bisher bekannten Fakten beim Namen und erläutern, was es damit auf sich hat. Betroffene und Angehörige berichten von »ihrer« Demenz und was sie mit ihrem Leben macht. Renommierte Autor:innen vermitteln Perspektiven auf sozial-politischer, medizinischer, vor allem aber auf menschlicher und spiritueller Ebene und zeigen auf, wie den Betroffenen respektvoll begegnet werden kann. »Das Standardwerk zu Demenz: 3. aktualisierte Auflage«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Verlag und die Herausgeberin bedanken sichfür die großzügige Unterstützung bei
Alzheimer Forum Schweiz
Hamasil Stiftung
Paulie und Fridolin Düblin Stiftung
sowie bei allen, die ungenannt bleiben wollen.
Der rüffer & rub Sachbuchverlag wird vom Bundesamt für Kulturmit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
Dritte Auflage Frühjahr 2022
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2016 by rüffer & rub Sachbuchverlag GmbH, Zü[email protected] | www.ruefferundrub.ch
Bildnachweis Umschlag:
© Alita Ong/Stocksy.com
E-Book-Konvertierung:
Bookwire GmbH
ISBN 978-3-907351-12-3
eISBN 978-3-907351-13-0
INHALT
Würde und Schicksal
Irene Bopp-Kistler
1DEMENZ – EINE KRANKHEIT MIT VIELEN FACETTEN
Die Demenz beginnt schleichend
Irene Bopp-Kistler
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Frau W.
Wenn der Hausarzt gefordert ist
Klaus Bally
Was Alois Alzheimer nicht ahnen konnte
Irene Bopp-Kistler
Blaue Katzen gibt es nicht – Neuropsychologische Perspektiven
Brigitte Rüegger-Frey
Die Frage der Vererbung
Irene Bopp-Kistler
Urteilsfähigkeit und selbstbestimmte Entscheidungen
Manuel Trachsel, Daniel Hürlimann
2BOTSCHAFTEN AUS DEM LAND DES VERGESSENS
Humor ist meine beste Medizin – Alzrainer berichtet
Rainer Diederichs
Zeit für meine Zukunft als Alzheimerpatient
Herr und Frau T.
Die glückliche Heimbewohnerin
Brigitte Hauser
Flaschenpost aus dem Durcheinandertal – Die Perspektive der Betroffenen
Irene Bopp-Kistler
Was »macht« Demenz mit den Menschen?
Christoph Held
»Am meisten ärgert mich, dass ich das Einfache nicht mehr kann« – Demenz am Arbeitsplatz
Margrit Sprecher
3VON GRENZERFAHRUNGEN IM ALLTAG
Einmal nach nirgendwo
Irene Bopp-Kistler
Der Dementor in Zeiten des Nebels
Isabella Lauener
Angehörigengruppen: gemeinsam stark
Regula Bockstaller
Von Sein und Verhalten
Irene Bopp-Kistler
Verkannt und bagatellisiert – Die frontotemporale Demenz
Margrit Dobler
Die verschwundene Birke
Joël Meier
4THERAPIEN – EINE GROSSE PALETTE
Therapeutische Möglichkeiten
Irene Bopp-Kistler
Mythen und Wahrheiten
Michael Gagesch
Prävention – nie zu früh und nie zu spät
Sacha Beck
Bitte Zähne nicht vergessen
Christian E. Besimo
Die »Ess-Kümmerer«
Markus Biedermann
Das Vergessen vergessen – in der Musiktherapie
Antoinette Niggli
Begleitetes Malen – ein Anker im Sturm der Verluste
Katharina Müller
Aufgeweckte Kunst-Geschichten
Sandra Oppikofer, Susanne Nieke, Karin Wilkening
»Aber ich bin doch noch da« – Theater mit Demenzerkrankten
Christine Vogt
5VOM LOSLASSEN
»Sie sollen doch zuerst einmal alle anderen aus dem Verkehr ziehen …«
Irene Bopp-Kistler
»Man muss es eben so nehmen, wie es kommt« – Einfühlende Kommunikation
Andrea Mühlegg-Weibel
Der Badezimmerspiegel
Christoph Harms
Von verpflanzten Menschen und Bäumen
Michael Schmieder
Er schlägt mich
Frau K.
Medizinische Entscheidungen am Lebensende
Georg Bosshard
6VON SPEZIELLEN STRUKTUREN
DemenzSpitex – ein Beruf mit Zukunft
Cornelia Kaya
Aufsuchende Demenzarbeit in der Stadt Zürich
Gabriela Bieri-Brüning
Herausforderung: Demenzerkrankte im Spital
Irene Bopp-Kistler
Wenn es Migrantinnen und Migranten trifft
Christa Hanetseder
Facetten der Langzeitpflege
Silvia Silva Lima
7DIE SPIRITUELLE DIMENSION
Mensch sein – eine Ermutigung
Annina Hess-Cabalzar, Christian Hess
Die andere Seite der Palliation
Irene Bopp-Kistler
Forschung zum Thema Lebensende
Henrike Wolf
Weil die Seele nicht verstummt
Angelika U. Reutter
Demenz und Spiritualität – eine inklusive Sicht
Ralph Kunz
ANHANG
Glossar/Sachregister
Anmerkungen
Weiterführende Unterstützung
Buchempfehlungen der Herausgeberin
Weiterführende Informationen
Biografien
Bild- und Grafiknachweis
Dank
Irene Bopp-Kistler
Würde und Schicksal
Die erste Auflage dieses Buchs erschien im Jahr 2016, seither ist dieses Buch für viele Betroffene und Angehörige, aber auch Professionelle, zu einem ständigen Begleiter geworden, weil es Fragen aufwirft und mögliche Antworten anbietet.
Menschen mit Demenz stellen sich zu Beginn der Erkrankung oft die Frage, wie es sein wird, wenn sie nicht mehr die Person von früher sein werden. Angehörige fürchten sich, dass sie vergessen könnten, wie die geliebte Person einmal war. Klar ist: Würde kann keinem Menschen genommen werden, auch nicht einem Demenzkranken, solange ihn das Gegenüber in seinem veränderten Sein annimmt und versteht.
Demenz – Punkt. Es geht nicht um Richtig oder Falsch, es geht darum, dass wir uns nach dem Lesen dieses Buches für Gedanken öffnen, die uns bis anhin verborgen waren. Die Autor:innen sind einerseits renommierte Fachleute aus Medizin, Theologie und Wissenschaft, andererseits aber auch Menschen, die tagtäglich mit der Demenzerkrankung konfrontiert werden, sei das als direkt Betroffene, als Angehörige oder als Professionelle. Zu Wort kommen viele Persönlichkeiten und greifen Themen auf wie Sinnfindung, Abschied, Angst, Partnerschaft, Sexualität, Scham oder Wut. Was bedeutet die Erkrankung für Menschen mit Migrationshintergrund oder für Familien mit einer genetischen Belastung? Muss Palliation[] bei dieser Erkrankung anders definiert werden?
Die Demenz tritt schicksalhaft in das Leben der Betroffenen und ihrer Familien. Giovanni Maio meint dazu: »Die Medizin ist angetreten, um das Schicksal zu bekämpfen … Aber gerade dieser erreichte Erfolg droht heute der Medizin zum Verhängnis zu werden, weil die moderne Medizin in ihrer auf Machbarkeit orientierten Grundhaltung dem Irrglauben verfallen ist, dass sie überhaupt kein Schicksal mehr zu akzeptieren brauche …«1 Viele Demenzerkrankte und ihre Angehörigen zeigen uns, wie sie lernen – trotz Schmerz –, das Schicksal zu akzeptieren.
Die Erkrankung betrifft genau den Bereich, der uns so wichtig ist: unser Denken und unsere Persönlichkeit, weswegen sich die Frage stellt, ob ein solches Leben noch Sinn macht. Der Sinn des Lebens wird meist damit verknüpft, ob das Leben dem entspricht, was wir von ihm erwarten. Wenn man Sinn so definiert, dann hat das Leben mit Demenz tatsächlich wenig Sinn. Es könnte aber auch darum gehen, dass wir fähig werden, in jeder Situation, die uns schicksalhaft gegeben wird, nicht aufzugeben – wir alle sind Suchende. Der Sinn des Lebens ist nicht allein durch Hirnleistung bestimmt, sondern durch die bewusste Wahrnehmung jedes einzelnen, einzigartigen Moments. Eine Angehörige schreibt während des Sterbeprozesses ihres Ehemanns: »Ja, da sehnt man sich manchmal nach dieser Zeit, und wenn sie da ist, ist es auch wieder zu früh. Doch im Moment haben wir einfach ZEIT zum Dasein!«
Leben besteht aus dem ständigen Prozess des Loslassens. Betroffene und ihre Angehörigen sind gezwungen, immer wieder loszulassen. In diesem Prozess des Loslassens sind sie uns voraus.
Aus mir ist keine Mathematikerin geworden, wie ich es ursprünglich vorhatte, doch die Mathematik hat mir geholfen bei der Suche, Zusammenhänge und Widersprüche einzuordnen. Als Ärztin werde ich auch nach meiner Pensionierung weiterhin Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen auf der Suche nach Antworten begleiten, auch in Momenten, in denen die Sinnhaftigkeit des Lebens infrage gestellt wird.
Irene Bopp-Kistler, Juni 2022
Irene Bopp-Kistler
Die Demenz beginnt schleichend
Bevor die Menschen zu mir in die Sprechstunde kommen, liegt eine lange Zeit der Verunsicherung und schließlich der Verzweiflung hinter ihnen. Ein Name wird vergessen, ein Schlüssel nicht gefunden, die Wörter liegen nicht mehr auf der Zunge. Wir alle kennen die Reaktion auf solche Fehlleistungen: Wir sind verunsichert, spüren auch eine leichte Angst, die mit jeder weiteren Situation des Vergessens noch stärker wird. Solchen Situationen begegnen wir nur ab und zu, doch bei Menschen mit einer Demenz[] gehören solche Momente zum ständigen Erleben.
Eine Demenzerkrankung ist eine Hirnerkrankung, die zu Einschränkungen von mehreren Hirnfunktionen führt, was Einbußen im Alltag zur Folge hat. So lautet die kürzeste medizinische Definition der Demenz. Der Selbstwert und das Selbstverständnis der Betroffenen werden schon zu Beginn der Erkrankung erschüttert, die Angst ist ein ständiger Begleiter, und diese wird mit jeder noch so kleinen Fehlleistung immer größer. Menschen mit einer beginnenden Demenz haben enorme Angst, über ihre Aussetzer zu sprechen, weil sie sich vor der Reaktion ihres Gegenübers fürchten. Und das lässt die Angst noch größer werden. Erst wenn wir uns vor Augen halten, wie einsam und unverstanden sie sich fühlen müssen, können wir uns in die Menschen mit einer beginnenden Demenzerkrankung hineinversetzen.
Bei fast allen Patient:innen beginnen die Leidensgeschichten nahezu gleich.
Ständige Vergesslichkeit begleitet mich: Ich suche nach Namen, bin weniger speditiv, am Arbeitsplatz bringe ich nicht mehr die gewohnten Ergebnisse. Ich befinde mich in einer permanenten Stresssituation. Das Mitarbeiter:innengespräch fällt, nach Jahren der Zufriedenheit und der Wertschätzung, plötzlich schlecht aus. Ich fühle mich benachteiligt, nicht verstanden, alleine gelassen.
Am Morgen habe ich keine Lust aufzustehen. Ich habe keine Motivation, zur Arbeit zu gehen, bin erschöpft und lustlos. Ich bin wütend, mache andere für meine Situation verantwortlich. Ich fühle mich von Kolleginnen und Kollegen gemobbt. Hinter meinem Rücken wird über mich geredet, aber nicht mit mir. Ich lasse mich krankschreiben, Burn-out, da hat man das Recht dazu. Trotzdem fühle ich mich nicht besser. Auch zu Hause treten Fehler auf, auch hier werde ich nicht verstanden, es kommt ständig zu Streit. Ich wehre mich gegen alles, möchte einfach in Ruhe gelassen werden.
Ob ich Alzheimer []habe? Doch ich verdränge diesen Gedanken sofort. Die Menschen würden mit dem Finger auf mich zeigen. Ich stecke in einer Sackgasse. Alle machen mir Vorwürfe, wollen alles besser wissen. Es ist dicke Luft im Haus. Ich werde wieder krankgeschrieben, zuerst vom Hausarzt, dann von einem Psychiater wegen einer Depression []. Ich weiß nicht, ob ich depressiv bin, ich mag nicht mehr, mag auch nicht mehr unter die Leute.
Ich schäme mich, bin aber gleichzeitig froh, dass mich meine Frau endlich darauf anspricht, dass mit mir etwas nicht stimmt. Ich streite es ab, und dennoch nehme ich wahr, dass etwas anders ist. Erneut Streit, Argumente und Gegenargumente.
Und dann die Aufforderung meines Hausarztes, zu einer Abklärung in eine Memory Clinic []zu gehen. Ich sträube mich dagegen, doch so kann es auch nicht weitergehen. Andererseits: Endlich wird meine Situation ernst genommen. Doch was kann es sein? Hoffentlich nicht Alzheimer, ich bin doch erst 56? Ich hoffe auf eine Ursache, die man behandeln kann …
Ein Erleben, das Unzählige mitten unter uns durchmachen. Eine Geschichte, die nicht in den Zeitungen steht; eine Geschichte, die in keinem Lehrbuch zu finden ist, und dennoch ist sie lehrbuchhaft.
Jede Demenzerkrankung beginnt unmerklich, die Betroffenen spüren Veränderungen an sich, können diese aber nicht richtig einordnen. Angehörige nehmen Defizite wahr, ein eigenartiges Verhalten, wagen aber nicht, darüber zu sprechen. Doch die Veränderungen lassen sich nicht länger ignorieren. Eine Abklärung wird immer dringlicher.
Überweisungszeugnis eines 58-jährigen Ökonomen in verantwortungsvoller Position: Die überweisende Psychiaterin schreibt, dass sich der Patient umbringen würde, wenn ich ihm allenfalls die Diagnose der Demenz übermitteln müsste.
Vor mir sitzt eine starke Persönlichkeit, die im Berufsleben zunehmende Kränkungen erfährt, weil es immer wieder zu unangenehmen Vorfällen kommt. Es fällt die Diagnose eines Burnouts, der Patient versucht trotzdem wieder 50% zu arbeiten, aber es geht nicht, er fühlt sich müde und antriebslos. Nach intensiven Abklärungen zeigt sich, dass es sich bei ihm um eine beginnende Alzheimerdemenz handelt.
Im Beisein seiner Ehefrau sage ich: »Sie haben Alzheimerdemenz.« Nach einer kurzen Pause fahre ich fort: »Ihre Psychiaterin schreibt, dass Sie nun Ihrem Leben ein Ende setzen möchten.« Der Patient schaut mich an und erwidert: »Endlich kann ich meine Defizite richtig einordnen, ich möchte krankgeschrieben werden.«
Was hat diesen Menschen fast in den Suizid getrieben? Es war nicht die Diagnose einer Alzheimerdemenz, sondern die unklare Situation, die an seinem Selbstwertgefühl rüttelte. Der gestandene Ökonom wurde nur noch auf seine Defizite aufmerksam gemacht und nicht mehr auf seine Stärken.
Zwei Jahre später geht es dem Patienten subjektiv gut, für seine Ehefrau waren es Jahre des Wachstums und des Lernens. Der Patient braucht keine Antidepressiva mehr, er arbeitet nicht mehr und hat sich neue Aufgaben gesucht: mehr Sport, Mitwirken in einem Historikerclub (er wird dort geschätzt, hat seine Situation offen dargelegt), Reisen nach Amerika, wo er sich immer schon wohlfühlte. Auf meine Empfehlung hin hat er sich im Geschäft zu seiner Krankheit bekannt und darauf nur positive Reaktionen erhalten.
Immer wieder wird postuliert, dass man Menschen mit der Diagnosestellung Alzheimer in den Suizid treiben könnte. Genau das Gegenteil ist der Fall: Die Unsicherheit, das Verlorensein in einer nicht einzuordnenden Situation führt zu suizidalen Gedanken.
Eine offene Kommunikation über die Diagnose Demenz ermöglicht es Angehörigen und Betroffenen gleichermaßen, das Leben neu an die Hand zu nehmen, auch wenn die Diagnose zunächst schockiert. Und in der Mehrheit der Fälle führt die Diagnosestellung zu einer Milderung der Symptome.
Eine Abklärung erfindet keine Diagnose, sondern gibt Symptomen einen Namen!
Eine klare Diagnosestellung ist essenziell, weil sich nicht hinter jeder kognitiven[] Einbuße eine Alzheimerdemenz versteckt. Umso unverständlicher ist die Tatsache, dass oft geäußerte Symptome, die von Patient:innen beunruhigend empfunden werden, von ihrer Umgebung und leider auch von Hausärztinnen und -ärzten zu wenig ernst genommen werden.
Wieso werden ausgerechnet Beschwerden, die die Hirnleistung betreffen, von vielen Ärztinnen und Ärzten bagatellisiert? In einem Workshop für Hausärztinnen und Hausärzte habe ich genau diese Frage gestellt; die offene Antwort, von mehreren Kolleg:innen bestätigt: Im Vordergrund steht die Befürchtung, dass nach einer Demenzdiagnose ein riesiges Case Management nötig ist, für das sie kaum Zeit finden. Dazu gehören beispielsweise die Besprechung der Fahreignung[], die Abklärung der Urteilsfähigkeit, die Organisation von Hilfe, der Miteinbezug von Angehörigen. Diese längst nicht vollständige Liste zeigt, wie komplex die Situation nach einer Demenzdiagnose ist. Die Antworten zeigen aber auch, dass unser Gesundheitssystem sehr stark auf die Behandlung der Somatik (= körperliche Beschwerden) ausgerichtet ist und dass zeitintensive sozialmedizinische Betreuung finanziell nicht adäquat abgegolten wird. Das muss sich ändern, denn Demenzkranke werden eine Realität in allen Praxen sein. Das Gesundheitssystem sollte die praktizierenden Ärztinnen und Ärzte unterstützen, die sich bereit erklären, solche Patient:innen ganzheitlich zu betreuen, und die auch die Bereitschaft mitbringen, Krisensituationen zu managen. Denn: Krisen sind bei allen Demenzbetroffenen vorprogrammiert.
Ein weiterer Grund, wieso Grundversorger:innen vor der Diagno sestellung zurückscheuen: Die medikamentösen therapeutischen Möglichkeiten sind begrenzt. Immer wieder höre ich: Keine Therapie, wieso also eine Abklärung? Ein solcher Satz zeugt von einem medizinischen Denken, das nur auf »Machbarkeit« ausgerichtet ist.
Ein hochbetagter Mensch mit einer leichten Hirnleistungsstörung, der bereits über ein breites Unterstützungsnetz verfügt und bei dem keine größeren sozialmedizinischen Schwierigkeiten vorhanden sind, braucht auch aus meiner Sicht nicht dieselbe intensive Abklärung wie ein jüngerer, der noch im Arbeitsprozess steht. Doch auch ältere Menschen mit kognitiven Problemen haben das Recht auf Abklärung und Wissen. Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, dass bezüglich technischer Abklärungen und Eingriffe keine Altersbeschränkung vorhanden ist, doch wenn es um Hirnleistung geht, dann wird nicht mit der gleichen Elle gemessen.
Die Abklärung einer Hirnleistungsstörung ist nicht nur wegen des ganzheitlichen therapeutischen Ansatzes gefragt, sondern vor allem, um mögliche Ursachen zu identifizieren, die behandelbar sind. Dazu gehören unter anderem Stoffwechselstörungen, Vitaminmangelzustände und Entzündungen. Neben einer breiten internistischen Abklärung sollte auch immer eine Bildgebung (MRI[] oder ein CT[]) gemacht werden, mittels denen die Suche nach Tumoren oder Blutungen möglich ist. Speziell soll an dieser Stelle das Subduralhämatom[] erwähnt werden, das oft unerkannt bleibt oder mit einer Demenzerkrankung verwechselt wird.
Die Assistenzärztin ruft mich zu einem älteren, leicht verwirrten Mann. Die Ehefrau berichtet, dass er sich in den letzten Monaten mehr und mehr zurückgezogen habe und eine deutliche Störung des Gedächtnisses []zeige. Er könne aber immer noch gut gehen, sie unternehmen noch lange gemeinsame Spaziergänge.
Das in unserer Klinik routinemäßig durchgeführte MRI des Hirns zeigt zu unserem Erstaunen zwei ausgedehnte Subduralhämatome, obwohl das klinische Bild überhaupt nicht dazu passte. Nach einem operativen Eingriff erholte sich der Patient.
Mit der Untersuchung der Hirnflüssigkeit (= Liquor[]) kann einerseits eine Entzündung ausgeschlossen oder gefunden werden, andererseits ist es auch möglich, gewisse Marker zu identifizieren, die spezifisch bei der Alzheimerkrankheit vorkommen.
Ein Mann, 70-jährig, verwirrt, sturzgefährdet, völlig wesensverändert, soll in einem Pflegeheim betreut werden. Der sanfte Großvater bedrohte plötzlich seine Enkelkinder. Von der Memory Clinic hatte er gehört und war bereit für eine Abklärung, weigerte sich jedoch, ins Pflegeheim einzutreten.
Meine erste Frage: »Was stört Sie am meisten?« Die Antwort lautete: »Meine Kopfschmerzen, und dass ich plötzlich zuckerkrank bin.« Gedächtnisstörungen erwähnte er nicht. Ich ging auf seine Schmerzen ein, der Patient fasste Vertrauen und willigte schließlich in alle Abklärungen ein.
Die Liquoruntersuchung []ergab eine schwere Entzündung, hervorgerufen durch Borrelien []. An einen Zeckenbiss konnte sich der Patient allerdings nicht mehr erinnern. Die Zuckerkrankheit war durch die Infektion ausgelöst worden. Kopfschmerzen sind kein Leitsymptom der Alzheimerkrankheit. Der Patient wurde während drei Wochen mit Antibiotika behandelt, die Symptome haben sich mehrheitlich zurückgebildet. Er fährt nun wieder mit seinem Auto in sein geliebtes Rustico im Tessin.
Vermutlich gibt es wenige Gebiete in der Medizin, in denen man mit so großer Unsicherheit und auch schlechter Prognosefähigkeit umgehen muss, wie in der Abklärung von Hirnleistungsstörungen. Selbst wenn die Ergebnisse aller Untersuchungen auf eine beginnende Demenz hinweisen, taucht umgehend die Frage auf, ob das wirklich sein kann.
Jede Demenzerkrankung beginnt Jahre zuvor mit einer subjektiven Gedächtnisstörung (SCI)[]. Diesem Stadium folgt eine ganz leichte Einbuße verschiedener Hirnleistungen, auch mild cognitive impairment (MCI)[] genannt, oder nach neuer amerikanischer Nomenklatur auch mild neurocognitive disorder (NCD)[].
Die Sachlage wird noch komplizierter, wenn man bedenkt, dass nur ein kleiner Bruchteil der Patient:innen mit einer subjektiven Gedächtnisstörung und etwa die Hälfte der Patient:innen mit einer milden kognitiven Beeinträchtigung nach Jahren an einer Demenz erkranken werden. Demgegenüber steht die Tatsache, dass es sich bei einem Teil der Patient:innen sogar spontan verbessern kann; bei einem anderen Teil bleiben die leichten Defizite bestehen, werden aber nicht stärker. Dieser unklare Umstand belastet und kann zu Depression und Verzweiflung führen, insbesondere dann, wenn die Betroffenen noch im Berufsleben stehen. Deshalb ist es angebracht, weitere, auch kostspielige Abklärungen (Liquorpunktion, PET[]) durchzuführen. Leider zeigen Studien, dass ausgerechnet die Menschen, die Angst vor einer Demenzerkrankung haben und tatsächlich eine leichte Hirnleistungsstörung aufweisen, wirklich gefährdet sind, im Laufe der Jahre eine Demenzerkrankung zu entwickeln.1 Die Forschung ist noch nicht so weit, dass die Diagnose zu Lebzeiten mit 100-prozentiger Sicherheit gestellt werden kann, wir können uns ihr mit 70- bis 90-prozentiger Sicherheit annähern.
Eine Diagnosestellung setzt sich wie ein Puzzle zusammen: Am Anfang steht die Anamnese[], die wichtiger ist als jede medizinische und neuropsychologische[] Abklärung. Zuhören, Nachfragen, die geschilderten Beschwerden und Symptome richtig einordnen, zeitliche Zusammenhänge erfragen, verschiedene Wahrnehmungen aufnehmen. Das Geheimnis des guten ärztlichen Gespräches: sich einlassen auf die Patient:innen und Angehörigen und nicht nur die technischen Abklärungen im Auge haben. Letztere sind notwendig und aussagekräftig, doch heutzutage verliert man sich oft in technischen Abklärungen und vergisst dabei den Menschen mit seinen ureigenen Sorgen und Beschwerden.
Das Ziel eines Diagnosegespräches
Das Verständnis von Krankheitsprozessen und deren Auswirkungen ist sowohl die Grundlage jeder rationalen Therapieplanung als auch die Voraussetzung für die Kommunikation mit den Patient:innen und deren Angehörigen. Eine längerfristige Therapieplanung darf nie nur aus einer medikamentösen Therapie bestehen, sondern muss milieutherapeutische[] und sozialmedizinische Maßnahmen beinhalten.
Die Übermittlung einer Demenzdiagnose entspricht der Übermittlung einer schlechten Nachricht. Aus der Onkologie ist seit Jahrzehnten bekannt, dass das Wie der Diagnoseeröffnung für die weitere Verarbeitung der so herausfordernden Situation von größter Wichtigkeit ist. Alzheimer Europe2 stellt seit Langem die Forderung, dass der/die Patient:in primär das Recht auf eine klare Information bezüglich seiner Diagnose hat und dass ihm/ihr dieses Recht nur in dem Fall nicht zukommen soll, wenn er/sie dies nicht wünscht. Manchmal braucht es etwas Überzeugungskunst, doch es ist hilfreich, wenn sowohl Betroffene wie auch die Angehörigen die Diagnose gleichzeitig hören. Die Erfahrung zeigt, dass die Angehörigen nicht früh genug mit einbezogen werden können. Dennoch ist es äußerst wichtig, dass nicht über die Demenzerkrankten gesprochen wird, sondern mit ihnen. Nur so können gemeinsame Lösungsstrategien gefunden werden, auch wenn der/die Patient:in seine Symptome nicht gleich wahrnimmt wie das Umfeld (Anosognosie[]).3
In der Praxis sieht es aber oft anders aus: Man spricht mit den Angehörigen über die Patient:innen, auch in deren Gegenwart. Immer wieder hört man die Aussage von Angehörigen: »Diese Diagnose kann man doch den Betroffenen nicht zumuten.« Man versucht den/die Patient:in zu schonen, doch die Folge davon ist die Unmöglichkeit gemeinsamer Gespräche. Die gleichzeitige Information aller Beteiligten hat mit Respekt und Wertschätzung dem/der Patient:in gegenüber zu tun und mit einer partnerschaftlichen Arzt-Patient-Angehörige-Beziehung.
Zu klären ist, ob die Betroffenen und die Angehörigen die Diagnose tatsächlich wissen wollen. Dieser Frage ist man auch in unzähligen Studien nachgegangen, und in nahezu allen wurde der Wunsch nach Information sowohl von Betroffenen wie auch von Angehörigen bestätigt.4 Es konnte zudem gezeigt werden, dass Paare, die bereits eine Demenzerkrankung befürchteten, mit Erleichterung auf die Diagnose reagierten, auch wenn sie gehofft hatten, dass eine andere Erklärung für die Symptome gefunden werden könnte.5 Nur die Menschen, die in keiner Weise mit einer Demenzdiagnose gerechnet hatten, reagierten teils schockiert. Meine Erfahrung weist aber darauf hin, dass sich im Laufe der Erkrankung auch bei solchen Paaren eine offene Kommunikation als positiv erweisen wird. Auch wenn schlimmste Befürchtungen bestätigt werden, ist dies besser als die nagende Ungewissheit.
Schwieriger ist die Diagnoseübermittlung bei Alleinstehenden, besonders wenn sie keine Krankheitseinsicht haben. In solchen Situationen ist es unumgänglich, Hilfe (Spitex[], aufsuchende Beratung oder auch Involvierung der Behörden) zu organisieren.
Wichtig ist, Betroffene und Angehörige nach dem Diagnosegespräch mit ihren Ängsten nicht alleine zu lassen, sondern ihnen eine von menschlicher Anteilnahme und fachlichem Wissen geprägte Begleitung anzubieten. Die Erfahrung zeigt, dass Außenstehende die Demenzerkrankung oft sehr wohl wahrgenommen haben und dass nach erfolgter Diagnoseeröffnung eine wesentlich offenere Kommunikation im Familien- und Freund:innenkreis möglich ist.
Auch einige Ärztinnen und Ärzte vertreten die Meinung, dass Demenzerkrankte nicht über die Diagnose informiert werden sollten. Dies kann mehrere Gründe haben, zum Beispiel Unsicherheit, was die Diagnosestellung bei den Betroffenen auslösen könnte, insbesondere ob sie mehr schaden als nützen würde.6 Zudem fürchten sich Ärztinnen und Ärzte davor, dass sie die Betroffenen damit verärgern könnten, dass diese noch hilfloser würden, ihren Selbstwert verlieren könnten oder dass die Diagnoseübermittlung eine Krise, wenn nicht gar Stigmatisierung auslösen könnte.7 Doch die Realität sieht anders aus: In keiner Arbeit konnte bisher gezeigt werden, dass durch die Bekanntgabe der Diagnose die Betroffenen neu eine Depression entwickelten oder Suizid begingen.8 Es zeigt sich vielmehr, dass vor der Diagnosestellung das Unwissen, die Unsicherheit, die Kränkungen und die Ungewissheit, die Krisensituation und der Kampf um das Verstecken der Symptome die Menschen in die Depression und Suizidalität treibt.
Der Suizid von Gunter Sachs könnte dafür ein Beispiel sein. Er hat seinem Leben ein Ende gesetzt, weil, wie er selber schreibt: »Der Verlust der geistigen Kontrolle über mein Leben […] ein würdeloser Zustand [wäre], dem entschieden entgegenzutreten ich mich entschlossen habe.« In diesem Abschiedsbrief geht es um Begriffe wie Würde und Lebenssinn, wenn die kognitiven Funktionen nicht mehr in dem Maß vorhanden sind wie zuvor. Eine klare Diagnosestellung fand vermutlich nicht statt. Es wird somit für immer offen bleiben, ob es sich wirklich um eine beginnende Demenzerkrankung handelte oder nicht vielmehr um eine Depression, die häufig auch von kognitiven Ausfällen begleitet wird.
Selbst wenn die Ärztinnen und Ärzte keine durchschlagende medikamentöse Therapie anbieten können, löst die Diagnoseübermittlung nur dann Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit aus, wenn die Mediziner:innen nicht fähig sind, den Patient:innen trotz der Schwere der Erkrankung Wege aufzuzeigen, wie auch mit einer Alzheimerkrankheit ein gutes Leben möglich ist.
Das Diagnosegespräch als erster therapeutischer Schritt
Die Therapie beginnt mit der Diagnoseeröffnung. Das Diagnoseeröffnungsgespräch, an dem alle wichtigen Bezugspersonen anwesend sind, sollte in einem ruhigen Rahmen und mit genügend Zeit durchgeführt werden. Zwar müssen die wichtigsten Befunde erklärt werden, doch viel wichtiger ist, dass auch die Betroffenen und Angehörigen Raum erhalten, ihre Gefühle auszudrücken. Der Palliativmediziner [] Gian D. Borasio9 weist darauf hin, dass die Zufriedenheit der Patient:innen nach einem Gespräch direkt mit der Dauer des eigenen Gesprächsanteils zusammenhängt. Dieser Anteil sollte idealerweise größer als derjenige der Ärztin oder des Arztes sein. Eine hohe Messlatte, neigen Ärztinnen und Ärzte doch dazu, möglichst alle medizinischen Details zu übermitteln. Das führt dazu, dass komplizierte medizinische Sachverhalte oft in einer Sprache erläutert werden, die für die meisten Patient:innen unverständlich ist. Dabei rückt das Wesentliche in den Hintergrund: die Übermittlung der schlechten Nachricht.
Die ersten Emotionen und Sätze nach der Diagnoseeröffnung sind für die weitere Gesprächsführung äußerst wichtig und sollten nicht durch das rasche Aufzählen medizinischer therapeutischer Möglichkeiten unterbunden werden, nur weil sich die Diagnoseübermittler:innen unsicher fühlen. Es ist beispielsweise eindrücklich zu erfahren, was eine Pause im Gespräch auslösen kann, wenn nicht sofort von ärztlicher Seite Lösungen vorgeschlagen werden.
Es ist essenziell, dass in erster Linie mit den Betroffenen direkt gesprochen wird und in einem zweiten Schritt mit den Angehörigen. Die Demenzerkrankten fühlen sich ernst genommen, was sie erleichtert. Wertschätzung, Betonung der Stärken, positive Formulierungen und Spiegeln der Gefühle stärken ihn. Der Einbezug der Biografie, die den Menschen zu dem gemacht hat, der er ist, ist eine Möglichkeit, Lösungsstrategien aufzuzeigen, weil sich damit der Demenzerkrankte nicht nur als Patient:in wahrnimmt, sondern als ebenbürtige/r Gesprächspartner:in.
Eine ehemalige Spitexfachfrau kommt in die Memory Clinic, sie wird von ihrer Nichte dazu gezwungen. Die Diagnose: eine leichte bis mittelschwere Demenz. Die Nichte kann nicht zuschauen, wie der Haushalt ihrer Tante zunehmend verwahrlost. Die Patientin lehnt jede Hilfe ab, auch von der Spitex. Sie meint, dass sie es besser könne, sie habe ja die Spitex mit aufgebaut. Jede Argumentation der Nichte wird mit einem Gegenargument beantwortet. Ich wende mich an die Patientin: »Das muss eine Herausforderung sein, Sie als Pionierin der Spitexdienste sollen nun selber Hilfe annehmen. Und hier sitzen zwei Frauen: Sie eine Powerfrau, und ich eine Powerfrau, und nun soll die eine Powerfrau der anderen vorschreiben, was sie zu tun hat. Ich bewundere Sie für alles, was Sie gemacht haben, aber auch dafür, wie Sie mit der jetzigen Situation umgehen. Sie kämpfen und geben nicht auf, und dennoch verstehe ich, dass sich Ihre Nichte Sorgen macht …«
Die Patientin wurde ganz ruhig und meinte, dass sie verstehen kann, dass wir uns Sorgen machen, und sie willigte kurz danach ein, dass die Spitex organisiert wurde.
Durch sogenanntes aktives Zuhören[], durch das Spiegeln ihrer Gefühle, fühlte sich die Patientin plötzlich verstanden und konnte ihre ablehnende Haltung ablegen. Bereits in diesem Erstgespräch brachte ein validierendes Verhalten den gewünschten Erfolg. Validation[] ist in allen Phasen der Demenz möglich. Die Patientin musste sich nicht mehr rechtfertigen und war auch erleichtert, dass der Kampf mit der Nichte, die sie eigentlich liebte, ein Ende fand.
Im Diagnosegespräch sollten auch die Angehörigen zu Wort kommen. Schon zu Beginn der Erkrankung tritt fast unmerklich eine Änderung der Persönlichkeit bei den Betroffenen auf, die zu Konflikten führt. Bereits im ersten Gespräch sollten Themen angesprochen werden, die die Nöte und Gefühle der Angehörigen spiegeln, denn sie sind äußerst dankbar für Erklärungsmodelle. Antriebslosigkeit nicht mehr als Provokation oder Desinteresse zu erleben, sondern als Teil der Erkrankung zu verstehen, hilft ihnen und verhindert Wut und Aggressionen gegenüber den Erkrankten.
Jede Geschichte ist einzigartig. Worte wie »Sie sollten, Sie brauchen, nehmen Sie doch Hilfe an« verletzen mehr, als sie helfen. Fragen hingegen wie: »Was schmerzt am meisten, wie kann ich Ihnen helfen?«, berühren auf der persönliche Ebene. Ein junger Ehemann einer Patientin antwortete auf die Frage, was ihn am meisten schmerzt: »Dass ich mich nicht mehr anlehnen kann.«
Die individuelle Beratung und Begleitung der Angehörigen ist wichtiger als jeder andere therapeutische Ansatz.10 Patient:innen sind das »Spiegelbild« der Angehörigen. Gehen die Angehörigen nicht argumentativ, sondern verstehend mit den demenzerkrankten Personen um, fühlen sich die Betroffenen sicher, und es entstehen weniger Verhaltensstörungen. Und das ist möglich, wenn von Anfang an Kommunikationshilfen aufgezeigt werden. Angehörige sind dankbar für jeden Hinweis, eine von ihnen brachte es auf den Punkt: »Es ist mehr zu lernen als in der Schule.« Wenn die Angehörigen zum Beispiel erkennen, dass es die Krankheit ist, die dazu führt, dass der/die Patient:in seine Symptome nicht wahrnimmt, müssen sie sich nicht verletzt fühlen. Ein Angehöriger meinte ein halbes Jahr nach dem Diagnosegespräch:
»Seit Sie mir gesagt haben, dass es für meine Frau immer wie das erste Mal ist, wenn sie mich das Gleiche fragt, kann ich damit umgehen. Und wenn sie x-mal dasselbe fragt, dann denke ich einfach an Sie und unser Gespräch, und es geht mir wieder gut, weil ich weiß, dass meine Frau es nicht extra macht. Auch ihr geht es viel besser, weil ich sie nicht ständig daran erinnere, dass sie dasselbe schon unzählige Male gefragt hat.«
Inzwischen ist allgemein bekannt, dass noch keine wirksame Therapie bei einer Alzheimererkrankung existiert. Dennoch gibt es Hilfestellungen – manchmal nur ein liebevolles Wort –, das einen enormen Unterschied bewirkt. Ich habe große Hochachtung vor den Angehörigen, mit wie viel Liebe und Achtsamkeit sie die Hinweise, die Ärztinnen oder Ärzte und Therapeut:innen anzubieten haben, umsetzen. Das ist allerdings nur möglich, wenn der Boden dafür gelegt wurde. Und darin besteht die Kunst des Diagnosegespräches: Es ist der Schlüssel, mit dem die Angehörigen, aber auch die Betroffenen in der so herausfordernden Situation wachsen und neue Hoffnung finden können. Dies verlangt große Empathie vonseiten der Professionellen, Verständnis für Trauer und Tränen und vielleicht auch einmal eine Umarmung oder ein kurzes Händehalten, was in den klassischen Therapiebüchern tabuisiert wird. Wird hingegen die Diagnoseübermittlung lediglich als Bekanntgabe der Befunde abgehandelt, können ein solches Gespräch und die schlechte Nachricht für immer als traumatisch in Erinnerung bleiben.
Bereits im ersten Gespräch sollten weitere Konsultationen vereinbart werden, in denen Themen wie Vorsorgevollmacht[], Testament, Patientenverfügung[] u.a. besprochen werden. Zudem muss oft auch die Fahreignung angesprochen werden. Es ist bekannt, dass von einem Gespräch zwischen Ärztin oder Arzt und Patient:in weniges »ankommt«, doch was vom ersten Gespräch in Erinnerung bleiben sollte, ist die Tatsache, dass sich Betroffene und Angehörige verstanden fühlen und mit der Demenzdiagnose nicht alleine gelassen werden. Die Erfahrung zeigt, dass man offen sprechen kann, auch im Beisein der Demenzerkrankten, selbst wenn diese nicht adäquat folgen oder reagieren können. Wichtig ist, dass sie sich nicht ausgeschlossen fühlen. Auch wenn die sprachliche Kommunikation schon erschwert sein sollte, nehmen Demenzerkrankte sehr wohl wahr, was emotional geschieht. Borasio11 spricht von einer generellen Gratwanderung zwischen Fürsorge durch die Ärztin oder den Arzt und Selbstbestimmung der Patient:innen. Bei Demenz ist die Sachlage noch etwas anders, weil die Wünsche der Patient:innen und ihrer Angehörigen häufig verschieden sind. Um in diesem Spannungsfeld allen gerecht zu werden, braucht es ein hohes Einfühlungsvermögen, um zu entscheiden, wie viel Fürsorge gerade im Moment benötigt wird.
Es ist beeindruckend, dass einzelne Sätze oder auch Bilder (z.B. MRI) für immer erinnert werden. Somit muss man nachfragen, ob ein MRI-Bild wirklich gemeinsam angesehen werden soll. Dies kann das Verständnis für das Geschehen verstärken, es kann damit aber auch das Gegenteil bewirkt werden, weil das geschrumpfte Hirn ein Bild des Schreckens ist.
Welche Sätze in Erinnerung bleiben ist nicht vorhersehbar, weshalb Informationen behutsam weitergegeben werden müssen, und Angehörige und Betroffene müssen auf diese Sätze immer wieder von Neuem zurückkommen dürfen.
Ein Diagnosegespräch löst immer Emotionen aus. Was die Angehörigen besonders betroffen machen kann, ist das Verhalten der Patient:innen. Diese reagieren teils völlig unbeteiligt, was für die Angehörigen, die sich in einem emotionalen Ausnahmezustand befinden, verletzend sein kann. Es gibt jedoch auch das Gegenteil:
Die Ehefrau ist nach der Diagnoseübermittlung in Tränen aufgelöst, der Ehemann nimmt ihre Hand: »Das schaffen wir schon.«
Am Schluss des Gespräches stelle ich stets die Frage nach der Befindlichkeit. Nach einem konfliktbeladenen Familiengespräch erwarte ich eher aggressive Feedbacks, doch der Demenzerkrankte antwortet: »Jetzt weiß ich, dass meine Familie zu mir steht und nicht gegen mich ist.« Die Familie hatte mich zuvor gebeten, das Gespräch ohne den/die Patient:in zu führen, was ich stets ablehne.
Formen der Demenz
Der Begriff Demenz stammt vom Lateinischen »de mente« und bedeutet Abwesenheit des Geistes, des Gedächtnisses. Ein Wort, abwertend, fast schon stigmatisierend, und dennoch ist es nicht mehr aus dem allgemeinen Sprachgebrauch zu entfernen, auch wenn inzwischen die amerikanische Nomenklatur versucht, Demenz durch »neurocognitve disorder« (DSM-V[]) zu ersetzen.
Bei der Alzheimerdemenz kommt es zu Ablagerungen im Hirn. Dabei handelt es sich zum einen um sogenannte senile Plaques, die aus Eiweißbruchstücken (beta-Amyloid Peptid) bestehen, zum anderen um faserförmige Ablagerungen, den sogenannten Neurofibrillenbündel, die aus abnormem, verklumptem Eiweiß (Tau-Protein mit falsch angehängten Phosphatgruppen) bestehen. Die Alzheimerdemenz beginnt fast immer mit Gedächtnisstörungen, schon bald treten weitere Störungen der Hirnleistung auf (Orientierungsstörung, Sprachstörung, Störung der Geschicklichkeit u.a.).
Die zweithäufigste Form ist die vaskuläre Demenz[], die durch Durchblutungsstörung, insbesondere der kleinen, aber auch größerer Hirngefäße verursacht wird. Immer wieder auftretende Hirnschläge, die durch einen Verschluss größerer Gefäße verursacht werden, können ebenfalls zu einer Demenz führen. Wer kennt nicht den Begriff »Arterienverkalkung des Hirns«, der früher mit der Demenz gleichgesetzt wurde. Erst später wurde klar, dass nicht alle Zustände chronischer Verwirrtheit auf die Verkalkung der Gefäße zurückzuführen sind, sondern dass dafür in der Mehrzahl der Fälle die Alzheimerkrankheit verantwortlich ist. Doch das Bild der Großeltern mit Arterienverkalkung ist tief im Denken unserer heutigen Gesellschaft verankert. Ein Ausdruck, der zu früheren Zeiten gebraucht wurde, ist das POS, das psychoorganische Syndrom; in Zusammenhang mit der Demenzerkrankung wird er nicht mehr verwendet.
Bei der vaskulären Demenz handelt es sich nicht um eine neurodegenerative Erkrankung[], sondern um eine Erkrankung der Gefäße, die durch dieselben Risikofaktoren beeinflusst wird wie andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der größte Risikofaktor bezüglich Arteriosklerose der Hirngefäße ist ein schlecht eingestellter erhöhter Blutdruck, aber auch Fettstoffwechselstörungen, Übergewicht, Rauchen und mangelnde Bewegung können auslösende Faktoren sein. Inzwischen weiß man, dass vaskuläre[] Veränderungen gar nicht so selten zusätzlich zu den typischen krankhaften Schäden bei der Alzheimererkrankung hinzukommen können. Deswegen geht man davon aus, dass eine Prävention von Gefäßrisikofaktoren das Auftreten der Alzheimererkrankung positiv beeinflussen kann. Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass viele Alzheimererkrankte bis zum Zeitpunkt ihrer Erkrankung sehr gesund gelebt haben.
Auch okkulte[] Blutungen kleinerer oder größerer Hirnareale können eine Demenz verursachen, wenn die Brüchigkeit der Gefäße erhöht ist, was im Rahmen einer sogenannten cerebralen Amyloid-Angiopathie[] der Fall ist, bei der die Eiweißablagerungen (Amyloid) sich nicht im Hirngewebe selber befinden, sondern in der Gefäßwand.
Wichtige weitere Demenzerkrankungen sind die frontale Demenz[] und die Lewy-Body-Demenz[]. Letztere manifestiert sich völlig anders als eine Alzheimerdemenz: Betroffene Patient:innen zeigen zuerst Probleme in der räumliche Orientierung, während das Gedächtnis noch lange erhalten bleibt. Sie können sich kaum mehr auf etwas konzentrieren, sodass das Autofahren schon in einem sehr frühen Stadium aufgegeben werden muss. Zudem entwickeln sie Symptome wie bei einer Parkinsonerkrankung, und oft treten Halluzinationen auf. Bei der Lewy-Body-Demenz kommt es zur Ablagerung von Eiweißen, den sogenannten Lewy-Körperchen, die sich vom Amyloid der Alzheimerpatient:innen unterscheiden. Diese wurden erstmals vom deutschen Arzt Friedrich Lewy im Jahre 1912 beschrieben, weswegen sie seinen Namen tragen. Erst viele Jahrzehnte später (1990) hat man diesem Krankheitsbild mehr Beachtung geschenkt. Nach wie vor denkt man aber auch heute noch viel zu wenig an diese Krankheit, wenn es um die Diagnosestellung geht. Dabei ist diese Form die zweithäufigste Demenzerkrankung! Helga Rohra12 leidet an dieser Krankheit und hat ebenfalls die schmerzliche Erfahrung machen müssen, dass sie zu lange keine Diagnose erhielt: Menschen mit Lewy-Body-Demenz zeigen ganz andere Symptome als Alzheimerpatient:innen, sie weisen meist Fehlwahrnehmungen und Halluzinationen auf, weswegen man sie oft als psychisch krank bezeichnet: »Ein paar Tage später geschah etwas Merkwürdiges, ich begann, vor mir einen Film zu sehen. Es waren Bilder in Farbe, Szenen aus meiner Jugend, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt … Natürlich bekam ich es mit der Angst zu tun: Werde ich vielleicht verrückt?«13
Die Schilderungen von Fehlwahrnehmungen sind äußerst anschaulich: Einige meiner Patient:innen haben für Familienmitglieder oder auch für Fremde jeden Tag den Tisch gedeckt, weil sie Menschen in der Wohnung wahrnahmen. Menschen mit Lewy-Body-Demenz leiden zudem früh im Krankheitsverlauf unter Orientierungsschwierigkeiten, sie sind in ihrer Aufmerksamkeit eingeschränkt und extremen Schwankungen ausgesetzt: Innerhalb weniger Stunden können sich ihre geistigen Fähigkeiten ändern, Schläfrigkeit wechselt mit starker Agitation oder Verwirrung. Gedächtnisstörungen kommen im Gegensatz zur Alzheimerkrankheit erst spät dazu; zudem treten bei der Lewy-Body-Demenz rasch Parkinson-Symptome wie Steifheit und Zittern auf. Die krankhaften Ablagerungen befinden sich sowohl in der Hirnrinde (v.a. in den hinteren Bereichen und in der Sehrinde) sowie in den tiefen Hirnstrukturen (in den sogenannten Basalganglien, die auch bei der Parkinsonerkrankung betroffen sind).
Die frontale Demenz [ Beiträge »Blaue Katzen gibt es nicht«, »Was ›macht‹ Demenz mit den Menschen?«, »Verkannt und bagatellisiert«] ist vermutlich die herausforderndste Form, weil sich die Persönlichkeit der Patient:innen ganz stark verändert. Es gibt noch unzählige Demenzformen, die selten sind, alle zeigen typische Leitsymptome. So die semantische Demenz[], in der die Bedeutung der Sprache verloren geht, und die primär progressive Aphasie[], die zu einem Verlust der Sprachflüssigkeit führt.
Seltene Demenzformen
Beim Hydrocephalus malresorptivus[] kommt es nach Blutungen, Infektionen oder auch ohne ersichtlichen Grund zu einer Verklebung der den Liquor rückresorbierenden Membranen, sodass es ein Ungleichgewicht zwischen Liquorproduktion und Wiederaufnahme in die Zelle entsteht, was zu einer Vergrößerung der Ventrikel[] führt. Die Betroffenen zeigen in der Folge die typische Trias einer Gangstörung, einer Inkontinenz und in der Folge auch kognitive Störungen. Eine ursächliche Therapie ist nicht möglich. Den Patient:innen kann aber mithilfe einer Shunteinlage geholfen werden: Bei diesem Eingriff wird ein flexibles Schlauchsystem von der Hirnkammer unter der Haut bis in die freie Bauchhöhle eingelegt. Zwischengeschaltet wird ein Ventil, womit die Durchflussmenge von außen gesteuert werden kann. Vor einem solchen Eingriff sollte aber sorgsam abgewogen werden, ob dieser sinnvoll ist, weil sich auch im Rahmen einer Alzheimerdemenz die Ventrikel durch die Schrumpfung des Hirngewebes vergrößern können.
Die progressive supranukleäre Paralyse[] (progressive supranuclear palsy, PSP oder Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom nach den Erstbeschreibern) ist eine neurodegenerative Erkrankung des Gehirns, speziell der Basalganglien. Die Basalganglien spielen eine wichtige Rolle bei der Steuerung automatischer Bewegungen. Ihre Schädigung kann zu Problemen beim Bewegen und beim Halten des Gleichgewichtes, bei der Augensteuerung (Blickrichtung nach unten, aber auch nach oben), der Schlucksteuerung und der Sprechsteuerung führen. Betroffene sehen verschwommen, fühlen sich unsicher, es kommt zu unvorhersehbaren Stürzen (auch nach hinten) und zu einer ausgeprägten Gangunsicherheit. Die Sprache wird leiser und unverständlicher, das Schlucken zunehmend schwierig. Im Laufe der Erkrankung entwickeln sie auch kognitive Probleme, es kommt zu einer Demenzerkrankung. Die supranukleäre Paralyse weist Ähnlichkeit mit der Parkinsonerkrankung auf, sie zählt zum Krankheitsbild der atypischen Parkinson-Syndrome. Betroffene sprechen deutlich weniger auf die Antiparkinsonmedikamente an. Im Gegensatz zu Parkinsonerkrankten weisen Patient:innen mit PSP eine Schrumpfung im Bereich des Mittelhirns auf, diese kann im MRI nachgewiesen werden.
Bei der corticobasalen Degeneration[] handelt sich um eine Erkrankung, in der nicht das Amyloid, sondern krankhafte Ansammlungen des Tau-Proteins das Hirn angreifen (= Tauopathie). Betroffene haben einerseits Symptome wie Parkinsonerkrankte (atypisches Parkinsonsyndrom), andererseits auch weitere neurologische Symptome wie Apraxie[], Dystonien (= Verkrampfungen und Fehlhaltungen der Muskulatur) und schwere Gleichgewichtsstörungen. Die Erkrankten haben größte Mühe, gezielt Bewegungen auszuführen, oft wird eine Extremität als nicht mehr die eigene wahrgenommen, man spricht dann von einem alien limb Syndrom (= Fremdes-Glied-Syndrom). Auf Aufforderung sind sie zwar fähig, die Extremität zu bewegen, oft hängt diese aber wie ein Fremdkörper herab. Die Krankheit führt obligat zu einer Demenz, sie wird in letzter Zeit vermehrt der Gruppe der FTLD[] zugeordnet.
Die Erfahrung zeigt, dass sich Familien mit Alzheimerdemenz gut informieren können, dass aber Betroffenen mit seltenen Formen wesentlich weniger Informationen zur Verfügung stehen. Obwohl es sich eingebürgert hat, dass sich Organisationen, die sich um Demenzerkrankte kümmern, überall Alzheimergesellschaft nennen, haben auch sie ausgezeichnetes Informationsmaterial für sämtliche Demenzformen erarbeitet.14
Frau W.
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Frau W. ist 54 Jahre alt und unterrichtet Sprachen. Sie war bereit, ihre Gedanken unmittelbar nach der Diagnosestellung Demenz niederzuschreiben. Obwohl im Gespräch immer wieder Wortfindungsstörungen auffallen, ist ihre Fähigkeit zu schreiben unverändert vorhanden.
Nach reiflicher Überlegung und vielen Gesprächen mit meinem Partner habe ich mich entschlossen, vorerst so gut wie möglich im »Normalmodus« weiterzuarbeiten. Ich möchte bis zur »sicheren« Diagnose noch nicht mit den Arbeitgebern sprechen und auch sonst mit niemandem. Nur eine enge Freundin habe ich eingeweiht. Ich werde versuchen, stark zu sein und weiterzufunktionieren, so gut es geht. Die Arbeit gibt mir Selbstvertrauen und Motivation, und ich habe dann das Gefühl, es sei doch alles in Ordnung mit mir. Tendenziell geht es mir an Tagen, an denen ich an der Schule bin, oft besser als an den freien, wenn ich Zeit zum Grübeln habe.
Ich verschließe mich aber keineswegs der fast sicheren Diagnose, sondern lese oft im Internet und befasse mich intensiv mit allen damit zusammenhängenden Fragen. Nach dem Buch von Helga Rohra lese ich nun das Buch von Richard Taylor, »Leben mit Dr. Alzheimer im Kopf«. Ich kann das meistens ganz rational erfassen, doch ab und zu überwältigen mich dann Gefühle der Verzweiflung, Angst und Trauer, nicht aber Wut.
Mein Partner ist mir eine große Stütze. Langsam wird er sich auch immer mehr bewusst, was die Diagnose bedeutet, und wir können offen über Eventualitäten reden. Nur beim Thema Exit[] wird er äußerst emotional und will keinesfalls etwas davon hören oder darüber reden. Doch für mich ist klar, dass ich die dritte Phase von Demenz, falls ich sie erreichen sollte, nicht erleben will. Ich hoffe, dass er mit der Zeit verstehen und akzeptieren kann, dass dies mein starker Wunsch ist. Ob ich es dann auch wirklich ausführe, kann ich dann ja immer noch entscheiden. Ich werde die nötigen Vorkehrungen inklusive angepasste Patientenverfügung bald treffen. Jedenfalls habe ich mich (heimlich) schon mit Exit in Verbindung gesetzt und gefragt, wie ich bei Alzheimer vorgehen müsste. Ich würde aber bis zum letztmöglichen Zeitpunkt warten und das Leben vorher noch so intensiv wie möglich genießen. Für mich ist Exit wie ein Rettungsanker, der mir und vor allem auch meinen Liebsten die letzten qualvollen Jahre oder Monate ersparen kann. Vielleicht werde ich es dann auch nicht tun, doch ich habe die Möglichkeit, und dies gibt mir Trost.
Mein Partner und ich haben viel über die finanziellen Konsequenzen gesprochen. Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir möglichst schnell heiraten wollen, in erster Linie aus Liebe, aber auch im Lichte oder besser gesagt: Schatten der neuen Zukunftsperspektiven. Es geht uns auch darum, dass mit einer Heirat die Position meines Partners gegenüber meiner Familie gestärkt wird, wenn ich nicht mehr entscheidungsfähig bin. Auch gäbe es für ihn eine verbesserte finanzielle Situation, wenn wir verheiratet wären. Wir würden dies wahrscheinlich ganz still und ohne Verwandte tun und erst nachher alle informieren. Eventuell würden wir nur unsere vier Kinder einbeziehen. Doch bevor wir dies in die Wege leiten, warten wir den Termin der nächsten ärztlichen Besprechung ab. Als Nächstes sollten wir uns um eine/n finanzielle/n Berater:in bemühen, dem/der wir voll vertrauen können.
Meiner Erfahrung nach waren bei mir die ersten Symptome Gedächtnisprobleme, und diese begannen schon vor ca. 12 Jahren. Deshalb ließ ich mich ja schon einmal im Neurologischen Institut der Universität Zürich untersuchen, wo man aber erstaunlicherweise nichts fand. Damals hatte ich, glaube ich, noch keine auffällige Wortfindungsstörungen. Im Herbst 2015 wurde bei mir eine progressive logopenische Aphasie diagnostiziert. Gemäß Internet sind aber die ersten Symptome davon nicht Gedächtnisstörungen, sondern Sprachstörungen, wie ich sie ja jetzt an mir bemerke. Aber waren meine Gedächtnisprobleme denn nicht zuerst da, was doch eher gegen die logopenische Variante der Alzheimererkrankung[]spräche? Und da ich diese Gedächtnisprobleme schon so lange habe, heißt das eventuell, dass meine Demenz schon vor über zehn Jahren angefangen hat? In dem Fall hätte sie sich außergewöhnlich langsam entwickelt, was mir wiederum Hoffnung machen würde.
Einen Monat später: Nun sind schon einige Wochen seit dem Diagnosegespräch vergangen. Es war und ist noch immer eine turbulente Zeit mit vielen »Ups« und »Downs«. An manchen Tagen bin ich sehr besorgt, zweifle an meinen Fähigkeiten als Lehrerin und denke daran, mich krankschreiben zu lassen. Nach unseren erholsamen Ferien musste ich meine Lektionen vorbereiten. Ich war so gestresst beim Gedanken, in dieser Woche 20 Lektionen zu unterrichten, dass ich wie gelähmt am Pult saß. Ich brauchte ca. 8 Stunden, um die 6 Lektionen vorzubereiten, und war mit dem Resultat unzufrieden! Deshalb änderte ich vieles in letzter Minute, was mich noch mehr stresste. Ich weiß nicht, ob die Lernenden etwas merkten. Beim Unterrichten war ich so angespannt, dass ich Mühe hatte, mich zu konzentrieren, und z.T. langsamer war als meine Lernenden. Zu Hause war ich so erschöpft und verzweifelt, dass ich nur noch heulte und mich schon als IV-Empfängerin [] sah. Zum Glück tröstete mich mein Partner und machte mir Mut.
Heute geht es mir sehr gut! Das Unterrichten der 8 Lektionen an der Berufsschule war kein Problem, machte mir Spaß und gab mir die Bestätigung, dass ich es doch noch immer gut kann.
Ich habe mich unterdessen entschlossen, meinem Umfeld weiterhin noch nichts über die Diagnose zu sagen. Denn ich hege noch immer die kleine Hoffnung, dass mein Hirn schon immer nicht sehr gut war und ich viel mit Fleiß kompensiere. Könnte es nicht auch sein, dass mein Hirn vor allem dann schlecht funktioniert, wenn ich gestresst bin? Die Wortfindungs- und Aussprachestörungen hatte ich zwar auch in den Ferien, als ich entspannt war. Wenn ich lernen würde, alles lockerer zu nehmen und weniger perfektionistisch wäre, könnte ich vielleicht auch konzentrierter und besser denken. Könnte da eine Psychotherapie vielleicht helfen?
Ich habe die Diagnose mehrmals genau gelesen. Meiner Interpretation nach ist es ja nicht 100-prozentig sicher, dass ich den Anfang einer Demenz habe. Was könnte es denn sonst sein? Gibt es noch Hoffnung? Denn diese stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Klaus Bally
Wenn der Hausarzt gefordert ist
Meine Patient:innen fürchten nach dem Überschreiten der Lebensmitte keine Krankheit mehr als die Demenz. Demenzerkrankungen sind in unserer Gesellschaft nach wie vor mit einem Stigma behaftet. Nicht nur die betroffenen Menschen, auch ihre Angehörigen und sogar die behandelnden Ärztinnen und Ärzte empfinden ein Schamgefühl, wenn sie bei einem/r Patient:in zunehmende kognitive Einbußen feststellen.
Den meisten Patient:innen wie auch ihren Angehörigen fällt es keineswegs leicht, mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt über Gedächtnis- und Orientierungsstörungen oder gar über Fehlleistungen im Beruf oder Verkehr zu sprechen. Oft haben sie sich Wochen oder gar Monate Gedanken gemacht, ob und wann sie dieses Problem ihrer Ärztin oder ihrem Arzt mitteilen sollen. Hierfür verantwortlich sind einerseits die beschriebenen Schamgefühle, aber auch die Angst, dass die Ärztin oder der Arzt die Diagnose einer schwerwiegenden, möglicherweise nicht behandelbaren Krankheit stellen könnte. Viele Menschen ängstigen sich vor dem Verlust ihrer Selbständigkeit, dass sie mittelfristig auf Pflege und Betreuung angewiesen sein und somit anderen Menschen zur Last fallen könnten.
Es ist meine hausärztliche Aufgabe, die Fragen der Betroffenen selbst sowie der Angehörigen ernst zu nehmen. Wenn ich Betroffenen beschwichtigend mitteile: »Wissen Sie – auch ich vergesse manchmal einen Namen«, ist ihnen und ihren Angehörigen nicht gedient. Viel zu groß ist in der Regel die Not, die sie zu mir geführt hat. Eine derartige vermeintliche Beruhigung trägt nicht dazu bei, dass sich ein Mensch, der bei sich ein allmähliches Entschwinden seines Erinnerungsvermögens wahrnimmt, von seiner Ärztin oder seinem Arzt verstanden und ernst genommen fühlt.
Im Rahmen der diagnostischen Abklärungen ist es entscheidend, das Vertrauensverhältnis mit dem/r Patient:in aufrechtzuerhalten, um ihn/sie sowie seine/ihre Angehörigen oftmals über viele Jahre auch in seiner Erkrankung weiterhin ärztlich und menschlich begleiten zu können. Einerseits sollte eine mögliche Demenzdiagnose zeitgerecht gestellt werden, auf der anderen Seite möchte ich meine Patient:innen nicht verunsichern. Gerade zu Beginn einer möglichen Demenzerkrankung besteht oftmals nicht nur bei den Betroffenen und ihren Angehörigen, sondern auch bei Ärztinnen und Ärzten eine Ungewissheit, ob nun tatsächlich eine ernste Erkrankung vorliegt.
In dieser Phase werde ich mir schon einige ganz zentrale Fragen stellen: Wie viel an Information und Aufklärung kann mein/e Patient:in zum jetzigen Zeitpunkt verstehen und ertragen? Welche Konsequenzen hat die Diagnose einer Demenzerkrankung für ihn/sie und seine/ihre Angehörigen? Ist es denkbar, dass die Gewissheit über das Vorliegen einer Demenzerkrankung zu einer Beruhigung für den/die Patient:in und sein/ihr Umfeld führen könnte? Oder bricht für meinen/e Patient:in mit dieser Erkenntnis eine Welt zusammen; könnte er/sie sich gar das Leben nehmen? Gibt es Dinge, die in unmittelbarer Zukunft zu regeln sind und daher einer Sicherung der Diagnose bedürfen? Fährt mein/e Patient:in Auto? Darf ich nach einem in der Hausarztpraxis üblichen Prinzip die Diagnose vorläufig offenlassen, abwarten und weitere diagnostische Schritte je nach Verlauf zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen?
Frühdiagnose
Frau G., 75 Jahre alt, kommt mit ihrem Ehemann zu einer Kontrolle ihrer Blutzuckerwerte in meine Praxis. Sie und ihr Ehemann leiden unter einem Altersdiabetes. Die Kontrolle ergibt befriedigende Werte für den Blutzucker, das Cholesterin und den Blutdruck. Zum Schluss bemerkt Frau G. beiläufig, dass sie in letzter Zeit etwas vergesslicher geworden sei; sie müsse sehr viel auf Notizblätter schreiben und habe beim Einkaufen auch schon vergessen, Milch oder Brot nach Hause zu bringen. Den Haushalt erledige sie aber ohne Probleme; auch hüte sie ihr fünfjähriges Enkelkind jeden Mittwoch; am Sonntag spiele sie jeweils eine Stunde Klavier. Der Ehemann lobt die Kochkünste seiner Gattin. Frau G. meint, dass auch ihre gleichaltrigen Freundinnen in letzter Zeit vergesslicher würden – das sei wohl ein Zeichen des Älterwerdens. Herr G. stört sich übrigens nicht an der Vergesslichkeit seiner Gattin; wenn sie beim Einkaufen etwas vergesse, laufe er zum Lebensmittelgeschäft – das sei sogar gut für seine Zuckerkrankheit.
Als Hausarzt frage ich mich: Besteht hier Handlungsbedarf? Hat Frau G. eine beginnende Demenzerkrankung – oder liegt ein MCI (mild cognitive impairment) vor? Ist ein einfacher Test ihrer kognitiven Fähigkeiten in der Hausarztpraxis angezeigt? Braucht sie eine eingehendere Blutuntersuchung, eine MRI-Untersuchung ihres Gehirns oder jetzt schon eine Überweisung in eine Memory Clinic? Das Vorgehen in einer derartigen Situation wird nicht nur in der populärwissenschaftlichen, sondern auch in der medizinischen Fachliteratur kontrovers thematisiert: So schreibt der bekannte Theologe und Soziologe Reimer Gronemeyer etwas plakativ in seinem 2013 erschienenen Buch »Das 4. Lebensalter – Demenz ist keine Krankheit«:16 »Die Demenz wird medikalisiert … dem Zwang zur Vorsorgeuntersuchung bei der Schwangeren entspricht der wachsende Druck zur Demenzdiagnose beim Alten.«
Und David Le Couteur, ein namhafter Professor für Geriatrie aus Syndney, Australien, schreibt in der renommierten wissenschaftlichen Zeitung »BMJ« im Jahre 2013 unter der Rubrik »Too much medicine«:17 »Die Forderung von Politikern, dass Hausärzte bei allen Menschen Testverfahren einsetzen sollen, um eine mögliche Demenzdiagnose früh stellen zu können, entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage und missachtet den potenziellen Schaden, der damit angerichtet werden kann.«
Auf der anderen Seite wird immer wieder berichtet, dass die Früherkennung von Demenzerkrankungen in Hausarztpraxen zu wünschen übrig lasse und dass Hausärztinnen und -ärzte ihre Patient:innen unbefriedigend über Diagnose und Prognose aufklären:18 Heute ist bekannt, dass das weitere diagnostische und therapeutische Vorgehen von Hausärztinnen und -ärzten in einer derartigen Situation nicht nur davon abhängig ist, wie viel sie über die Diagnose und Behandlung von Demenzerkrankungen wissen. Ebenso bedeutsam ist, was sich in einer derartigen Situation auf der Gefühlsebene der Ärztin oder des Arztes abspielt und welchen Einfluss der Beziehungsaspekt auf das weitere Vorgehen nimmt. Es konnte gezeigt werden, dass die jahrelange Vertrautheit einer Ärztin oder eines Arztes mit seinen/ihren Patient:innen ein unvoreingenommenes Herangehen an die möglicherweise vorliegende Demenzproblematik eher erschwert als erleichtert.19 Daher ist es unabdingbar, sich dieser auf der Beziehungs- und affektiven Ebene abspielenden Faktoren bewusst zu sein.20
Abklärung
Nach reiflicher Überlegung entscheide ich mich, bei Frau G. erste diagnostische Schritte in die Wege zu leiten. Einer einfachen Blutuntersuchung stimmt meine Patientin zu; eine kurze Befragung mit ein paar Standardfragen macht das Vorliegen einer Depression eher unwahrscheinlich. Einen Mini-Mental-Status []empfindet sie als sehr unangenehm – es sei wie bei einer »Prüfung«. Dabei erreicht sie 27 von 30 möglichen Punkten; vor allem die Rechenoperationen gelingen ihr nicht befriedigend. Frau G. meint, dass Rechnen schon früher nie ihre Stärke gewesen sei. Eine bildgebende Untersuchung möchte sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht vornehmen lassen.
Wenige Tage später ruft die Tochter der Patientin an; sie sei sehr beunruhigt: Die Vergesslichkeit ihrer Mutter bereite ihr zunehmend Sorgen – und nun auch noch das unbefriedigende Resultat im Mini-Mental-Test; sie, die Tochter, verlange eine rasche Abklärung in der Memory Clinic.
In einer derartigen Situation muss, solange keine Selbst- und Fremdgefährdung besteht, die Autonomie meiner Patientin respektiert werden, und es ist erst dann eine eingehendere Abklärung in einer Memory Clinic in die Wege zu leiten, wenn die hierfür urteilsfähige Patientin dazu Hand bietet. Im Bewusstsein, dass in einer Memory Clinic eine sorgfältige Abklärung mit eingehendem Aufklärungsgespräch stattfindet, ist es meine Aufgabe, die Patientin entsprechend vorzubereiten: Was geschieht in der Memory Clinic? Viele Patient:innen fürchten, die »Prüfung« nicht zu bestehen und nach dem Besuch der Memory Clinic von ihrem Umfeld nicht mehr als kognitiv kompetent angesehen zu werden. Schon diese Voraufklärungsgespräche benötigen viel Zeit, Ruhe und oftmals mehrere Konsultationen.
Aufklärung und Therapieeinleitung
Einige Wochen später kommt Frau G. erneut in die Sprechstunde. In der Memory Clinic wurde die Diagnose einer beginnenden Demenz vom Alzheimertyp gestellt; Sorgen und Ängste werden in der Sprechstunde thematisiert. Wird Frau G. weiterhin fähig sein, den Enkel zu betreuen? Frau G. ist nun auch in der Lage, angesichts der sich möglicherweise verschlechternden Gedächtnis- und Orientierungsleistungen über ihre Wertvorstellungen zu sprechen und gemeinsam mit ihrem Ehemann, der Tochter und mir eine Patientenverfügung zu verfassen. Zudem wird Frau G. im Beisein der Familie über Behandlungsmöglichkeiten und Hilfsangebote informiert.
Nach dem Diagnosegespräch in der Memory Clinic vereinbaren viele Patient:innen sehr rasch einen erneuten Termin in meiner Praxis. Sie erwarten von mir, dass ich die Diagnose in den mir bekannten Gesamtkontext einordne. Einerseits erlebe ich bei Patient:innen und Angehörigen Gefühle der Beruhigung, da endlich Klarheit über die Natur der Erkrankung besteht, andererseits aber auch Trauer, Wut oder gar Ablehnung der in den Diagnoseprozess involvierten Fachpersonen; die Diagnose wird angezweifelt, und manche Patient:innen erklären sich die schlechten Testresultate damit, dass sie vor lauter Aufregung in der Nacht vor dem Abklärungstermin kaum schlafen konnten. Hier ist es meine Aufgabe, einerseits Verständnis für die Gefühle der Patient:innen aufzubringen, andererseits auch den Rückhalt aufzuzeigen, den ihnen die Hausarztpraxis und die Memory Clinic mit dem interdisziplinären Hilfsangebot bieten.
In dieser Phase erleben Patient:innen und ihre Angehörigen vor allem die Defizite: »Bis vor Kurzem konnte sie noch alleine in die Stadt zum Einkaufen fahren – jetzt geht auch das nicht mehr.« Als Hausarzt, der seine Patient:innen über Jahre kennt, werde ich ihnen aufzeigen, welche wertvollen Ressourcen noch vorhanden sind: Das sonntägliche Klavierspiel, das gute, vom Ehemann geschätzte Essen und vielleicht auch der Humor, der bei vielen Menschen über längere Zeit erkennbar sein kann.
Ältere Menschen nehmen oftmals eine Vielzahl von Medikamenten ein. Meine Erfahrung zeigt, dass vor allem Demenzmedikamente sehr rasch abgesetzt werden, da Patient:innen naturgemäß keine unmittelbare Wirkung wahrnehmen und selbst bei klarer Diagnose das Vorliegen einer Demenzerkrankung nicht wahrhaben wollen. Man weiß auch, dass aufseiten der Hausärztinnen und -ärzte das Vertrauen in die Wirksamkeit von Antidementiva[] vergleichsweise gering ist, da offensichtlich in einer Verzögerung des Fortschreitens der Erkrankung kein echter Therapieerfolg erkannt wird. Letztlich geht es darum, eine Priorisierung der Medikation vorzunehmen, Nutzen und Nebenwirkungen sowie Interaktionen jeder einzelnen Substanz abzuwägen und einen Medikationsplan aufzustellen, der eine für die Patient:innen zumutbare Medikamenteneinnahme erlaubt.
Die Hausärztin, der Hausarzt als Teil eines Betreuungsnetzwerkes
Demenzerkrankte Menschen werden mit dem Fortschreiten ihrer Erkrankung oftmals von mehreren Personen unterschiedlicher Berufsgruppen betreut. Diese multiprofessionelle Betreuung stellt eine große Herausforderung für alle Beteiligten dar: Wer weiß wie viel über die Erkrankung, über die Medikation? Wer kümmert sich hauptverantwortlich um die Patient:innen, wer um die Angehörigen? Werden die Angehörigen als Teil des Betreuungsnetzwerkes wahrgenommen oder als Last empfunden, deren Anwesenheit die Pflege aufwändiger und komplizierter gestaltet? Werden Angehörige auch als Abschiednehmende und Trauernde wahrgenommen? Sind alle Pflegenden ausgebildet, um Äußerungen von Unmut oder Schmerzen korrekt zu erkennen und zu bewerten? Sind alle Beteiligten über eine evtl. vorhandene Patientenverfügung informiert? Gerade bei schwer demenzerkrankten Patient:innen, die daheim oder in einer Pflegeinstitution betreut werden, erachte ich es als eine meiner wichtigsten Aufgaben, die Behandlung zu koordinieren und allen Beteiligten den gleichen Wissensstand zu ermöglichen. Pflegende in Langzeitpflegeinstitutionen vollbringen über die Jahre eine enorme Leistung; es gehört zu den hausärztlichen Aufgaben, sie zu beraten und zu begleiten. Letztlich wird das unseren an Demenz erkrankten Mitmenschen zugutekommen und ihnen sowie ihren Angehörigen ein würdiges Lebensende und Abschiednehmen ermöglichen.
Irene Bopp-Kistler
Was Alois Alzheimer nicht ahnen konnte
»Wie heißen Sie?« – »Auguste.« – »Familienname?« – »Auguste.« – »Wie heißt Ihr Mann?« – Auguste Deter zögert, antwortet schließlich: »Ich glaube … Auguste.« – »Ihr Mann?« –»Ach so.« – »Wie alt sind Sie?« – »51.« – »Wo wohnen Sie?« – »Ach, Sie waren doch schon bei uns.« – »Sind Sie verheiratet?« – »Ach, ich bin doch so verwirrt.« – »Wo sind Sie hier?« – »Hier und überall, hier und jetzt, Sie dürfen mir nichts übel nehmen.« – »Wo sind Sie hier?« – »Da werden wir noch wohnen.« – »Wo ist Ihr Bett?« – »Wo soll es sein?«
Dieses Interview von Alois Alzheimer mit Auguste Deter ging 1906 um die ganze Welt. Er beschrieb damit den ersten Fall einer eigenartigen Erkrankung, die seither seinen Namen trägt.
Die Kriterien zur Demenzdiagnose haben sich im Lauf der Jahrzehnte immer wieder geändert, doch etwas blieb: Die Krankheit wurde sowohl mit klinischen Kriterien wie auch auf Zellebene (Histologie) definiert. Mittlerweile stehen moderne technische Verfahren wie Bildgebungen (MRI und CT), auch gewisse Marker in Liquoruntersuchungen und PET-Untersuchung zur Verfügung.
Hinter der Demenzdiagnose steht ein Mensch mit seiner Biografie, seiner Persönlichkeit, mit seinen Stärken und Schwächen. Ist es nicht so, dass oft nur seine Defizite benannt werden und das Menschsein immer mehr in den Hintergrund tritt? Deswegen wehre ich mich gegen den Ausdruck »der Demente«, weil damit der Mensch nur auf die Krankheit reduziert wird. Und trotzdem: Kriterien, die eine Krankheit definieren, sind wichtig für die Forschung wie in der ärztlichen Praxis, damit alle dieselbe Sprache sprechen.
Die Demenz wird mittels ICD (International Classification of Disease)[] und mittels DSM-V (Diagnostisches und statistisches Manual mentaler Störungen) definiert. In den neuesten Kriterien der DSM-V aus Amerika (2013) wurde das Wort Dementia (= Demenz) durch den Begriff major neurocognitive disorder (NCD) ersetzt. Doch so wie sich die Bezeichnung Alzheimer halten konnte, wird man vermutlich auch in Zukunft von Demenz sprechen, obwohl dieser Ausdruck nicht wertneutral ist. Im Konzept von DSM-V wird im Gegensatz zu früheren Definitionen nicht mehr obligat eine Gedächtnisstörung zur Diagnosestellung einer Demenz verlangt. Dies ist aus meiner Sicht äußerst wichtig, da bei mehreren Demenzerkrankungen primär nicht eine Gedächtnisstörung im Vordergrund steht (z.B. bei der Lewy-Body-Demenz und frontotemporale Demenz[]). Zudem wird erstmals auch die soziale Kognition mit einbezogen, womit das Einfühlungsvermögen und die Empathie gemeint sind. Der Einbezug dieser Komponente ist wichtig, da Angehörige genau unter dieser Störung oft besonders leiden.
Was bedeutet es, wenn das Gedächtnis, das Denken, die Orientierung, die Auffassungsgabe, das Rechnen und Lernen, die Sprache und die Urteilsfähigkeit beeinträchtigt sind? Führe ich mit meinen Patient:innen einfache Tests durch (z.B. den bekannten MMS[] und den Uhrentest[]), wird mir bewusst, wie schwierig es sein muss, auf lang Erlerntes plötzlich nicht mehr zugreifen zu können: Wenn ein Ingenieur die einfachsten Rechnungen (z.B. von 100 mehrmals 7 subtrahieren) nicht mehr durchführen kann, er zeitlich nicht mehr orientiert ist, wenn er drei Worte nicht mehr erinnern kann und gewisse Aufforderungen gar nicht mehr versteht, wenn er eine einfache Figur nicht mehr abzeichnen kann und ratlos vor dem Testformular sitzt. Umso wichtiger ist es, dass wir auch in solchen Situationen des Testens therapeutisch mit den Patient:innen umgehen und sie auf emotionaler Ebene wieder aufrichten.
Laut DSM-V ist eine Demenz dann vorhanden, wenn eine signifikante Abnahme der Hirnleistung gegenüber früher in mindestens einer der folgenden Bereiche vorhanden ist:
1.Lernen und Gedächtnis
2.exekutive Funktionen (= Planung, logisches Denken u.a.)
3.Sprache
4.perzepto-motorische Fähigkeit (Wahrnehmung, Bewegung)
5.komplexe Aufmerksamkeit (Konzentration gleichzeitig auf mehrere Dinge)
6.soziale Kognition (z.B. Einfühlungsvermögen)
Doch was stört am meisten? Sind es die Gedächtnisstörungen oder die fehlenden Emotionen, das verminderte Einfühlungsvermögen oder die nachlassende Wahrnehmung und die Antriebsstörung, die die Angehörigen so stressen? Wenn das Erledigen der Finanzen nicht mehr geht, kann man sich Hilfe suchen, auch für das Medikamente Richten. Wie steht es jedoch mit dem Zusammenleben, mit den ständigen kleinen Fehlleistungen im Alltag, die gar dazu führen, dass der Betroffene den Arbeitsplatz verliert … Oder die Notwendigkeit der Abgabe des Fahrausweises, weil die Orientierung im Raum nicht mehr vorhanden ist.
Interessanterweise wird die Demenz sowohl im ICD wie auch im DSM unter die psychischen Krankheiten eingereiht. Im ICD werden einzelne Krankheiten auch zu den neurologischen Erkrankungen gezählt, oft mit Doppelcodierung. Ich möchte diese Tatsache nicht überinterpretieren, doch aus meiner Sicht handelt es sich bei der Demenz um eine Erkrankung des Nervensystems, die zu psychischem Leid führt. Auguste Deter21





























