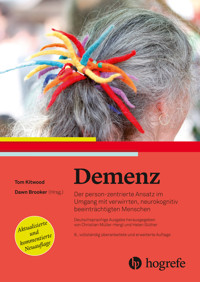
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Kognitive Beeinträchtigungen, wie Demenz und Altersverwirrtheit gehören zu den häufigsten Erkrankungen im Alter. Bücher über Demenz gibt es wie Sand am Meer. Aber das Buch des britischen Psychogerontologen Tom Kitwood wurde wegen seines radikal anderen person-zentrierten Ansatzes weltweit begeistert aufgenommen. Verbunden mit der Methode des "Dementia Care Mappings" entstand damit der wesentlichste Behandlungsansatz in der Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz. Der person-zentrierte Ansatz war prägend bei der Entwicklung des neuen DNQP-Expertenstandards «Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz». Die 9. Auflage wurde neu übersetzt, gestaltet und illustriert. Die Interviews, Nachworte, Literatur, Links, Texte und das Glossar im Anhang wurden überarbeitet. Internationale Demenzexperten steuerten neue ausführliche Kommentare zu jedem Kapitel und den aktuellen Entwicklungen bei. Über 20 Jahre nach dem Erscheinen von Kitwoods klassischem Text denken sie frisch über die Fragen nach was es heißt eine Person zu sein, wie sich der Begriff der Demenz verändert hat, wie eine Persönlichkeit untergraben und erhalten wird, wie Menschen die Erfahrung der Demenz erleben, wie sich die Pflege von Menschen mit Demenz verbessern lässt, welche neuen Anforderungen sich an eine Betreuungsperson stellen, wie aus versorgenden auch fürsorgliche Institutionen werden können und wie sich die Kultur in einer Institution verändern lässt zum Wohl und Wohlbefinden von Menschen mit Demenz und den sie begleitenden Menschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 696
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Tom Kitwood
Dawn Brooker (Hrsg.)
Demenz
Der person-zentrierte Ansatz im Umgang mit verwirrten, neurokognitiv beeinträchtigten Menschen
9., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
Aus dem Englischen von
Gabriele Kreutzner und Michael Herrmann
Deutschsprachige Ausgabe herausgegeben von
Christian Müller-Hergl und Helen Güther
Demenz
Tom Kitwood, Dawn Booker
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Pflege:
André Fringer, Winterthur; Jürgen Osterbrink, Salzburg; Doris Schaeffer, Bielefeld; Christine Sowinski, Köln; Angelika Zegelin, Dortmund
Tom Kitwood† Prof. Dr. (PhD), Psychogerontologe, ehem. Inhaber der Alois Alzheimer Professur für Psychogerontologie an der Universität Bradford. Begründer und Leiter der Bradford-Demenzgruppe und Psychologiedozent an der Universität Bradford; verstorben am 1. November 1998 in GB-Bradford.
Dawn Brooker (engl. Hrsg.) Professorin für Demenzstudien und Direktorin der Vereinigung für Demenzstudien an der Universität von Worcester, UK.
Christian Müller-Hergl (dt. Hrsg.) Dipl.-Theologe, BPhil., Altenpfleger, DCM-Trainer und Supervisor. Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Witten/Herdecke, Fakultät für Gesundheit, Dialog- und Transferzentrum Demenz; Hochschule Osnabrück (DZLA).
E-Mail: [email protected]
Dr. rer. cur. Helen Güther (dt. Hrsg. und Autorin) Dipl.-Heilpädagogin (Univ.), MPH. Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Witten/Herdecke, Fakultät für Gesundheit
Stockumer Str. 12, 58453 Witten
E-Mail: [email protected]
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Pflege
z. Hd. Jürgen Georg
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Jürgen Georg, Joëlle Zemp, Fabienne Suter, Martina Kasper, Franziska Schönberger
Herstellung: Daniel Berger
Umschlagabbildung: Martin Glauser, Münsingen
Umschlag: Claude Borer, Riehen
Illustration/Fotos (Innenteil): Cathy Greenblatt, NY
Satz: Claudia Wild, Konstanz
Format: EPUB
Das vorliegende Buch ist eine Übersetzung aus dem Englischen.
Der Originaltitel lautet „Dementia reconsidered, revisited“ von Tom Kitwood und herausgegeben von Dawn Brooker
© 2019. Open University Press, Open International Publishing Ltd, London/New York
9. Auflage 2022, Hogrefe Verlag, Bern
© der deutschsprachigen Ausgaben 2022 Hogrefe Verlag, Bern
© der deutschsprachigen Ausgaben 2000, 2001, 2003, 2005, 2008, 2013, 2019. Verlag Hans Huber, Hogrefe AG
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96138-5)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76138-1)
ISBN 978-3-456-86138-8
https://doi.org/10.1024/86138-000
Nutzungsbedingungen
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort zur deutschsprachigen Ausgabe
Geleitwort zur englischsprachigen Ausgabe
Vorwort der Herausgeberin der englischsprachigen Ausgabe
Danksagung der Herausgeberin
EinleitungTom Kitwood
1 Was heißt es, eine Person zu sein?Tom Kitwood
1.1 Der Begriff des Personseins
1.2 Wen schließt der Begriff ein?
1.3 Personsein und Beziehung
1.4 Die Psychodynamik des Ausgrenzens
1.5 Die Einzigartigkeit von Personen
1.6 Personsein und Verkörperung
1.7 Kommentar von Jan Dewing
1.7.1 Nochmals zurück zu Kernkonzepten
1.7.2 Einheit aller menschlichen Wesen
1.7.3 Inklusion
1.7.4 Beziehung
1.7.5 Die Einzigartigkeit von Personen
1.7.6 Verkörperung/Embodiment
1.7.7 Vorwärts gehen …
1.7.8 Resümee
1.7.9 Punkte, die ein Nachdenken lohnen
2 Demenz als psychiatrische KategorieTom Kitwood
2.1 Einiges zur Definition
2.2 Neuropathologie und Demenz
2.2.1 Pathologie vom Alzheimer-Typus
2.2.2 Pathologie vom vaskulären Typus
2.2.3 Pathologie vom „gemischten“ Typus
2.3 Genaueres zur Neuropathologie und Demenz
2.4 Demenz diagnostizieren
2.5 Die Untersuchung der Prävalenz
2.6 Depression und Demenz
2.7 Psychotische Komplikationen
2.8 Verändert sich die Persönlichkeit?
2.9 Die Genetik der Alzheimer-Krankheit
2.10 Körperliche Zustände, die eine Demenz verstärken
2.11 Ein Paradigma in Auflösung
2.12 Kommentar von Julian C. Hughes
2.12.1 Was stimmt nicht mit Kapitel 2?
2.12.2 Was ist richtig an Kapitel 2?
2.12.3 Die Höhenlage
2.12.4 Punkte, die ein Nachdenken lohnen
3 Das Untergraben des PersonseinsTom Kitwood
3.1 Eine Geschichte aus der Gegenwart
3.2 Das problematische Erbe
3.3 Maligne, bösartige Sozialpsychologie
3.4 Die Dialektik der Demenz
3.5 Kommentar von Steven R. Sabat
3.5.1 Grundlagen schaffende Vorläufer der malignen Sozialpsychologie
3.5.2 Punkte, die ein Nachdenken lohnen
4 Der Erhalt des PersonseinsTom Kitwood
4.1 Eine Angelegenheit von wachsender Bedeutung
4.1.1 Die Person mit Demenz
4.1.2 Pflegepraxis
4.1.3 Ambulante und teilstationäre Pflege und Betreuung
4.2 Hinweis auf eine positive Sichtweise: eine Fallstudie
4.3 Weitere Hinweise auf eine positive Sichtweise: Erfahrung und Forschung
4.4 Bei extremer neurologischer Beeinträchtigung
4.5 Ein zweiter Blick auf die Dialektik der Demenz
4.6 Kommentar von Dawn Brooker
4.6.1 Die Dialektik der Demenz: ein dritter Blick
4.6.2 Punkte, die ein Nachdenken lohnen
5 Das Erleben von DemenzTom Kitwood
5.1 Intersubjektivität und ihre Grenzen
5.2 Das Erleben einer jeden Person ist einzigartig
5.3 Sieben Zugangswege
5.4 Die Bandbreite des Erfahrens bei Demenz
5.5 Was brauchen Menschen mit Demenz?
5.5.1 Trost
5.5.2 Primäre Bindung – „Attachment“
5.5.3 Einbeziehung
5.5.4 Beschäftigung
5.5.5 Identität
5.6 Die Erfahrung einer person-zentrierten Pflege
5.7 Kommentar von Keith Oliver und Reinhard Guss
5.7.1 Wie Keith zum ersten Mal auf Dementia Reconsidered stieß
5.7.2 Wie Reinhard zum ersten Mal auf Dementia Reconsidered stieß
5.7.3 Was wir angesichts der heutigen Situation (2017) von dem Kapitel halten
5.7.4 Sieben Zugangswege – neu bedacht
5.7.5 Wie wir das Erleben von Demenz verstehen
5.7.6 Die Kitwood-Blume
5.7.7 Schlussfolgerungen
5.7.8 Punkte, die ein Nachdenken lohnen
6 Die Pflege verbessern – Der nächste Schritt voranTom Kitwood
6.1 Die Natur von Interaktion
6.2 Positive Arbeit an der Person
6.3 Interaktionen zwischen Menschen mit Demenz
6.4 Interaktion stärken
6.5 Demenzpflege und Psychotherapie
6.6 Zwei Arten der Rechtfertigung
6.7 Jenseits palliativer Behandlungs- und Betreuungskonzepte
6.8 Demenzpflege als Interaktion
6.9 Kommentar von Richard Cheston
6.9.1 Punkte, die ein Nachdenken lohnen
7 Die für- und versorgende OrganisationTom Kitwood
7.1 Organisationsstil und -struktur
7.2 Stress, Anspannung und Burn-out
7.3 Für das Personal sorgen
7.3.1 Bezahlung und betriebliche Leistungen
7.3.2 Einarbeitung
7.3.3 Ein Team schaffen
7.3.4 Supervision
7.3.5 Betriebsinternes Training
7.3.6 Individuelle Personalentwicklung
7.3.7 Anerkennung beruflicher Erfahrung und Beförderung
7.3.8 Effiziente Qualitätssicherung
7.4 Die richtigen Leute einstellen
7.5 Abwehrmechanismen von Organisationen und Demenzpflege
7.6 Veränderungen Wirklichkeit werden lassen
7.7 Das Pflege-Setting und die Gemeinde
7.8 Kommentar von Bob Woods
7.8.1 Das größere Ganze: Der Status von Pflegearbeit
7.8.2 Aktionsforschung: das Kapitel wird auf den Prüfstand der Praxis gestellt
7.8.3 Qualitätssicherung
7.8.4 Achtung wichtig: Einstellungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
7.8.5 Personalfortbildung
7.8.6 Veränderungen Wirklichkeit werden lassen
7.8.7 Punkte, die ein Nachdenken lohnen
8 Anforderungen an eine BetreuungspersonTom Kitwood
8.1 Der Anteil der Betreuungsperson an der Interaktion
8.2 Lebenskonzepte und Pflegearbeit
8.3 Erholung vom Lebenskonzept
8.4 Schmerzliche und verletzliche Punkte
8.5 Die Psychodynamik der Demenzpflege
8.5.1 Die Natur von Empathie
8.5.2 Projektive und empathische Identifikation
8.6 Zwei Wege der persönlichen Entwicklung
8.7 Kommentar von John Keady und Ruth Elvish
8.7.1 Pflegende Angehörige
8.7.2 Wohlergehen am Arbeitsplatz
8.7.3 Demenzfreundliche Kommunen
8.7.4 Abschließende Gedanken
8.7.5 Punkte, die ein Nachdenken lohnen
9 Die Aufgabe der kulturellen TransformationTom Kitwood
9.1 Pflegekulturen und ihr erweiterter Kontext
9.2 Die alte und die neue Kultur
9.3 Quellen des Widerstands
9.4 Der Veränderungsprozess
9.5 Die Implikationen auf breiterer Ebene
9.6 Kommentar von Claire Surr
9.6.1 Soziale Bewegungen und Aktivismus von Menschen mit Demenz
9.6.2 Demenz als weltweite politische und gesundheitliche Dringlichkeit
9.6.3 Demenz im öffentlichen Bewusstsein
9.6.4 Über Kitwoods „Neue Pflegekultur“ hinausgehen
9.6.5 Und die Zukunft?
9.6.6 Punkte, die ein Nachdenken lohnen
9.6.7 Die inklusive Kultur für Bürgerinnen und Bürger, die mit Demenz leben
Nachwort von Kate Swaffer
Literatur Kapitel 1 bis 9
Interview mit Christian Müller-Hergl
Biografie von Tom Kitwood
Nachwort von Christian Müller-Hergl
Person-zentrierte PflegeHelen Güther
Literatur „Person-zentrierte Pflege“
Deutschsprachige Adressen und Links
Dementia Care im Verlag Hogrefe
Glossar
Expertenstandard: Beziehungsgestaltung mit Menschen mit Demenz
Sachwortverzeichnis
|11|Geleitwort zur deutschsprachigen Ausgabe
Kitwood neu gelesen
Tom Kitwoods Buch „Dementia Reconsidered“ (1997) ist bis heute eins der am meisten gelesenen Fachbücher zu diesem Themenkreis. In dem Werk gelang es ihm, seine wesentlichen Überlegungen der letzten zehn Jahre vor seinem frühen Tod 1998 zusammenzufassen. Mit dem Ansatz der „personzentrierten Pflege von Menschen mit Demenz“ beeinflusste er nachhaltig Demenzkonzepte auf internationalen, nationalen, fachlichen und organisationsbezogenen Ebenen. Wie sehr sein Denken die tatsächlichen Rahmenbedingungen und die Praxis der Pflege verändert hat, ist dagegen umstritten. Zwar stießen seine Überlegungen eine Vielzahl von Forschungen an, Kernannahmen aber (z. B. das dialektische Modell der Demenz oder die fünf zentralen psychologischen Bedürfnisse) wurden seitens der Forschung kaum aufgegriffen.
Kitwood wirkte und schrieb in einer Zeit, in der die empirische Pflege- und Versorgungsforschung zu Menschen mit Demenz noch nicht sehr viel zu bieten hatte. Daher sind seine Überlegungen oft gewagt, eklektisch, empirisch wenig fundiert und aus eher theoretischen Überlegungen und persönlichen Erfahrungen abgeleitet. Dennoch gelang es ihm, das empirische Wissen seiner Zeit wo immer möglich zu berücksichtigen. Er ging dann aber weit darüber hinaus und nahm viele Entwicklungen vorweg, die sich erst in den nächsten 20 Jahren voll entfalteten, darunter das biopsychosoziale Verständnis von Demenz und die Abkehr von einem einseitig medizinisch orientierten Ansatz, ein wertorientiertes Verständnis in Versorgung und Pflege (Personenorientierung), die Vorstellung, Menschen mit Demenz vermehrt Gehör zu schenken und alle Dienstleistungen an ihren Bedürfnissen zu orientieren, sowie eine evidenzbasierte Entwicklung von Diensten anhand der konkreten Befindlichkeiten und Aktivitäten von Menschen mit Demenz (DCM). Schwer nachvollziehbar bleibt es weiterhin, dass Kitwood durchaus kompatible und teilweise auch weiterführende Vorstellungen aus der (Umwelt-)Gerontologie (z. B. Lawton: Competence-Stress-Modell1) und der Verhaltensforschung (Cohen-Mansfield2) nicht aufgegriffen hat.
Übergreifend machte er den Pflegenden (ob Angehörigen oder Professionellen) Hoffnung, dass ihre Arbeit und Zuwendung einen Unterschied für Menschen mit Demenz bedeutet; dass Menschen in ihrer Demenz eine Entwicklung durchmachen und diese durchaus beeinflussbar ist – dass demnach ein therapeutischer Nihilismus unangebracht und kontraproduktiv ist; dass Menschen mit Demenz etwas beizutragen haben, von dem auch Pflegende einen Gewinn davontragen. Kitwood lud dazu ein, nicht so sehr auf die Krankheit zu starren und alle Aspekte des Menschen aus diesem Blickwinkel zu |12|betrachten, sondern die Krankheit als einen und nicht alles bestimmenden Aspekt der Person und ihrer Geschichte aufzufassen. „Schau auf die Person, nicht auf ihre Demenz“ wurde das oft zitierte Schlagwort. Hiermit wurde die Vorstellung angegriffen, dass mit der Diagnose Demenz der Mensch eine unsichtbare Schwelle ohne Wiederkehr überschreitet und sich in „etwas“ verwandelt, das fremd, bedrohlich und grauenerregend ist (die Diagnose als stigmatisierender sozialer Akt der Exklusion). Auf eher grundsätzlicher Ebene gab er zu bedenken, welche Rolle Demenz in unserem Selbstverständnis spielt und warum Demenz für den modernen Menschen und die spätkapitalistische Gesellschaft eine zentrale Herausforderung darstellt.
Die Kritik am Standardparadigma und die Entwicklung des biopsychosozialen (ganzheitlichen) Ansatzes
Das medizinische Standardparadigma beschränkte sich auf ein ausschließlich neuropathologisches Verständnis der Demenz mit der Folge, dass nur ein Medikament, z. B. in Form einer Impfung, eine Lösung versprach. Je weniger sich diese Hoffnung erfüllen ließ, desto düsterer erschienen die Aussichten für Kranke, Angehörige und Professionelle: Was immer sie tun oder lassen, es hat kaum eine Auswirkung auf das Fortschreiten und die Entwicklung der Demenz. Die nihilistische Sicht und die damit einhergehende funktionale, zum Teil menschenverachtende Praxis bilden den Ausgangspunkt für die Kritik am Standardparadigma. Andererseits: je weniger ein neuropathologisches Verständnis allein zur Aufklärung der Demenz beiträgt und sich als ungenügend erweisen lässt, desto eher bieten sich andere Verstehenskontexte an, die für alle Beteiligten mit hoffnungsvolleren Aussichten verbunden sein könnten.
Kitwoods Verweise auf die ungenügende Erklärungskraft des Standardparadigmas sind auch der Absicht geschuldet, psychologische und soziale Faktoren als mitverursachend zu identifizieren, sodass Interventionen in diesen Bereichen den Verlauf und das Erleben von Demenz positiv beeinflussen. Aus diesen Überlegungen entwickelte sich das dialektische Verständnis der Demenz: In einer komplizierten Wechselwirkung kumulieren nach Kitwood neurologische, psychologische und soziale Faktoren, die entweder in einer Involutionsspirale (Abwärtsspirale) münden, oder aber, im günstigen Fall, eine „Remenz“ in die Wege leiten – eine Zurückentwicklung der Demenz mit messbar verbesserten Werten für kognitive Funktionen. Beobachtungen Kitwoods zu Vorkommnissen der „bösartigen Sozialpsychologie“ in Einrichtungen der Altenpflege legten die Vermutung nahe, dass sich unter ungünstigen Bedingungen der Verlauf der Demenz dramatisch beschleunigt und verschlechtert. Dies ließ vermuten, dass günstige Bedingungen und ein gutartiger Umgang (benigne Sozialpsychologie) zu mehr Momenten von Luzidität, aber auch zu mehr Zufriedenheit und Wohlbefinden beitragen, ja vielleicht sogar der Demenz Einhalt gebieten könnten.
Die Kritik am Standardparadigma wurde mit ganz unterschiedlichen Aspekten und auf verschiedenen Hintergründen weitergeführt, z. B. von Whitehouse3, Olde Rikkert4, Savva5, Ritchie und Lovestone6, Demetrius7 und vielen ande|13|ren8, und kann in die Diskussion um beeinflussbare Risikofaktoren bzw. sekundäre Prävention eingeordnet werden: Insbesondere vorhergehende psychische Erkrankungen (Depressionen), Persönlichkeitsstörungen, chronische Entzündungen, Stress und vaskuläre Erkrankungen, aber auch das Alter selbst (Störung im Energiehaushalt der Zellen) und die damit einhergehenden Anpassungsstörungen scheinen Vorkommen, Verlauf und Erleben von Demenz wesentlich zu beeinflussen.9 Demenz wird eher dimensional als kategorial, eher multifaktoriell als monokausal und zunehmend eher in Kontinuität mit dem normalen Alter gedacht. Ob sich der Alterungsprozess und die Demenz sauber trennen lassen, wird immer wieder bezweifelt. „Gemischte“ Zustände mit zugleich vorliegenden, unterschiedlichen und sich wechselseitig beeinflussenden Ursachen (unterschiedliche Formen von Proteinfehlfaltungen) scheinen eher die Regel denn die Ausnahme zu sein und stellen das nosologische System von sauber getrennten „Demenzentitäten“ infrage.10 Ein Großteil des kognitiven Niedergangs scheint ursächlich nicht auf die üblichen neuropathologischen Prozesse zurückführbar zu sein.11 Kognitive Dysfunktion ist eine Angelegenheit von großer Spannbreite und wird beeinflusst von genetischen, entwicklungsabhängigen und Lebensstilfaktoren, angehäuften neuralen Insulten, angeborener und cerebraler Reservekapazität sowie Kompensationsmechanismen und altersabhängigem Abbau. Demenz ist das Ergebnis eines Zwischenspiels protektiver und verschlimmernder Faktoren wie z. B. Genen, Familiengeschichte, sozioökonomischem Status und weiteren Faktoren.
Im Ergebnis kann der Kritik am Standardparadigma aus heutiger Sicht nur zugestimmt werden. Allerdings folgt daraus nicht eine empirische Bestätigung des dialektischen Verständnisses der Demenz selbst. Kofaktoren wie Stress scheinen sich eher auf den Modus, das Erleben, vielleicht auch auf den Verlauf, weniger auf die Res – die Demenz selbst – auszuwirken. Von der Möglichkeit einer „Remenz“ hat Kitwood selbst am Ende auch Abstand genommen. Im günstigsten Fall führen positive Interventionen zu einer Verlangsamung, Stabilisierung und Verdichtung des Krankheitsprozesses sowie einer verbesserten Integration der erlebten Veränderung (Adaption). Positive und warme Beziehungen erleichtern es, Demenz zu ertragen und verringern das Vorkommen herausfordernden Verhaltens,12 führen demnach eher zu palliativen denn kurativen Wirkungen. Immer noch wichtig am Ansatz Kitwoods: Dass menschliche Beziehungen und ein günstiges Milieu sich insgesamt mildernd auf den Verlauf und das Erleben von Demenz auswirken können – allerdings, so müsste man heute konzedieren, nicht müssen.
Vom Wohlbefinden zu psychologischen Bedürfnissen
Am Beginn von Kitwoods Auseinandersetzung mit Demenz stand die Vorstellung, dass Unwohlsein – z. B. in Form einer Dysphorie oder als Ergebnis von Traumatisierung oder sozialer |14|Marginalisierung – Menschen für die Demenz prädisponiert. Dem widerspricht nun aber, dass traumatisierte Personen nicht deutlich häufiger eine Demenz erleiden (wohl aber möglicherweise vermehrt unter ihr leiden).
Diese nie ganz aufgegebene Vorstellung machte dann aber im Kontext von konkreten Beobachtungen dem Konzept Platz, dass Unwohlsein in der Demenz eher eine Folge ungünstiger Umgebungen und verweigerter oder schlechter Beziehung darstellt. Unwohlsein müsste damit eher schlechter, Wohlbefinden eher guter Pflege entsprechen. Je eher sich ein Mensch in seiner Demenz (relativ) wohl fühlt, weil er angenommen, verstanden, gehört und unterstützt wird, desto mehr kann er seine Ressourcen nutzen und am Ende sein Personsein erhalten. Auch dieser Ansatz hatte seine Tücken: gibt es doch Menschen, die sich unter schlechten Bedingungen dennoch ihres Lebens erfreuen und andere, die trotz günstiger Rahmenbedingungen und vielfältiger Zuwendung an ihrer Demenz verzweifeln. Diese Widersprüche lassen sich nur auflösen, indem man zugesteht, dass binäre Vorstellungen (Unwohlsein/Wohlbefinden) nicht weiterführen und es ein Zugleich unterschiedlicher Arten von Unwohlsein und Wohlbefinden gibt, die auf ganz unterschiedliche Weise äußeren Einflüssen unterliegen (oder eben auch nicht). An diese Überlegungen knüpft in den letzten Werken Kitwoods das Konzept der (objektiven) psychologischen Bedürfnisse an.
Eher aus konkreten Beobachtungen heraus entwickelte Kitwood zwölf Indikatoren des Wohlbefindens wie z. B. Anerkennung (recognition), Beschäftigung, Zugehörigkeit, angemessene Stimulation, die eher einem eudämonistischen („tugendhaftes Leben“, persönliches Wachstum, Sekundärprozesse) und nicht hedonistischen (Primärprozesse, Affekte, Lust) Verständnis von Wohlbefinden entsprechen: Ist man sozial gut eingebettet, sinnvoll beschäftigt, von anderen anerkannt, und lebt man in einer angemessenen und gut angepassten Umgebung – lebt also im aristotelischen Sinne „tugendhaft“ (gesittet, an gesellschaftlichen Normen orientiert, adäquat sozial unterstützt, im weiteren Sinne „nützlich“), dann ist dies für das Wohlbefinden wichtig und entscheidend auch dann, wenn es sich nicht im mimischen Ausdrucksverhalten (Affekte) niederschlägt.13
An diese eher „objektivistische“ Auffassung von Wohlbefinden knüpft dann letztendlich die Idee der fünf psychologischen Bedürfnisse an: Tätigsein, Bindung, Identität, Trost (comfort), Inklusion. Zusammenfassend: das Bedürfnis, geliebt zu werden und lieben zu dürfen. Wohlbefinden und Erhalt des Personseins bedeuten nicht mehr und nicht weniger als dass diese Bedürfnisse zureichend erfüllt sind. Daher bedarf es einer reflektierten Praxis, herausforderndes Verhalten oder neuropsychiatrische Symptome unter anderem als Mangel an Bindung und Sicherheit zu rekonstruieren, als symbolischer und körperlicher Ausdruck unerfüllter, aber zentraler Bedürfnisse, die einer gezielten Intervention bedürfen. Kitwoods Überlegungen knüpfen daher nahtlos an das Konzept des „Need-driven compromised behaviour“ (NDB-Modell) von Whall und Algase an.14
Viele Fragen bleiben hierbei offen. Um beim letzten Punkt anzuknüpfen: Nur einige, nicht alle neuropsychiatrischen Symptome sind medizinischen oder nicht-pharmakologischen Interventionen zugänglich. Dies gilt insbesondere für die Apathie („vaskuläre Depression“, |15|„depletion syndrom“), die Agitiertheit (Symptomtrias von psychomotorischer Unruhe, Erregung und Gespanntheit, oft einhergehend mit Negativismus bis Feindseligkeit) sowie für anhaltende Vokalisierungen (Pseudobulärer Effekt) und abweichendes motorisches Verhalten. All diese einschlägig bekannten und belastenden Symptome sind häufig nur marginal beeinflussbar und nicht unbedingt nur als Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse zu verstehen.15
Dann: Wie ist Kitwood auf diese fünf Bedürfnisse gekommen und wie begründet er diese Auswahl – dies hat er nicht gemacht, bzw. er liefert keine Theorie, aus der sich diese Bedürfnisse ableiten ließen. Dabei hätten sich vielfältige Anknüpfungen angeboten, z. B. Kompetenz, Verbundenheit und Autonomie nach Ryan16 oder der Dreiklang von Stimulanz, Balance und Dominanz nach Häusel17 sowie viele weitere ähnliche Bezüge. Neurowissenschaftliche Ansätze könnten helfen, diesen bunten Strauß theoretisch präziser zu erfassen.
Wie ist das Verhältnis von objektiven psychologischen Bedürfnissen und Affekten zu denken – also den objektiven und subjektiven Anteilen des Wohlbefindens? Wie kann man feststellen, ob die psychologischen Bedürfnisse erfüllt werden? Kann man aus dem äußeren Verhalten zuverlässig auf die subjektive Befindlichkeit schließen und ist letztere ein Indikator dafür, dass die objektiven Bedürfnisse, individualisiert ausgedrückt in Präferenzen, erfüllt sind? Und wie misst man subjektive Befindlichkeit, wenn nicht am Affekt der Personen mit Demenz? Positive Affekte als Ausdruck gelingender Affektregulation, von Homöostase im Sinne der Broaden-and-Build-Theorie?18 Oder vielleicht eher daran, dass Menschen mit Demenz in einer erleichternden Umgebung ohne Widerstand leben und agieren können, sodass ein stressfreier „Alltagsflow“ entsteht? Ist letzteres ein möglicher Anhaltspunkt, da Affekte in der Demenz verflachen und oft nur der 0-Affekt gesehen wird?
Obwohl gut versorgt und ohne erkennbare Traumatisierungen, verzweifeln zuweilen Menschen schon am Alter und erst recht an der Demenz (Verlust des Urvertrauens bedingt durch sekundäre Strukturdefizite) – wie kann man dies erklären? Gute Umgebungen können nicht nur Wohlbefinden steigern, sondern – wie Kitwood zugibt – dazu beitragen, dass Menschen ihre Befindlichkeit ausgiebiger explorieren und – weil nicht durch Medikamente kontrolliert – negative Affekte wie Ärger, Projektionen, quälende Anspruchshaltungen akzentuierter leben. Ist dies dann zu begrüßen oder zu bedauern? Ist erkennbarer Ärger eher Ausdruck von Selbstbehauptung (positiv) oder von Unzufriedenheit (negativ) oder vielleicht von beidem zugleich? Wie ist es zu sehen und wie geht man damit um, wenn Menschen an ihrer Demenz verzweifeln – haben sie dazu nicht allen Grund? Sind Menschen, die nicht tätig sein wollen und sich nicht für andere interessieren, notwendigerweise unzufrieden und müssen als „apathisch“ eingestuft werden – oder heben sie ab in Sphären der „Gerontotranszendenz“?19 Vielleicht entziehen sie sich ab einem bestimmten |16|Grad der Demenz unserem Verständnis, sodass wir mehr projizieren als verstehen?
Und weiter: Wenn es dann Personen mit Demenz schlecht geht, haben dann notwendigerweise die Pflegenden „versagt“ und sind gar „schuld“, da sie nicht in der Lage waren, zentrale Bedürfnisse zu identifizieren und zu erfüllen? Daran knüpft die „Gretchenfrage“ an: Ist es wirklich so, dass eine gute Versorgung und Pflege das Personsein und das Wohlbefinden von Menschen mit Demenz erhält oder ist die Macht der Krankheit größer und durchschlagender als alle Interventionen? Bilden die schönen Interventionen wie Validation, sensorische Anregung und Erinnerungsarbeit eher ein „Trostpflaster“ für Pflegende, um die Situation für sich erträglich zu gestalten, oder wirken sie sich wirklich nachhaltig positiv auf Menschen mit Demenz aus? Oder entsteht durch personzentrierte Praxis mit der Zeit ein anderes gesellschaftliches Umfeld, in dem die Macht der Krankheit durch soziale Praktiken relativiert und damit als gar nicht mehr so mächtig empfunden wird? Dies wird in jedem Fall und bei jeder Person anders zu gewichten sein, sodass sich ein abschließendes Urteil verbietet.
Man könnte behaupten, dass in den bald 25 Jahren nach Kitwoods Tod die unterschiedlichsten Antworten und Theorien zu diesen Fragen aufgestellt wurden, ohne dass dies bislang zu einem übergreifenden Konsens geführt hat. Die grundlegenden Fragen, die sich aus Kitwoods Überlegungen ergeben, treiben Theorie und Praxis weiter um.
Das zentrale Konzept: Personsein
Das Konzept der zentralen psychologischen Bedürfnisse hängt eng zusammen mit dem Konzept des Personseins – erstere sollen Personen (nach-)nähren, aufbauen, erhalten. Inhaltlich grenzt sich personzentrierte Pflege von einer funktional orientierten Pflege ab. Ein Sich-Kümmern um Menschen mit Demenz – so die Vorstellung – soll über eine gute Ernährung, eine erhaltene Mobilität, eine gute Bekämpfung von Schmerzen etc. deutlich hinausgehen. Dies im Sinne einer existenziellen oder „seelsorglichen“ Begleitung, eines inneren, aber fachlich wohl fundierten Anteilnehmens und aktiven Eingehens auf den schwierigen Anpassungs- und Übergangsprozess, den die Demenz für die Betroffenen darstellt. Pflegende stellen sich als sicheren Hafen, existenziellen Halt, als Bindungsobjekt zur Verfügung und vermitteln der Person mit Demenz das Gefühl, gehört, gesehen, angenommen und verstanden zu werden und mit anderen in Verbindung zu sein. Sie sind eine Art „existenzielles Hilfs-Ich“ und arbeiten dem Gefühl der Verlorenheit, der Auflösung und der Angst entgegen. Oder systemtheoretisch ausgedrückt: Pflegende stellen Adressabilität, möglichst im Höchstmodus der Anerkennung oder Liebe wieder her („amicable Verlangbarkeit“), erfüllen den Inklusionsdrift moderner Gesellschaften an einem besonders heiklen Punkt.20
Diese Position ist eng verbunden mit der theoretischen Perspektive des „sozialen Interaktionismus“ und der Bindungstheorie: Die Natur des Selbst ist sozial und hängt von sozialer Interaktion ab.21 Menschen werden zu Personen durch Beziehung, Anerkennung und Gemeinsam-Sein und -Tun. Demenz bedeutet in diesem Verständnis, dass sichere Bindung, Urvertrauen und höhere Selbstfunktionen erodieren und die Personen wieder einer äußeren, interaktiven Unterstützung bedürfen (der Pflegende als Hilfs-Ich oder gar Ersatz-Ich). Dies impliziert für die Pflegenden, über professionelle Rollen hinauszuwachsen und ein Wagnis einzugehen, das verbunden ist mit Spontanität, Wärme, dem Zeigen von Gefühlen und mit Identifikation. Pflegende, so könnte man sagen, sind interaktive Affektregulatoren, sie regeln Ängs|17|te herunter, sodass bei Menschen mit Demenz wieder mehr kognitives Funktionieren und damit Kontrolle möglich wird. Auch Pflegende sind damit in und mit ihrer Person gefordert, selbst dann, wenn diese Nähe aus einer professionellen Distanz heraus zu gestalten ist. Das Individuelle, Nicht-Ableitbare, das Besondere der Person (eigentlich beider: der Person mit Demenz und des Pflegenden) ist dabei die Basis für Kontakt, nicht die eher distanziert-professionelle Rolle, die jeden „gleich“ behandelt („Uniformierung“).
Mit dem Konzept des Personseins betrat Kitwood ein philosophisch hoch umstrittenes Terrain. Zuweilen wird er dafür kritisiert, nicht der begrifflichen Konfusion zwischen der eher metaphysisch-analytischen Frage nach dem, was Personsein ausmacht/bedeutet, und der eher ethisch-moralischen Frage, was dies an Folgen für Interaktion und Verhalten mit sich bringt, zu entgehen. Ob diese Kritik zutrifft, hängt davon ab, ob man „Person“ als Wertbegriff begreift, dessen Zuschreibung nicht von kognitiven Merkmalen abhängt. Der enge Zusammenhang zwischen kognitiver, emotionaler und sozialer Attribution legt eine Abhängigkeit allerdings sehr nahe.22
Ein prozessorientiertes, neuropsychologisch fundiertes Verständnis des Selbst sieht dies in der Orchestrierung, der Zusammenarbeit und der Integration diverser Hirn-Hubs verankert.23 Eben diese Orchestrierung verliert sich in der Demenz (Dissoziation) mit der Folge, dass man legitimerweise fragen kann, ob man mit einer „Personalisierung“ des Kontaktes bei schwerer Demenz den Betroffenen immer einen Gefallen tut. Je de-kontextualisierter (von der Vergangenheit, von der Umgebung, von anderen Menschen, am Ende sogar vom eigenen Körper) die Person, desto fraglicher, ob wir uns im Kontakt noch auf unsere Intuition verlassen können. Werden Menschen zunehmend zu Kontexten ihrer selbst, dann kann es rätselhaft werden, was sie brauchen. Dann ist – nach dem dialektischen Modell von Kitwood – mehr Personalisierung möglicherweise mehr vom Falschen. Werden sie also doch zu „Anderen“ im Sinne des „Othering“?
Ursprünglich ist sein Person-Konzept religiös fundiert, eine Perspektive, die Kitwood aber später zugunsten des sozialen Interaktionismus und der Bindungstheorie aufgibt. Abschließend charakterisiert er Personsein als soziales Konstrukt, als Ergebnis einer „sozialen Positionierung“, als wertorientierte Zuschreibung, die durch Anerkennung, Respekt und Vertrauen gelebt wird bzw. sich darin manifestiert. Diese Position wendet sich theoretisch gegen ein fähigkeitsorientiertes Verständnis von Person, die unter Person ein Wesen versteht, das gewisse Merkmale erfüllt (metaphysisch-analytische Position, z. B. die sechs kognitiven Domänen nach DSM-5).
Kritisch ist zu diesem Ansatz zu vermerken, dass damit das Personsein von Menschen mit Demenz (und in der Tat von allen Menschen) in nichts Grundlegenderem verankert ist als der aktuellen sozialen Praxis, Menschen (mit Demenz) als Person anzuerkennen.24 Soziale Praktiken können sich aber verändern: Es ist durchaus ein gesellschaftlicher Diskurs vorstellbar, der im Rahmen einer metaphysisch-analytischen Fähigkeitsorientierung – unterfüttert von ökonomischen Interessen – die Erfüllung gewisser, in der Regel kognitiver Merkmale zur Voraussetzung für soziale Anerkennung macht. Kann die moralische Anerkennung von Personsein ohne das Vorhandensein der metaphysischen Basiskomponenten (z. B. Reflexion, narrative Identität, weitere performative Kompe|18|tenzen wie Sprache) erfolgen?25 Oder wäre es nur folgerichtig, bei massiven Veränderungen der „seelischen Infrastruktur“ eine Einschränkung oder gar einen Verlust des Personseins zuzugestehen? Wenn man Personsein, eingebettet und mitkonstituiert durch Beziehungen zu bedeutsam anderen, eher dimensional als kriteriologisch denkt (ein gefährliches Unterfangen), wie weit kann dann das „distale Ende“ (Unterstützung, Kontakt, Beziehung) das „proximale Ende“ (die individuelle Person) noch halten, also proximale Defizite distal kompensieren?26 Andererseits: Rechtfertigen erworbene Defizite den einmal erreichten Status als Person abzusprechen oder sind sie nicht eher ein Ansporn dafür, die Assistenz zu optimieren? Sind die „metaphysischen Komponenten“ nicht eher Ausdruck einer sozial und geschichtlich bedingten Überbewertung des Rationalen, die es gerade zu überwinden gilt? Vielleicht – um eine dritte Position anzubieten – ist der Begriff der Person eher eine nützliche Fiktion, eine regulative Idee, eine konstruktive Utopie, nach der wir streben, die wir aber nicht als realisiert begreifen dürfen (Kant nannte dies den „transzendentalen Schein“), die uns aber hilft, unsere Vorstellung von Personsein elastisch auszuweiten (Expansion der „Wir-Intentionen“). Also die bislang erfolgten Erweiterungen des Personalen (von der Abschaffung der Sklaverei bis zu Kinderrechten) zum Anlass zu nehmen, diese antizipatorisch zu extrapolieren und mit mehr Personalisierungen zu rechnen? Sodass wir auch dann, wenn wir uns der metaphysisch-analytischen Qualität des Personseins unsicher geworden sind, dennoch so handeln sollten, wie wenn Personsein der Fall wäre? Eine Art zunehmend echolose Dauersimulation sozialer Inklusion um unser selbst willen? So geht der Diskurs hin und her.
Die grundlegenden und praktischen Probleme der Demenz bleiben bestehen. Dass Menschen mit Demenz Personen bleiben – abstrakt und konkret – scheint von der Verantwortung und sozialen Praxis derer abzuhängen, die nicht an Demenz leiden. Man fühlt sich an die aktuellen Diskurse zur Inklusion und Exklusion erinnert. Somit biegt sich der Spaten (die Frage nach dem Personsein der „Anderen“) auf „uns“ (die Nicht-Dementen) zurück: ob wir eine Praxis an den Tag legen wollen, die Menschen mit Demenz zu Personen macht. Die Frage nach dem „Sein“ wird zu einer Frage nach dem „Sollen“.
Februrar 2021
Christian Müller-Hergl
Lawton, M. P. & Nahemow, L. (1973). Ecology and the aging process. In C. Eisdorfer & M. P. Lawton (Eds.), The psychology of adult development and aging (pp. 619–674). Washington, DC: American Psychological Association.
Cohen-Mansfield, J., Werner, P. & Marx, M. S. (1989). An observational study of agitation in agitated nursing home residents. International Psychogeriatrics, 1(2), 153–165.
Whitehouse, P. & George, D. (2008). The myth of Alzheimer’s. New York: St. Martin’s Press.
Olde Rikkert, M., Teunisse, J.-P. & Vernooij-Dassen, M. (2005). One hundred years of Alzheimer’s disease and the neglected second lesson of Alois Alzheimer on multicausality in dementia. American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias, 20(5), 269–272.
Savva, G. M., Wharton, S. B., Ince, P. G., Forster, G., Matthews, F. E. & Brayne, C. (2009). Age, neuropathology, and dementia. The New England Journal of Medicine, 360(22), 2302–2309.
Ritchie, K. & Lovestone, S. (2002). The dementias. Lancet, 360(9347), 1759–1766.
Demetrius, L. A. & Driver, J. A. (2015). Preventing Alzheimer’s disease by means of natural selection. Journal of the Royal Society Interface, 12(102), 20140919
Vgl. zusammenfassend: Herrup, K. (2010). Reimagening Alzheimer’s disease – an age-based hypothesis, The Journal of Neuroscience, 39(50), 16755–16762; McDonough, I. M. & Allen, R. S. (2019). Biological markers of aging and mental health: A seed and soil model of neurocognitive disorders. Aging & Mental Health, 23(7), 793–799.
Vgl. Müller-Hergl, C. (2020). Demenz-Round-Up Sommer 2020. Verfügbar unter https://www.dzla.de/demenz-round-up-sommer-2020/
Rahimi, J. & Kovacs, G. (2014). Prevalence of mixed pathologies in the aging brain. Alzheimer’s Research and Therapy, 6(9), 82–89.
Boyle, P. A., Yu, L., Leurgans, S. E., Wilson, R. S., Brookmeyer, R., Schneider, J. A. & Bennett, D. A. (2019). Attributable risk of Alzheimer’s dementia attributed to age-related neuropathologies. Annaly of Neurology, 85(1), 114–124.
Hedman, R., Hansebo, G., Ternestedt, B.-M., Hellström, I. & Norberg, A. (2012). How people with Alzheimer’s disease express their sense of self: Analysis using Rom Harre’s theory of selfhood. Dementia, 12(6), 713–733.
O’Rourke, H. M., Fraser, K. D. & Duggleby, W. (2015). Does the quality of life construct as illustrated in quantitative measurement tools reflect the perspective of people with dementia? Journal of Advanced Nursing, 71(8), 1812–1824.; O’Rourke, H. M., Duggleby, W., Fraser, K. D. & Jerke, L. (2015). Factors that affect quality of life from the perspective of people with dementia: A metasynthesis. Journal of the American Geriatric Society, 63(1), 24–38.
Eine gute Einführung in: Halek, M. & Bartholomeyczik, S. (2006). Verstehen und Handeln: Forschungsergebnisse zur Pflege von Menschen mit Demenz und herausforderndem Verhalten. Hannover: Schlütersche.
Zur Diskussion: Cunningham, C., Macfarlane, S. & Brodaty, H. (2019). Language paradigms when behavior changes with dementia: #BanBPSD. International Journal of Geriatric Psychiatry, 34(8), 1109–1113.
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The „what“ and „why“ of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquire, 11(4), 227–268.; Ryan, R. & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials. Annual Review of Psychology, 52(1), 141–166.
Häusel, H.-G. (2019). Think Limbic! (6. Aufl.) München: Haufe.
Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology. The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56(3), 218–226.
Wadensten, B. (2007). The theory of gerotranscendence as applied to gerontological nursing – Part 1. International Journal of Older People Nursing, 2(4), 289–294.
Fuchs, P. (2013). Inklusion und Exklusion: Essay zu den Konturen professioneller Inklusionsarbeit. Zeitschrift für Sozialpädagogik, 11(1), 93–99.
Gute Darstellung dieser Diskurse in: Ballenger, J. F. (2006). Self, senility, and Alzheimer’s disease in modern America. Baltimore: John Hopkins University Press.
Simm, L. A., Jamieson, R. D., Ong, B., Garner, M. W. J. & Kinsella, G. J. (2017). Making sense of self in Alzheimer’s disease: reflective function and memory. Aging & Mental Health, 21(5), 501–508.
Knösche, T. R. (2008). Das Hirn als Netzwerk. Verfügbar unter https://www.mpg.de/336848/forschungsSchwerpunkt1
Rorty, R. (1989). Contingency, irony, and solidarity. Cambridge: Cambridge University Press
Higgs, P. & Gilleard, C. (2016). Interrogating personhood and dementia. Aging & Mental Health, 20(8), 773–780.
Hughes, J. C., Louw, S. J. & Sabat, S. R. (2006). Seeing whole. In J. C. Hughes, S. J. Louw, S. R. Sabat (Eds.), Dementia: Mind, meaning and the person (pp. 1–40). Oxford: Oxford University Press.
|19|Geleitwort zur englischsprachigen Ausgabe
Es ist eine Ehre, das Vorwort zu dieser wichtigen Aktualisierung von Tom Kitwoods bahnbrechendem Werk zu schreiben. Er war ein echter Visionär, der ein Bild der Zukunft entwarf, in der Menschen, die wie ich mit einer Demenz leben, eine Pflege zuteilwird, die unser Personsein respektiert. Kitwood schrieb sein Buch wie auch seine zuvor veröffentlichten Beiträge in einer Zeit, in der Menschen mit Demenz als nicht einsichtsfähig und wenig mehr als physische Körper galten, die gerade einmal das Nötigste an Pflege brauchen. Das war auch die Auffassung, der ich zum Zeitpunkt meiner Diagnosestellung im Jahr 1995 begegnete. Damals sagte man mir, ich würde in den kommenden fünf Jahren komplett abbauen, danach noch ein paar Jahre komplette somatische Pflege brauchen und dann schließlich versterben. Ich war frisch geschieden und Mutter dreier Mädchen im Alter von neun, dreizehn und neunzehn Jahren. Es gab keinerlei Hoffnung, einzig die Aussicht auf einen Tod bei lebendigem Leib, der just in jenem Moment in den Räumlichkeiten der Spezialisten einsetzte, in dem man mir das Etikett eines Zustands aufklebte, der mit einem schrecklichen Stigma der Angst vor einem künftigen „Nicht-Sein“ behaftet war.
Wer würde ich sein, wenn es ans Sterben ginge? Wäre ich dann noch immer Christine? Würde ich noch irgendjemanden erkennen? Was würde dieser Tod bei lebendigem Leib für meine drei Mädchen und mich bedeuten? Aber dann gab mir ein mitfühlender Neurologe neue Hoffnung. Er verschrieb mir die erste Anti-Demenz Behandlung, die damals erhältlich war, und lehnte es ab, mich mit dem üblichen „Gehen Sie nach Hause und bringen Sie Ihre Angelegenheiten in Ordnung“ abzuspeisen. Er ließ mich ein wenig Hoffnung schöpfen und verstand, dass jede Person, die mit Demenz lebt, einzigartig ist und er mir keinerlei verlässliche Prognose geben konnte.
Damals, in jenen frühen Tagen des Internets, ist es mir dann gelungen, einige andere Menschen mit Demenz rund um den Erdball ausfindig zu machen und wir boten uns gegenseitig Unterstützung und Ermutigung. Als nächstes begann ich, über unsere Erfahrungen zu sprechen – erstmals auf einer Nationalen Konferenz und dann auf der Internationalen (ADI) Konferenz 2001. Aber man glaubte mir nicht und hinterfragte meine Glaubwürdigkeit, weil ich nicht dem üblichen Stereotyp von Menschen mit Demenz entsprach. Innerhalb weniger Jahre erhoben dann mehr von uns ihre Stimme und veränderten die Art und Weise, wie Menschen mit Demenz gesehen wurden. Es brauchte unsere Schilderungen, wie sehr wir gegen das nachlassende Erinnerungsvermögen, sprachliche Fehlfunktionen und das Unvermögen kämpfen, mit Stress zurecht zu kommen und für die Zukunft zu planen. Als Experten im Erleben von Demenz haben wir zu verdeutlichen versucht, wie unser Leben sich innerhalb von Stunden oder Tagen von einem wie Sirup anmutenden Nebel in einen sonnigen Tag verwandeln kann. An manchen Tagen und in manchen Stunden können wir fast als „normal“ durchgehen, doch zu anderen Zeiten sind wir davon abhängig, dass unsere Familien und diejenigen, die uns unterstützen, uns durch das Labyrinth des Lebens führen. Inmitten des Flugsands der Demenz |20|müssen wir zuerst und vor allem anderen als Menschen gesehen werden, statt lediglich als ein Zustand, der in unserer Gesellschaft gefürchtet und gemieden wird.
Wichtig ist auch Kitwoods Weitsicht dafür, dass Menschen mit Demenz nach wie vor Menschen sind und seine Erkenntnis, dass unsere Pflege mit Achtung erbracht werden muss, statt schlicht das Erfordernis darzustellen, uns zu duschen und mit Essen zu versorgen, tagsüber aus dem Bett zu holen und abends wieder dorthin zurückzubringen. Kitwood berief sich auf das Werk des Religionsphilosophen Martin Buber „Ich und Du“, demzufolge die Beziehung zwischen Menschen die eines Ich zu einem Du sein soll, statt der eines Ich und eines Es – ganz gleich, ob wir Demenz haben oder nicht. Dies stand im Zentrum von Kitwoods Vision, in der das einzigartige Personsein des Menschen mit Demenz in der Sorgebeziehung aufrechterhalten wird, anstatt lediglich unseren körperlichen Bedürfnissen nachzukommen.
Kitwood sah die Wichtigkeit des Neuroplastizität-Ansatzes voraus, die dann 2007 im Zuge der Veröffentlichung des Buches The Brain that Heals Itself (deutsche Ausgabe: Neustart im Kopf) von Norman Doidge weltweite Aufmerksamkeit erfahren sollte. Kitwoods Buch entstand zudem vor der weithin bekannten, sogenannten Nonnenstudie von David Snowdon, die zeigte, dass der Demenz genannte Zustand nicht notwendigerweise in einem direkten Zusammenhang zur Neuropathologie des Gehirns steht, sofern man diese nach dem Tod untersucht. Kitwood ließ diese Erkenntnisse erahnen, als er schrieb, dass Demenz nicht in einer unmittelbaren Beziehung zu Schädigungen des Gehirns steht und auf sein zentrales Konzept verwies, demzufolge Demenz nicht einfach ein biologisches Problem darstellt, sondern auch ein Merkmal einer depersonalisierenden und behindernden psychosozialen Umwelt ist.
Auf gerade einmal 140 Seiten ließ Kitwood die Zukunft in einem deutlich anderen Licht erscheinen – dem einer Zukunft, in der Menschen mit Demenz gehört werden können und ihre Umgebung zur Unterstützung ihrer Funktionen verbessert wird. Seine Vorstellung stellte in der Tat eine neue Art des Sehens dar, die den Zweck verfolgte, einen wesentlichen Kulturwandel herbeizuführen. Sein Werk hatte und hat weiterhin eine enorme Wirkung.
Was wir zudem in Erinnerung rufen sollten ist, dass Kitwood sein Buch schrieb, bevor Antidementiva verfügbar wurden und bevor die Welt begann, die Stimmen von Menschen mit Demenz zu vernehmen und ihnen Glauben zu schenken. Er musste kreative Wege finden, um die Welt aus unserer Perspektive zu sehen. Ich glaube, das ist ihm ebenso gelungen, wie er erfolgreich dabei war, uns unser „Personsein“ zurückzugeben. Als Person, die mit Demenz lebt, hat mir Kitwood mein „Selbst“ zurückgegeben, das ich aus meiner eigenen Perspektive sehe, aus der ich „Ich“, „Mich“ und „Mein“ sagen kann. Dabei beachte ich freilich, dass Personsein die Perspektive derjenigen ist, die uns begleiten und pflegen, die ja die einzige Stimme war, die Kitwood damals zur Verfügung stand.
Ich habe Kitwoods Buch 2002 im Zuge der Vorbereitung eines Beitrags gelesen und war von seinem Gegenkultur-Ansatz begeistert. Jetzt, wo ich das Buch ein weiteres Mal lese, bin ich wieder verblüfft darüber, wie er es geschafft hat, ein derart prägnantes Werk hervorzubringen, das zum Kern der Notwendigkeit vordrang, die Kultur der Pflege von Menschen mit Demenz zu verändern und diejenigen zu unterstützen, die sich um uns sorgen – Familien und Freunde ebenso wie beruflich Pflegende. Seine Methode des Dementia Care Mapping hat sich in zahlreiche Länder verbreitet und wirkt sich in bedeutsamer Weise auf die Anerkennung der Notwendigkeit aus, die Pflegekultur zu verändern.
Die Relevanz der nun vorliegenden Aktualisierung besteht darin, dass sie das Werk Kitwoods im Licht der Veränderungen der letzten 20 Jahre umformt und eine neue Vorstellung für die Zukunft bietet. Die wichtigste unter diesen Veränderungen ist natürlich in den Stimmen der Menschen mit Demenz zu sehen, die die Art |21|von Pflege beschreiben können, die wir brauchen. In dieser Hinsicht ist der Beitrag von Keith Oliver als jemand, der mit einer Demenz lebt, von unschätzbarem Wert; er ist der Experte des Erlebens von Demenz.
Andere Veränderungen betreffen das Thema Sprache und Sprechen, wenn wir etwa nicht länger „Opfer“ oder „Leidende“ sind, deren Identität durch unseren Zustand verschüttet und in diesem aufgegangen ist. Wir sind Menschen, die zufällig mit einer Demenz leben. Festhaltenswert ist zudem das Einsetzen gemeindebezogener Reaktionen wie etwa die „Demenzfreundlichen Kommunen“, denn unsere Beziehungen gehen über das Ich-Du hinaus zu einem Ich-Wir. Wir möchten nicht dadurch in Isolation geraten, dass für uns Hürden dafür existieren, mit unserem Umfeld zu Rande zu kommen. Deshalb sind diese Anstrengungen wichtig, unsere Lebenswelten anzupassen und die Kommune als Ganze aufzuklären.
Leider sind wir nach wie vor mit dem Kostendruck konfrontiert, auf den Kitwood hingewiesen hat. Dieser bedeutet, dass das Verhältnis von Personal zu Klienten alles andere als ideal ist. Hinzu kommt, dass die Ausbildung, die diejenigen erfahren, die für unsere Pflege zuständig sind, nicht immer hinreicht, um ein wirkliches Verständnis dessen herbeizuführen, was es bedeutet, mit Demenz zu leben und was getan werden kann, um uns zu unterstützen. Wichtig ist auch, dass unser geographischer Lebensort ebenfalls eine große Auswirkung auf die Art Pflege haben kann, die wir erhalten, wie auch auf die Art von Unterstützung, die diejenigen brauchen, die für uns sorgen.
Die vorliegende Aktualisierung von Kitwoods bahnbrechendem Werk anerkennt diese sich fortsetzenden Themen und wird dringend gebraucht, wenn wir eine bessere Pflege für Menschen mit Demenz einschließlich einer besseren Unterstützung unserer Familien und derjenigen erreichen wollen, die uns in Form bezahlter Arbeit unterstützen. Die Aufnahme der zum Nachdenken anregenden Punkte am Ende eines jeden Kommentars ermöglicht es Leserinnen und Lesern, mit Bedacht auf die Beiträge reagieren zu können. Hierdurch lässt sich das Buch sowohl in der Lehre als auch dafür nutzen, einer interessierten Leserschaft Anregungen zum Nachdenken über die Zukunft und darüber zu geben, wie sich jene Vision am besten in die Zukunft fortschreiben lässt, die ursprünglich von Kitwood auf den Weg gebracht wurde.
Kitwood hat Menschen mit Demenz als leiblich verankerte und relationale Wesen begriffen, die gut auf Ich-Du Verbindungen wie auch auf eine Pflegekultur ansprechen, die jedem Individuum in seiner Einzigartigkeit mit Respekt begegnet. So etwas wie eine typische Person mit Demenz gibt es nicht. Wir alle haben unsere je eigene Lebensgeschichte, Persönlichkeit und inneren Ressourcen, die wir heranziehen können, um den Herausforderungen dieses Zustands entgegenzutreten. Ich rechne auf eine Zukunft, in der unsere Kultur der Pflege von Menschen mit Demenz mitsamt der Unterstützung derjenigen, die Pflege erbringen, von dieser wichtigen Wiederaufnahme des Kitwood’schen Werkes geformt und geleitet, weiterhin besser wird.
In der Tat: Die Person muss und wird stets zuerst kommen.
Christine Bryden, PhD
Person mit Demenz, Autorin und Advokatin in Sachen Demenz
Adjunct Research Fellow am Public and Contextual Theology Centre, Charles Sturt Universität, Australien, April 2018
|23|Vorwort der Herausgeberin der englischsprachigen Ausgabe
Mehr als 20 Jahre ist es her, dass Tom Kitwoods Dementia Reconsidered: The Person comes first bei Open University Press veröffentlicht wurde. Im Feld der Demenzstudien (Dementia Studies) war dies ein bahnbrechender Text, der nach wie vor zitiert und als Kernlektüre zur person-zentrierten Pflege von Menschen mit Demenz empfohlen wird. Zweifellos haben die Ideen und die Theorieentwicklung in den neun Kapiteln des Buches die moderne Pflege wie auch die Demenzforschung geprägt. Tom starb unerwartet im Alter von 61 Jahren, nur zwölf Monate nach Erscheinen des Buches. Er sah Dementia Reconsidered als Werk, das die Schlüsselthemen verband, die ihn in seinem wissenschaftlichen Schreiben in den Jahren zuvor umgetrieben hatten. Wäre ihm ein Weiterleben vergönnt gewesen, hätte er zweifellos weiterhin reduktionistische Denkmuster von Demenz kritisiert, die in der ganzen Welt nach wie vor weite Teile der Programmatik, Forschung und Praxis beherrschen. Auch wenn es Tom nicht mehr möglich war, ganz unmittelbar zu den laufenden Debatten über person-zentrierte Pflege beizutragen, hat er doch viele der im Feld aktiven Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler inspiriert. Im Vergleich zur Welt von vor 20 Jahren ist die heutige ein deutlich anderer Ort und es ist an der Zeit, eine Ausgabe zu veröffentlichen, die einerseits die originären Kapitel abdruckt, aber auch zusätzliche Inhalte bietet, die das Buch auf ein zeitgenössisches Niveau hin aktualisieren. Ich habe Expertinnen und Experten ihrer jeweiligen Spezialgebiete dafür gewonnen, für jedes Kapitel einen Kommentar inklusive Kritik zu erstellen und Leserinnen und Leser auf den gegenwärtigen Stand von Forschung, Theorie und Praxis des jeweiligen Bereichs zu bringen. Der Originaltext enthielt auch eine Reihe von Photographien von Menschen, die mit Demenz leben. Diese haben wir durch einige von den Autorinnen und Autoren und von Cathy Greenblat zur Verfügung gestellten Bilder ersetzt, deren Photographien einiges dazu beigetragen haben, die stereotypen Sichtweisen von Menschen mit Demenz weltweit zu verändern. Alle, die ich angesprochen und um einen Beitrag gebeten habe, waren in ihrem Engagement dafür, dieses Buchprojekt anzugehen, einhellig bei der Sache.
Tom Kitwood war mein Mentor und Freund. Ich habe ihn erstmals 1988 auf einer Konferenz sprechen gehört; damals arbeitete ich als leitende klinische Psychologin für ältere Menschen des National Health Service (NHS) in Birmingham, UK. Es war eine Zeit, in der die emotionalen und psychologischen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz schlicht nicht berücksichtigt wurden. Als Tom über „maligne (bösartige) Sozialpsychologie“ und die „Dialektik der Demenz“ sprach, war dies, als hätte jemand ein helles Licht auf das Leben der Menschen geworfen, mit denen ich tagtäglich arbeitete. Ich und viele andere wie ich hörten Toms Worte und verschlangen die Folge von Zeitschriftenbeiträgen, die er in den dann folgenden zehn Jahren produzierte. Zum ersten Mal sahen wir, was wir tun konnten, um Menschen dabei zu helfen, mit Demenz zu leben. Die Forschung für meine Doktorarbeit wurde unter Toms Beratung abgeschlossen. Der Tag, an dem er mir ein Exemplar von Dementia Reconsidered geschenkt hat, und jener, an dem er gestorben ist, sind Er|24|innerungen, die mir für immer bleiben werden. Ich hatte das Glück, nach seinem Tod viele Jahre in der Bradford Dementia Group arbeiten zu können. Dort habe ich versucht, seinem Erbe die Treue zu halten und anderen auf der ganzen Welt zu helfen, an sein visionäres Werk anzuknüpfen.
Wie auch meine Mitbeitragenden hoffe ich, dass Sie es ebenso genießen werden, dieses Buch zu lesen, wie wir genossen haben, es zu schreiben. Es sollte für Leserinnen und Leser, die mit dem ursprünglichen Text vertraut sind, ebenso von Interesse sein wie für solche, die sich vielleicht erstmals mit ihm befassen, aber sichergehen wollen, sich ein zeitgemäßes Verständnis der Themen anzueignen, die Kitwood aufgeworfen hat. Das Buch ist eine großartige Möglichkeit, die Erinnerung an Tom in Ehren zu halten und zugleich seine Ideen für die nächste Generation von Impulsgebern und treibenden Kräften auf den aktuellen Stand zu bringen.
Dawn Brooker
|25|Danksagung der Herausgeberin
Meine Dankbarkeit möchte ich all denen zum Ausdruck bringen, die mir Hilfe, Kritik, Feedback, Rat und Unterstützung gewährt haben, vor allem Elizabeth Barnett, Errollyn Bruce, Sean Buckland, Brenda Bowe, Andrea Capstick, David Coates, Joan Costello, Linda Fox, Brian Gearing, Buzz Loveday, Tracy Petre, Bob Woods, und John Wattis. Mein Dank geht auch an Chris Bowers, der die Grafiken besorgte, und an Jo Daniels, die sich um alle abschließenden Schreibarbeiten kümmerte.
Die Fotografien wurden von der The Grange Day Unit, Sunderland, von den Methodist Homes for the Aged, von der Darnall Dementia Group in Sheffield und von Paul Schatzberger zur Verfügung gestellt.
|27|Einleitung
Tom Kitwood
In der Welt der Natur gibt es manche Fluten, die dramatisch steigen: Die See ist ein Aufruhr gigantischer Wellen, die Klippen erzittern, und Schaum fliegt hoch empor. Andere Fluten steigen still, über Kilometer von Schlamm und Sand leise vorankriechend, und verursachen keine erkennbare Störung. Obwohl ihr Vordringen kaum wahrgenommen wird, sind sie nichtsdestoweniger mächtig und nachhaltig. So ist es auch mit den Fluten, die den Verlauf der Menschheitsgeschichte verändern.
Die steigende Flut von Demenz ist von der letztgenannten, stillen Art.27 Seit vielen Jahren steigt die Prävalenz nun schon langsam, aber stetig an und wird dies wahrscheinlich auch in Zukunft noch viele Jahre tun. Demenz ist primär ein Merkmal der industrialisierten Gesellschaften, wo das Bevölkerungsprofil während der vergangenen 100 Jahre immensen Veränderungen unterworfen war, in deren Verlauf der Anteil an Menschen höherer Altersgruppen erheblich zunahm. Viele Regionen der Welt, die früher „unentwickelt“ waren, durchlaufen zurzeit eine ähnliche demographische Verschiebung und werden zum gegebenen Zeitpunkt wahrscheinlich einer der unsrigen sehr ähnlichen Situation gegenüberstehen. Das Problem ist von enormer Tragweite. Allein in Großbritannien gehen die meisten Schätzungen davon aus, dass die Anzahl der Betroffenen zwischen 500 000 und 1 Million liegt. Unter Umständen erweist sich die Demenz als das bedeutsamste epidemiologische Merkmal des beginnenden 21. Jahrhunderts. Ihre Präsenz wird tiefgreifende und anhaltende Auswirkungen auf das gesamte Gefüge unseres politischen, ökonomischen und sozialen Lebens haben – zum Guten oder zum Schlechten.
Wie müssen wir Demenz verstehen und damit eine passende Antwort darauf finden? Heutzutage wird sie überwiegend als „organisch bedingte psychische Erkrankung“ hingestellt, und ein medizinisches Modell, das ich als Standardparadigma bezeichnen werde, hat sich als vorherrschend erwiesen. Nach den großen neuropathologischen Untersuchungen der sechziger Jahre schien es, als sei der Nachweis einer Organizität derart überwältigend, dass es einer „technischen“ Herangehensweise an das Problem bedurfte, und zwar im Wesentlichen, um die pathologischen Prozesse zu erhellen und dann Wege zu finden, um sie zum Stillstand zu bringen oder zu verhindern. Die Psychiatrie tendierte von da an zu einem eher enggefassten Umgang mit Demenz, bei dem oft die größeren menschlichen Themen ignoriert wurden, und andere mit der Medizin verbundene Disziplinen schlossen sich dem an.
Wie wir sehen werden, gibt es eine Menge Probleme mit dem Standardparadigma. Unser heutiges Bild des Nervensystems ist weitaus komplexer als das, welches jenem Paradigma zugrunde gelegt wurde. Vor allem gilt das Gehirn heute als ein Organ, das zu einer kontinuierlichen strukturellen Adaptation in der Lage ist; seine Schaltkreise sind nicht statisch, wie in einem Computer, sondern dynamisch und verändern sich langsam entsprechend den Anforderungen der Umgebung. Auch aus der |28|Pflegepraxis ergeben sich Hinweise, die eine Herausforderung für das Standardparadigma bilden: Es ist heute klar, dass die früheren, extrem negativen und deterministischen Ansichten über den Prozess der Demenz nicht richtig waren. Natürlich lässt sich ein Paradigma über nahezu unbegrenzte Zeit hinweg „retten“, etwa durch subtile Neudefinitionen, dadurch, dass gewisse Fakten vernachlässigt und andere hervorgehoben werden oder gar durch schlichtes Unterdrücken widersprechender Ansichten. Die Wissenschaftsgeschichte scheint indessen zu zeigen, dass sich in dem Moment, wo die Ungereimtheiten allzu offensichtlich aufscheinen, jemand findet, der die Probleme auf andere Weise darzustellen versucht: Die Zeit für ein neues Paradigma ist gekommen.
Das Hauptziel dieses Buches besteht demnach darin, die Herausforderung anzunehmen und ein Paradigma vorzustellen, in dem die Person an erster Stelle steht. Es bietet ein reicheres Spektrum an Fakten und Belegen als das medizinische Modell und löst einige von dessen gravierendsten Ungereimtheiten. Außerdem bietet es die logische Grundlage für einen Pflegeansatz, bei dem viel mehr auf menschliche als auf medizinische Lösungen geachtet wird. Viele Menschen haben intuitiv ihren eigenen Weg zu solch einem Ansatz gefunden, und langsam entsteht eine neue Demenzpflegekultur.
Mein eigener erster Kontakt mit Demenz fand im Jahre 1975 statt. Durch Zufall war meine Frau im örtlichen Supermarkt einer gebrechlichen alten Dame um die 70 begegnet und hatte ihr bei der Auswahl eines Schmerzmittels geholfen. Es stellte sich heraus, dass sie nur 2 Kilometer entfernt wohnte, und an jenem Tag brachte meine Frau sie nach Hause. Nach und nach wurde Frau E., wie wir sie allmählich nannten, zu einer Freundin. Wir wussten, dass sie sich hin und wieder einsam und traurig fühlte, aber sie war eine ausgezeichnete Gesellschafterin, sehr gastfreundlich und liebte Kinder. Mit der Zeit fanden wir ein wenig über ihr Leben heraus. Sie war seit über 10 Jahren verwitwet und lebte allein. Ihr Haus, das der Gemeinde gehörte, hatte einst einen Blick über Felder und Ackerland gehabt, heute stand da eine große Wohnanlage, die für ihr raues soziales Klima berüchtigt war. Während ihrer Ehe und noch einige Zeit danach hatte sie als Schneiderin gearbeitet, und in einem Raum ihres Hauses stand noch immer die Nähmaschine. Sie war kinderlos und ihre nächste Verwandte war eine Nichte, die rund 150 Kilometer entfernt wohnte. Frau E. war katholisch und früher eine regelmäßige Kirchgängerin gewesen. Inzwischen besuchte sie den Gottesdienst seltener, aber der Priester kam regelmäßig zu Besuch bei ihr vorbei. Gelegentlich hatten wir den Eindruck, sie könnte vielleicht nicht genug zu Essen bekommen, jedoch geschähe dies dann eher aus Nachlässigkeit oder Vergesslichkeit als aus Gründen der Armut. Manchmal boten wir ihr ein informelles „Essen-auf-Rädern“, indem wir ihr eine Portion der für unsere Familie zubereiteten Mahlzeit vorbeibrachten.
Das letzte Mal, das ich mit Frau E. als der Person zusammen war, die ich kennengelernt hatte, war der Ostersonntag 1979. Sie kam zum Mittagessen zu uns, und anschließend wuschen wir ab. Es war ein klarer, kalter Tag und die Osterglocken leuchteten im Wind, wir waren beide guter Laune und sangen. Eines der Lieder, das sie selbst aussuchte, stammte von den „Seekers“, und sein Refrain lautete: „Der Karneval ist vorbei, und wir werden uns nie wiedersehen.“
Dieses Lied erwies sich als tragische Vorahnung, denn ein paar Monate später befand sich Frau E. in einer Einrichtung, um nie wiederzukehren. Erst später fand ich nach und nach heraus, was geschehen war. Scheinbar war sie in ihrem eigenen Zuhause unsicher geworden und wenigstens einmal ins Feuer gefallen. Außerdem hatte man sie dabei beobachtet, wie sie nachts durch die Straßen wanderte. Mitglieder ihrer Kirchengemeinde hatten zu helfen versucht, aber ein Sozialarbeiter war hinzugezogen worden, und man hatte Kontakt zu Frau E.’s Nichte aufgenommen. Eines Tages kamen die |29|Nichte und ihr Mann bei „Tantchen“ vorbei, um sie zu besuchen, wie sie es oft getan hatten. Sie sagten, sie würden sie auf eine Spazierfahrt mitnehmen, aber diesmal endete der Ausflug in der örtlichen Psychiatrie, wo sie zur Begutachtung aufgenommen wurde. Nach kurzem Klinikaufenthalt wurde Frau E. in eine Einrichtung des Sozialdienstes (Social Services Home) eingewiesen. Es war ein riesiges Gebäude aus geschwärztem Stein, das an einem öden Hang in Bradford lag. Als ich sie besuchte, war ich entsetzt über die Veränderung, und sie schien mich überhaupt nicht zu erkennen. Ich blieb nicht lang. Ich dachte, es hätte keinen Zweck, wo sie doch jetzt so offensichtlich „senil“ geworden war. Zu meiner Schande war dies mein einziger Besuch, nachdem sie von zuhause weggebracht worden war. Frau E. starb ein paar Monate darauf. Ich war überrascht, wie viele Menschen zu ihrer Beerdigung kamen.
Zu der Zeit, als Frau E. zu meinen Bekannten zählte, arbeitete ich als Psychologe an der Universität, versagte jedoch gänzlich darin, mein berufliches Wissen zu ihren Gunsten anzuwenden. Ich nahm einfach die Vorstellung als gegeben hin, dass manche Menschen eben „senil“ werden und dann außer der Befriedigung körperlicher Grundbedürfnisse nicht mehr das Geringste für sie getan werden könne. Es kam mir nicht einmal in den Sinn, meine Vorstellungskraft auf den Versuch eines Verständnisses dessen zu verwenden, was Frau E. da erleben könnte, oder meine Kreativität zu nutzen, um einen neuen Weg der Kommunikation zu bahnen. Wie viele andere Menschen damals und heute stand ich völlig unter dem Einfluss der vorherrschenden Sichtweise: Demenz ist ein „Tod, der den Körper zurücklässt“.
Einige Zeit später, im Jahre 1985, begann ich mit und für Menschen mit Demenz zu arbeiten. Dabei ging die Initiative zunächst nicht von mir aus: Ein Psychiater und ein klinischer Psychologe baten mich, ihr „Doktorvater“ zu sein. Ich konnte ihnen eine allgemeine Anleitung in Forschungsmethoden bieten und ihren Ideen ein geneigtes, aber dennoch kritisches Ohr leihen, besaß jedoch kein substantielles Wissen auf ihrem Gebiet. Dies alles änderte sich allerdings sehr bald, und ich sah mich zunehmend in ihre Arbeit hineingezogen. Ich wurde Mitglied der „Alzheimer Disease Society“ und begann, die monatlichen Treffen der Ortsgruppe zu besuchen. Außerdem begann ich, bei einem kleinen kommunalen Fürsorgeprogramm mitzuwirken. Ich stellte fest, dass ich Menschen mit Demenz mag. Oft bewunderte ich ihren Mut. Ich spürte, dass ich etwas von ihrer Zwangslage verstand, und bisweilen entdeckte ich, dass ich mit ihnen auf scheinbar fruchtbare Weise interagieren konnte. Zu den weiteren Unternehmungen gehörten die Mithilfe bei der Unterstützung Betreuender sowie das allmähliche Nachvollziehen von Lebensgeschichten anhand ausgedehnter Interviews mit Angehörigen.
Mit zunehmendem Eingebundensein begegnete ich mehreren wirklich ausgezeichneten Pflegepraktikern und freundete mich mit ihnen an. Zunächst durch sie und später aufgrund meiner eigenen unmittelbaren Erfahrung gelangte ich zu der Ansicht, dass viel mehr getan werden könne, um Menschen mit Demenz zu helfen, als allgemein angenommen wurde. Je mehr ich mich in die psychiatrische Literatur zur Demenz einlas, wurde ich darüber hinaus immer skeptischer gegenüber vielen Sichtweisen. Ich begann mich zu fragen, ob nicht wenigstens einige der Symptome, die gewöhnlich beobachtet werden, eher auf ein Versagen im Verständnis und in der Pflege als auf ein strukturelles Versagen des Gehirns zurückzuführen sein könnten. Ich entdeckte, dass einige Wenige in der Tat in diesem Sinne publiziert hatten, ihre Arbeiten jedoch im Allgemeinen mit Vorbehalt aufgenommen oder vernachlässigt wurden.
Frisch aus einem anderen Arbeitsbereich der Psychologie gekommen und mit Beratung, Psychotherapie und moralischer Entwicklung befasst, war ich oft schockiert über die Art, in der Menschen mit Demenz herabgewürdigt und missachtet wurden. Eine meiner ersten Untersuchungen bestand in der Dokumentation der |30|verschiedenen Weisen, in denen persönliche Wesenheit oder das Personsein untergraben wurde; ich nannte dies provokant die „maligne, bösartige Sozialpsychologie“, die die Demenz umgibt. Es war überraschend festzustellen, dass tatsächlich weder in der Praxis noch in der Literatur irgendein Versuch unternommen wurde, die Subjektivität von Demenz zu verstehen. Unter der äußerst fadenscheinigen Begründung, man habe es hier mit einer „organisch bedingten psychischen Erkrankung“ zu tun, war darüber hinaus auch eine Untersuchung zwischenmenschlicher Prozesse irgendwie verboten. Ich wollte die Formulierung „Die Sozialpsychologie der Demenz“ verwenden; indessen schien dies vor 10 Jahren fast Blasphemie. Bisweilen fühlte ich mich sehr ängstlich, beinahe schuldig, wenn ich meine versuchsweisen Vorstellungen vorbrachte. Als ich dann den Begriff des „rementing“, der Wiederherstellung personaler, darunter auch geistiger Funktionen aufbrachte, den viele inzwischen akzeptiert haben, war dies nahezu Häresie.
Mit der Weiterentwicklung und Vertiefung meiner Arbeit kam ich immer stärker mit den Einzelheiten der Pflege von Menschen mit Demenz in Berührung, wobei ich vor allem Vorstellungen und Praktiken aus der psychotherapeutischen Arbeit heranzog, bei der der Schwerpunkt auf der Authentizität in Kontakt und Kommunikation liegt. Viele Menschen brachten wirklich wertvolle Innovationen in die Pflegepraxis ein, jedoch war ich davon überzeugt, dass das volle Spektrum der Möglichkeiten zur Steigerung des Wohlbefindens noch nicht zur Gänze erwogen worden war. Da vieles von der guten Arbeit, die geleistet wurde, außerdem keine kohärente theoretische Grundlage hatte, fehlte ihm die allgemeine Glaubwürdigkeit. Meine Kollegin Kathleen Bredin und ich versuchten, einige der Fragmente zusammenzufügen. Der Psychotherapie nach Rogers folgend nannten wir den gesamten Ansatz „person-centred care“ (person-zentrierte Pflege). Einige der Grundlagen finden sich in unserem Büchlein „Person to Person: A Guide to the Care of Those with Failing Mental Powers“ (Kitwood & Bredin, 1992c). Die Theorie und die empirischen Grundlagen wurden detailliert in einer Reihe von Veröffentlichungen zwischen den Jahren 1987 und 1995 dargelegt, die sich allesamt in der Bibliographie zu diesem Buch finden. Unsere Forschungen zu dieser Zeit führten zur Bildung der Bradford Dementia Group, deren zentrales Anliegen in der Entwicklung einer person-zentrierten Pflege besteht.
Eine unserer wichtigsten Innovationen war eine neue Methode zur Evaluation der Pflegequalität in formellen Settings, die wir Dementia Care Mapping (DCM) nannten. Es beruht unter Anwendung einer Kombination von Empathie und Beobachtungsgabe auf dem ernsthaften Versuch, den Standpunkt der dementen Person einzunehmen. Die DCM-Methode hat sich als enorm interessant erwiesen, wie sich daran zeigt, dass das Handbuch inzwischen in die 7. Auflage gegangen ist. Die besonderen Stärken des Verfahrens scheinen in der Art, in der der aktuelle Pflegeprozess beleuchtet wird, sowie in der Aufmerksamkeit, die der „Entwicklungsschleife“, d. h. einer Denk- bzw. Diskussionspause zur Entwicklung eines gemeinsamen Plans (developmental loop), für das Bewirken von Verbesserungen gewidmet wird, zu liegen. Es bildet daher eine mächtige, sehr positive Herausforderung für jede Organisation, die an der Pflege von Menschen mit Demenz beteiligt ist.
Das Konzept der person-zentrierten Pflege lässt sich in jedem Kontext anwenden, es ist nicht nur eine Angelegenheit formeller Settings, z. B. der stationären und teilstationären Pflege. In all der Zeit, in der ich mich mit Demenz beschäftige, habe ich mitgeholfen, pflegende Angehörige bei ihrer nahezu übermenschlichen Aufgabe zu unterstützen. Dabei war ich tief beeindruckt von ihrem Mut, ihrem Humor und ihrer vollkommenen Zielgerichtetheit sowie von ihrer Fähigkeit, anderen in vergleichbarer Situation Freundschaft und Ermutigung zukommen zu lassen. In den vergangenen Jahren hat die Bradford Dementia Group zur Unterstützung Betreuender ein strukturier|31|tes Programm mit einem umschriebenen Maßnahmenkatalog und genauer Betrachtung des Prozesses entwickelt. Vor kurzem haben wir die Vorbereitung der Materialien abgeschlossen und damit begonnen, andere darin zu unterweisen, wie sie ein solches Programm für Betreuende in ihrer eigenen Gemeinde unterhalten können. Forschung und Entwicklung dieser Art war ein zentraler Punkt unserer Arbeit.
Wie viele andere entdeckte ich, dass die intensive Beschäftigung mit dementen Menschen und den sie Betreuenden hohe emotionale Anforderungen stellt. Da gibt es ein hohes Maß an Angst und Leid, und manchmal glaubt man, in einem ungeheuren Sumpf unbefriedigter Bedürftigkeit zu versinken. Es gab mehrere Punkte, an denen ich mich sehr mutlos fühlte und aufzugeben bereit war. Heute glaube ich, dass ich allmählich meinen eigenen Ängsten gegenüber dem Altern und der Entwicklung einer Demenz ins Auge zu sehen und mich hindurchzuarbeiten begann. Außerdem wurde mir klar, dass ich auf eine geradezu perverse Art entschlossen war, diesem Arbeitsgebiet verbunden zu bleiben. Solcher Art waren meine ersten dunklen Ahnungen von dem, was wir heute in der Bradford Dementia Group die „Tiefenpsychologie der Pflege von Menschen mit Demenz“ nennen: die unbewussten Formen der Abwehr, die Zwänge und die zwischenmenschlichen Prozesse, die dieses Arbeitsgebiet durchziehen.
Alle bis dahin erwähnten Themen wurden in das Buch aufgenommen, das folgendermaßen aufgebaut ist: Wir beginnen mit der Betrachtung des gedanklichen Konzepts, das die gesamte Diskussion in sich vereint, nämlich dem des Personseins, und untersuchen seine ethische, sozialpsychologische und neurologische Bedeutung. Kapitel 2 gibt eine kurze Übersicht dessen, was über die Natur der Demenz und ihrer Begleiterkrankungen bekannt ist. Hier befinden wir uns überwiegend auf dem Standardterrain der Psychiatrie, und ich stelle einige der Schwierigkeiten und inneren logischen Brüche der Art des medizinischen Modells heraus, das in einfache Lehrbücher Eingang findet. In Kapitel 3





























