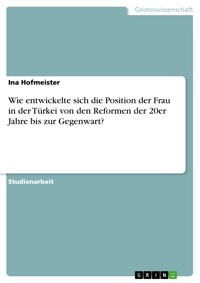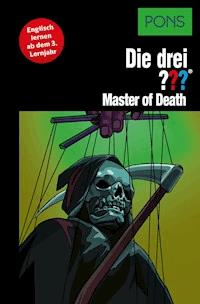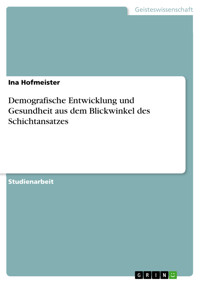
Demografische Entwicklung und Gesundheit aus dem Blickwinkel des Schichtansatzes E-Book
Ina Hofmeister
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Sozialwissenschaften allgemein, , Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der demografischen Entwicklung der Gesundheit in der Bundesrepublik Deutschland aus dem Blickwinkel des Schichtansatzes. Aus dem Titel resultiert die Fragestellung, ob theoretische Schichtansätze die gesellschaftlichen Ungleichheiten mit Hilfe demografischer Tendenzen hinsichtlich der Gesundheit der Bevölkerung praxisrelevanter bestimmen können? Das Ziel der Ausführungen besteht darin, anhand der Methodik der Schichttheorien zu erfahren, wie sich Lebenslagen im Rahmen einer sozialwissenschaftlichen Sichtweise durch die Betrachtung der Ungleichheiten in Schichten differenzieren und inwiefern sich in Verbindung mit dem Instrument der Demografie die gesundheitliche Situation der sozialen Gruppen in Hinblick auf die Wirkungsweise einiger ausgewählter sozioökonomischen Faktoren bewerten lässt. Das Vorgehen unter Verwendung von demoskopisch ermittelten Daten verdeutlicht den tatsächlichen Stellenwert, den die Gesundheit für den sozialen Status einer Person einnimmt. (Vgl. Kap. 3) Der Schichtansatz beleuchtet die sozialen Aspekte des Lebens, auch unter dem Gesichtspunkt der Wertung materieller Einflüsse, und bestimmt die soziale Positionierung der Menschen durch die eher subjektiv erscheinende Einordnung in Schichten. (Vgl. Kap. 2) Die Verbesserungen und Ergänzungen der schichttheoretischen Ansätze durch bekannte Soziologen führen zwar zu einer Weiterentwicklung der Schichtkonzepte, zeigen aber auch die Grenzen der theoretischen Dimension im Bereich der ausschließlichen Differenzierung zwischen den jeweiligen Schichten, man spricht in diesem Zusammenhang von einer vertikalen Differenzierung. Diese Darstellung bedeutet keineswegs, dass der Schichtansatz defizitär ist, bestätigt aber, dass eine Forderung nach erweiterten Denkmodellen besteht, mit deren Unterstützung die sozialen Erfordernisse einer dynamischen, sich fortwährend wandelnden Gesellschaft in Deutschland umfassender dargestellt und abgebildet werden kann. (Vgl. Kap. 4) Auf die Wiedergabe von Tabellen und Grafiken wird zu Gunsten der Textressourcen verzichtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Schichtansatz, Demografie und Gesundheit
2. Theoretischer Ansatz der Schichtmodelle
2.1 Der Schichtmodellansatz von Geiger
2.2 Der Modellansatz nach Dahrendorf
2.3 Die Schichttheorie nach Geißler
3. Der Zusammenhang zwischen Demografie und Gesundheit
3.1 Gesundheit und Einkommen
3.2 Gesundheit und Bildung
3.3 Gesundheit und Arbeit
4. Demografische Unterschiede der Gesundheit aus schichttheoretischer Perspektive
Literaturverzeichnis
1. Schichtansatz, Demografie und Gesundheit
2. Theoretischer Ansatz der Schichtmodelle
Es ist interessant, zu erfahren, aus welchen sozialen Gruppen sich bestimmte Merkmale für die demografische Entwicklung, auch bezüglich der Gesundheit, ableiten lassen. Bevor man auf die Erörterung dieser Zusammenhänge eingehen kann, bereitet eine Darstellung einiger ausgewählter Bezugskonzepte zur Schichtentheorie die Voraussetzung für die Bildung einer Verbindung zu den Parametern demografische Entwicklung und Gesundheit vor.
Burzan beschreibt, dass die Schichtenmodelle als Ausgangsbasis der Betrachtung auf ungleiche Lebensbedingungen und dadurch bedingt ungleiche Lebenschancen Bezug nehmen. (vgl. Burzan, 2005, S. 71 ff.) Sie geht davon aus, dass die Zugehörigkeit zu einer Schicht sowohl die Einstellung als auch das Verhalten von Menschen beeinflusst. Es ist sicherlich nicht das Ziel von Schichtansätzen, stereotypische Verhaltensweisen in definierte Schichten zu beschreiben, eine Bezugnahme zu einer bestimmten Handlungsorientierung lässt sich allerdings nicht verwerfen. Eine weitere Grundannahme beschreibt, dass sich Schichten untereinander nicht gegensätzlich verhalten müssen. Aus dieser Annahme kann man schlussfolgern, dass sich die Schichten als porös erweisen, das bedeutet, dass sich beispielsweise aufgrund von Heirat, Beruf oder Einkommen eine, wenn man es so ausdrücken möchte, beidseitige Durchlässigkeit in den Bereich umgebender Schichten ergeben kann.
Die Schichtmodelle verfolgen also den Ansatz, die komplizierten Zusammenhänge der sozialen Ungleichheit zu ordnen und einzuteilen, sie bilden sozusagen die Komplexität der Realität modellhaft ab. Stellvertretend für die Schichttheorien stellen sich hier zentrale Ansätze von Geiger, Dahrendorf und Geißler vor.
2.1 Der Schichtmodellansatz von Geiger
Geiger gilt zeitlich früher als Dahrendorf als Vertreter der klassischen Schichtmodelle. Er versteht den Terminus „Schicht“ im soziologischen Sinn als Begriff der Untersuchung vom Zusammenhang der sozialen Strukturen, wobei er von einer sozialen Ungleichheit ausgeht. (Vgl. Burzan, 2005, S. 26 ff.)
Die Bezeichnung „Schicht“ wird bei Geiger als Oberbegriff für die Beschreibung einer bestimmten sozialen Lage hinsichtlich der Kennzeichnung der Sozialstruktur einer Gesellschaft eingesetzt. Er differenziert zwischen dem objektiven und dem subjektiven Schichtbegriff. Der objektive Schichtbegriff bezieht sich auf die äußeren Kennzeichen der sozialen Situation wie die Einkünfte, Besitz und Qualifikation, Geiger nennt diese auch objektive Schichtdeterminanten, der subjektive Schichtbegriff beschreibt eine gemeinsame Geisteshaltung als psychische Verfassung aller an einer Schicht Beteiligten, die keine Bindung an Charakteristika oder Eigenschaften der sozialen Lage darstellt. (Vgl. Geißler, 2010, S. 37) Die in der Terminologie von Geiger genannten gemischten Begriffe stellen eine Bindung hinsichtlich der Lage und der Haltung her. Durch die getrennte Aufnahme von Lagen und Haltungen und dem nachträglichen Vergleich der Verteilung von Lagen und Haltungen erkennt er bestimmte Haltungen als allgemeingültig in bestimmten Lagen. Diese Haltungen nennt man Mentalität und teilt sie einer Schicht, bedingt durch den nachträglichen Vergleich, retrospektiv zu. (Vgl. Burzan, 2005, S.26 ff.)
Der Leitgedanke von Geiger lässt sich in der Aussage darstellen, dass soziale Schichten einer erkennbaren Prägung durch gemeinsame Haltungen, hier als normaltypische Mentalität definiert, unterliegen. Diese aus gemeinsamer Mentalität resultierende Prägung bezieht sich auf die Mitglieder einer sozialen Schicht und ist übertragbar auf die Lebenswelt und auf die Lebensgewohnheiten der Menschen, die der Schicht zugeordnet sind. Dieser Gedanke hat auch durchaus Auswirkungen auf ökonomische Handlungen von sozialen Individuen in Bezug auf Konsumgewohnheiten und inkludiert auch das Verhältnis zur Gesundheit.
Zum besseren Verständnis erfolgt die Darstellung des Fünf-Schichten-Modells, mit dessen Hilfe Geiger den Versuch unternimmt, die Daten der Volkszählung von 1925 in Hinblick auf eine soziale Schichtung des deutschen Volks zu untersuchen: (Vgl. Burzan, 2005, S. 29)
-Kapitalisten – 0,9% der Berufszugehörigen
-Alter Mittelstand (mittlere und kleine Unternehmer) – 17,8% der Berufszugehörigen
-Neuer Mittelstand (Lohn- und Gehaltsbezieher mit höherer Qualifikation) – 17,9% der Berufszugehörigen
-Proletaroide (Tagewerker auf eigene Rechnung) – 12,7% der Berufszugehörigen