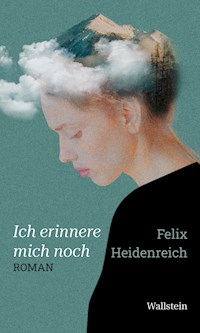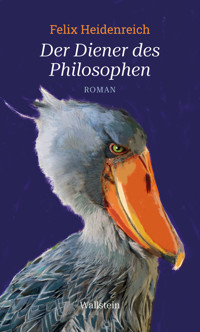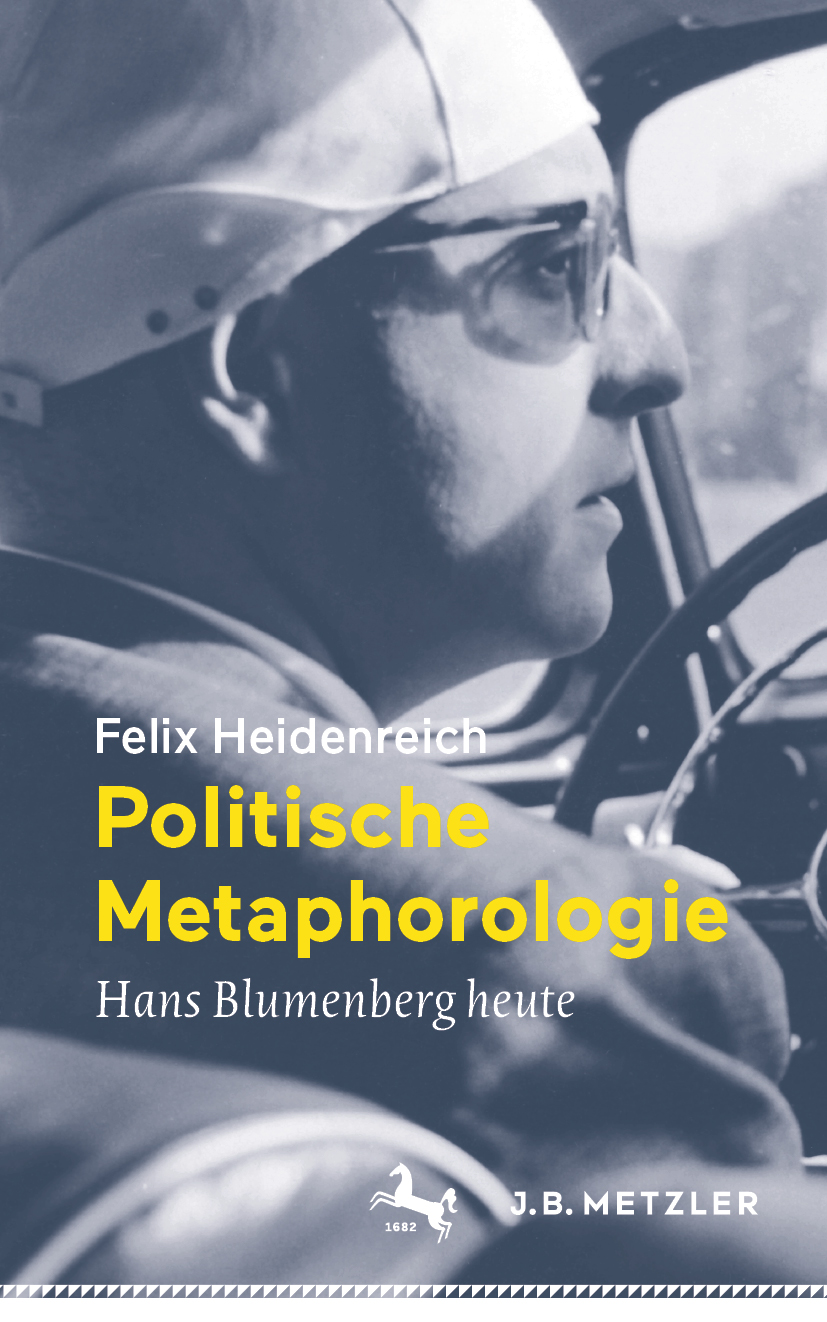18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Demokratien brauchen aktive Demokraten. Beteiligung an politischen Entscheidungen war in der Antike in Athen Privileg und Pflicht. Spricht man Bürgerinnen und Bürger angemessen und nicht als schonbedürftige Kinder oder nutzenmaximierende Konsumenten an, werden aus Privileg und Pflicht Verantwortung. Diese andere Bürgerlichkeit mag eine Zumutung sein. Sie macht vor allem: Mut auf mehr und Mut auf die selbst mitgestaltete Zukunft. Die Demokratie wird angegriffen. Aber die Verteidigungsfront verläuft nicht nur in der Ukraine, in Hong Kong, Taiwan, Afghanistan. Nicht nur äußere Feind bedrohen die Freiheit, sondern auch eine Erosion demokratischer Haltungen und Gewohnheiten. Eigentlich handelt es sich aber um eine tiefe Entfremdung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den Repräsentanten Ihres Staates. Während die Menschen in der Ukraine einen Heroismus zeigen, der uns fremd geworden ist, fragen wir uns, was uns das Leben in der Demokratie wert ist? Felix Heidenreich zeigt in seinem Buch vor, dass die demokratische Selbstregierung immer auch eine Zumutung war. Dabei geht es nicht nur um die einfache Erfüllung von Pflichten. Erst als Antwort auf eine angemessene Ansprache werden die Menschen zu Bürgerinnen und Bürgern in einem starken Sinne, zu citoyens, die Politik nicht wie nörgelnde Kinder konsumieren, sondern verantwortlich mitgestalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Felix Heidenreich
Demokratie als Zumutung
Für eine andere Bürgerlichkeit
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburgunter Verwendung einer Abbildung von Shutterstock/SFC
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98079-0
E-Book ISBN 978-3-608-11925-1
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
1
Einleitung: Zeitenwende
Die autoritäre Herausforderung – die Feinde der Demokratie
Mögliche Erklärungen: Die große Entfremdung
Wege aus der Entfremdung
Zum Aufbau des Buches
2
Krisendiagnosen im Vergleich
Die Anfeindung von innen
Zwei Hauptstraßen, viele Nebenwege
An jeder Ecke stehen Menschen, deren Meinung uns gefällt
Krise oder Syndrom?
Die latente und die eskalierende Krise
Distanzrepräsentation: Entfremdung ist nicht nur schlecht
Angriffe von außen: Das Ende der Feindlosigkeit
Suchrichtung, nicht Antwort
3
»Angebote machen« – Demokratie als Konsum
Eine singularisierte Wählerschaft?
Neue Input-Kanäle
Aporien demokratischer Angebotspolitik
Beteiligung als Konsum
4
Die falsche Ansprache
Ökonomisierung:
liefern
Emotionalisierung: Das Bauchgefühl
Welche Furcht wem zumuten?
Infantisilierung: der große Spaß
Infantilisierung und Pädagogisierung
Rollen spielen – und zugleich ernst nehmen
Die Rolle des Bürgers und der Bürgerin
5
Eine Demokratie, die in Anspruch nimmt
Haben wir Identitäten oder Erfahrungen?
Erfahrungen statt Identität
Die maximale Zumutung
Der Körper als absolute Grenze
Von Churchill zur Gegenwart
Republik von Venedig: Arsenale
The New Republic:
Die USA als neues Rom
6
Eine andere Bürgerlichkeit
Institutionen statt Personen
Der Bürger und der
citoyen
Was ist eine citoyenne, was ein citoyen?
Der Mensch antwortet: Responsive Subjekte
Von Lévinas über Althusser zu uns
Das
Ego
des
Cogito
als responsives Wesen
Von Lévinas zur Subjektivierung
Was genau bedeutet es, in Anspruch genommen zu werden?
Inner life? Von Monty Python’s merchant banker zu Trump
Wo und wie entstehen Bürgerinnen und Bürger?
Was ist »soziales Kapital«?
Die normativen Grundlagen des demokratischen Staates
Politik der Zumutung: Mit Haut und Haaren
7
Vom Wehrdienst zum Bürgerdienst
Die USA und ihre
Army
Frankreich: Die
Levée en masse
und die
grande armée
Die Armee als Egalisierungsmaschine
Der »andere Machiavelli« – die Bürgerarmee
Bürgerdienste – noch einmal: Die Schweiz
Sanitäter mit »Stichwesten« – oder lieber Pflichtfeuerwehr?
Hand- und Spanndienste: Deutsche Traditionen
Die dunkle Seite: Bürgerwehren
Tsahal – Die israelische Armee
Die Utopie der Universal Army
8
Wahlpflicht: Entscheiden als Zumutung
Das Hochamt der Demokratie
Antreten zum Wählen!
Wahlen als Instrument der Disziplinierung
Wahlpflicht – einige Beispiele
Die »Stimmpflicht«
Was bewirkt eine Wahlpflicht?
9
Einberufung in einen Bürgerrat durch Los
Die athenische Praxis
Die Landsgemeinde von Glarus
Per Los in den Bürgerrat
Welche Rolle für Bürgerräte?
10
Gemeinsam urteilen: Schöffen
»Die zwölf Geschworenen« als Demokratiedrama
Was genau leisten Schöffen?
»Unser« Rechtsstaat?
11
Politische Bildung: Subjektivierung in der Schule
Eine andere Perspektive auf Bildung: In Anspruch nehmen
Demokratie als Lerngemeinschaft
Condorcet: Demokratie als Bildungsprojekt
Die Rolle der Musik bei Aristoteles
Der »Schuldienst« im weitesten Sinne
12
Zumutung konkret: Ein Gedankenexperiment
Die Ebene der Gemeinden: Vom Putztag zur Pflichtfeuerwehr
Die Landesebene: Regionale Zugehörigkeit
Der Bund: Über Bufdis und ihre Verallgemeinerbarkeit
Europa dienen – ist das denkbar?
Wo machst Du Deinen Bürgertag?
13
Ausblick: Freiheit und Beteiligung
Noch einmal: »Zeitenwende«
Pervertierung von Freiheit
Die Grenzen der individuellen Freiheit
Passivitätskompetenz: Sich bestimmen lassen
Die Zumutungen der Freiheit
Nachwort
Anhang
Anmerkungen
Einleitung: Zeitenwende
Krisendiagnosen im Vergleich
»Angebote machen« – Demokratie als Konsum
Die falsche Ansprache
Eine Demokratie, die in Anspruch nimmt
Eine andere Bürgerlichkeit
Vom Wehrdienst zum Bürgerdienst
Wahlpflicht: Entscheiden als Zumutung
Einberufung in einen Bürgerrat durch Los
Gemeinsam urteilen: Schöffen
Politische Bildung: Subjektivierung in der Schule
Zumutung konkret: Ein Gedankenexperiment
Ausblick: Freiheit und Beteiligung
Literaturverzeichnis
Register
Bildnachweis
1
Einleitung: Zeitenwende
Der 24. Februar 2022. Um 4.30 Uhr werden die ersten Angriffe auf die Ukraine(1) gemeldet. Die Russische(1) Föderation attackiert einen souveränen Staat aus mehreren Richtungen. Cyberangriffe gab es schon in den Tagen zuvor, nun aber werden Luftangriffe und Raketenbeschuss gemeldet. Mehrere Grenzposten werden überrannt, Panzer überqueren die Grenze. Der ukrainische(2) Präsident Wolodymyr Selenskyj(1) ruft den Kriegszustand aus. Schon bald sind die Ausfallstraßen von Kiew(1) verstopft. Es war schon vorher Krieg in Europa, in der Ostukraine(1), aber jetzt geht es plötzlich um einen großen, um einen offenen Krieg gegen ein ganzes Land, um einen Krieg zwischen Staaten, nicht zwischen einem Staat und selbsternannten »Volkrepubliken«, in denen Räuberbanden regieren.
Katastrophen werden nicht dadurch weniger schockierend, dass sie vorhersehbar waren. Obwohl nach Monaten des Truppenaufmarschs, der Hassreden, der Propagandalügen im russischen(2) Staatsfernsehen niemand überrascht sein kann, ist man doch entsetzt: Putin(1) tut es wirklich! Er beginnt einfach einen Krieg! Wenn es noch irgendeines Belegs für die akute Bedrohung der Demokratie(1) durch den Nationalismus und Autoritarismus bedürft hätte – Putins(2) Angriffskrieg gegen die Ukraine(3) hat ihn geliefert. Der Nebel ist endgültig weg, alle, nicht nur die Finnen(1) und Balten(1), die US-Amerikaner, die Menschen in Hongkong(1) oder Taiwan(1) können nun sehen, dass sich die Demokratien in einem Abwehrkampf befinden.
Dies ist eigentlich keine neue Erkenntnis. Denn es gibt nicht nur eine äußere Anfeindung der Demokratie(2). Längst war der Niedergang in vielen Demokratien nicht nur atmosphärisch zu spüren, sondern auch empirisch belegbar. Eine Fokussierung auf die äußeren Feinde der Demokratie ist verständlich und geboten. Aber Wladimir Putin(3) und Xi Jinping(1) haben kein überzeugendes Gegenmodell anzubieten, sonst bräuchten sie die Zensur nicht. Sie können die Demokratie nur militärisch bedrohen, nicht intellektuell. Gefährlich ist ihr autoritäres Modell nur, wenn es auch in den Demokratien auf Resonanz stößt – bei denjenigen, die autoritär fühlen und denken. Die eigentliche Gefahr geht von der Erosion demokratischer Werte, Gewohnheiten, Normen aus, die im Inneren stattfindet.[1]
Ja, es stimmt: Von einer Krise der Demokratie(3), der politischen Parteien oder der politischen Repräsentation(1) ist seit langem die Rede. Und doch wäre es gefährlich aus der langen Geschichte derartiger Diskussionen auf ihre Irrelevanz zu schließen und die aktuellen Krisendiagnosen als unvermeidliche Begleitmelodie des demokratischen Alltags oder als unangemessene Dramatisierung abzutun.[2] Die Entwicklungen in vielen etablierten Demokratien, aber auch in Osteuropa oder Lateinamerika(1) zeigen, dass Demokratien hochgradig fragile Gebilde sind und das Abgleiten in Autoritarismus eine reale Gefahr darstellt. Gerade wenn man davon ausgeht, dass die Erosion der Demokratie leise und unscheinbar vonstattengehen kann, gibt es gute Gründe, sich Sorgen zu machen, auch nach der Wahl Joe Bidens(1).[3]
Womöglich besteht gerade darin ein zweiter Schock, der allen Demokraten nach Putins(4) Angriff in die Glieder fahren sollte: Erstmals gibt es in den USA keinen Moment des parteiübergreifenden rallying behind the flag, des Sich-Versammelns hinter der Flagge. Weite Teile der Republikaner sind immer noch, wie ihr Anführer Trump(1), begeistert davon, wie clever und geschickt Putin(5) vorgeht. Sie kritisieren Biden(2), nicht Putin. Mit der erhofften Einigkeit des Westens ist es nicht weit her. Auch in Europa tun sich bald Risse auf. Viktor Orban(1), lange ein enger Freund Putins(6), will keine Waffen über Ungarn(1) an die Ukraine(4) liefern lassen.
Die autoritäre Herausforderung – die Feinde der Demokratie(4)
Eine erste Herausforderung besteht darin, diese Feinderklärung anzunehmen, die Verfechter autoritärer, xenophober oder populistischer Demokratiekonzeptionen als das zu sehen, was sie sind: Feinde der Demokratie(5), nicht bloß Gegner in einem fairen Wettbewerb. Sie mögen das Gegenteil für sich in Anspruch(1) nehmen, sich als Retter der »wahren« oder Ermöglicher einer »eigentlichen« »Volksdemokratie« inszenieren. Aber es ist wichtig, sich hier keine Illusionen zu machen. Was hier als »Demokratie« bezeichnet wird ist nichts anderes als eine ethnozentrische, den Institutionen und Verfahren des Rechtstaats feindlich gegenüberstehende politische Ideologie. Wenn unter »illiberaler Demokratie« zu verstehen ist, dass die Möglichkeiten der Opposition beschnitten, dass Minderheitenrechte ausgesetzt werden und ein Klima der Feindseligkeit und der Verleumdung einzieht, so haben wir es mit dem Gegenteil von Demokratie zu tun.
Aus guten Gründen schreckt man in Demokratien davor zurück, in den Kategorien von Freund und Feind zu denken. Schließlich stammt diese Begrifflichkeit von Carl Schmitt, also gerade von den Feinden der liberalen Demokratie. Aber es sind nicht nur ideenpolitische Skrupel, die zögerlich machen. Feindverleugnung ist auch bequem. Es wäre schön, wenn Donald Trump(2), Viktor Orban(2) oder der neue polnische(1) Nationalismus nur temporäre Ausschläge darstellten. Auch bei der jahrelangen Verharmlosung Putins(7) war der Wunsch der Vater des Gedankens. Man wollte nicht sehen, was man hätte sehen müssen.
Vor allem das an ökonomischen Modellen geschulte Denken lässt sich leicht dazu verführen, so etwas wie eine Tendenz zu Mittelwerten anzunehmen. So kennt man das aus der Ökonomie: Preise, Angebote, ja selbst Börsenwerte streben trotz heftiger Ausschläge langfristig auf so etwas wie ausgeglichene Mittelwerte zu. Der Trend werde schon irgendwann wieder umschlagen, so war lange zu hören. Das Pendel werde auch wieder in die andere Richtung schwingen.
Aber ökonomische Modelle lassen sich nicht so einfach auf die Politik übertragen. Nichts gibt Anlass zu der Vermutung, dass sich die repräsentativen, liberalen Demokratien(6) wie durch Naturgesetze oder eine unsichtbare Hand des politischen Marktes selbst stabilisieren werden. Die Leitmetapher des Pendels ist in dieser Hinsicht verführerisch. Es suggeriert, es gäbe so etwas wie eine natürliche Schwerkraft, die die Dinge wieder ins Lot bringen werde.
Ein zweiter Denkfehler besteht in der Bildung falscher historischer Analogien. Es stimmt natürlich, dass zahlreiche Phänomene der Gegenwart auch schon früher zu beobachten waren. Was heute echo-chamber heißt, war früher die Parteizeitung. Immer schon gab es Polarisierung, selbst politische Gewalt. Vor allem in den USA ist vor diesem Hintergrund zu hören, die Verfassung habe schon viel schlimmere Dinge überlebt: einen Bürgerkrieg, zwei Weltkriege, Präsidentenmorde, Vietnam(1), selbst Nixon(1), Reagan(1) und George W. Bush(1). Das Demokratiegefühl der Amerikaner(4) sei stärker denn je, die Institutionen wehrfähig, die Öffentlichkeit wach.
Aber diese historischen Analogien drücken keine logische Notwendigkeit aus. Dass eine Notlandung bei Sturm und ohne Sicht bereits fünf Mal geklappt hat, besagt nicht, dass es auch beim nächsten Mal gutgehen wird. Aus deutscher Sicht müsste gerade die Formulierung »immer schon« hellhörig machen: Immer schon gab es fake news, Verleumdung, Hetze, Antisemitismus, Verschwörungstheorien. Aber vor dem Hintergrund historischer Erfahrung wird man ergänzen müssen: Immer schon gab es massenhafte politische Gewalt, den Kollaps politischer Systeme, verheerende Kriege. Dass die heutigen fake news in den »Protokollen der Weisen von Zion« einen historischen Vorläufer haben, wäre dann gerade alles andere als beruhigend. Es gibt gute Gründe, alarmiert zu sein.
Eine verharmlosende Einschätzung der Lage ist folglich gefährlich, selbst wenn man nicht, wie Barbara F. Walther, die Bedingungen für einen amerikanischen Bürgerkrieg als gegeben betrachtet.[4] Wenn Demokratie vor allem durch Rechtspopulisten und Rechtsextreme bedroht wird, ist es für konservative Parteien verführerisch, diesen Umstand zu verharmlosen. Dort versucht man sich einzureden, Donald Trump(3) sei vielleicht gar nicht so schlimm, ein bisschen nationalistische und populistische Töne vielleicht unschön, aber im Kampf gegen die verhasste Linke durchaus nützlich. In den USA sind es vor allem evangelikale Gruppen, die so argumentieren: Im Kampf gegen Homo-Ehe und Abtreibung seien alle Mittel recht, selbst Trump, der alle christlichen und konservativen Moralvorstellungen öffentlich verhöhnt, für den jede Schwäche ein Makel darstellt. Man muss es in dieser Härte sagen: Donald Trump(4) dürfte Jesus wohl nur als loser betrachten – und die Evangelikalen wissen es. Es ist ihnen egal, denn im Kampf gegen den Satan ist der Beelzebub ein willkommener Verbündeter. Nur so ist zu erklären, dass rund 80 Prozent der evangelikalen Christen in den USA für eine Person als Präsidenten stimmten, dem konservative Werte wie Bescheidenheit, Zurückhaltung, Höflichkeit und Respekt vollkommen wesensfremd sind.
Historische Vergleiche sind immer heikel, wie wir gesehen haben. Vor allem vor Vergleichen mit der NS-Zeit wird zu Recht gewarnt. Und doch: Bestand nicht genau darin der Denkfehler des deutschen Konservativismus? Hitler(1) sei zwar dumm, unmoralisch, unbürgerlich – aber immer noch besser als die Kommunisten. Man werde ihn schon einbinden und zivilisieren können, so lautete das Kalkül. Auch dies war eine Feindverleugnung, die viele im deutschen Konservativismus bitter bereut haben. Vor allem konservative Parteien stehen in der Gefahr, sich zum Steigbügelhalter explizit antidemokratischer Kräfte zu werden. Im November 2020 gewann Donald Trump(5) wohlgemerkt Stimmen hinzu. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Republikaner und Trumpisten wieder trennen werden. Auch in Osteuropa sehen wir solche Bündnisse.
Diese Gefahr ist vor allem deshalb akut, weil die neuen Feinde der Demokratie(7) sich selbst als Demokraten bezeichnen. Der neue Nationalismus, Populismus und Autoritarismus sehen anders aus als der Nationalsozialismus. Die neuen Feinde der Demokratie kommen fröhlicher, professioneller, meist, wenn auch nicht immer, weniger plebejisch daher. Man gibt sich bürgerlich oder gar postmodern, als rechte Hipster, vielleicht gar intellektuell. Einige zusammengerührte Theorieversatzstücke aus dem ideengeschichtlichen Proseminar zur Zwischenkriegszeit werden wie Puderzucker über die Propaganda des Hasses gestreut.
Doch die antidemokratische Ausrichtung ist unbestreitbar. Was soll ein von der neuen Rechten verbreitetes Wort wie »Remigration« am Ende anderes bezeichnen als eine sanftere oder unsanftere Form der ethnischen Säuberung? Was soll ein Wort wie »Ethnopluralismus« anderes kaschieren als ein durch und durch völkisches Denken, das Menschen auf ihre Herkunft reduziert und Individuen durch Stammeszugehörigkeit ordnet? In den USA lässt sich beobachten, was geschieht, wenn konservative Kreise dies verkennen, wenn sie wie die evangelikalen Christen glauben, ein Bündnis zwischen Wertkonservativen und Populisten eingehen zu können. Konservativen, die glauben, Populisten als nützliche Idioten instrumentalisieren zu können, droht ein schreckliches Erwachen. Sie selbst enden als die benutzten Idioten der neuen populistischen Regierungen.
Der Mann, der sich damit brüstete, Frauen jederzeit an die »Pussy« greifen zu können, diffamierte den republikanischen Kriegshelden John McCain als Feigling(1). Er biederte sich bei Feinden der USA wie Wladimir Putin(8) an (warum auch immer) und hofierte Autokraten wie Erdoğan(1).
In diesem Sinne ist Putins(9) offene Aggression zwar militärisch der gefährlichste Gegner der Demokratie(8), aber ideologisch besteht die größte Herausforderung in der internen Aushöhlung der Demokratie – die oft im Namen der Demokratie betrieben wird. Zwar mag es für einen Moment so scheinen, als führe die Aggression von außen alle Demokratinnen und Demokraten im Inneren zusammen. Doch dem ist nicht so. Ein äußerer Feind allein wird die Brüche in den demokratischen Gesellschaften nicht heilen können. Die Demokratie muss auch nach innen gestärkt werden.
Mögliche Erklärungen: Die große Entfremdung
Feindverleugnung kann träge machen. Und doch folgt aus der Anerkennung einer ernsten Lage noch nichts über mögliche Handlungsoptionen. Dazu müsste man eine präzise Theorie darüber haben, was eigentlich in die Krise der Demokratie(9) geführt hat. Interessanter als die Populisten und Demagogen sind dabei ihre Wählerinnen und Wähler. Ein Konsens ist hier kaum zu erwarten, weder in der Politik noch in der Politikwissenschaft. Und doch gibt es so etwas wie dominante Erklärungen, Narrative, die die große Entfremdung erklären sollen.
Aber was genau bedeutet in diesem Kontext »Entfremdung«?[5] Sind sich hier zwei Partner »fremd« geworden, die eigentlich zusammengehören? Oder handelt es sich um eine Form von Fremdheit, die unvermeidlich ist, die vielleicht gerade durch Differenz produktiv werden kann? Meist scheint das erste Bild zu dominieren. Schnell ist man versucht, fragwürdige Kontrastfolien einer vermeintlich besseren Vergangenheit zu verwenden. Meist wird der Begriff der »Entfremdung« diffus benutzt, um eine Unzufriedenheit, einen Groll, eine systematische Frustration zu beschreiben.
Eine weit verbreitete Erklärung für diese Gefühlslage in der repräsentativen Demokratie(10) lautet, dass es sich um eine Störung des Verhältnisses zwischen Bürgerinnen und Bürgern[6] einerseits und politischen Verantwortungsträgern andererseits handelt.[7] Die Störung dieses Resonanzverhältnisses[8] wird meist als eine mangelnde Responsivität des politischen Systems beschrieben: Interessen und Präferenzen vor allem von ökonomisch schwachen oder kulturell marginalisierten Gruppen würden so lange überhört[9], bis sie sich irgendwann eruptiv in populistischen Bewegungen artikulierten. »Hört uns endlich zu!«, scheinen aus dieser Perspektive diejenigen zu rufen, die zu den Verlierern von Globalisierung, Migration und ökonomischer Dynamisierung gehören oder sich zumindest potenziell davon bedroht sehen. Die Krise der repräsentativen Demokratie ist aus dieser Sicht abzuwenden, indem »die Politik« auf den Anspruch(2) der Bürgerinnen und Bürger(1) möglichst genau und schnell, ja womöglich gar »unvermittelt« antwortet.
Genau dies – eine unvermittelte Umsetzung des Volkwillens – versprechen bekanntlich die Populisten, Nationalisten und autoritären Führer.[10] Dies würde erklären, warum Donald Trump(6) im Herbst 2020 weitere Stimmen hinzugewinnen konnte – trotz einer katastrophalen Amtszeit.
Aber besteht das Problem tatsächlich ausschließlich in mangelnder Responsivität? Bisweilen scheint es, als sei die Kommunikation nicht nur bezogen auf Sachfragen wie die Migrationspolitik gestört. Es gibt eine Entfremdung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern einerseits und ihrem Staat andererseits. Gerade das Possessivpronomen kommt nur noch wenigen über die Lippen. Wer redet heute noch von »meinem Staat«, »meiner Bundeskanzlerin«, »meinem Bundespräsidenten«? Viele erleben diesen Staat nicht als »ihren« Staat. Manche lehnen ihn offen ab, Rechtsextreme, Linksextreme, »Reichsbürger«. Andere haben innerlich gekündigt, interessieren sich nicht mehr für Politik, wollen mit »all dem« nichts mehr zu tun haben. Sie beobachten die Politik voller Wut und Groll, skeptisch gegenüber denen »da oben«. Und in der mildesten Form besteht die Entfremdung darin, aus dem politischen Gemeinwesen möglichst viel herauszuholen und zugleich möglichst wenig hineinzustecken: ökonomischer Opportunismus.
In Deutschland(1) und der Schweiz(1) mögen diese Krisensymptome nicht gefährlich erscheinen. Aber wie sieht es in anderen Ländern aus? In den USA, Brasilien(1), Österreich(1), Ungarn(2), Polen(2)?
Obwohl viele dieser Trends global ähnlich zu verlaufen scheinen, gibt es jedoch große nationale Unterschiede. In Frankreich(1) beispielsweise ist die Entfremdung besonders groß. Die politische Kultur oszilliert hier zwischen überhöhten Erwartungen an einen Staat, der alles und jedes leisten soll einerseits, und dem Groll gegen »die da oben«, deren oft malträtierte Inkarnation der normale Polizist, Sanitäter oder Feuerwehrmann (oder -frau) darstellt, der in den Hochhaussiedlungen mit Verachtung und Steinen ›begrüßt‹ wird. Von einer »Entfremdung« zu sprechen, scheint da schon euphemistisch. Auch in Deutschland(2) werden immer öfter Beamte angepöbelt, bespuckt, bedroht. Die Stimmung schaukelt sich seit Jahren hoch. Es gibt Gewalt in beide Richtungen. Als im November 2020 drei Polizisten in Paris(1) einen schwarzen Musikproduzenten über zwanzig Minuten malträtierten, konnte man, dank einer Videokamera, einen Blick in den Abgrund werfen.
Angegriffen werden in Frankreich(2) jedoch nicht nur Polizisten, nicht nur massenhaft stationäre Radarstationen, die währen der Proteste der Gelbwesten flächendeckend zerstört wurden, sondern auch die Symbole der Republik selbst. In Deutschland(3) wenig bekannt ist beispielweise, dass in Frankreich(3) zu dutzenden die öffentlichen Bibliotheken in kleinen Gemeinden zum Opfer des Vandalismus werden besprüht oder schlicht niedergebrannt. Wie groß muss eine Enttäuschung sein, wie weit der Weg in die Entzivilisierung gegangen, um eine Bibliothek anzuzünden? Die Zerstörung der Bibliothek von Leuven(1) durch die Deutschen(4) ist aus guten Gründen in unserem kollektiven Gedächtnis als barbarischer Akt eingebrannt.
Und am anderen Ende des Spektrums? Am Genfer See(1) ist der Weg nicht weit in eine recht andere soziale Wirklichkeit. Ja, auch in der Schweiz(2) gibt es bisweilen Frustration über Politik. Basel(1) war lange bekannt für seine Hooligan-Szene. Doch Angriffe auf Feuerwehrmänner sind hier vollends unbekannt. Dass Sanitäter flächendeckend mit Stichwesten ausgerüstet werden wie in Niedersachsen(1), wäre hier undenkbar. Auch in der Eidgenossenschaft(3) ist nicht alles so schön, wie es im Licht des Alpenglühens aussehen mag. Und doch: Das Verhältnis von Bürgerinnen und Bürgern einerseits und Staat andererseits ist ein ganz anderes.
Gerade in diesen Unterschieden zwischen Ländern keimt also eine Hoffnung: Die Krise der Demokratie(11) ist kein Schicksal. Wenn es manchen Ländern besser geht als anderen, dann doch wohl deshalb, weil man dort manche Sachen anders macht, offenbar besser. Es gibt Handlungsoptionen. Aber welche?
Wege aus der Entfremdung
Der vorliegende Essay versucht, diese Entfremdung genauer zu verstehen und einen anderen Weg aus dieser Sackgasse aufzuzeigen. Was hier vorgeschlagen wird, ist eine Art kopernikanische Wende in der Art und Weise, das Verhältnis von Bürgerinnen und Bürgern einerseits und »dem Staat« oder »der Politik« zu denken. Für gewöhnlich ist zu hören, »die Politik« solle »liefern«. Bürgerinnen und Bürger(2) stellen Ansprüche an die Demokratie(12) – und diese hat zu reagieren. Die Formel vom Anspruch(3) der Demokratie wird in der Regel so aufgefasst, dass »wir« einen Anspruch haben auf Demokratie. Demokratie ist etwas, das den Menschen oder zumindest den Bürgerinnen und Bürgern zusteht, etwas, worauf wir Anspruch erheben können.
Diese Sichtweise ist richtig. Schon in den Menschenrechten steckt potenziell ein Anspruch(4) auf demokratische Mitbestimmung. Und doch ist diese Sichtweise, wenn man sich die Geschichte der Demokratie(13) ansieht, relativ neu. Und relativ einseitig. Denn es gibt auch einen umgekehrten Anspruch: einen Anspruch, den die Demokratie an Bürgerinnen und Bürger(3) stellt. Etwas gestelzt formuliert: Die Demokratie nimmt uns in Anspruch. Sie ist immer auch eine Zumutung(1).
Diese Einsicht ist wie gesagt nicht neu. Im Gegenteil: Dass Demokratie(14) auch mit Pflichten einhergeht, ist eine Trivialität. Aber die Idee des Anspruchs und der Zumutung(2) geht weiter. Er besagt nicht nur, dass Personen Pflichten haben, sondern dass es Personen verändert, in Anspruch(5) genommen zu werden, dass Antworten und Haltungen entstehen, je nachdem ob und wie man in Anspruch genommen wird, je nachdem wie man angesprochen wird.
Dieser Essay schlägt daher versuchshalber einen Perspektivwechsel vor, der die Bemühungen um eine Ausweitung der Partizipation weder kritisieren noch gar konterkarieren, aber doch wesentlich ergänzen soll. Könnte die Rede vom Anspruch(6)auf Beteiligung(1) nicht auch anders gelesen werden, als ein Anspruch der Demokratie(15), ein Anspruch, den nicht die Bürger(4) gegenüber »der Politik« formulieren, sondern den die Demokratie an die Bürger stellt? Diese Umkehrung der Perspektive geht von der Hypothese aus, dass in gestörten Beziehungen stets beide Seiten das jeweilige Verhalten überdenken müssen. Neben der Frustration von Bürgerinnen und Bürgern, die sich nicht »gehört« fühlen, gibt es auch eine Ermüdung von Verantwortungsträgern, die sich einem unspezifischen politischen Unmut ausgesetzt sehen, der bisweilen mit politischem Desinteresse und mangelndem Engagement einhergeht.[11] Selbst auf kommunaler Ebene werden heute Politikerinnen und Politiker immer öfter angefeindet.
Versteht man Demokratie(16) als ein Resonanzverhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern einerseits und politischen Verantwortungsträgern andererseits, so muss dieses Verhältnis als ein Dialog gedacht werden, in dem keineswegs nur die eine Seite auf die andere zu hören hat. Resonanzverweigerung findet nicht nur durch jene politischen Eliten statt, die keine Kultur des Zuhörens pflegen; sie kann auch bei Bürgerinnen und Bürgern beobachtet werden, die glauben, dem politischen Gemeinwesen nichts zu schulden, ihm voller Rechte aber ohne Pflichten gegenüberzustehen. Demokratie ist jedoch eine Regierungsform, die uns nicht nur erlaubt, unsere Ansprüche zu formulieren, sondern die uns auch in Anspruch(7) nimmt.[12] Sie formuliert – mit Christoph Möllers(1) gesprochen – nicht nur Versprechen, sondern auch Zumutungen(3).[13]
Dies würde aber voraussetzen, dass man Demokratie(17) wieder als das wahrnimmt, was sie historisch immer schon war: ein sehr anstrengendes Geschäft. Dies wird besonders deutlich in den antiken Formen von Demokratie, die wir heute wohl kaum als solche bezeichnen würden. Beteiligung(2) war hier nicht so sehr etwas, was einem zustand, sondern etwas, das wie ein Frondienst für die Allgemeinheit abzuleisten war. Schon in Athen(1) gab es konkrete Techniken, mit denen die Beteiligung an Ratsversammlungen regelrecht erzwungen wurde. Demokratie als Zumutung(4) – dies würde bedeuten, dass man ein Framing überwindet, indem eine Demokratie vorrangig darin besteht, Ansprüche zu artikulieren und Forderungen zu stellen. Demokratie würde dann bedeuten, auch gefordert zu werden.
Der Begriff der Zumutung(5) enthält zwei Bedeutungsfacetten. Eine Zumutung kann unangenehm, belastend, lästig sein. Dies meinen wir, wenn davon die Rede ist, die Feinstaubbelastung an einer Ausfallstraße sei »unzumutbar«. Eine solche Zumutung verfolgt keinen höheren Zweck, sie wird nicht durch einen Sinn gerechtfertigt. Dann aber gibt es auch Dinge, die wir uns selbst zumuten. Wer zu Fuß die Alpen überquert, mutet sich durchaus auch etwas zu – das Ganze ist schließlich auch eine Strapaze. Aber in diesem zweiten Fall handelt es sich um eine Zumutung, die wir uns aus guten Gründen antun. In der Zumutung steckt dann auch der Mut. Wer in München(1) losläuft und bis Venedig(1) gehen will, mutet sich im Doppelsinn etwas zu: Er oder sie traut sich auch etwas zu. Es besteht die Hoffnung, dass durch die Zumutung etwas zum Vorschein kommt, sich eine Haltung entwickelt, ein Charakterzug zeigt, der ohne Zumutung vielleicht verschüttet bliebe.
In diesem zweiten Sinne ließe sich die Demokratie(18) als eine Zumutung(6) lesen, die wir uns selbst antun. Nicht behelligt zu werden, sich nicht interessieren zu müssen, sich auf die bloße Beobachtung zurückzuziehen wäre vielleicht einfacher. Aber eine echte Demokratie ist eben mehr als eine solche Service-Einheit. Sie ist vor allem nicht eine Zumutung, die den Bürgerinnen und Bürgern von anderen, von »denen da oben« angetan wird, sondern etwas, das sich eine demokratische Gemeinschaft von Bürgerinnen und Bürgern im besten Falle selbst auferlegt. Demokratie ist dann nicht etwas, auf das »wir« Bürgerinnen und Bürger(5) Anspruch(8) haben, sondern etwas, das uns in Anspruch nimmt.
Eine solche kopernikanische Wende impliziert eine Umkehr oder zumindest Gleichverteilung der Problemzuschreibung. Dem einseitigen Vorwurf, »die Politik« sei zu wenig responsiv, kommt nun eine ergänzende Diagnose hinzu: Es gibt auch so etwas wie eine Krise des Bürgersinns. Was ist damit gemeint?
Ein wichtiger Schritt besteht zunächst darin, Bürgerlichkeit(1) als Haltung zu verstehen.[14] Bürgerlichkeit ist kein sozialer Status, sondern eine Disposition zu einem bestimmten Handeln. Eine solche »andere Bürgerlichkeit« wird noch genauer zu bestimmen sein. Vorausschickend lässt sich schon einmal sagen, dass sie nicht naturwüchsig mit den sogenannten »bürgerlichen Parteien« zusammenhängt. Die »andere Bürgerlichkeit« ist auch keineswegs neu – im Gegenteil. Ich versuche zu zeigen, dass in anderen Konstellationen die Bereitschaft zu finden war, sich für das politische Gemeinwesen viel mehr zuzumuten, als es uns heute angemessen erscheint. Im Umkehrschluss lassen sich ausgehend von einem begrifflich klar bestimmten Ideal von Bürgerlichkeit gewisse »Haltungsfehler« beschreiben, die die Krise der Demokratie(19) begünstigen. Wie es dazu kommt, wird uns in Kapitel 2 noch genauer beschäftigen.
In jedem Fall soll diese Diagnose keine moralische Schuldzuschreibung darstellen. Die Alternative zu einer Anspruchshaltung ist nicht ein bloßer Pflichtbegriff, sondern die Umkehrung des Akts des »Anspruchs«, das Zulassen von Zumutung(7). In diesem Sinne ist das hier verfolgte Projekt auch nicht als konservativ zu begreifen. Es geht nicht um individuelles Fehlverhalten, um einen Appell an moralische Werte oder eine Verfallsdiagnose, die abstrakt den modernen Individualismus zum Problem erklärt. Dass viele Bürgerinnen und Bürger(6) sich so verhalten, wie sie sich verhalten, ist gerade aus Perspektive einer Theorie, die den Menschen als responsives Wesen versteht, nur allzu verständlich. In diesem Sinne handelt dieses Buch von Institutionen und Routinen und appelliert nicht an einzelne Personen.
Eine solche Umkehrung der Perspektive, weg von der Frage, was die Bürgerinnen und Bürger(7) von der Demokratie(20) erwarten dürfen, hin zu der Frage, was ein demokratischer Staat den Bürgerinnen und Bürgern aus guten Gründen zumuten darf, gewinnt im Moment äußerer Bedrohung an Relevanz. Als am 24. Februar 2022 der Angriff Putins(10) auf die Ukraine(5) begann, waren viele Stimmen zu hören, die Solidarität mit den Opfern russischer(3) Aggression forderten und vorlebten. Aber es gab auch viele Stimmen, die lediglich nach den Konsequenzen für die eigene Situation fragten: Was bedeutet der Krieg für meine Sicherheit, für mein Aktienportfolio, für die Konjunktur und die Inflation in Deutschland(5)? Wird nun das Gas teuer? Wie hoch steigt der Benzinpreis?
Der Angriff stellt alle Demokratinnen und Demokraten vor die Frage, was ihnen das Leben in Freiheit(1) eigentlich wert ist, wie es um die Solidarität wirklich steht. Ist die Demokratie(21) nur ein Mechanismus, der es erlaubt, persönliche Selbstentfaltung, ökonomischen Wohlstand und ein individuelles »Streben nach Glück« zu ermöglichen? Oder geht es doch um mehr? Um ein Leben in Würde, ein Leben ohne Angst, ein Leben in Freiheit? Was wollen wir uns zumuten, um diese Errungenschaften zu verteidigen, rhetorisch und politisch im Inneren, notfalls militärisch nach außen? Haben wir überhaupt noch jene Vorverständnisse, die nötig sind, um zu verstehen, dass Demokratie immer auch eine Zumutung(8) darstellt?
Diese Frage ist leider offen. Die Wahl Trumps(7) hat gezeigt, dass selbst und vor allem im Herzen des »Westens« grundlegende Normen der Demokratie(22) für viele Menschen irrelevant geworden sind. Am Phänomen Trump ist nicht die Person erschreckend, sondern der Umstand, dass so viele Menschen nicht zu verstehen scheinen, was sein Verhalten tatsächlich bedeutet. Als am 6. Januar 2022 bei einer Gedenkminute im Repräsentantenhaus jenen Personen gedacht wurde, die ein Jahr zuvor bei der Verteidigung des Kapitols gegen den von Trump(8) aufgehetzten Mob ihr Leben verloren hatten, waren nur zwei Republikaner anwesend. Nur Dick Cheney(1) und seine Tochter Liz Cheney(1) waren gekommen.
Zum Aufbau des Buches
In einem ersten Schritt werde ich verschiedene Diagnosen vergleichen, die eine politikwissenschaftlich gestützte Antwort auf die Frage nach den Ursachen einer Krise der Demokratie(23) leisten. Konkurrierende Angebote erweisen sich in der Rekonstruktion als ergänzend und schließen sich nicht unbedingt gegenseitig aus (Kapitel 2). Wer das Gefühl hat, in den vergangenen Jahren genug (oder vielleicht schon zu viel) über die Krise der Demokratie gelesen und gehört zu haben, kann dieses Kapitel auch überspringen. Das folgende Kapitel wird eine kritische Auseinandersetzung mit einem Antwortversuch leisten, der vor allem darauf setzt, »mehr Angebote« zu machen. Partizipation und Deliberation(1) sind zu den zentralen Hoffnungen bei der Suche nach einer Überwindung der Krise geworden. Aber halten sie dieses Versprechen tatsächlich? (Kapitel 3) Eine kritische Perspektivierung der Partizipationswelle rückt ein gewisses Paradox ins Zentrum: Partizipation kann die Form von Konsum annehmen. Interessen zu artikulieren ist legitim, aber eine Gefahr des Partizipations- und Deliberationsparadigmas besteht in der Perpetuierung eines ökonomischen framing. Im schlimmsten Fall besteht die Partizipation nur darin, eine möglichst präzise Bestellung aufzugeben und dann darüber frustriert zu sein, dass »die Politik« nicht »liefert«.
Vor diesem Hintergrund wird das folgende Kapitel die These entfalten, dass es sich lohnt, den citoyen(1) und die citoyenne als responsives Wesen wiederzuentdecken. Demokratien(24) sind an sich unbequemer als autoritäre Regime, die zumindest in vielen Fällen das Biotop ungestörter Privatheit anbieten. Zumindest republikanisch verstandene Demokratien fordern etwas – und verändern damit jene, an die sich diese Forderungen richten (Kapitel 4).
Wie das im Einzelnen aussehen kann, historisch ausgesehen hat und auch heute in manchen Ländern noch aussieht, zeigen die folgenden Kapitel, die sich mit den Wehr- und Bürgerdiensten, der Wahlpflicht, der Rekuritierung durch Losverfahren(1) und der verpflichtenden Mitarbeit am Justizwesen beschäftigen. Lassen sich daraus konkrete Vorschläge ableiten? Wie könnte heute eine politische Praxis aussehen, die Bürgerinnen und Bürger(8) nicht nur als Konsumenten anspricht? Zumindest behutsame Schritte in diese Richtung scheinen möglich. Der Ausblick wird abschließend noch einmal die Frage nach den Grenzen des demokratischen Anspruchs diskutieren. Gibt es auch Fälle, in denen man der Demokratie(25) die Antwort verweigern darf? Der Begriff der Freiheit(2) steht dabei im Zentrum; er beinhaltet im Falle politischer Freiheit gänzlich andere Intuitionen und Denkbilder als im Falle ökonomischer Freiheit. In der Demokratie gibt es nicht nur Wahlfreiheit, sondern auch die Freiheit, sich gegenseitig in Anspruch(9) zu nehmen.
2
Krisendiagnosen im Vergleich
Im Juni 2016 veranstaltete ich eine deutsch(6)-französische(4) Tagung mit britischer(1) Beteiligung(3). Das Thema lautete: Konstellationen der Souveränität in Europa. Wir hatten uns vorgenommen, der Wiederkehr einer Rhetorik der Souveränität nachzugehen. Nicht nur in Frankreich(5) forderte Marine Le Pen(1), ihr Land müsse endlich wieder souverän werden. Auch in Großbritannien(2) war im Rahmen der Brexit-Kampagne beständig der Verweis auf Souveränität zu hören. Take Back control!
Seit 2015 war auch in Deutschland(7) der Ruf nach nationaler Souveränität lauter geworden. In einem interdisziplinären Setting wollten wir nachvollziehen, welche ideengeschichtlichen Topoi hier verwendet, welche staatsrechtlichen Fragen hier aufgeworfen und welche Konstruktionsprobleme in der EU damit zu Recht thematisiert wurden. Denn meist war die Rede von der »Souveränität« vor allem gegen die EU gerichtet: Sie zerstöre die nationale Souveränität und damit die nationalstaatliche Demokratie(26). Wir hörten Beiträge aus dem Staatsrecht und den Medienwissenschaften. Hat die EU wirklich ein Demokratiedefizit? Worin genau besteht es? Wie verhalten sich verschiedene Ansprüche auf Souveränität zueinander? Ist die EU ein Mechanismus, der Nationalstaaten die Ausübung von Souveränität in einer globalisierten Welt allererst ermöglicht? Wie plausibel ist der Begriff überhaupt noch? Das waren unsere Fragen.
In den Kaffeepausen war das anstehende britische(3) Referendum Thema. That’s not going to happen, war man sich einig. »Mit der EU im Rücken können die Briten(4) in Hongkong(2) vielleicht noch ein Wörtchen mitreden, ohne EU sind sie ein Zwerg.« »So blöd sind die Briten(5) nicht.« Doch eine britische(6) Teilnehmerin war vorsichtiger. »Wer weiß, was alles passiert.« Die Unzufriedenheit in ihrer Heimat sei groß. Wer immer nur nach London(1) reise, mache sich keine Vorstellung davon, wie perspektivlos die Lage in manchen Regionen Englands sei, wie tief der englische(7) Nationalismus sitze.
Wenige Tage später kam der große Knall. Boris Johnson(1) feierte seinen Independence Day. Nigel Farage(1) triumphierte. Über Jahre als Spinner verhöhnt, hatte er es allen gezeigt. Die Briten(8) waren raus, und die EU stand da wie ein Verein von Trotteln. Aber auch die Politikwissenschaft hatte Grund für Selbstzweifel. Kaum jemand hatte den Brexit kommen sehen. Und als rund ein halbes Jahr später Donald Trump(9) gewählt wurde, ging die zweite kalte Dusche auf das Haupt der politikwissenschaftlichen Expertinnen und Experten nieder. Niemand hatte dies für möglich gehalten, nicht nur aufgrund der Umfrageergebnisse, sondern weil die Phantasie schlicht nicht ausreichte, sich Trump(10) tatsächlich als Präsidenten auszumalen.
Verantwortlich für diesen Mangel an Phantasie war wohl eine gewisse universitäre Betriebsblindheit. Welcher Akademiker kennt schon die Reality-Show »The Donald«? Selbst der Besitz eines Fernsehers gilt in manchen akademischen Kreisen bereits als untrügliches Zeichen einer gefährlichen Verlotterung. Eine größere Gefahr ist die Projektion rationalen Verhaltens auf eine Wählerschaft, die nach ganz anderen, viel stärker erratischen Kriterien urteilt. Die »Wissenschaft« möchte gerne einen Gegenstand haben, der sich auch für eine rationale Untersuchung eignet: rationale Wähler, strategisch denkende Eliten, langfristige Pläne. Dass viele Wählerinnen und Wähler gar nicht wissen, wen sie wählen, dass Entscheidungen auf Stimmungen und Bildern, nicht auf abgewogenen Präferenzen beruhen, weiß man zwar irgendwie, aber es ist schwer die Konsequenzen zu ziehen.
Sollte man also öfter die BILD-Zeitung, die Gala, das Goldene Blatt lesen, um die Krise der Demokratie(27) zu verstehen? Müssen wir auf die medialen Misthaufen dieser Welt steigen, zu FoxNews, ins deutsche Privatfernsehen, in die Facebook-Gruppen und Chats der Rechtsextremen, um zu verstehen, was geschieht? Mit welchen Mitteln, aus welcher Perspektive, mit welchen begrifflichen, wissenschaftlichen, statistischen Mitteln lässt sich die Krise der Demokratie angemessen beschreiben?
Der Politikwissenschaftler Yascha Mounk(1) stellte 2016 in einem immer noch bemerkenswerten Artikel dem eigenen Fach ein schlechtes Zeugnis aus: Verliebt in die eigenen Methoden, die Korrelationsanalysen und Rationalitätsmodelle, sei seine Disziplin betriebsblind geworden.[1] Nicht zu wenig, zu viel komplizierte Methodik sei das Problem.
Diese Verunsicherung über die angemessene Arbeitsweise des Faches muss man im Hinterkopf behalten, wenn man die politikwissenschaftliche Debatte über die Krise der Demokratie(28) rekonstruieren will: In vielen Fällen unterscheiden sich nicht erst die Folgerungen und Ergebnisse, sondern bereits die Werkzeuge fundamental. Wer Zahlen sehen will, wird anderes finden als jene, die auf Symbole, Gefühle, politische Phantasien, das sogenannte »politische Imaginäre« blicken. Die Tatsache, dass der Aufstieg Trumps(11) weite Teile des Fachs so kalt erwischt hat, sollte durchaus Anlass dazu geben, das wissenschaftliche Instrumentarium in Frage zu stellen, mit dem in der Regel über Demokratie geforscht wird.
Die Anfeindung von innen
Januar 2020. Der Blick in die Nachrichten bietet ein nahezu apokalyptisches Bild. Soeben ist der iranische General Soleimani(1) in Bagdad(1) durch eine amerikanische(10) Drohne getötet worden. Der Iran(1) kündigt Vergeltungsmaßnahmen an. Auf den Straßen Teherans(1) und Kermans(1), der Heimatstadt des Generals Soleimani(2), schwören Hunderttausende Anhänger den Amerikanern(11) Rache. Doch damit nicht genug. Der amerikanische(12) Präsident droht dem Iran(2), als Reaktion auf mögliche Angriffe kulturelle Ziele anzugreifen. 52 sollen es sein – genau die Anzahl der amerikanischen Geiseln, die einst in der Botschaft in Teheran festgehalten wurden und deren Demütigung im Nachgang der iranischen(3) Revolution wie eine offene Rechnung zwischen den beiden Regierungen steht.
Vor dem inneren Auge stehen die Bilder der berühmten Moscheen von Isfahan(1), die Ruinen von Persepolis(1), die Wüstenstadt Yazd(1). Die Welt horcht auf. Könnte das eine Falschmeldung gewesen sein? Oder hat tatsächlich der Präsident der USA, der, so wird stets gesagt, ältesten Demokratie(29) der Welt, mit Taten gedroht, die unzweifelhaft als Kriegsverbrechen zu werten wären? Taten, die die USA auf dieselbe Stufe wie die Taliban stellen würden, deren Zerstörung der Buddha-Statuen von Bamiyan(1) 2001 ihren Ruf als Barbaren nährten, auf dieselbe Stufe wie den IS, der mit der Zerstörung vom Palmyra(1) einen weiteren Mosaikstein in ein Schreckensbild legte?
August 2020. Dieses Mal befinden wir uns nicht in den USA, sondern in Deutschland(8), in Berlin(1), auf der Treppe des Reichstagsgebäudes. Ein Samstag, der 29. August. Soeben wurde eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen aufgelöst. Plötzlich überwinden rund 400 Rechtsextreme mit Reichsflaggen die behelfsmäßigen Absperrungen vor dem Reichstagsgebäude und stürmen die Treppe. Die Polizei ist nicht nur überrumpelt, sondern vor allem unterbesetzt. Mit großem Mut stellen sich einige wenige Beamte der Meute in den Weg. Später wird sich herausstellen, dass es sich bei dieser Attacke keineswegs um eine spontane Aktion handelte. Gegen die Heilpraktikerin Tamara K. werden Ermittlungen wegen »aufwieglerischen Landfriedensbruchs« eingeleitet. Sie stand kurz zuvor vor der russischen(4) Botschaft zwischen Reichskriegsflaggen und Neonazis am Mikrophon. Sie wähnt sich offenbar im Kampf gegen eine kommende Corona-Diktatur und hatte im Milieu der »Reichsbürger« für den Sturm des Parlaments plädiert. Fotos zeigen eine junge Frau aus der Eifel mit Meditationsarmband und langen Rastafari-Haaren. Nun heizt sie dem Mob ein und ruft dazu auf, sich das »Hausrecht« »zurückzuholen«. Die Bilder aus Berlin(2) gehen um die Welt. Selbst der Bundespräsident(1) äußert sich: »Reichsflaggen, sogar Reichskriegsflaggen darunter, auf den Stufen des frei gewählten deutschen Parlaments, das Herz unserer Demokratie(30) – das ist nicht nur verabscheuungswürdig, sondern angesichts der Geschichte dieses Ortes geradezu unerträglich.« Was ist bloß los in dieser Welt? Lange vor Putins(11) Angriff auf die Ukraine(6) war sie aus den Fugen.
Zwei Hauptstraßen, viele Nebenwege
Diese Frage nach den Ursachen scheint unendlich schwer. Und doch gibt es zwei klassische, man könnte auch sagen idealtypische Antworten auf die Frage nach der Ursache der Krise: Ökonomie oder Kultur. Die eine dürfte wohl eher eine »linke« Erklärung, die andere eher eine »rechte« sein. Da diese Krisendiagnosen in den vergangenen Jahren enorm breit diskutiert wurden, werde ich mich im Folgenden auf eine sehr kursorische Rekapitulation beschränken.[2] Mir geht es dabei vor allem darum, diesen Diagnosen einen neuen »spin« zu geben.
Die erste Erklärung verweist auf eine wachsende ökonomische Ungleichheit, wofür vor allem die neoliberalen Reformen verantwortlich gemacht werden, die Ronald Reagan(2) und Margret Thatcher(1), zeitlich versetzt Tony Blair(1) und Gerhard Schröder(1) durchgesetzt haben. Die neoliberale Wende, so die These, hatte zwei zentrale Auswirkungen: Zum einen wurde die Vermögensentwicklung der Reichsten vom Rest der Gesellschaft entkoppelt. Es entstand eine neue Klasse der Superreichen, die sich der Besteuerung systematisch entzog oder aber durch »Steueroptimierung« nur ein Minimum abführte. Für die Steueroasen in der Karibik, aber auch für so manchen Schweizer(4) Kanton war diese Entwicklung vorteilhaft – für den Rest der Gesellschaft indes fatal.
Parallel zur Spreizung von Einkommen und vor allem Vermögen schwand jedoch die Möglichkeit, diesem Trend politisch entgegenzuarbeiten. Es entstand eine »Postdemokratie«, in der, wie der Politikwissenschaftler Colin Crouch(1) ausführte, nur die vermeintlich alternativlosen Sachzwänge des globalisierten Marktes durchgesetzt werden konnten und politische Alternativen gar keine Chance hatten. Die EU spielte dabei aus Sicht der Kritiker eine negative Rolle, denn sie schützte nicht etwa das Modell des europäischen Sozialstaats vor der Konkurrenz aus Niedriglohnländern, sondern fungierte als eine Art Vasallenorganisation, um lediglich die Imperative der institutionellen Anleger in politische Programme zu übersetzen: Flexibilisierung, Lohndumping, »Niedriglohnsektor« bei sinkender Kaufkraft und explodierenden Mieten waren die Folge.
Da die daraus entstehende Frustration keine erkennbaren Akteure adressieren konnte – institutionelle Anleger und Superreiche sind ja, dies ist ihr Privileg, quasi unsichtbar – suchte sich die Wut eine andere, eine sichtbare Hassfigur: Migranten, später Mitglieder der LGBTQ+-Community, das »dekadente Europa«, das »links-grün versiffte Milieu«. Alter, verfestigter Rassismus vermengt sich dann mit einer diffusen Angst vor dem Fremden, dessen Prekarität und Haltlosigkeit der eigenen Frage eine Gestalt gibt.
Die konservative Gegenerzählung nimmt einen anderen Ausgangspunkt. Sie beginnt mit der These, dass funktionierende Demokratien(31) eine »Leitkultur« brauchen, also kulturell mehr oder weniger homogen sein müssen, um all die anderen Widersprüche überhaupt aushalten zu können. Aus dieser Perspektive sind es nicht in erster Linie die ökonomischen Ungleichheiten, sondern die kulturellen Konflikte, die die etablierten Demokratien an den Rand des Kollapses führen. Vor allem der Multikulturalismus, der (so zumindest die Kritiker!) die grundsätzliche Gleichheit(1)aller Kulturen behauptet, ist demnach für einen latenten Bürgerkrieg verantwortlich.
Diese Lesart gibt es in blank rassistischen, xenophoben, homophoben und islamophoben Varianten. Von der bisweilen gezielt abgemilderten Rhetorik sollte man sich keineswegs täuschen lassen: Es gibt auch Krisendiagnosen, die schlicht eine »weiße Vorherrschaft« und die »Reinheit« eines Volkes »schützen« wollen. Diejenigen, die von sich behaupten, das »Abendland« verteidigen zu wollen, fallen meist durch große Unkenntnis über den hybriden Charakter dieser Kultur auf. Leibniz(1)’ Beschäftigung mit der chinesischen Sprache, Schopenhauers(1) Auseinandersetzung mit dem Buddhismus, Nietzsches(1) Entdeckung der Psychologie bei Dostojewskij(1)? Die selbsternannten »Verteidiger des Abendlandes« kennen gar nicht, was sie verteidigen, sie wissen nicht um den hybriden Charakter der europäischen Kultur.
Aber nicht jede mit dem Begriff der »Kultur« operierende Krisendiagnose ist a priori bereits rassistisch. Natürlich ist Multikulturalismus nicht nur eine Bereicherung, sondern auch eine Herausforderung. Das war jenen, die den Begriff in den 1980er Jahren bekannt machten, durchaus bewusst, zum Beispiel Claus Leggewie(1) und Daniel Cohn-Bendit(1). Man wird einer Grundschullehrerin keinen Rassismus vorwerfen wollen, wenn sie darauf hinweist, wie schwierig es ist, eine Klasse zu unterrichten, in der zwar zehn verschiedene Muttersprachen, aber kaum Deutsch gesprochen wird.
Eine ernstzunehmende Krisendiagnose, die im weitesten Sinne auf »Kultur« referiert, geht von der Erosion des Selbstverständlichen aus. Migration ist hier nur eine Ursache unter vielen, die dazu beitragen, dass moderne, ausdifferenzierte Gesellschaften gerade durch den Pluralismus dazu tendieren, eine immer höhere Regelungsdichte zu implementieren, um so den Schwund des Sich-von-selbst-Verstehenden zu kompensieren.
Der fortschrittliche Impuls, alles, was »sich gehört«, auch in Frage zu stellen, hat einen Preis: Interaktionen werden stärker norm- und weniger wertebasiert. Selbst die Frage, wer mit welchen Personalpronomina angesprochen werden muss, wird dann plötzlich zu einer Frage, die kollektiv verbindlich geregelt und explizit ausformuliert werden muss. Nicht nur Verwaltungen, sondern auch Universitäten, ja in Fällen wie Kanada(1) ganze Bundesstaaten, schreiben dann vor, welches Binnen-I oder Sternchen wo zu setzen ist. »Politisierung« bedeutet eben auch, dass immer weniger selbstverständlich ist. Und das ist anstrengend.
Unabhängig davon, wie man zu diesen sprachpolitischen Fragen steht, drängt sich der Eindruck eines »Normenhungers« auf: Die explizite Regelung macht zugleich notwendig, auch die Sanktionen explizit zu regeln. Wo man sich nicht mehr auf einen »gesunden Menschenverstand« berufen kann (den man aus guten Gründen in Frage stellt), zieht jede Norm weitere Normen nach sich. Denn auch die Anwendung von Normen muss wieder normiert werden. Damit wird jede Kommunikation zähflüssig, soziale Interaktion verliert ihren spielerischen Charakter.
An jeder Ecke stehen Menschen, deren Meinung uns gefällt
Eine solche Verkomplizierung der Kommunikation durch einen Mangel an implizit geteiltem Wissen und nicht-thematischen Codes provoziert Gegenreaktionen. Nicht nur Groll und Hass sind demokratietheoretisch bedenkliche Reaktionen. Auch der Rückzug in Blasen, in denen eine jeweilige »Leitkultur« herrscht, ist fragwürdig. Genau eine solche Bildung von je spezifischen sozio-ökonomischen und vor allem kulturellen Milieus beobachten wir jedoch. In Frankreich(6) verwendet man hierfür den Begriff des communautarisme; in den USA spricht man eher von tribalism. Die Kommunikations- und Lebensstilblasen bilden sich aber nicht nur in den Echokammern des Internets, sondern auch in der realen Welt. Unter dem Titel The big sort beschreibt der amerikanische(17) Journalist Bill Bishop(1), wie sich Milieus auch ganz konkret im Stadtbild sortieren.[3] Auch in Deutschland(9)