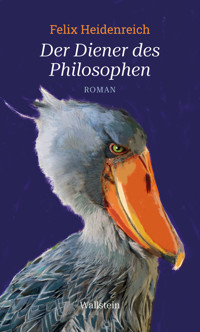Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dorelas Affäre mit Antoine ist so unbeschwert wie das Studentendasein in Fribourg. Doch der plötzliche Tod des Onkels Durs gibt Rätsel auf: Seine Beschäftigung mit den Indianern war ihm offenbar zur Obsession geworden. Warum hat er sich zu Tode gestürzt? Und warum verschwindet Antoine plötzlich? An einem nasskalten Septembermorgen macht sich Dorela in Graubünden auf den Weg zurück an ihren Studienort Fribourg. Plötzlich vernimmt sie ein Geräusch: Ruft da jemand nach Hilfe? Einige Tage später erfährt Dorela vom Tod ihres Onkels Durs. Dorela ist verliebt und möchte ihr Studentenleben mit Antoine genießen. Doch gemeinsam mit ihrer Mutter reist sie nach Berlin, wo ihr Onkel für die Schweizer Vertretung tätig war. Das Chaos in seiner Wohnung löst Entsetzen aus: Zahllose auf dem Boden verteilte Dokumente, Aufzeichnungen und Notizen lassen vermuten, dass sich Durs völlig in der Besiedlungsgeschichte Nordamerikas verloren hat. Hatte sich der Onkel womöglich in den Wunsch verstiegen, Indianer zu werden? Wonach hatte er gesucht? Und was hat es mit dem mysteriösen, im Keller gegrabenen Loch auf sich? Hinweise lassen Dorela vermuten, dass auch sie Teil dieser Geschichte ist. Ein Netz rätselhafter Bezüge verbindet die Geschichte ihres Onkels mir ihrem eigenen Leben, mit Antoine und den Orten, an die sie reist. In Südfrankreich, Paris, Venedig und New York fügen sich ihre Erinnerungen zu einem Bild. Anhand detailreicher Beschreibungen der Ereignisse und Orte zieht Felix Heidenreich den Leser seines Debütromans wie durch einen Sog mit hinein in seine Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Felix Heidenreich
Ich erinnere mich noch
Roman
Inhalt
Umschlag
Titel
Ich erinnere mich noch
Impressum
I.
Ich erinnere mich noch, dass es ein nasskalter Septembermorgen im Jahr 1985 war, als ich vor die Tür trat und mit meinem Rucksack beladen den Weg hinunter ins Tal einschlug. Morgendunst lag wie Watte am Talgrund und zerfetzte Wolken zogen langsam durch die Baumwipfel. Den gegenüberliegenden Piz Mitgel konnte ich nur als Koloss erahnen, doch die Lärchen, die für die Landschaft Graubündens so typisch sind, zeigten bereits die ersten gelben Nadeln und kündigten einen Herbst an, in dem wie jedes Jahr die Wälder in strahlenden Farben leuchten würden.
Ich hatte einige Tage bei meinen Eltern verbracht, die damals noch ein bereits in die Jahre gekommenes Hotel betrieben, das unsere Familie mit Ach und Krach finanziell über Wasser hielt. Die beiden waren in aller Frühe mit mir aufgestanden und wir hatten schweigend gefrühstückt, so wie es auch auf den Höfen dieser Gegend üblich war und noch immer ist, wo man um vier Uhr aufsteht, weil man sich mit dem ersten Tageslicht um das Vieh kümmern muss.
Mit hungrigen Atemzügen sog ich die herrliche Morgenluft in meine Lungen und meine Gedanken begannen, an meinen Studienort zu wandern, nach Fribourg, wohin ich über Tiefencastel, Chur und Zürich an diesem Tag zurückreisen wollte, um in der kommenden Woche das neue Semester zu beginnen. Meine Eltern, im Türrahmen stehend, hatten mir einen letzten Gruß mit auf den Weg gegeben, ein leises »Bun viadi, Dorela!«, und es schien mir, als sei dieser nach wenigen Tagen erfolgende Abschied mit einer besonderen Schwere beladen, ganz so, als verließe ich mein Elternhaus aufs Neue. Da mein jüngerer Bruder Mathis im Sommer ebenfalls ausgezogen war, lebten meine Eltern nun allein.
Die Dorfstraße führte nach einer langgezogenen Kurve in den Wald, wo ich auf einen schmalen Weg abbog, der als Abkürzung diente und erst kurz über Tiefencastel wieder aus dem Wald hinausführte. Mein Blick flog über den weichen Waldboden, über Wurzeln und Steine, die aus der Erde ragten, über Buschwerk am Rande des Weges, auf dem sich der Morgentau gesammelt hatte. Nun in die schöne Universitätsstadt in der Westschweiz zurückzukehren, war eigentlich nichts Besonderes, beinahe schon eine Art Routine. Und doch ging mir durch den Kopf, dass ich als junge Frau, deren Eltern nicht studiert hatten, die aus einem winzigen Dorf in einer entlegenen Gegend kam, wie in eine andere Welt fuhr. Sprachen waren mir schon in der Schule leichtgefallen, denn wer in unserem Tal aufwuchs, hatte nicht nur das Rätoromanische und Schweizerdeutsche im Ohr, sondern auch das Italienische, das die wenigen Bergkuppen zum nahen Tessin mühelos überwand und schon damals, in den 1970er- und 80er-Jahren, durch viele Verbindungen präsent war, nicht nur durch die Handwerker und Bauarbeiter, sondern auch durch wohlhabende Skitouristen aus Mailand.
Da vernahm ich ein Geräusch. Ich blieb stehen, lauschte und hörte eine Art Schreien, das eindeutig vom Abhang links unter mir kam. War das ein Tier oder ein Mensch? Ich trat einige Schritte ins Gebüsch am Wegesrand und blickte in ein undurchdringliches Grün aus Buschwerk und Bäumen. Wieder hörte ich den seltsamen Schrei, mit dem irgendetwas Lebendiges um Hilfe schrie. Ich rief hinab, doch das Schreien endete nicht, als habe man mich nicht gehört.
Kurz entschlossen setzte ich meinen schweren Rucksack ab und stieg, mehr rutschend und schlitternd als gehend, nach unten in eine Talsenke, an deren Grund ich außer Atem das Gleichgewicht wiedersuchte. Ich konnte keine Spuren entdecken, die einen Rückschluss auf ein mögliches Ereignis erlaubt hätten. Ein kleiner Bach, fast ein Rinnsal, suchte sich friedlich seinen Weg durch den Wald, das Schreien aber war nicht mehr zu hören. Noch einmal rief ich in den Wald, doch es waren nur das leise Plätschern und ein wenig Gezwitscher zu hören. Mein Blick schweifte über die mächtigen Stämme der Lärchen, deren Spitzen sich sanft im Wind bewegten und ein mir vertrautes Rauschen erzeugten.
Mühsam stieg ich wieder hinauf zu meinem Pfad, wo ich verschwitzt, mit schmutzigen Händen und rasendem Puls ankam. Für einen kurzen Moment stützte ich mich mit den Händen auf den Knien ab und atmete tief durch. Hatte ich mir diesen Schrei vielleicht eingebildet? Ich schulterte den Rucksack und ging, nachdem ich auf die Uhr gesehen hatte, mit schnellen Schritten weiter, in der Gewissheit, mit diesem schnellen Tempo den Zug gerade noch zu erreichen.
Als ich kurz darauf den Bahnhofsplatz in Tiefencastel überquerte, eine trostlose und kahle Betonfläche, auf der die großen, gelben Postbusse wendeten, warf ich einen Blick zurück in die Richtung jener Stelle, an der ich das seltsame Schreien gehört hatte, und da schien es mir, als blinkte etwas im Wald, als reflektierte sich das Licht der aufgehenden Sonne in einem Spiegel oder Metallteil. Schon rollte mein Zug ein, der damals noch nicht elektrisch angetrieben war, sondern mit dröhnender Dieselkraft, aber nicht weniger zuverlässig und pünktlich die Strecke, aus dem Engadin kommend, nach Chur bediente.
Nur wenige Fahrgäste stiegen zu dieser Stunde ein, einige Pendler, die durch ihre Arbeitskleidung erkennbar waren und ganz offenbar in der Hauptstadt des Kantons jene Arbeit gefunden hatten, die es hier in den entlegenen Tälern nicht gab. Ich setzte meinen Rucksack ab und ließ mich in meinen Sitz fallen, verwirrt und beunruhigt. Auch heute noch erinnere ich mich an die Beschaffenheit und den eigenartigen Geruch, der von diesen Zugsesseln ausging, von ihrem unverwüstlichen, grauen Stoff, auf dem sie alle Fahrgäste gleichermaßen willkommen hießen. Täuschte mich meine Erinnerung, oder fiel mir diese Duldsamkeit der Sitze an diesem Morgen wirklich zum ersten Mal auf? Noch einmal blickte ich durchs Zugfenster hinüber auf den Berghang, den ich soeben zu Fuß durchkreuzt hatte, und wieder sah ich das merkwürdige Blinken, das erst verschwand, als sich der Zug in Bewegung setzte.
Zunächst fiel es mir schwer, den Vorfall zu vergessen, und während sich der Zug durch die kurvenreichen Tunnel dieser Gegend arbeitete, hing ich in meinen Gedanken der Frage nach, wer oder was dort so seltsam geschrien haben mochte. Ein verletztes Kind, das sich verlaufen hatte? Hätte ich noch länger, gründlicher suchen müssen? In Chur stieg ich um, und mit der ins Rheintal hinabstrahlenden Sonne und dem schnelleren Tempo, das die gerade Strecke erlaubte, die die Bahnfahrt von Chur nach Zürich prägt, traten diese Gedanken in den Hintergrund und mein Heimattal rückte weiter in die Ferne.
Ich dachte nun wieder an Fribourg, mein Studium, das kommende Semester, mein beginnendes letztes Studienjahr. Im Frühling hatte ich dort jemanden kennengelernt, der mich auf seltsame Weise interessierte. Antoine strebte – wie ich – das Lehramt an; wir waren uns in mehreren Kursen begegnet, wo er sich fast immer an den linken Rand des Saales setzte. Er hatte tiefschwarze Augen und schwarzes, dichtes Haar, stammte aus Genf und sein Name, Antoine Guérin, machte seine Erscheinung aus mir selbst unerfindlichen Gründen noch interessanter. Klang Guérin nicht irgendwie wie guérir, heilen?, dachte ich, während ich aus dem Zugfenster auf den Rhein sah, der bei Chur bereits zu einer Art Wasserautobahn geformt und in einen schnurgeraden Betonkanal gezwängt war. Wenn ich Antoine an der Uni traf, war ich mir unsicher, ob auch er in diesen Momenten eine besondere Spannung, ein Gefühl des Möglichen spürte, so dachte ich aus dem Fenster blickend.
Eigentlich hätte ich Stendhals Rot und Schwarz lesen sollen, un grand classique, wie unsere Professorin betont hatte, als sie uns die Lektüreliste erläuterte, doch ich musste unwillkürlich an Antoine denken. Alles, ausnahmslos alles, war für sie ein großer Klassiker, und so schlug ich Stendhal entschlossen zu. Ob ich in Antoine verliebt war, hätte ich zu diesem Zeitpunkt wohl nicht sagen können, denn die wenigen Begegnungen hatten zumindest nicht zu einem coup de foudre geführt, zum Blitzeinschlag einer leidenschaftlichen Liebe, die keine Rückfragen zulässt. Und obwohl ich das unbestimmte Gefühl hatte, mich in ihn verlieben zu können, würde ich es nur darauf anlegen, dachte ich, während meine Blicke gedankenverloren erst über das Rheintal und dann den Züri-See schweiften.
Ich erinnere mich noch, dass es mir die längere Umsteigezeit in Zürich erlaubte, eine Ausgabe der NZZ zu kaufen, eine dicke Samstagsausgabe, die ich schon damals besonders liebte, ein teures Wochenendgeschenk, das ich trotz meines beschränkten Budgets vor mir rechtfertigen konnte mit dem Argument, hier werde ich etwas lernen. Der Platzspitz in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs begann schon damals, Mitte der 80er-Jahre, jene Entwicklung einzuschlagen, die ihm am Ende des Jahrzehnts den Ruf eines europaweiten Heroin-Hotspots einbringen sollte, auch wenn damals die Junkies ihrer Sucht noch etwas verstohlener nachgingen. Wie seelenlose Zombies liefen hier manche Gestalten umher, mit weißer Haut, als seien sie bereits tot, auf der Suche nach dem nächsten Schuss. Ich war froh, als ich endlich wieder im Zug saß und mich meiner Zeitung widmen konnte, doch es gelang mir nicht, mich in der Lektüre zu verlieren, und immer wieder wanderte mein Blick auf die Bergkuppen des Berner Oberlandes, die mir im Vergleich zu den schroffen Gipfeln meiner Bündner Heimat seltsamerweise friedlicher erschienen.
Als ich schließlich in Fribourg vom Bahnhof zu meinem Wohnheim trottete, war ich erschöpft, und meine Gedanken waren keineswegs klarer geworden. Vielmehr fühlte ich mich erdrückt von dem Gedanken, dass jeder mögliche weitere Schritt, der mich Antoine nähern oder mich von ihm entfernen würde, meinem ganzen Leben eine Richtung geben könnte. Mein Lebensweg, ob ich Kinder haben würde, wo ich leben und ob ich glücklich werden würde, all dies könnte davon abhängen, ob ich den ersten Regungen einer Zuneigung nachgeben oder diese eher beiseite schieben würde. Damals war alles möglich, mit ihm glücklich oder unglücklich, ohne ihn glücklich oder unglücklich zu werden.
Erst als ich im Bett lag und nach einigen Seiten Stendhal das Licht ausknipste, stieg allmählich die Erinnerung an jenes Ereignis in mir auf, das am selben Tag in aller Frühe und am anderen Ende des Landes geschehen war und mir nun vorkam wie eine Erinnerung an eine andere Welt, wie ein bloßes Traumgebilde. Und in diese Welt aus Bildern und Klängen sank ich schnell hinüber in einen Schlaf voll wirrer Träume, aus dem ich erst spät am folgenden Morgen erwachte.
Am nächsten Morgen wurde ich von den lauten Gesprächen meiner Kommilitoninnen in der Gemeinschaftsküche unseres Wohnheims geweckt. Ich ging schließlich schlaftrunken hinüber in den kahlen Raum, wo Marlène und Sylvie vor großen Kaffeetassen saßen und rauchten, vor ihnen ein bereits gut gefüllter Aschenbecher. Die neuesten Ereignisse waren bald berichtet, zumal ich aus irgendeinem Grund über mein Erlebnis vom vorangegangenen Morgen schwieg, ganz so, als handele es sich um eine zu intime Angelegenheit. Die beiden studierten »Jus«, wie man in der Schweiz sagt, und auch wenn wir uns als Freundinnen betrachteten, öffnete sich der Graben zwischen uns umso stärker, desto weiter wir uns auf das Ende des Studiums zubewegten. Wie wir so beisammen saßen, die beiden in Morgenmänteln, ich in einem Flanellpyjama, hatte ich das Gefühl, ich müsse um Marlènes Freundschaft kämpfen, das Gefühl, sie bewege sie sich von mir weg durch kaum merkliche Gesten und einen neuen Tonfall in ihrer Stimme. Schließlich stand ich auf und ging zurück in mein Zimmer, unschlüssig darüber, wie ich den freien Tag verbringen wollte.
In Fribourg war der September heller und sommerlicher als in meiner Heimat. Ein Gang ins nahegelegene Bad, das berühmte Motta-Schwimmbad, das schon damals über die großen 50-Meter-Bahnen verfügte, war eine naheliegende Möglichkeit, einen Sonntag vor Semesterbeginn zu verbringen. Anders als im Falle der Saane, die sich bekanntlich in engen Bögen um die Altstadt schlängelt und viele Bademöglichkeiten bietet, konnte man im Motta-Schwimmbad das Wasser nicht nur zur Abkühlung nutzen, sondern konzentriert einige Bahnen durch klares Wasser ziehen. Die Begeisterung für Sport, die viele meiner Mitschüler am Ende meiner Schulzeit ergriff, hatte ich nie nachvollziehen können, und doch hatte ich mir angewöhnt, morgens, in aller Frühe, in die Basse Ville zum Motta-Schwimmbad hinunterzuradeln und zusammen mit einer eingeschworenen Gemeinschaft von Frühschwimmern ins bisweilen klirrend kalte Wasser zu steigen. An diesem Sonntag war ich jedoch später dran, es waren bereits deutlich mehr Gäste als sonst vor Ort, und doch freute ich mich über das Glitzern auf der sich bewegenden Wasseroberfläche.
Ich brauchte einige Zeit, um meinen Rhythmus zu finden, das weit ausgreifende Kraulen mit der Schlagbewegung der Beine und dem Atem so zu synchronisieren, dass alle Elemente nahtlos ineinandergriffen wie in einem Uhrwerk. Unter mir zog der gekachelte Boden des Beckens dahin und in meinen Ohren rauschte das Wasser. Schon als kleines Kind habe ich die schönen Muster geliebt, die entstehen, wenn das Licht durch die sich bewegende Oberfläche auf den Grund des Beckens fällt.
Ich war aus dem Wasser gestiegen und schloss gerade für einen kurzen Moment die Augen unter der Außendusche, wo ich mir das chlorhaltige Wasser vom Leib spülte, da spürte ich eine kurze Berührung an meinem rechten Arm. Ich öffnete die Augen und sah Antoine, der mich im Vorbeigehen gestreift hatte und mir, ohne anzuhalten und nur von einer kurzen Kopfdrehung begleitet, ein leises »Pardon!« zuflüsterte, lächelnd wie ein kleiner Junge. Ich antwortete etwas verwirrt mit »Salut!« und tat so, als wäre ich keineswegs überrascht.
Er ging weiter zum Becken und seine Schritte hinterließen Fußabdrücke aus Wasser auf dem hellen, gelben Stein. Ich blickte erstaunt auf seinen schlanken und athletischen Körper, der auffallend sportlich war. Als er ins Wasser stieg, sah ich die Muskeln auf seinem Bauch und wandte etwas beschämt die Augen ab, ganz so, als hätte ich mich selbst bei einem zu aufdringlichen Blick ertappt.
In der Umkleidekabine zog ich meinen Badeanzug aus, trocknete mich ab und schlüpfte in einen Bikini. Ich setzte mich im Halbschatten der hohen Platanen auf mein Handtuch und zog die Zeitung, die ich gestern nicht zu lesen vermocht hatte, aus dem Rucksack. Als mein Blick über das Schwimmbecken glitt, sah ich Antoine in regelmäßigen Abständen aus dem Wasser tauchen und sah, dass er nicht kraulte, wie ich es tat, sondern offenbar ein Brustschwimmer war.
Aus meinen langen, hellbraunen Haaren tropfte das Wasser immer wieder auf die Zeitung, die ich mir auf die gekreuzten Beine gelegt hatte und die mir nun viel verständlicher und interessanter erschien als gestern im Zug. Im Kulturteil blieb ich an einer kurzen Meldung hängen, in der über eine Entdeckung in einem Archiv, über einen Brief Stendhals, berichtet wurde, der, so wurde gesagt, den Blick auf sein Werk völlig verändere. Ein sanfter Wind strich über meine Haut, auf der sich die Härchen gegen die Kühle sträubten. Es wurde nicht näher ausgeführt, worum es in Stendhals Brief eigentlich ging, und obwohl ich den kurzen Artikel mehrfach las, konnte ich nicht herausfinden, was genau in dem erwähnten Dokument Umstürzendes zutage trat. Der Name des Autors war nur als Kürzel daruntergesetzt – E. H. – offenbar ein Redaktor, der lediglich eine Meldung bearbeitet hatte.
Ich war gerade bei den weniger interessanten Lokalnachrichten aus Zürich angekommen, als ein einzelner kalter Tropfen auf meinen Oberschenkel fiel. Er stammte nicht aus meinen Haaren, sondern von Antoine, der sich neben mich gestellt hatte und mir über die Schulter sah, offenbar, um zu sehen, was ich da las. Ich erinnere mich noch, dass dieser Tropfen wie ein Meteorit einschlug und sich anfühlte wie eine Berührung. Er lief kalt an der Innenseite meines Schenkels nach unten.
»Il dit quoi, ton journal?«, fragte Antoine und legte sich auf den Rücken vor mir ins Gras. Ich erzählte ihm von Stendhals Brief, doch er lächelte nur und sagte, Stendhal sei ja nicht schlecht, aber Camus sei der Größte. Er hatte sich auf die Ellbogen gestützt und auf seinem Bauch glitzerten die Wassertropfen, während er mir erzählte, er wolle eines Tages nach Lourmarin fahren, wo Camus begraben sei, um den schlichten Grabstein zu sehen, auf dem beinahe nichts geschrieben stehe, nur die Lebensdaten, so habe er gelesen. Dieser Grabstein sei, so Antoine, als Camus’ letzter Text zu betrachten, der in seiner Klarheit und Einfachheit das Werk abschließe wie eine letzte Unterschrift.
Für einen kurzen Moment verspürte ich den Impuls, mich nach vorne zu lehnen, ihm einfach über den Bauch zu streichen und ihn zu küssen, doch stattdessen hörte ich ihm zu, während er davon schwärmte, wie schön der Süden sei, dass er Aix-en-Provence gut kenne und unbedingt von dort aus den Lubéron erkunden wolle. Von Camus hatte ich noch nicht viel gelesen, nur die allseits bekannten Romane, keine Essays, und so fühlte ich mich unsicher, als mir Antoine von einem Autor vorschwärmte, der damals, Mitte der 1980er-Jahre, bereits zu einem Klassiker geworden war.
Zu meiner Unsicherheit trug aber vor allem der Umstand bei, dass ich intensiver als je zuvor das Gefühl hatte, meinen Blick nicht von Antoines Augen abwenden zu können. Sein glänzendes Haar fiel ihm in pechschwarzen Strähnen ins Gesicht, und ich war mir unsicher, ob die dahinter aufblitzenden Augen nun hellgrün oder hellblau waren. In diesem Moment im La Motta verliebte ich mich in ihn.
Mit größter Aufmerksamkeit achtete ich auf Signale, die darauf schließen lassen könnten, dass es ihm ähnlich ging, dass auch er meinen Blick suchte, doch er wirkte so entspannt und redete so beiläufig, als wäre all dies für ihn nicht wichtig, als könnte er genauso gut mit jedem anderen Mädchen über jeden anderen Autor plaudern.
Irgendwann schlug er vor, noch einmal schwimmen zu gehen, und nach einigen Bahnen saßen wir in der Mittagssonne am Beckenrand nebeneinander, etwas fröstelnd, denn der Wind hatte aufgefrischt und die Sonne war hinter einer großen Wolke verschwunden. Unsere Beine baumelten im Wasser, als Antoine mich nach meinem Akzent fragte, und ich erinnere mich noch, dass er in dieser Frage selbst den ersten Wortteil nach Schweizer Art etwas stärker betonte – un áccent bízarre –, als es in Frankreich üblich ist. Ich erzählte ihm, woher ich kam, les Grisons, da sah ich, dass meine Mitbewohnerin Marlène ins Schwimmbad kam und sich umsah, als suchte sie jemanden. Sie entdeckte schließlich mich, und in dem Moment spürte ich, wie Antoines nasser Oberarm meinen berührte, ganz beiläufig. Doch ich konnte nicht reagieren, denn schon stand Marlène vor mir und sagte: »Deine Mutter hat angerufen. Es ist etwas passiert. Du sollst sie zurückrufen.«
»Je dois y aller«, sagte ich zu Antoine, ging sofort in die Umkleide und zog mich in großer Eile um. Als ich das Bad verließ, sah ich, dass Marlène sich mit Antoine unterhielt, der noch immer mit den Beinen im Wasser saß und durch seine nassen Haare zu ihr aufblinzelte. Ich entriegelte mit zittrigen Händen das Fahrradschloss und trat kräftig in die Pedale, um schnell voranzukommen. Auf dem Weg zurück zum Wohnheim, wo auf dem Gang unser Gemeinschaftstelefon an der Wand hing, versuchte ich verzweifelt eine Antwort auf die Frage zu finden, was geschehen sein könnte.
Nur selten benutzen wir das Telefon, da man sich unter Studenten in der kleinen Stadt ohnehin ständig über den Weg lief. Damals war das Telefonieren noch teuer, und wir hatten eine kleine Liste neben dem Telefon hängen, auf der wir notierten, wer wie viele Einheiten zu bezahlen hatte. Ich drehte die Wählscheibe mit zitternden Händen. Das Freizeichen ertönte zwei Mal, dann nahm meine Mutter ab. »Ich bin’s. Was ist passiert?«, sagte ich.
Ihre Stimme bebte, als sie mir erzählte, ihr Bruder Durs sei in Berlin verschwunden, seit einer Woche nicht in der Schweizer Vertretung erschienen, wo er als Hausmeister und Fahrer arbeitete, die Polizei habe sie angerufen, weil die Mitarbeiter der Vertretung sich Sorgen machten. Alle Verwandten seien kontaktiert, die Berliner Polizei habe heute früh in Anwesenheit einer Vertreterin der Schweizer Botschaft aus Bonn die Wohnung geöffnet, aber nichts gefunden, auch keinen Abschiedsbrief. Ich solle mich sofort melden, falls mein Onkel Kontakt mit mir aufnehme.
»Hab keine Angst, Mama«, antwortete ich, ein idiotischer Ratschlag, wie mir selbst sofort auffiel, denn natürlich war dieses Verschwinden beunruhigend, zumal mein Onkel Durs nicht zu spontanen Reisen oder zu Unzuverlässigkeit neigte. Wir versprachen uns gegenseitig, einander sofort zu kontaktieren, falls es etwas Neues gebe, und so verabschiedeten wir uns mit dem Gefühl, dass etwas sehr Ernstes geschehen sein musste. Ich hängte den Hörer auf und starrte das Telefon mit seiner Wählscheibe einen Moment rätselnd an. Noch heute habe ich die seltsam kraftlos-beige Farbe des Plastiks vor Augen. Dann ging ich den Gang hinab in mein Zimmer.
Dort setzte ich mich auf mein Bett und überlegte, fand aber keine Erklärung. Durs war mein Lieblingsonkel, ein stiller, ehrlicher Mann. Er hatte lange in Chur bei der Kantonalverwaltung gearbeitet und war dann über Kontakte nach Berlin gewechselt in den diplomatischen Dienst, auf der untersten Ebene, als Verwaltungsangestellter. Er war, so hatte ich ihn verstanden, eine Art Mann für alles, kümmerte sich um die Mittelverwaltung, den Dienstwagen, ja sogar den Garten der Vertretung. Ein Suizid schien mir ausgeschlossen, und die Vorstellung, Durs könne in kriminelle Machenschaften verwickelt sein, war schlicht grotesk. Während ich meine Badesachen zum Trocknen aufhängte, kreisten meine Gedanken weiter. Auch ein Badeunfall war unwahrscheinlich, denn mein Onkel war gesund und würde sich auf den Badeseen im Berliner Umland nicht zu unvernünftigen Abenteuern hinreißen lassen. Mir wurde klar, dass ich momentan nichts unternehmen konnte, um dieses Rätsel zu lösen, da fiel mein Blick auf die Zeitung, die ich aus meiner Badetasche genommen hatte. Ich schnitt den Artikel über Stendhals Brief sorgfältig aus und legte ihn in meine Ausgabe von Le Rouge et le Noir. Dann begann ich, meine Dinge für das beginnende Semester zu ordnen, Kurse aus dem Vorlesungsverzeichnis herauszusuchen und mir einen Überblick zu verschaffen.
Damals waren die formalen Anforderungen im Studium noch gering und man musste nur eine kleine Anzahl von Scheinen erwerben, um zum Examen zugelassen zu werden. Zu den Pflichtveranstaltungen für angehende Französischlehrer gehörten neben den Sprachübungen und der Sprachgeschichte einige literaturwissenschaftliche Kurse. Ich hatte bereits bei Erscheinen des Vorlesungsverzeichnisses einige Dinge ins Auge gefasst, erstellte mir nun aber einen präzisen Wochenplan, in den ich alle Kurse sorgfältig eintrug. Neben dem 18. Jahrhundert standen vor allem die großen Romane des 19. Jahrhunderts auf dem Programm, daneben Sprachgeschichte und Landeskunde. Im Frühling würde ich bereits meinen Abschluss machen, dann eine kantonale Nachprüfung in Graubünden durchstehen müssen und schließlich ins Schulpraktikum überwechseln. Mir schauderte bei dem Gedanken, dass mein Studium bereits auf der Zielgeraden war, dass der oft beschworene Ernst bald beginnen würde.
Am Abend arbeitete ich in einer der Studentenkneipen in der Altstadt, dem Café populaire