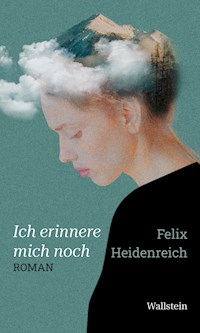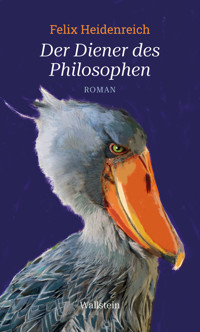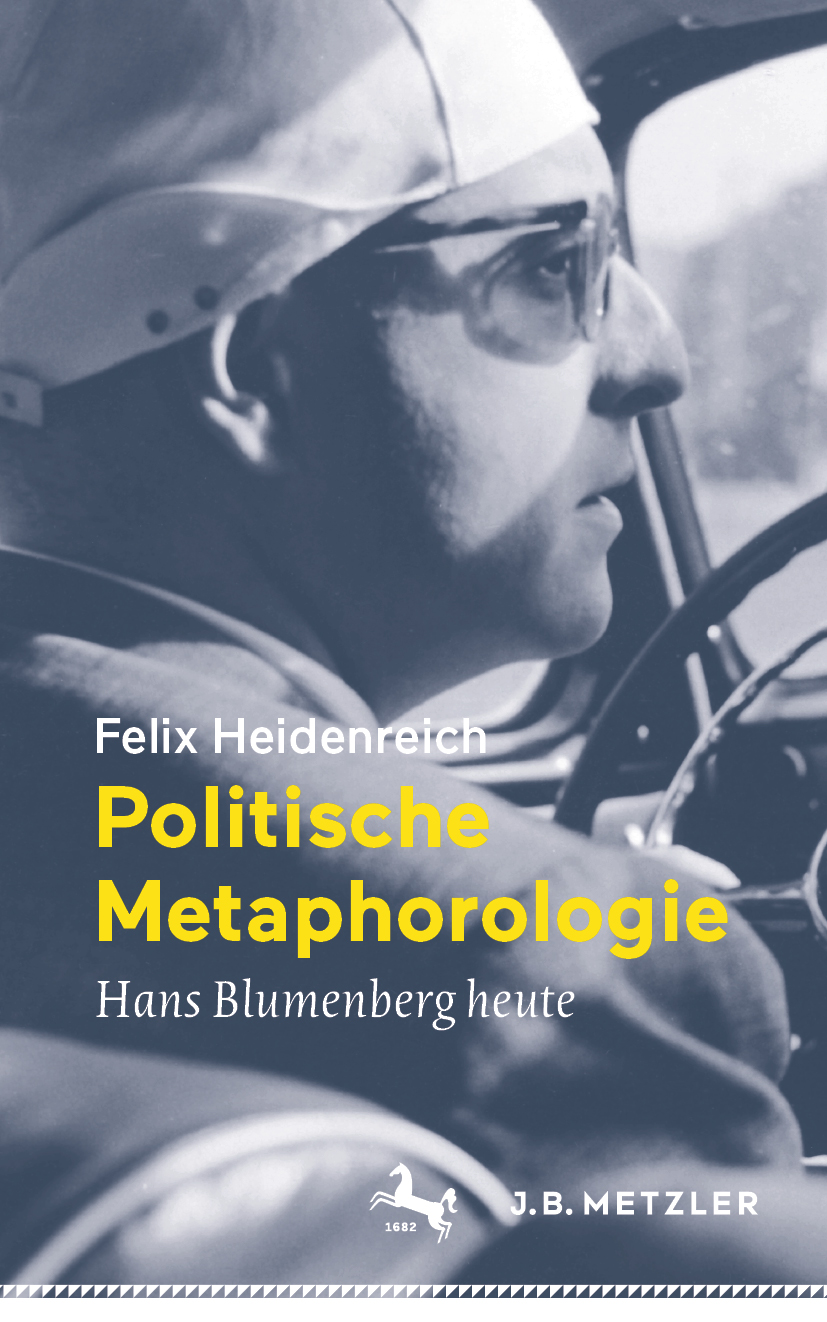19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was bedeutet das Ziel der Nachhaltigkeit für unsere Demokratie? Angeblich besteht ein Gegensatz zwischen dem Anspruch auf individuelle Freiheit einerseits und der ökologischen Notwendigkeit der kollektiven Selbstbeschränkung andererseits. Um einen Weg aus diesem vermeintlichen Dilemma aufzuzeigen, greift Felix Heidenreich in seinem grundlegenden Buch auf die republikanische Tradition der Demokratietheorie zurück. Wo der Liberalismus die Freiheit als individuelle Ungebundenheit feiert, konzipiert der Republikanismus Freiheit als kollektive Selbstbindung. Demokratie besteht dann nicht darin, einem Minimum an Regelungen unterworfen zu sein, sondern sich selbst als Koautor:in kollektiver Selbstbindungen zu verstehen, die den Aufbau nachhaltiger Lebenswelten ermöglichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
3Felix Heidenreich
Nachhaltigkeit und Demokratie
Eine politische Theorie
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der 2. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2388.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-77448-9
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Vorwort
1 Einleitung: Unser Haus brennt
1.1 Nachhaltigkeit – demokratieneutral?
1.2 Nachhaltigkeit: technisch, kulturell, lebensweltlich
1.3 Zwei Szenarien: Absturz oder weiche Landung
1.4 Ziel, methodische Vorbemerkungen und Struktur des Buches
2 Warum geschieht so wenig? Fünf idealtypische Antworten
2.1 Antwort 1: Fernstenethik als Moral für die technisierte Welt (Jonas)
2.2 Antwort 2: Ausdifferenzierung und Umweltwahrnehmung (Luhmann)
2.3 Antwort 3: Wettbewerb und der kollektive Tod der Trittbrettfahrer
2.4 Antwort 4: Verhaltensökonomik und Sozialpsychologie
2.5 Antwort 5: Kulturelle Fehlhaltungen und die sozialphilosophische Kritik des expressiven Individualismus
2.6 Welche Antworten überzeugen? – ein Zwischenfazit
3 Der Begriff der nachhaltigen Lebenswelt
3.1 »Lebenswelt« in der Philosophie und der Soziologie
3.2 Exkurs: Die Lebenswelt – »unbewusst«?
3.3 Lebenswelt als interagierendes Ensemble dreier Elemente
3.4 Die technisch-materielle Gestaltung von Lebenswelten
3.5 Das Politische als Gestaltung von Lebenswelten
4 Die »große Transformation«: liberal oder republikanisch?
4.1 Zwei Grammatiken politischen Denkens
4.2 Gestaltung von Lebenswelten: liberal oder republikanisch?
4.3 Warum Nachhaltigkeit nicht liberal zu organisieren ist
5 Der Republikanismus der Nachhaltigkeit
5.1 Statischer versus dynamischer Republikanismus
5.2 Nachhaltige Freiheit
5.3 Politisierung: Regelungsausweitung erzwingt höhere Input-Legitimation
5.4 Partizipation und Nachhaltigkeit trotz Komplexität und Distanz
5.5 Drei mögliche Strategien: Recht, Expertenbeiräte, Bürgerräte
5.6 Expertokratie, Meritokratie, Demokratie
6 Die autopaternalistische Regierung des Verhaltens: Drei Anwendungsfelder
6.1 Verbraucherdemokratie: Politik des nachhaltigen Konsums
6.2 Die Macht des Möglichen: Nachhaltige Mobilität gestalten
6.3 Digitale Lebenswelten für Nachhaltigkeit
6.4 Wie lässt sich die Theorie nachhaltiger Lebenswelten »anwenden«?
7 Schluss: Governance, Gouvernementalität und Demokratie der Nachhaltigkeit
7.1 Nachhaltigkeitsdiskurs zwischen der Politik und dem Politischen
7.2 Das Subjekt in der Gouvernementalität der Nachhaltigkeit
7.3 Demokratie der Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit der Demokratie
Dank
Fußnoten
Informationen zum Buch
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
7Vorwort
Als Greta Thunberg am 20. August 2018 einen »Schulstreik für das Klima« ausrief, begann eine neue globale Bewegung. Thunberg formulierte in kompromissloser Schärfe, was alle wussten oder wissen konnten: dass der globale Ressourcenverbrauch des Menschen für die Biosphäre untragbar ist und der in zahllosen Reden beschworene Umstieg auf einen nachhaltigen Lebenswandel so schnell wie möglich vollzogen werden muss. Zwar war dieser Aufruf an uns alle als Individuen adressiert, aber richtig ist auch, dass die daraus entstandene Fridays-for-Future-Bewegung zum politischen Handeln aufruft, zu Entscheidungen, die nicht nur individuell, sondern kollektiv bindend sind. Auch wenn seit Januar 2020 die Corona-Pandemie die öffentlichen Debatten dominierte und seit Februar 2022 mit dem Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine eine weitere aktute Krise die öffentliche Aufmerksamkeit in Beschlag nimmt, dürfte unstrittig sein, dass die langfristig größte Herausforderung für die Politik darin besteht, den Transformationsprozess hin zu einer nachhaltigen Lebensweise zu gestalten. Weniger konsensfähig ist indes die These, dass diese Transformation umfassende Folgen für die Praxis und den Begriff der Demokratie impliziert.
In diesem Buch möchte ich den Versuch unternehmen, diese Implikationen zumindest zu skizzieren. Dazu werde ich relevante Einsichten und Forschungsergebnisse aus sehr verschiedenen Wissens- und Forschungsfeldern zusammenführen und zur Beantwortung der Frage, was der Umbau hin zu einer nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise für die Vorstellungen und Praktiken der Demokratie bedeutet, synthetisierend verwenden. Dies nötigt zu einer inter- beziehungsweise transdisziplinären Arbeitsweise, ohne dass damit der Anspruch auf Stringenz und Konsistenz, der mit der Ausbildung spezifischer Methoden seit der neuzeitlichen Ausdifferenzierung der Wissenschaften verbunden ist, verabschiedet wird: Inter- und Transdisziplinarität darf nicht zur Disziplinlosigkeit werden. Und dennoch zwingt das Thema dazu, über Fächergrenzen hinweg zu denken.
Dass die Frage, wie Nachhaltigkeit und Demokratie auszusöhnen sind, nur in einem Zugang zu behandeln ist, der verschiede8ne methodische Ansätze zu Rate zieht, ist unmittelbar einleuchtend. Gerade die Komplexität und die Fülle des potenziell diskutierbaren Materials verführt nicht selten dazu, auch die Antwort sehr umfangreich ausfallen zu lassen. Ohne dieses Vorgehen kritisieren zu wollen, will ich im Folgenden doch einen anderen Weg beschreiten: nicht den einer im Doppelsinn erschöpfenden Diskussion des komplexen Themas, sondern den der Verdichtung. Dies führt dazu, dass Aussparungen und zusammenfassende Querverweise unvermeidlich werden und in vielen Fällen auf die ausführliche Darstellung von Argumentationen in vorliegenden Publikationen verwiesen werden muss. Den Leserinnen und Lesern soll auf diese Weise eine möglichst klare und lesbare Auseinandersetzung mit dem Thema geboten werden.[1]
91 Einleitung: Unser Haus brennt
Mit zunehmender Vehemenz machen sich die Anzeichen und Vorboten einer fundamentalen Krise bemerkbar, die in den Peripherien der Weltgesellschaft schon jetzt dramatische Ausmaße annimmt. Aber auch in den OECD-Ländern sind die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels in Gestalt extremer Wetterlagen, neuer Formen der Klimamigration, der Ausbreitung tropischer Krankheiten in der gemäßigten Zone und zahlreicher anderer Indikatoren nicht zu übersehen.[1] Es besteht kein Zweifel mehr: Unser Haus brennt. Verfalls- und Untergangsszenarien, die ihrerseits die Emotionalisierung und den Populismus befördern, haben Hochkonjunktur. Der Umbau hin zu einer anderen Form des Wirtschaftens und Lebens wird allseits beschworen und gefordert, auch wenn die Konkretisierungen nur langsam vorankommen. Die keineswegs neue »unbequeme Wahrheit« (Al Gore) lautet: Der Ressourcenverbrauch, der Lebensstil, die Konsumgewohnheiten der »Ersten Welt« sind erkennbar nicht nachhaltig.
Die Wissenschaft hat durchaus reagiert. Längst entstehen mit den Transformationswissenschaften und der Nachhaltigkeitswissenschaft[2] eigene Disziplinen, Fachgebiete und Studiengänge, die sich meist in einem transdisziplinären Rahmen damit beschäftigen, wie ein Umbau hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft möglich ist.[3] Allerdings stehen sie häufig tief im Feld der Klima-, Landwirtschafts-, Mobilitäts- und Energiepolitik und beschäftigen sich hauptsächlich mit »empirischen« Themen wie etwa Wasserversorgung, Urbanisierung oder demografischem Wandel, so dass weder 10Raum noch Zeit bleibt für die Bearbeitung der grundlegenden demokratietheoretischen Fragen: Wie lassen sich Nachhaltigkeit und Demokratie aussöhnen? Wie lässt sicht die Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft so gestalten, dass normative Ansprüche an unser Gemeinwesen weder durch einen ökologischen Nanny-State noch durch eine Expertokratie ausgehöhlt werden? Wie passen Nachhaltigkeit und Demokratie zusammen? Es liegt nahe, ihre Beantwortung der Politikwissenschaft und der Politischen Theorie zu übertragen, die sich jedoch nach wie vor primär auf begriffliche Grundlagen oder ideengeschichtliche Entwicklungen konzentrieren und bestenfalls am Rande für die praktische Seite nachhaltiger Entwicklung interessieren.
Dass die Problemstellung nach einer systematischen Begegnung von Theorie und Empirie verlangt, liegt auf der Hand.[4] Bereits die Idee der nachhaltigen Entwicklung hat einerseits eine empirisch messbare, deskriptiv operationalisierbare und nüchtern analysierbare Dimension und andererseits den Charakter eines moralischen oder sozialen Telos, einer »regulativen Idee« im Sinne Kants, einer performativ zu affirmierenden Richtschnur.[5] Gerade auf einer abstrakten Ebene besteht ein erstaunlich breiter, in zahllosen Par11teiprogrammen, Sonntags-, Kirchentags- und Parlamentsreden beschworener Konsens darüber, dass der Übergang zu einer nachhaltigen Entwicklung die zentrale Herausforderung der entstehenden Weltgesellschaft im 21.Jahrhundert darstellt.
Gerade der konsensuale Charakter des Ideals »Nachhaltigkeit« sollte indes zu denken geben. Längst ist »Nachhaltigkeit« als Topos oder bloße Phrase selbst zum Objekt empirischer Forschungen der Linguistik geworden.[6] In vielen Fällen droht der Begriff die Zielkonflikte zu verbergen, die eigentlich einer genuin politischen Auseinandersetzung bedürften, um umfassend legitimierte, kollektiv bindende Entscheidungen zu treffen.[7] In diesem Fall wird die Rede von der Nachhaltigkeit zu einem Instrument der Entpolitisierung, ja, sie kann zu einer regelrechten Ideologie werden, wenn die Zielsetzungen und die Wahl der Mittel als alternativlos dargestellt werden.[8]
Niklas Luhmanns Einwände gegen abstrakte Werte wie »Gerechtigkeit« könnten dann auch für »Nachhaltigkeit« gelten: Werte, so Luhmann, seien wie Luftballons; an Feiertagen würden sie aufgeblasen, während an Werktagen unauffällig die Luft herausgelassen werde.[9] Zur Handlungsorientierung in komplexen, funktional ausdifferenzierten Gesellschaften seien sie nur als rhetorisch notwendige, aber beinahe inhaltsleere »Kontingenzformeln« zu gebrauchen.[10]
Ich möchte hingegen einen Beitrag zur Repolitisierung des 12Nachhaltigkeitsbegriffs leisten und in diesem Buch der Frage nachgehen, welche demokratietheoretischen Folgen sich aus dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung ergeben.[11] Die leitende These lautet, dass das Ziel der nachhaltigen Entwicklung gegenüber den demokratischen Strukturen, Institutionen, Verfahren, ja selbst gegenüber fundamentalen demokratietheoretischen Begriffen wie »Freiheit« nicht neutral ist. Eine nachhaltige Gesellschaft wird nicht auf dieselbe Art und Weise politisch operieren und sich politisch verstehen können wie eine nichtnachhaltige. Vielmehr gibt es eine Art Rückkopplungseffekt, der von der Ebene der policy auf die Ebenen von polity und politics durchschlägt und den es genauer zu verstehen gilt, und zwar im Lichte der bereits thematisierten Verschränkung von empirischer und normativer Perspektive, ohne die Ebenen einfach zu vermischen. Dabei soll im Einzelnen ausgeführt werden, inwiefern normative Ziele konkrete politische Programme notwendig machen, die ihrerseits auf das Verständnis von Demokratie zurückwirken.
1.1 Nachhaltigkeit – demokratieneutral?
Mit meiner leitenden These widerspreche ich einer dominanten Sichtweise, die Nachhaltigkeit als primär technische Herausforderung versteht und in den entsprechenden Debatten und Diskursen eine im weitesten Sinne ingenieurwissenschaftlich-technische Rahmung der gesellschaftlichen Auseinandersetzung erzeugt: Nachhaltigkeit, so eine verbreitete Vorstellung, sei wie ein »End-of-Pipe«-Problem zu behandeln, bei dem durch technische Innovationen, Effizienzsteigerungen und die Erschließung neuer Ressourcen der Umbau zu einer nachhaltigen Lebensweise sozusagen auf der Hinterbühne der Gesellschaft erfolgen könne, ohne für die Bürgerinnen und Bürger wahrnehmbar zu sein. Diese technomorphe Verkürzung des Nachhaltigkeitsbegriffs führt dazu, dass die Nachhaltigkeitsdebatte heute in weiten Teilen ohne eine Beteiligung der Politischen Theorie stattfindet.[12] Während ingenieurwissenschaft13liche, ökonomische, rechtswissenschaftliche und soziologische Perspektiven sehr systematisch miteinander verzahnt werden, bleibt die Frage nach den demokratietheoretischen Implikationen des Begriffs »Nachhaltigkeit« meist ausgeklammert.[13] Im Folgenden möchte ich zunächst drei mögliche Gründe für diese Situation anführen, um genauer zu erläutern, warum eine Repolitisierung der Nachhaltigkeitsdebatte dringend geboten ist und gegen welche strukturellen Hindernisse diese erarbeitet werden muss.
(a) Der erste strukturelle Grund für die vergleichsweise schwache Präsenz demokratietheoretischer Überlegungen in der Nachhaltigkeitsdebatte hängt mit einer These zusammen, die viele normative und empirische Demokratietheorien unausgesprochen voraussetzen. Ihr zufolge sind die Begriffe und Begründungen der Demokratietheorie gegenüber den konkreten Inhalten und Politikfeldern neutral. Wenn beispielsweise John Rawls nach den »Grundstrukturen« einer gerechten Gesellschaft fragt oder Jürgen Habermas Bedingungen für gelingende demokratische Deliberation formuliert, so geschieht dies als Erläuterung formaler Bestimmungen unter Absehung von inhaltlichen Themen. Nach diesem Schema kann die Politische Theorie »Grundlagen«, »Formen«, Verfahren oder institutionelle Settings angeben, deren inhaltliche Füllung in einem zweiten Schritt erfolgen soll. Rawls’ Prinzipien oder Habermas’ Deliberationsregeln müssen auf Diskussionen über Gesundheitspolitik, Bildungspolitik oder Steuerpolitik gleichermaßen anwendbar sein. Bezogen auf die Frage der Nachhaltigkeit heißt das: Um den Umbau zu einer nachhaltigen Lebensweise zu gestalten, werden moderne Demokratien zwar vieles ändern müssen, zum Beispiel die Energiepolitik, den Ressourcenverbrauch und das Mobilitätsverhalten der Bürgerinnen und Bürger; was sie aber nicht ändern 14müssen, sind die Begriffe und Verfahren des demokratischen Willensbildungsprozesses. Diese Neutralität gegenüber einzelnen policies muss vorausgesetzt werden, wenn die Politische Theorie allgemeine Aussagen über die Legitimation politischer Institutionen und Verfahren erbringen will.[14] Die Frage eines Umbaus moderner Wirtschaftskreisläufe hin zu einem nachhaltigen Wirtschaften ist dann ein Problem unter vielen, ja vor allem: ein Problem wie andere auch.
Eine solche Perspektivierung des Problems ergibt sich sowohl für Rawls’ »ideale« Gerechtigkeitstheorie als auch für Habermas’ Konzept deliberativer Demokratie. Auch Axel Honneths Theorie demokratischer Sittlichkeit, Michael Walzers Kommunitarismus und Philip Pettits Neorepublikanismus behandeln beinahe ausschließlich die Beziehungen zwischen Menschen und setzen dabei deren Beziehung zu ihrer Umwelt einfach voraus.[15] »Gerechtigkeit«, »Herrschaft«, »Anerkennung« – alle diese Leitbegriffe der Politischen Theorie sind Relationsbegriffe, die sich auf die Beziehungen zwischen Menschen beziehungsweise zwischen Bürgerinnen und Bürgern beziehen, nicht auf ein System, in dem Mensch und Umwelt in Wechselwirkung gedacht werden.[16] Die Vorstellung, diese sozialen Beziehungen ließen sich in einem ersten Schritt formal ordnen, um dann in einem zweiten Schritt mit konkreten Inhal15ten gefüllt zu werden, gewinnt ihre Plausibilität nicht zuletzt durch die Nähe politischer Ordnungsvorstellungen zum Verfassungsrecht.
Auch hier findet sich seit dem Konstitutionalismus des 18.Jahrhunderts das Schema einer in Grundrechten und einer ausformulierten Verfassung definierten formalen Ordnung, die den politischen Willensbildungsprozess für die konkrete inhaltliche Bestimmung definiert.[17] Disziplinär reflektiert die Rechtswissenschaft diese Vorstellung in der Ausdifferenzierung von Staatsrecht, Strafrecht und Zivilrecht. Während das Staatsrecht gewissermaßen ein Gefäß darstellt, für dessen Umgestaltung besonders hohe Hürden gesetzt sind, können die Inhalte von Straf- und Zivilrecht einfacher geändert werden. Spielregeln einerseits und Spielzüge andererseits stehen sich hier scheinbar unvermittelt gegenüber.[18]
Das oben genannte Schema könnte man auf die Formel der Demokratieneutralität der Nachhaltigkeit bringen: Die »große Transformation«, von der der damalige Leiter des Potsdam-Instituts für Klimaforschung (PIK) Hans Joachim Schellnhuber im Zusammenhang mit dem Umbau zu einem nachhaltigen Wirtschaften sprach,[19] würde aus dieser Sicht unsere Demokratietheorie, unsere politischen Grundbegriffe (zum Beispiel Freiheit, Gleichheit, Men16schenwürde) unberührt lassen. Die nachhaltige Gesellschaft würde sich demnach technisch und vielleicht auch ökonomisch von der gegenwärtigen unterscheiden, nicht jedoch politisch. Eine politische Theorie nachhaltiger Lebenswelten wäre aus dieser Sicht gar nicht nötig, weil technische, soziologische oder städteplanerische Antworten die Transformation vollständig zu bewältigen in der Lage sind.
(b) Zur unterstellten Demokratieneutralität kommt zweitens eine sozialstrukturelle Komponente hinzu, die die Sonderstellung ökologischen Denkens im Spektrum politischer Ideologien aus einer wissenssoziologischen Perspektive verständlich macht. Anders als Begriffe wie »Tradition«, »Nation«, »Freiheit« oder »soziale Gerechtigkeit« hatte das Anliegen der Nachhaltigkeit keine weltanschaulich oder sozialstrukturell eindeutig zuzuordnenden Trägergruppen.[20] Konservatives Gedankengut konnte bei Grundbesitzern, Landwirten oder in Kirchenkreisen auf Unterstützung hoffen; liberale Ideen fanden ihre Bannerträger unter dem aufstrebenden Bürgertum, bei Selbstständigen und Unternehmern; die Lösung der sozialen Frage hatte mit den Industriearbeitern über einen gewissen Zeitraum eine Trägergruppe, bei der ebenfalls Ideen und Interessen konvergierten. Die ökologische Bewegung indes war seit ihren Anfängen eine heterogene Ansammlung verschiedenster Anhänger, deren Spektrum von linken Anarcho-Spontaneisten über adelige Grundbesitzer bis hin zu romantisch-konservativen Naturschützern reichte.[21] Man könnte dieses lose Band zwischen nachhaltiger Politik und denjenigen, die sich für sie einsetzen, auch so beschreiben, dass »Nachhaltigkeit« ein zu abstraktes Interesse darstellt, um tatsächlich politische Gruppen systematisch zu mobilisieren. Es gibt keine sozialen Gruppen, deren Interesse an Nachhaltigkeit spezifisch begründbar ist – während es sehr wohl Gruppen geben kann, die ein genuines Interesse an freien Märk17ten oder umfassender Sozialgesetzgebung haben. Anders als reaktionäres, konservatives, liberales oder sozial-emanzipatives Denken stieß eine mögliche politische Theorie der Nachhaltigkeit nicht auf eine durch soziale Milieus strukturierte Nachfrage. Erst die Fridays-for-Future-Bewegung leitete hier bis zu einem gewissen Grad einen Paradigmenwechsel ein: Es ist das Alter, die Zugehörigkeit zu einer Generation der (zukünftig) Betroffenen, die eine verbindende Motivation herstellt.
(c) Zu der nur lockeren Beziehung zwischen inkohärentem Ideenhaushalt und heterogener Trägergruppe kommt ein dritter Aspekt hinzu, der mit dem Zeitpunkt zusammenhängt, an dem sich so etwas wie ein ökologisches Bewusstsein zu formieren begann. Während die anderen Familien politischer Ideologien – Liberalismus, Konservativismus, Sozialismus – ihre Wurzeln im 17., 18. und 19.Jahrhundert haben (man denke an die wegweisenden Arbeiten von John Locke, Edmund Burke und Karl Marx), setzt die Verbreitung ökologischer Ideen zu einem Zeitpunkt ein, an dem »Weltbilder« oder »Meistererzählungen« bereits in eine Krise gerieten.[22] Jean-François Lyotards La condition postmoderne beschrieb 1979 eine bereits weitverbreitete Skepsis gegenüber den »méta-récits«.[23] Schon zu Beginn der 1970er Jahre ließ sich nicht mehr, wie noch im 19.Jahrhundert, ein schlüssiges Gesamtkonzept, eine in die Breite wirkende politische Theorie mit ideologisch-motivierender Kraft entwickeln. Konservativismus, Sozialismus und Liberalismus verfügten als politische Ideologien über entsprechende politische My18then und literarisch ausgemalte Utopien – die Ökologiebewegung indes konnte sich nur in Ansätzen auf ähnliche Elemente beziehen.[24] Zum Zwecke der Motivation konnte die Umweltbewegung vor allem auf Dystopien verweisen, auf Szenarien von Atomkatastrophen, saurem Regen, Waldsterben oder die schleichende Vergiftung von Natur und Mensch. Positive Szenarien mussten sich hingegen meist auf recht vage Vorstellungen einer künftigen Harmonie zwischen Mensch und Natur oder gar auf eine Rückkehr zu einer imaginierten ursprünglichen Einfachheit beschränken (vgl. unten, 2.5).
Die drei genannten Faktoren – die dominante These von der Demokratieneutralität der Nachhaltigkeit, die heterogene soziale Trägergruppe des Nachhaltigkeitsthemas und der Eintrittszeitpunkt des Themas in den Diskurs der Moderne – machen plausibel, warum die Politische Theorie die Frage der Nachhaltigkeit meist als nur ein Thema unter anderen behandelt. Warum und inwiefern das Thema Nachhaltigkeit auch eine demokratietheoretische Dimension enthält, ist vor diesem Hintergrund begründungsbedürftig. Eine solche Begründung werde ich einleitend dadurch leisten, dass ich die Bedeutung des politischen Ziels der Nachhaltigkeit für die Lebenswelten der Bürgerinnen und Bürger aufzeige. In einem ersten Problemaufriss ist herauszuarbeiten, dass eine nachhaltige Entwicklung nicht nur technische Innovationen, sondern auch einen kulturellen Wandel, ja eine Transformation der Lebenswelt in den industrialisierten Gesellschaften unvermeidlich macht. Dazu ist es jedoch nötig, zunächst einer auf die Dimension der Technik verkürzten Lesart des Begriffs der Nachhaltigkeit zu widersprechen.
1.2 Nachhaltigkeit: technisch, kulturell, lebensweltlich
Unter der Annahme der Demokratieneutralität von Nachhaltigkeit wird das Ziel der Nachhaltigkeit als bloß technische Herausforderung behandelt. Die Aufgaben des Ressourcenschutzes, des Klimaschutzes, ja der Nachhaltigkeit insgesamt sind aus dieser Sicht mit 19den Ideen, Begriffen und Institutionen, die seit Mitte des 18.Jahrhunderts entstanden sind, vollumfänglich zu bewältigen. Da die problematischen langfristigen Wirkungen menschlichen Handelns vor allem durch technische Innovationen möglich geworden sind, sei es auch eine technische Herausforderung, diese Wirkungen wieder zu minimieren. Heilen soll also jene Waffe, die die Wunde schlug. Wie bereits erwähnt, gibt es aus dieser Perspektive keinen strukturellen Unterschied, ob ein Parlament über die Gesundheitspolitik, die Verteidigungspolitik oder eben die Klimapolitik debattiert: Immer und überall sind Probleme komplex, durch internationale Verflechtung gekennzeichnet und betreffen mehr als eine Generation. Steuerreformen, Bildungspläne und die Frage des Klimaschutzes würden dann allesamt zu ein und derselben Kategorie von Entscheidungen gehören. Und die Hoffnung wäre, dass auch die »große Transformation« zumindest auf lange Sicht mit demselben Erfolg und mit ähnlich geringen Folgen für die demokratischen Institutionen bewältigt werden könnte wie andere Herausforderungen.
Diese Perspektive auf das Verhältnis von Nachhaltigkeit und Demokratie beansprucht mit Nachdruck einige Plausibilität. Ist Nachhaltigkeit nicht vielleicht doch ein »End-of-Pipe«-Problem, die Rede von der »großen Transformation« also eine bloße Übertreibung? Dann wäre Nachhaltigkeit tatsächlich »ein Fall für die Experten«, wie der FDP-Vorsitzende Christian Lindner behauptete.
In vielen Bereichen hat die Umweltpolitik in der Tat spektakuläre Erfolge erzielt, die vor wenigen Jahrzehnten undenkbar schienen. Die Luftqualität hat sich in vielen entwickelten Ländern rasant verbessert, das Wasser vieler Binnengewässer ist wieder trinkbar, das Waldsterben scheint wenn nicht gestoppt, so doch kontrollierbar geworden zu sein und das Ozonloch verkleinert sich, wenn auch sehr langsam.[25] Es ist also durchaus verständlich, dass jene, die einen technisch begründeten Optimismus verbreiten und die zahlreichen Beispiele für erfolgreiche Innovationen auflisten, öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen.[26] Nichtsdestotrotz ist die These, 20dass der Umbau hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft die demokratischen Institutionen, Begriffe und Verfahren unangetastet lässt, falsch. Nachhaltigkeit, so meine Behauptung, ist keine Herausforderung wie andere auch. Damit sind wir beim wohl entscheidenden demokratietheoretisch relevanten Streitpunkt angelangt. Er betrifft die Frage, ob technische Innovationen tatsächlich ausreichende Effizienzgewinne ermöglichen, um eine nachhaltige Wirtschaftsweise ohne massive Veränderungen des Lebenswandels zu bewerkstelligen. Die Debatte zwischen den Effizienztheoretikern und den Suffizienztheoretikern ist hier einschlägig.[27]
Es ist vor allem der Verweis auf die empirisch nachweisbaren Rebound-Effekte, der deutlich macht, dass technische Effizienzgewinne das Problem endlicher Ressourcen zwar verschieben, aber nicht beheben können.[28] Solange die Nachfrage schneller wächst, als die Effizienz gesteigert wird, ist nachhaltiges Wirtschaften unmöglich. Armin Grunwald ist daher zuzustimmen, wenn er seine ausführliche Diskussion dieser Frage mit dem Fazit schließt, die Hoffnung auf eine rein technische Lösung des Nachhaltigkeitsproblems bleibe illusionär.[29] Für alle zentralen Politikfelder wie die Klimapolitik, den Ressourcenschutz oder die Finanzpolitik lasse sich zeigen, dass weder der hohe Ressourcenverbrauch in den entwickelten Ländern noch das Konzept einer beständigen Steigerung von Produktion und Konsumption durch technische Innovationen nachhaltig zu 21gestalten sind. Technische Innovationen können die »große Transformation« zwar begünstigen (und tun dies auch in erheblichem Maße); solange jedoch die soziale Innovationsfähigkeit dahinter zurückbleibt und nicht zugleich eine Kultur der Nachhaltigkeit ausgebildet wird, werden alle Effizienzgewinne durch steigenden Konsum zunichtegemacht.[30] Besonders deutlich wird das Scheitern der Effizienzrevolution im Flugverkehr, wo die Effizienzsteigerungen minimal sind (und aufgrund der langen Betriebszeiten von Flugzeugen sehr langsam erfolgen), während die Nachfrage weiter wächst. Zudem muss man davon ausgehen, dass die Versuche der Effizienzsteigerung im Flugverkehr schon bald an physikalische Grenzen stoßen werden.[31]
Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass in der Nachhaltigkeitsdebatte mittlerweile ein zumindest von den Fachleuten (weniger vielleicht von der breiten Öffentlichkeit) geteilter Konsens darüber besteht, dass eine nachhaltige Entwicklung nur durch eine Kultur der Nachhaltigkeit möglich sein wird. Das von Claus Leggewie und Harald Welzer am Kultuwissenschaftlichen Institut (KWI) in Essen durchgeführte Projekt »Klimakulturen« hat diesen Umstand nicht nur öffentlichkeitswirksam zum Gegenstand gemacht, sondern durch zahlreiche Teilprojekte und Aktivitäten auch Wege aufgezeigt, wie eine Transformation der Kultur möglich ist.[32] Eine Kultur der Nachhaltigkeit – und in dieser Hinsicht ist der Begriff der »großen Transformation« sehr ernst zu nehmen – bedeutet dann aber einen epochalen Wandel, der wohl am ehesten 22mit dem Übergang von der hierarchisch stratifizierten Gesellschaft der europäischen Feudalordnung zur funktional ausdifferenzierten Gesellschaft moderner, rechtsstaatlich verfasster, demokratisch geordneter Marktwirtschaften zu vergleichen ist. Der Umbau hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft betrifft dann nicht nur die Produktionsweise, Stoffkreisläufe und Infrastrukturen, sondern auch die Gewohnheiten, die Erwartungen und die Selbstideale der Bürgerinnen und Bürgern, also die – in der treffenden Terminologie Harald Welzers – »mentalen Infrastrukturen«,[33] die impliziten Gewohnheiten und Standards in Konsum, Mobilität und Verhalten. Der Vergleich zur »Sattelzeit« (Reinhart Koselleck) des 18.Jahrhunderts wirft dann die Frage auf, ob diese Transformation revolutionär oder evolutionär, gesteuert oder emergent erfolgen wird. Um mein Projekt einer politischen Theorie nachhaltiger Lebenswelten in diesem Kontext zu verorten und die einleitend aufgerufene Herausforderung einer nachhaltigen Entwicklung präziser zu umreißen, möchte ich als Nächstes zwei Szenarien skizzieren, die zusammengenommen als Denkbild zur Konzeption des Transformationsprozesses dienen können.
1.3 Zwei Szenarien: Absturz oder weiche Landung
Vorhersagen über die Zukunft stehen in der Regel im Ruf, unwissenschaftlich zu sein. Nur in engen Teilgebieten wie der Demografie, der Klimawissenschaft oder der Epidemiologie können Modelle einen gewissen Grad an Zuverlässigkeit für sich beanspruchen, während technische Innovationen, soziale Verwerfungen oder eskalierende Konflikte und ihre Eigendynamiken nur schwer angemessen zu modellieren sind. Dies bedeutet aber nicht, dass sich die Sozialwissenschaften einer Beteiligung an der Identifikation von Zukunftsrisiken und Herausforderungen einfach enthalten können. Insbesondere die Politische Theorie bedarf auch eines »Möglichkeitssinnes« (Robert Musil), nicht nur eines Wirklichkeitssinnes. Um die Relevanz der in diesem Buch angestellten Überlegungen deutlich zu machen, reicht es, sich zwei idealtypische Szenarien vor 23Augen zu führen, die mögliche Formen einer Transformation zu einer nachhaltig operierenden (Welt-)Gesellschaft entwerfen. Sie heißen »Absturz« und »weiche Landung« und können im Rahmen einer reflektierten Analogie veranschaulicht werden.[34] Dazu stelle man sich die Weltgesellschaft als ein fliegendes Flugzeug vor, angetrieben und abhängig von endlichen Ressourcen wie karbonen Energieträgern (Erdöl und Erdgas), Metallen, Phosphat etc. Das System funktioniert, solange »Treibstoff«, also natürliche Ressourcen, und Externalisierungsoptionen in ausreichender Menge vorhanden sind. Politische Legitimation wird hier durch Rekurs auf gesellschaftlichen Wohlstand oder dessen Wachstum hergestellt;[35] die Gesellschaft operiert im Modus »dynamischer Stabilisierung«.[36]
Wie könnte die »Landung« dieses Flugzeugs (sprich: die Transformation der Weltgesellschaft) aussehen? Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder es gelingt, während des Flugs den Verbrauch drastisch zu senken und den Treibstoff zugleich durch erneuerbare Energien zu ersetzen oder in eine Kreislaufwirtschaft zu überführen; oder aber die Ressourcen gehen zu Ende, der Treibstoff ist irgendwann verbraucht, die Motoren setzen aus und das Flugzeug stürzt ab. Die »Grenzbegriffe«[37] dieses Denkbildes wären dann eine kaum spürbare, weiche Landung einerseits und der Crash, also der Kollaps oder Teilkollaps staatlicher Strukturen andererseits, der 24durch Stürme, Dürren, Überschwemmungen, Hungersnöte, Verteilungskämpfe, Klimamigration, ja inner- oder zwischenstaatliche »Klimakriege« provoziert würde.[38]
Dieses Bild ist in der Tat suggestiv und wie jede Analogie grundsätzlich hinterfragbar. Die im Szenario des Absturzes implizierte These lautet, dass es sich bei der ökologischen und sozialen Krise der Gegenwart in entscheidender Hinsicht um die Risikostruktur der Blase handelt. Diese bezeichnet einen langsamen Aufbau des Risikos (die Luft in der Blase wird allmählich mehr; die Haut der Blase allmählich dünner) – bis es zu einer schlagartigen Auslösung des Risikofalls kommt (plötzliches Zerplatzen). Diese Risikostruktur kennen wir von Aktienbörsen oder Immobilienmärkten, wo Blasen über Jahre aufgebaut werden und in vielen Fällen innerhalb weniger Stunden oder Tage zusammenbrechen. Andere Beispiele wären Felsstürze, Erosionslawinen oder in spezifischen Fällen Wassernot.[39] Bezogen auf die Abhängigkeit von karboner Energie und anderen natürlichen Ressourcen wie Phosphat würde dies bedeuten, dass die Abhängigkeit über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte aufgebaut wird, die Versorgung mit diesen Ressourcen jedoch abrupt abbricht.
Das zweite Szenario, das der »weichen Landung«, operiert mit der Hoffnung, dass die Verknappung von Ressourcen und die sich aus dem Klimawandel ergebenden Probleme nicht schlagartig eskalieren, sondern sich graduell ankündigen und daher in kleinen Schritten zu einer Reaktion nötigen. Steigende Energiepreise würden nach diesem Szenario langfristig den Ausbau erneuerbarer Energien attraktiver machen, zum schonenden Umgang mit Ressourcen anleiten, in kleinen und deshalb erträglichen Schritten 25einen neuen Lebenswandel herbeiführen. Nur am Rande sei darauf verwiesen, dass ein solches Szenario genau dann wahrscheinlicher wird, wenn die Sensibilität, die Wahrnehmung und wissenschaftliche Erforschung der künftigen Probleme gestärkt und diese öffentlich wirksam diskutiert werden.[40]
Es ist sinnvoll, sich die theoretischen Annahmen, die den beiden Szenarien zugrunde liegen, noch einmal genauer anzusehen, denn beide basieren, so scheint es, nicht nur auf unterschiedlichen wissenschaftlichen oder empirischen Einzelannahmen, sondern auch auf konkurrierenden Weltmodellen. Die leitende Hypothese des Szenarios »Absturz« besagt, dass Prozesse – sowohl soziale als auch biologische und physikalische – eine Eigendynamik entwickeln können, die sich der Steuerung entzieht. Blasen, Kipppunkt-Effekte, Phänomene sozialer Emergenz sind gefährlich, weil in ihnen Quantität in Qualität umschlägt.[41] Entsprechende Eigendynamiken befürchten viele Klimaforscher für das Klimasystem der Erde. Zu den möglichen Effekten der Selbstverstärkung gehören der Austritt von Methangas durch das Abschmelzen der Permafrostböden, der Kollaps des Golfstroms oder die Versalzung der Ozeane.[42] Auch hier gilt: Das Problem wächst zunächst quantitativ, scheint kalkulierbar – und kippt dann plötzlich durch einen qualitativen Sprung um in eine nicht mehr revidierbare, nicht mehr kontrollierbare Eigendynamik. Gerade die Komplexität des Phänomens des Klimawandels macht daher seine Gefährlichkeit aus. Dies gilt auch für die sozialen Folgen. Wie Menschen auf einen sinkenden Grundwasserspiegel und 26Nahrungsverknappung reagieren, ist ebenso schwer vorherzusagen, wie die physikalischen Prozesse in ihrer Komplexität nur schwer modellierbar sind.[43] Aufgrund der Komplexität, der kaum zu überblickenden Interaktion der Faktoren, sind diese Systeme also nichtlinear. Festzustellen, welche Wirkungen eine Handlung zeitigt, ist enorm anspruchsvoll. Will Steffen spricht daher zu Recht von einem »wahrhaft komplexen und teuflischen Policy-Problem«.[44]
Schauen wir nun auf die Vorannahmen des Szenarios »weiche Landung«. Hier wird implizit davon ausgegangen, dass die entscheidenden Prozesse linear ablaufen und in einem noch überschaubaren Tempo. Daher seien sie sowohl kalkulierbar als auch kontrollierbar und gestatteten entsprechende Anpassungen »während des Fluges«. Die unterstellte Linearität von Prozessen lässt zudem Raum für die regulierende Kraft von Marktmechanismen. Um ein Beispiel zu nennen: Eine wachsende Knappheit von Wasser bei steigender Nachfrage führt nur dann zu höheren Wasserpreisen und steigenden Investitionen in die Wassergewinnung, wenn diese Knappheiten keine qualitativen, sondern nur quantitative Veränderungen provozieren. Die Nachfrage nach Wasser darf in diesem Szenario also wachsen, aber sie darf ihren Artikulationsmodus nicht qualitativ verändern, beispielsweise indem Präferenzen mit Waffen statt mit Geld durchgesetzt werden.
Es lässt sich leicht sehen, wie sehr diese konkurrierenden Szenarien samt den ihnen zugrunde liegenden ontologischen Annahmen die Bewertung von Marktmechanismen beeinflussen.[45] Wer kon27stante Wirkungsketten annimmt, kann darauf hoffen, dass Marktprozesse immer auf einen Mittelwert tendieren. Blasenbildungen sind aus dieser Sicht zwar unschön, aber prinzipiell nichts weiter als ruckartige Marktanpassungen. Soziale Ordnung ist aus dieser Perspektive möglich, weil soziale Interaktion auf linearen Mechanismen basiert; sie kann daher den Individuen relativ große Verhaltensspielräume lassen, weil diese wie in einem Rückkopplungssystem steuernd reagieren können. Abweichungen von der Norm sind tolerabel, weil deren allmähliche Rückanpassung an den Mittelwert zu erwarten ist. Geht man jedoch davon aus, dass soziale wie physikalische Prozesse stets Gefahr laufen, der Steuerbarkeit vollends zu entgleiten, erhöht sich die Legitimation, diesen Moment zu verhindern. Wo soziale Emergenz droht, ist soziale Steuerung nötig und legitim; Panik ist dann beispielsweise durch entsprechende Infrastrukturen systematisch zu vermeiden.[46]
Zweifelsohne finden wir in der Welt – in der physikalischen ebenso wie in der sozialen – sowohl lineare als auch nichtlineare Prozesse, die in einem Wechselverhältnis stehen. Daher kann es keine abschließende wissenschaftliche Antwort auf die Frage geben, welches Szenario wahrscheinlicher ist. Die beiden Grenzbegriffe »weiche Landung« und »Absturz« können indes verdeutlichen, warum die politiktheoretische Reflexion der nachhaltigen Entwicklung dringend geboten ist und worin ihre Aufgabe besteht: aus der Perspektive der Demokratietheorie zu einer »weichen Landung« beizutragen.
1.4 Ziel, methodische Vorbemerkungen und Struktur des Buches
Wenn die These von der Demokratieneutralität der Nachhaltigkeit falsch ist, wenn also richtig ist, dass sich vielmehr Form und Inhalt wechselseitig beeinflussen, ergeben sich zahlreiche Konsequenzen. Es ist damit zu rechnen, dass die Zielsetzung des nachhaltigen Lebenswandels sich auf die Struktur von Demokratien auswirken wird, dass neue Institutionen und Verfahren entstehen und etablierte Ordnungsvorstellungen zweifelhaft werden. Die Demokratie28theorie steht damit vor einer enormen Herausforderung und muss Antworten auf Fragen wie die folgenden liefern: Wie kann Demokratie Nachhaltigkeit umsetzen? Welche demokratischen Verfahren, Institutionen und Leitbilder tragen dazu bei, die Umsetzung von Nachhaltigkeit wahrscheinlich zu machen? Und welche sind in dieser Hinsicht eher hinderlich? Dazu ist es jedoch nötig, dass die Demokratietheorie ihr tradiertes begriffliches Instrumentarium, das im Wesentlichen aus dem 19.Jahrhundert stammt, grundlegend überdenkt. Dies betrifft nicht nur verfassungsrechtliche Grundbegriffe wie »Souveränität« und »Legitimation«, sondern auch kulturell so fest verankerte Begriffe wie »Freiheit«.
Die erforderliche Neuausrichtung der Demokratietheorie auf Nachhaltigkeit lässt sich auf zwei verschiedene Weisen bewerkstelligen. Die erste besteht in der Modellierung einer »idealen Theorie« nachhaltiger Demokratie. Hier greifen allerdings sofort jene Argumente, die im Rahmen einer breiten Debatte gegen »ideale Demokratietheorien« vorgetragen wurden, zum Beispiel von Raymond Geuss, der mit seiner Polemik gegen die Weltfremdheit der normativen politischen Theorie im Gefolge Rawls’ die Debatte ins Rolle gebracht hat, aber auch von Amartya Sen, der an Modellbildungen kritisiert, dass sie sich nicht für die Bedingungen ihrer Umsetzung interessieren.[47] Und gerade beim Thema »Nachhaltigkeit« besteht die Gefahr, durch die Konstruktion idealer Modelle eine Art nachhaltiges Wolkenkuckucksheim zu entwerfen, das sich nicht oder nur in außergewöhnlichen Einzelprojekten umsetzen lässt.[48] Solche »Leuchtturmprojekte«, die zeigen sollen, was möglich ist, sind aber nur dann sinnvoll, wenn die entsprechenden Lösungen auf die Gesellschaft insgesamt hochskaliert werden können.[49] Es gilt, was Honneth mit Blick auf Rawls’ Gerechtigkeitstheorie gezeigt hat: Sobald nach ihrer »Umsetzung« oder »Anwendung« gefragt wird, 29werden ideale Modelle oder Theorien genau um diejenigen Aspekte relativiert, die zuvor als ihr Abstraktionsgewinn ausgegeben wurden.[50]
Vielversprechender als der Weg der »idealen Theorie« ist eine zweite Herangehensweise, die dem Sein nicht ein abstraktes Sollen gegenüberstellt (ein Vorwurf, der klassischerweise gegen Kants praktische Philosophie erhoben wird), sondern vielmehr erfolgreiche Beispiele in der Wirklichkeit aufspürt und deren Erfolgsfaktoren abstrahierend herausarbeitet. Eine solche »Rekonstruktion« hat dann zwar kein vollständiges, kohärentes, in sich geschlossenes Modell zum Ergebnis, bietet jedoch einen Werkzeugkasten, gefüllt mit diversen realistischen Optionen.[51] Sie hat zudem den Vorteil, dass sie die Bedingungen ihrer Umsetzung nicht nachträglich einpreisen muss, sondern von Anfang an in Rechnung stellt.[52] Anders als in Honneths »normativer Rekonstruktion« oder Hans Joas’ »positiver Genealogie« werde ich im Folgenden versuchen, dabei mit einem Minimum an heuristischen Voraussetzungen zu arbeiten.[53]
Ich wende mich mit meinen in diesem Buch präsentierten Überlegungen außerdem gegen die durchaus verbreitete pessimistische Sicht, die unter Hinweis auf verschiedene Merkmale von Demokratien behauptet, Demokratie und Nachhaltigkeit seien schlicht inkompatibel.[54] Demokratien könnten keine Nachhaltigkeit, so wird 30behauptet, wegen der kurzfristigen Orientierungen politischer Eliten entlang von Legislaturperioden und aufgrund eines dominanten Schemas der »Legitimation durch Wohlstand«, aber auch weil sie durch zu viele Veto-Spieler gelähmt, zu unerträglich langsamen Verfahren gezwungen und durch die Garantie individueller Freiheitsrechte, die auch klimaschädliche Formen der Selbstentfaltung schütze, gebunden seien.[55]
Diese Inkompatibilitätsthese wird in zwei Varianten vertreten. Die erste Variante wird von einer Bewegung vertreten, die unter dem Begriff »Survivalism« bekannt geworden ist und dafür plädiert, bestimmte demokratische Verfahrensweisen zur Stärkung der Effizienz zumindest temporär auszusetzen.[56] Die in diesem Umfeld formulierten Szenarien entfalten ein Amalgam aus Plädoyer und Prognose, beschreiben und fordern gleichermaßen ein stärker autoritäres Regieren, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Im Hintergrund scheint dabei eine Gedankenfigur zu stehen, die aus dem Dezisionismus Carl Schmitts bekannt ist: Im Ausnahmezustand, in der akuten Gefahrensituation, ist es wichtiger, dass gehandelt wird, als was getan wird. Da die ökologische Krise auf diesen Punkt zusteuere, sei damit zu rechnen, dass früher oder später ein solcher Aufstieg autoritärer Regime beginnen werde. Diese erste Variante würde auf einen »harten Autoritarismus« hinauslaufen – mit kompromisslosen Grenzregimen, erzwungenen Impfungen, strikter Rationierung von Versorgungsgütern und präemptiver Umsiedlung potenzieller Flutopfer (inklusive ihrer Zwangsenteignung).[57]
Die zweite Variante ist weicher und lässt sich als »postdemo31kratisch« bezeichnen. Unter »Postdemokratie« versteht man in der Regel die Aushöhlung formal funktionierender demokratischer Institutionen durch eine primär ökonomische Elitenherrschaft.[58] Nach dieser Lesart sind es schon jetzt die großen Konzerne, die »institutionellen Anleger« (also große Investmentfonds und Versicherungsgesellschaften) sowie parademokratische Institutionen wie etwa die Weltbank, die die Demokratien steuern, ohne dass dies durchweg transparent würde. Daher ist in dieser Variante mit einer Ausweitung »weicher« Expertenherrschaft, mit sanfter Expertokratie zu rechnen, die sich eher nicht in spürbarer exekutiver Autoritätsausübung äußert (inklusive der Einschränkung von Bürgerrechten), sondern vielmehr Formen der weichen Steuerung annimmt, vor allem aber der verstärkten Input-Kanalisierung. Demokratische Wahlen werden dann darüber entscheiden, wer die Weisungen von Expertengremien, Kommissionen und Beiräten umsetzt, nicht so sehr, ob man es tut. Während der »harte Autoritarismus« eine Art erkennbare Ökodiktatur darstellen könnte, würde diese Variante einer schleichenden Entdemokratisierung vor allem mit technisch-wissenschaftlicher Legitimation arbeiten. Diese oder jene Maßnahme, Verhaltens-, Ernährungs- oder Arbeitsweise ist dann eben »alternativlos« und wird mehr oder weniger unauffällig anempfohlen oder anerzogen.[59]
Ziel dieses Buches ist die Entwicklung einer Alternative zu diesen beiden Varianten, das heißt einer dritten Variante, die zeigt, unter welchen Bedingungen die Transformation zu einem nachhaltigen Wirtschaften die Demokratie in der Tat transformiert, dabei aber die Qualitätsansprüche an Demokratie erhöht und nicht absenkt. Zu diesen Bedingungen gehört zwingend die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und sie impliziert die Demokratisierung von gesellschaftlichen Bereichen, die bisher demokratischer Kontrolle entzogen waren, wie in Kapitel 6 deutlich werden wird. Eine solche Weiterentwicklung von Demokratie durch das Ziel der Nachhaltigkeit hat jedoch bestimmte Voraussetzungen, die neue normative, institutionelle und konzeptionelle Fragen aufwerfen. Deren ausführliche Diskussion (Kapitel 4) soll den Blick für jene 32Prozesse schärfen, an denen sich beobachten lässt, wann die Herausforderung der Nachhaltigkeit und die sich bereits ankündigende Ressourcenverknappung katalytisch auf positive Tendenzen in der Demokratieentwicklung wirken. Dazu werde ich die breiten und ausdifferenzierten Debatten der Politischen Theorie mit jenen Diskursen und Praktiken in Verbindung setzen, die in der globalen Nachhaltigkeitsbewegung zu finden sind (Kapitel 5.5).
Die Frage, warum trotz wachsenden Bewusstseins die Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft so langsam vonstattengeht, ja in manchen Bereichen gar nicht abzusehen ist, hat die Sozialwissenschaften seit den 1970er Jahren beschäftigt. Das diesbezügliche value-action gap betrifft hier nicht mehr nur Individuen, sondern ganze Gesellschaften. In Kapitel 2 werde ich zunächst fünf idealtypisch zugespitzte Antworten auf diese Frage rekapitulieren: eine philosophische, die auf eine »Fernstenethik« (Hans Jonas) abhebt (2.1), eine systemtheoretische, die die Differenz zwischen gegebenem Problembewusstsein und nicht gegebener Handlungsbereitschaft mit der funktionalen Ausdifferenzierung moderner Gesellschaften erklärt (2.2), eine spieltheoretische, die das Problem der Nachhaltigkeit aus der Perspektive der Theorie der rationalen Wahl als ein Exempel des Gefangenendilemmas konzipiert (2.3), eine sozialpsychologische, die den Blick auf teils unbewusste gewohnheitsmäßige Verhaltensmuster lenkt (2.4), und schließlich eine im weiten Sinne ideologiekritische, die auf gesellschaftliche Blockaden hinweist, die unter anderem auf das Konto des expressiven Individualismus gehen (2.5).
Im Anschluss daran werde ich in Kapitel 3 einen synthetisierenden Vorschlag unterbreiten, der mittels des Begriffs einer nachhaltigen Lebenswelt das Zusammenspiel von Akteur, Anreizstruktur und Kultur nachvollziehbar machen soll. In Abgrenzung zu den in der Philosophie und in den Sozialwissenschaften üblichen Verwendungsweisen von »Lebenswelt« – bei Edmund Husserl und Hans Blumenberg einerseits, bei Alfred Schütz und Jürgen Habermas andererseits (3.1.) – soll der Begriff hier die Wechselwirkung zwischen Akteur und soziotechnischem System konzeptualisieren, die anhand dreier Schlüsseltexte von Denis Diderot, Günther Anders und Bruno Latour veranschaulicht wird (3.2). Die entscheidende Pointe dieser Begriffsbildung besteht darin, die Vorstellung von einem neutralen Staat, der die Frage nach dem guten Leben in die 33private Verfügung der Bürgerinnen und Bürger entlassen kann, als unplausibel auszuweisen (3.3) und die Grenzen des liberalen Paradigmas im Kontext der Nachhaltigkeitsfrage aufzuzeigen.
Um diese Grenzen jedoch exakt ziehen zu können, werde ich in Kapitel 4 zwei demokratietheoretische Großparadigmen auf ihre Eignung hin prüfen, die »große Transformation« zu einer nachhaltigen Gesellschaftsordnung zu bewerkstelligen. Dazu werde ich zunächst die Leitunterscheidung von liberalen und republikanischen politischen Ordnungsvorstellungen rekonstruieren (4.1) und Argumente vortragen, die zu dem Ergebnis führen, dass die republikanische Grundintuition die besseren Karten hat. Auf der Basis einer Differenzierung zwischen statischem und dynamischem Republikanismus lässt sich dann deutlich machen, unter welchen Umständen nachhaltige Lebenswelten durch republikanische und deliberative Mechanismen einer kollektiven Selbstbindung gestaltbar werden (4.2).
Der Umriss eines Republikanismus der Nachhaltigkeit muss jedoch auch auf seine Aporien hin befragt werden. Das geschieht in Kapitel 5. Zu den zentralen Elementen dieser Perspektive gehört eine Neudeutung des Begriffs der Freiheit (5.1), die, um nachhaltig zu sein, auf die Qualität, nicht die Quantität von Optionen zielen muss. In einer Auseinandersetzung mit verschiedenen Fassungen des Freiheitsbegriffs werde ich zeigen, inwiefern sich Freiheitsideale bereits heute verändern und eine Konzeption republikanischer Freiheit präsentieren, die bereits gelebte Praxis ist. Im Anschluss daran widme ich mich dem Verhältnis von Wahrheit und Demokratie und der Frage, wie sich das konflikthafte Verhältnis zwischen Bürgern und Expertinnen institutionell so gestalten lässt, dass eine fruchtbare Dynamik entsteht (5.2). Danach diskutiere ich verschiedene institutionelle Settings zur Bearbeitung des Zielkonflikts zwischen quality und equality (5.3) und setze die daraus gewonnenen Erkenntnisse abschließend erneut in Bezug zum normativen Ideenhaushalt des Republikanismus (5.4).
In Kapitel 6 werde ich dann anhand von drei Politikfeldern durchexerzieren, welche Konsequenzen die eingenommene Perspektive entfalten kann. In den Themengebieten der Konsumentendemokratie (6.1), der Mobilitätspolitik (6.2) und bezogen auf den Prozess der Digitalisierung (6.3) wirft die Theorie nachhaltiger Lebenswelten neues Licht auf aktuelle Fragen. Auf allen drei Po34licy-Feldern soll anhand erfolgreicher Projekte rekonstruiert werden, wie nachhaltige Demokratie gelingen kann und inwiefern die Perspektive des Republikanismus der Nachhaltigkeit dazu beiträgt, Probleme und Zielkonflikte in einer spezifischen Art und Weise zu beschreiben.
Das abschließende Kapitel 7 wird die Ergebnisse zusammenfassen und in der Form eines Ausblicks skizzieren, welche weiteren Forschungsfelder sich aus der in diesem Buch entwickelten Perspektive ergeben. Zudem werden die erarbeiteten Resultate zu möglichen Positionen in der Frage nach der Zukunft der Demokratie ins Verhältnis gesetzt. Dabei ist unter anderem wichtig, dass die Analysen dieses Buches ein neues Licht auf die Ambivalenz des Nachhaltigkeitsbegriffs werfen, der dazu dienen kann, politische Entscheidungen durch Verweis auf Sachzwänge zu entpolitisieren (7.1). Zum anderen ist eine Demokratie der Nachhaltigkeit als Gouvernementalität der Nachhaltigkeit auch daraufhin zu untersuchen, inwiefern sie Bürgerinnen und Bürger auf spezifische Weise »subjektiviert« und welche Machtbeziehungen in ihr wirken (7.2). Vor dem Hintergrund einer unbestreitbaren Krise der liberalen Demokratien, die von Populismus, neuem Nationalismus, autoritärem Denken und einer Sehnsucht nach einfachen Lösungen heimgesucht werden, wird abschließend die Frage nach der Nachhaltigkeit der Demokratie aufgeworfen. Was bedeutet es für unser Verständnis von Demokratie, wenn wir diese nicht nur als Mittel zur Gewinnung von Nachhaltigkeit, sondern auch als nachhaltig schützenswertes Gebilde verstehen (7.3)?
352 Warum geschieht so wenig? Fünf idealtypische Antworten
Längst ist der Nachhaltigkeitsdiskurs in der breiteren Öffentlichkeit fest etabliert und wird durch viele staatliche, nichtstaatliche und parastaatliche Institutionen, NGOs, Nachhaltigkeitsbeiräte (wie den Rat für Nachhaltige Entwicklung [RNE] in Deutschland), aber auch durch politische Stiftungen und von der Politik selbst vorangetrieben. In großer Zahl benutzen Zeitschriften, Fernsehsender und Bürgerbeteiligungsformate das Wort »Nachhaltigkeit« werbewirksam in ihren Selbstdarstellungen. Und auch im wissenschaftlichen Feld werden die möglichen Konsequenzen einer Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft intensiv diskutiert, insbesondere im Rahmen der Debatte um die »Transformationswissenschaft«.[1] Es handelt sich also um einen beinahe unüberschaubaren Diskurs, den ich in diesem Kapitel ein wenig entwirren möchte, indem ich fünf idealtypische Antworten herausarbeite, und zwar auf die Frage, warum angesichts der sich anbahnenden ökologischen Krise so wenig geschieht und wie man das ändern könnte. Meine Rekonstruktion zielt in keiner Hinsicht auf Vollständigkeit, zumal die Debatten in den jeweiligen nationalstaatlich verfassten Öffentlichkeiten unter je spezifischen Bedingungen stattfinden, sondern auf systematische Nützlichkeit. Sie soll ein geordnetes Spektrum an Problembeschreibungen und daraus resultierenden Handlungsoptionen präparieren und zugleich die entsprechenden Ansätze auf ihre Plausibilität prüfen.
362.1 Antwort 1: Fernstenethik als Moral für die technisierte Welt (Jonas)
Ein erster Typus von Ansätzen interpretiert die ökologische Krise der Gegenwart als Ausdruck einer moralischen Krise.[2] Sie liege darin begründet, dass in den hochentwickelten Gesellschaften der Gegenwart die technischen Möglichkeiten, das Niveau sozialer Komplexität und die ethischen Leitvorstellungen nicht mehr zusammenpassen. Paradigmatisch formuliert wird diese These von Hans Jonas in seinem berühmten Werk Das Prinzip Verantwortung von 1979, das international bis heute eine herausragende Wirkung entfaltet.[3]
Die historische Diagnose, die Jonas in diesem Buch formuliert, lautet, dass es gegenwärtig (das heißt: Mitte des 20.Jahrhunderts) im Wesentlichen zwei Moralkonzeptionen gibt, die mit Blick auf die aktuellen Problemlagen gleichermaßen unbefriedigend bleiben.[4] Das ist zum einen die Nächstenethik tribal organisierter Gesellschaften, welche die Verantwortung auf jene Personen bezieht, die dem Handelnden bekannt oder direkt präsent sind. Der Aufruf, 37gegenüber dem Nächsten gut zu handeln oder die eigene polis auch unter Einsatz des eigenen Lebens gegen äußere Feinde tapfer zu verteidigen, ist jedoch nur unter der Bedingung linearer, übersichtlicher, ja »anschaulicher« Kausalketten erfolgversprechend. Der Handelnde muss den Nächsten sehen, auf ihn einwirken können (in der neutestamentlichen Variante einer Nächstenethik); er muss wissen, wer Feind und wer Freund ist und welche Tugendvorstellungen in seiner Gemeinschaft gelten (in der Aristotelischen Variante einer Nächstenethik). Diese Bedingung ist in hochkomplexen modernen Gesellschaften nicht mehr gegeben. Sowohl die christliche als auch auf Aristoteles zurückgehende antike Tugendethik können folglich nur unter vormodernen Bedingungen als Skript sozialer Koordination dienen, so Jonas.
Die zweite Moralkonzeption im Angebot ist die Prinzipienethik, die laut Jonas in Reaktion auf gewisse Schwächen der Nächstenethik entstanden ist. Wenn in Platons Politeia unklar wird, was genau es heißt, jedem das Seine zu geben, müssen Ideen, abstrakte Prinzipien an die Stelle einer intuitiv verfahrenden Nächstenethik rücken. Gerechtigkeit besteht dann darin, der Idee des Guten entsprechend zu verfahren und dafür auch negative praktische Folgen in Kauf zu nehmen, also beispielsweise einen Justizirrtum zu ertragen, wie es Sokrates in der literarischen Inszenierung durch Platon in der Apologie und den Dialogen Kriton und Phaidon vorlebt. Dass Cicero den Begriff der Pflicht (officium