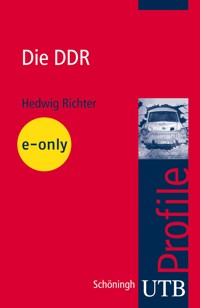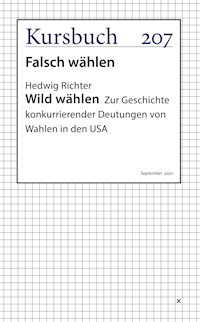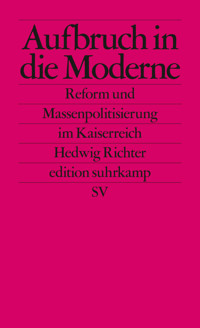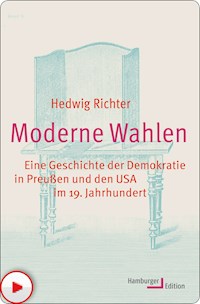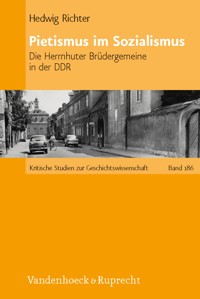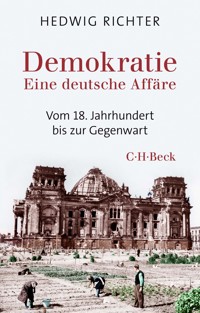
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dass alle Menschen – wirklich alle! – gleich sein sollen, galt die längste Zeit als absurd. Die Historikerin Hedwig Richter erzählt, wie diese revolutionäre Idee aufkam, allmählich Wurzeln schlug, auch in Deutschland, und gerade hier so radikal verworfen und so selbstverständlich wieder zur Norm wurde wie nirgends sonst. Politikverdrossenheit und geringe Wahlbeteiligungen lassen die Alarmglocken schrillen. Demokratie in der Krise! Doch von Anfang an bedurfte es besonderer Anstrengungen – von Alkohol über Geld bis zum staatlichen Zwang –, um Menschen zur Wahl zu bewegen. Ein besserer Gradmesser für die Demokratisierung ist daher der Umgang mit dem menschlichen Körper: die Abschaffung von Leibeigenschaft und Prügelstrafen, der steigende Wohlstand, die Humanisierung der Arbeit, die gleiche Behandlung der Geschlechter. Hedwig Richter erzählt die Geschichte der Demokratie als eine Chronologie von Fehlern, Zufällen und Lernprozessen, in deren Zentrum der Zivilisationsbruch des Holocaust steckt. Ihr anschauliches Buch konzentriert sich auf Deutschland, weil gerade an der deutschen Affäre mit der Demokratie deutlich wird, wie international verflochten die Wege zu Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hedwig Richter
DEMOKRATIE
EINE DEUTSCHE AFFÄRE
Vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart
C.H.Beck
ZUM BUCH
Politikverdrossenheit und geringe Wahlbeteiligungen lassen die Alarmglocken schrillen: Demokratie in der Krise! Doch von Anfang an bedurfte es besonderer Anstrengungen – von Alkohol über Geld bis zum staatlichen Zwang –, um Menschen zur Wahl zu bewegen. Ein besserer Gradmesser für die Demokratisierung ist daher der Umgang mit dem menschlichen Körper: die Abschaffung von Leibeigenschaft und Prügelstrafen, der steigende Wohlstand, die Humanisierung der Arbeit, die gleiche Behandlung der Geschlechter. Hedwig Richter erzählt die Geschichte der Demokratie als eine Chronologie von Fehlern, Zufällen und Lernprozessen, in deren Zentrum der Zivilisationsbruch des Holocausts steckt. Ihr anschauliches Buch konzentriert sich auf Deutschland, weil gerade an der deutschen Affäre mit der Demokratie deutlich wird, wie international verflochten die Wege zu Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit sind.
ÜBER DEN AUTOR
Hedwig Richter ist Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München. Für ihre Forschungen wurde sie vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis der Demokratie-Stiftung und dem Anna-Krüger-Preis des Wissenschaftskollegs zu Berlin.
INHALT
EINLEITUNG
1. ELITEN UND VOLK
Ideen von Gleichheit
Mitleid als demokratisierende Kraft
Absage an Gewalt
Öffnung des Gleichheitshorizonts für die Geschlechter
Die Weckung des Mitleids durch Skandalisierung und Kunst
Der Traum vom mündigen Bürger
Wirksamkeit der Partizipation
Gewöhnung an die Égalité
Gleichheit und körperliche Freiheit
Das Desinteresse des Volkes
Das Hochamt der Wahlen
Der wahlmüde Bürger
Disziplinierung und Freiheit
Wahlen in den USA: Eine Sache der Besitzeliten
Wahlen in Frankreich: Bestätigung der alten Eliten
Die Welt der Zahlen
Individualisierung
Durchdringung des Territoriums
Bedeutung des Wahlalters
Rationalität und Romantik
2. INKLUSION UND EXKLUSION
Armut als Skandal
Die hungrigen Vierzigerjahre
Das Bürgertum als Fürsprecher der Armen und frühe Arbeiterbewegung
Kunst, Literatur und Zeitungsmarkt als Verkünder neuer Werte
Skandalisierungen in den Zeitungen
Hunger und Konjunktureinbruch
Sichtbarkeit der Armut
Das Recht, gehört zu werden
Souveränität und Waffentragen
Parlamentarisches Leben in den preußischen Provinziallandtagen?
Kirchlicher Konstitutionalismus?
Eine neue Öffentlichkeit in Deutschland
Nationale Kommunikation
Ungeliebte Barrikaden
Nation
Die Gleichmacherin Nation
Wahleuphorie
Die Paulskirche, das deutsche Parlament
Vielfältige Hoffnungen und Widersprüche im Aufbruch
Das Wahlrecht der Paulskirche von 1849
Revolutionäres Nachspiel
Die Würde des Körpers
Frauen?
Maskulinisierung
Der Körper als Eigentum
Wohlstand
Besitz und Wahlrecht
1848/49: eine erfolgreiche Revolution?
3. DAS BÜRGERLICHE PROJEKT: MOBILISIERUNG UND BESCHRÄNKUNG
Die Massen machen Gesellschaft
Demokratisierung der Empathie
Die Massen in der Politik
Alle Männer wählen
Gewalt, Fälschungen, Manipulation
Neue Theorien über die Massen
Verfassung und Parlament
Ambiguitätstoleranz des verfassten Staates
Kommunikation
Wahlreformen
Reformzeitalter
Das soziale Jahrhundert
Sozialdemokratie: Reform oder Revolution?
Globale Reformbewegung
Den Körper neu denken und leben
Arbeitsschutz
Skandal! Hygiene, Wohnraum, Alkohol
Technik
Domestizierung der Politik
Kolonialismus
Vernichtungen
Die Entgrenzten
Imperial die Welt verbessern
4. GEWALT: HOMOGENISIERUNG UND DIVERSITÄT
«Mitleiderregend wie Menschen»: Zerfetzte Körper im Krieg
Kriegsaversion und patriotische Gesänge
Das Parlament zum Auftakt des Kriegs
Fleisch und Blut und Kot
Feldgraue Egalität
Der Aufbruch geht weiter
Erster Aufbruch: Demokratisierung der Demokratie
Der Krieg als Motor der Demokratisierung
Die Weimarer Verfassung
Zweiter Aufbruch: Warum soll ein Frieden nicht möglich sein?
Panik und Revolution
Die Ausgeschlossenen
Der Krieg geht weiter
Dritter Aufbruch: Der Sozialstaat
Verwirrungen
Entwürdigung
Vereinfachung
Entgrenzung
Drohung und physische Überwältigung
Parlament und Wahlen im Nationalsozialismus
Vernichtung
Das Ende der Privatheit
Segregation
Holocaust
Zweiter Weltkrieg
5. DEMOKRATIE NACH DEM NATIONALSOZIALISMUS
Die Unwahrscheinlichkeit der Demokratie
Kein Ende der Vernichtung
Hunger und Elendsquartiere
Neue Diktaturen und Demokratien
Lernende Nation
Das Grundgesetz
Erziehung, Selbsterziehung und Eliten
Beharrungskräfte
Wieder Wahlen in Deutschland
Wahlen im Sozialismus
Der befreite Körper
Wunder der Wirtschaft
Körperbeherrschung
Globale Gemeinschaft und globale Zerrissenheit: Kalter Krieg und Entkolonisierung
Globale Gefühle der Menschenwürde
Europa und die Welt
Das Europa der Ökonomie
Standards
Demokratisch und elitär
Nation in Europa
AUSBLICK: – EINE AFFÄRE VON KRISE UND GLÜCK
EPILOG
ANHANG
ANMERKUNGEN
Einleitung
1. Eliten und Volk
2. Inklusion und Exklusion
3. Das bürgerliche Projekt: Mobilisierung und Beschränkung
4. Gewalt: Homogenisierung und Diversität
5. Demokratie nach dem Nationalsozialismus
Ausblick Eine Affäre von Krise und Glück
BILDNACHWEIS
LITERATUR
PERSONENREGISTER
SACHREGISTER
EINLEITUNG
«Die Bauern sind Sklaven», so berichtete am Ende des 18. Jahrhunderts ein Zeitgenosse, und wer ein Dorf besuchte, dem liefen halb nackte Kinder nach Almosen schreiend entgegen. Die Erwachsenen hätten selbst «kaum noch einige Lumpen auf dem Leib, ihre Blöße zu decken». «Der Bauer wird wie das dumme Vieh in aller Unwissenheit erzogen», schrieb der Autor weiter. «Er muss vom Morgen bis zum Abend die Äcker durchwühlen.»[1] Die Charakterisierungen glichen sich: Das Gesinde auf dem Land werde «kaum als Menschen» angesehen, die Herrschaften traktierten die Menschen mit Grausamkeit, schlechter als das Vieh.[2] Die Beobachtenden allerdings waren die Städter, die Gebildeten, die Auswärtigen. Wie beurteilten die ländlichen Bewohnerinnen und Bewohner selbst ihre Lage? Was bedeutete Armut für sie? Was empfanden sie an ihrem Alltag als selbstverständlich, was als kritisch? Was war Glück?
Es ist nicht einfach, ihre Stimmen zu hören. Doch weisen sozialgeschichtliche Forschungen auf die Allgegenwart von Hunger in den ländlichen Räumen hin, auf den ungenügenden Wohnraum und die dürftige Kleidung. Harte physische Not prägte das Leben einer Mehrheit in ganz Europa, auch wenn es regionale Unterschiede gab und die Situation stark schwankte, je nachdem, wie die Ernte ausfiel, ob die Herren gütig waren oder das Land von Krieg überzogen wurde. Über Jahrhunderte, teilweise bis weit ins 19. Jahrhundert, glich sich die Lebenslage in ländlichen Räumen mit ihrer Ökonomie der Armut.[3]
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aber verbreitete sich eine explosive, ungeheure Idee, und immer mehr Denker wie Rousseau, Hugo Kołłątaj oder Friedrich Schiller, aber auch eine Frau wie Mary Wollstonecraft propagierten sie: die Idee von der Gleichheit und von der Würde der Menschen. «All men are created equal», hieß es 1776 in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Wenig später, im Jahr 1789, verkündigten die Männer der französischen Nationalversammlung die «Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte», die schnell in alle Sprachen Europas und darüber hinaus übersetzt wurde. Den Kern der Deklaration bildete neben der Freiheit erneut die Gleichheit: «Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren.»
Das war neu und unerhört: Naturrechtlich begründet war die Vision von Gleichheit «universal». Gleichheit für die wenigen hatte es schon in der Antike gegeben, nun sollte Gleichheit für alle Menschen gelten. Die Französische Revolution stieß diesen Stachel der Gleichheit in die Politik. Dort blieb er stecken, quälte, ließ keine Ruhe und führte zu Konsequenzen, die weitab dessen lagen, was Aufklärer und Revolutionäre gewollt hatten: Gleichheit der Menschen, unabhängig von Geschlecht und ethnischer Herkunft. Die Idee ließ sich nicht mehr aus der Welt schaffen. Nach und nach wurde sie überall zur Staatsaffäre. Dabei entfaltete «Universalismus» toxische Qualitäten, wirkte exklusiv, weil er lange Zeit nur für den weißen Mann galt und alle anderen umso schärfer ausschloss – denn es waren scheinbar schon «alle» gemeint. Dipesh Chakrabarty spricht von den «privilegierten Erzählungen der Staatsbürgerschaft», ohne die Moderne nicht zu denken sei und die der Konstruktion der anderen bedürfen, die außen vor bleiben.[4] Bis heute wird immer wieder neu um die Ausmaße von «Universalität» gerungen, doch bleibt sie als prinzipieller Anspruch unverzichtbar für die Entwicklung moderner Demokratie.
«Die Ideen von Freiheit und Gleichheit stehen wie zwei Sterne über den Völkern seit einem halben Jahrhundert», schrieb der Schweizer Jeremias Gotthelf 1841 über die Ausbreitung der neuen Gedankenwelten und fürchtete, die unteren Schichten würden die Versprechen beim Wort nehmen, aber wer wolle «es dem Armen verargen, wenn er ihre Bedeutung, ihre Verheißungen missverstund und immer mehr missversteht?»[5] Noch lange und immer wieder neu hofften Männer wie Gotthelf, den umstürzenden Gehalt von universeller Gleichheit aufhalten oder einschränken zu können. Oft genug gelang es ihnen.
Wie revolutionär die Verbindung von Gleichheit und Universalität war, wird erst angesichts der omnipräsenten Ungleichheit im 18. Jahrhundert deutlich: angesichts der Not der großen Mehrheit von Männern, Frauen und Kindern und der Selbstverständlichkeit ihres Elends gegenüber einer relativen Sicherheit im Leben weniger Privilegierter.[6] Wahrscheinlich widersprachen wenige Ideen mehr der Alltagserfahrung als die Idee der Gleichheit. Ungleichheit bildete die Grundlage des Lebens und trotz aller Aufklärung immer auch noch des Denkens. Sie war das Prinzip von Herrschaft, sie bildete den Boden des dörflichen und des ständischen Lebens, der Erziehung, der Kleiderordnungen und des Geschlechterverhältnisses. Exekutionen variierten je nach Stand. Den Kelch im Abendmahl erhielten oft nur die Geistlichen. Armut herrschte nicht als ein relatives Phänomen, sondern war eine Frage des nackten Überlebens: Wer am unteren Ende stand, der hatte oft nicht genug, um sein Leben zu erhalten.[7]
Gleichheit aber bildet das Herzstück von Demokratie – gemeinsam mit Freiheit und Gerechtigkeit, die ihre radikale Wirkung erst im Verbund mit Gleichheit entfalten. Wie bei der Gleichheit gilt auch hier: Freiheit und Gerechtigkeit für wenige, das war nichts Neues, nun aber ging es um die ganze Menschheit. Die Umbrüche mit dem Beginn der Moderne in den Jahrzehnten um 1800 sind ohne diese Radikalität kaum verständlich. Der Soziologe Rudolph Stichweh spricht von «Inklusionsrevolutionen», die seit dieser Zeit stattfanden: Die Gesellschaften bezogen immer mehr Gruppen ein, immer mehr Menschen nahmen an wesentlichen sozialen und politischen Prozessen teil.[8] Gewiss ist die Einteilung in Moderne und Vormoderne eine idealtypische Zuspitzung. Doch die Menschen selbst empfanden den tiefen Bruch im Übergang zur Moderne, und es ist kein Zufall, dass das Ideal der universellen Gleichheit in dieser Zeit auf den Plan trat und begann, das politische Leben auf den Kopf zu stellen. Fand in der Vormoderne die Kommunikation innerhalb der Ständeordnung statt, so ging sie nun darüber hinaus, die Inklusionsprozesse rückten die Menschen näher aneinander heran – was wesentlich zur Sichtbarkeit der Ungleichheit beitrug, ja, sie in gewisser Weise überhaupt erst produzierte und damit die Voraussetzungen schuf, sie zu skandalisieren und zu bekämpfen. Reinhart Koselleck nennt die Entstehung der Moderne um 1800 die Sattelzeit, in der gleichsam ein Bergsattel überschritten wurde und sich eine gänzlich neue Welt eröffnete.
Demokratie fasse ich also weit als ein Projekt von Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit. Definitionen sind Konventionen, Übereinkommen, damit klar ist, wovon die Rede ist. Es wäre genauso legitim, nach dem Begriff «Demokratie» zu fragen und zu klären, wann und wie er verwendet wurde, von Anarchisten im 19. Jahrhundert etwa oder von Theoretikern des Nationalsozialismus. Das vorliegende Buch interessiert sich jedoch nicht für die Begriffsgeschichte, sondern für das normative Projekt der liberalen Demokratie, das sich mit der Moderne und in enger Verbindung mit Vorstellungen von Menschenwürde herausgebildet hat. Der Begriff des Projekts verweist auf den Erwartungshorizont, die Fortschrittshoffnung, die mit Demokratie verbunden wird.[9] Die beiden Begriffe «Demokratie» und «Republik» sollen – wie zumeist seit der Moderne im 18. Jahrhundert – synonym verwendet werden. Ihre strenge Trennung ist vor allem eine nachträgliche ideenhistorische Konstruktion, zuletzt ins Feld geführt von Skeptikern gegenüber einer liberalen Demokratie, die die Republik als die bessere, weil elitärere Regierungsform verstehen.[10]
Es geht bei der Demokratie um das Glück der Menschen, um «pursuit of happiness», wie es in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung heißt. Glück und die Ideale von Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit bedeuteten zu allen Zeiten etwas anderes. Diese Geschichte der Demokratie will den Veränderungen nachgehen und schauen, welche Geltung die Menschenwürde, in der die demokratischen Ideale komprimiert sind, in den sich wandelnden Zeiten hatte. In historischen Demokratiestudien können enge normative Definitionen von Demokratie, die sie als eine bestimmte Staatsform mit bestimmten verfassungsrechtlichen Garantien verstehen, den Blick auf die oft widersprüchlichen Anfänge und die zuweilen divergierenden Entwicklungen von Demokratie verstellen. Das heißt, die Genese des normativen Projekts der Demokratie sollte nicht normativ analysiert werden. Sonst würde Demokratiegeschichte die dunklen Seiten der Demokratie ignorieren und die widersprüchlichen Entwicklungen ausblenden, die freiheitliche Demokratien historisch geprägt haben und ihre Institutionen bis heute bestimmen. Demokratie bedeutet eben nicht automatisch freiheitliche Demokratie, in deren Zentrum die Menschenwürde steht. Demokratie trägt immer auch die Versuchung des Populismus oder gar des Faschismus in sich.
Auch wenn ich – aus der heutigen Perspektive der liberalen Demokratie – den normativen Kern in der Gleichheit sehe, so entstand Demokratie doch nicht aus diesem einen Ideal. Demokratie entwickelte sich aus einem ungeordneten Konglomerat an Ideen und Praktiken, die sich oft genug widersprachen. Die Quellen der Demokratie sind vielfältig, und nicht immer sind sie rein und lauter. Die liberale Demokratie, die aus dieser Geschichte hervorgegangen ist, erweist sich daher nicht als ein Gebilde aus einem Guss, vielmehr ist sie ein Flickwerk, ein um Ausbalancierung ringendes Gefüge, in dem es darum geht, Kräfte und Gegenkräfte im Zaum zu halten und die sich in vielerlei Hinsicht widersprechenden Ideale von Gleichheit und Freiheit und Gerechtigkeit voreinander zu schützen und gegeneinander zu stärken. «Demokratie», so der Historiker Paul Nolte, «handelt von der Kontingenz der Dinge, von dem Auch-anders-sein-Können, eher von der Suche als von der definitiven Lösung.»[11] Demokratie ist kein mit bestechender Logik strahlendes System, sondern aufgrund ihrer merkwürdigen Geschichte eine zusammengeschusterte Ordnung. Demokratie ist eine spannungsgeladene Affäre, eine brenzlige Angelegenheit, wankend; nichts ist garantiert, ihr Modus ist die Krise.
Es ist daher zentral, einen Blick auf die Diktaturen des 20. Jahrhunderts zu werfen. Dabei verdeutlicht gerade die Analyse von Diktaturen, dass die vorliegende Definition «Demokratie» nicht als etwas Beliebiges fasst. Zwar ist Demokratie selten eine klare Angelegenheit von schwarz und weiß, das zeigt die Demokratiegeschichte. Sie ist, um mit Iris Marion Young zu reden, «not an all-or-nothing affair, but a matter of degree».[12] Aber im 20. Jahrhundert lässt sich doch ein Unterschied ausmachen zwischen einem Staat, der die Menschenwürde systematisch behindert oder zerstört, und einer Ordnung, die prinzipiell nach Wegen sucht, sie zu schützen.
Diese Geschichte erzählt von den Mühen und Freuden der Demokratie als einer Affäre. Sie erzählt von einer Staatsaffäre, die zur Angelegenheit der Bürger und zunehmend auch der Bürgerinnen wird. Es ist außerdem die Geschichte einer gar nicht selbstverständlichen, überaus komplizierten Liebe, die sich langsam entwickelt, in der aus Gleichgültigkeit Leidenschaft entsteht, die zuweilen im Geheimen befördert wird und in der Öffentlichkeit zum Eklat gerät. Es ist eine Geschichte, die den ganzen Menschen mit Leib und Seele betrifft. Sie ist voller Gefühle, die Menschen bewegen und begeistern, die Herzen zerbrechen, die aber auch erkalten können.
Es ist kompliziert. Demokratie ist keine einfache Angelegenheit. Sie lässt sich nicht begreifen, wenn sie nur als ein Anliegen des «Volkes» verstanden wird, als eine allein von unten ersehnte und erkämpfte Herrschaftsform. Das ist die erste These: Demokratiegeschichte ist nicht immer, aber häufig ein Projekt von Eliten. Denn es stellt sich die Frage: Wenn es zunächst überwiegend einige Gebildete waren, die für die Idee der Gleichheit eintraten, welche Rolle spielten dann die Mehrheiten für die Demokratisierung? In ihrem Alltag um 1800 hatten die Menschen der unteren Schichten meistens wenig Muße und kaum Ressourcen, um über Gleichheit und Mitbestimmung nachzudenken. Das änderte sich erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts.
Unter Elite verstehe ich dabei Personen, die sich in den Augen der Mehrheitsgesellschaft im weitesten Sinn durch Machtfülle oder Leistungen auszeichnen und dadurch Einfluss genießen.[13]
Demokratie sollte also nicht vorschnell als Kampf von unten und damit als Revolutionsgeschichte verstanden werden, und zwar der Revolution im Sinne eines bürgerkriegsähnlichen Umsturzes mit Gewalt.[14] Vielen gilt als selbstverständlich, was der Historiker Jakob Tanner so formulierte: «Demokratie ist, historisch betrachtet, das Resultat von Revolutionen.»[15] Zweifellos spielten Revolutionen für Demokratisierungsprozesse eine wichtige Rolle.[16] Doch spricht vieles dafür, dass Reformen in der Demokratiegeschichte zu wenig Beachtung finden und dass die antidemokratischen Kräfte und die Rückschläge, die Revolutionen häufig hervorrufen, zuweilen unterschätzt werden. Politikwissenschaftliche Studien über jüngere Transformationsprozesse zeigen, dass gewaltförmige Wandlungsprozesse eher zu Diktaturen führen und friedfertige Reformen mehr Potenzial zur Demokratisierung aufweisen.[17] Demokratiegeschichte ist nicht nur, aber immer wieder eine Geschichte der Eliten, und sie ist, so sollte die erste These ergänzt werden, ganz wesentlich eine Geschichte von Reformen, die häufig von diesen Eliten angestoßen werden, auch wenn sie dann oft von allen Schichten befördert und getragen werden.
Für Eliten konnten demokratische Reformen sinnvoll sein. Es ist eben nicht richtig, was der Historiker Sean Wilentz in seiner amerikanischen Demokratiegeschichte feststellt: «Demokratie ist nie ein Geschenk wohlwollender, weitsichtiger Herrscher, die ihre Legitimität stärken wollen. Demokratie bedarf immer des Kampfes.»[18] Warum sollte man die Komplexität von Menschen in diesem Fall so gering einschätzen und bestimmten Gruppen nur ein determiniertes Set an Motiven unterstellen? Eliten konnten neben ethischen Beweggründen und einem aufklärerischen Impuls auch ein egoistisches Interesse an Demokratie haben. Demokratie kann beispielsweise der Disziplinierung der Bürger dienen. Von Anfang an achteten Eliten zudem darauf, dass es nicht zu einer «Tyrannei der Mehrheit» kam. Die Regierungsform Demokratie steht nicht zuletzt in den liberalen Traditionslinien, in denen es um die Garantie geht, dass weder der Staat noch eine einzelne Person, weder eine Instanz noch eine Interessengruppe alleine durchherrschen kann, sondern eine Balance der Mächte erreicht wird, ein System von checks and balances, in dem die Freiheit des Individuums geschützt und sein Streben nach Glück möglich ist. Demokratiegeschichte ist immer auch die Geschichte ihrer Einschränkung. Das ist die zweite These.
Die Relevanz von Reformen und der Einschränkung der Demokratie wird umso deutlicher, wenn klar wird, dass es bei Demokratie um konkrete Praktiken geht, wie die Unverletzlichkeit der Wohnung oder eine wirkungsvolle Sozialhilfe. Denn Gleichheit und Freiheit lassen sich lange verkünden, aber für die Magd, die verprügelt werden darf und kein Recht auf einen Lohn zum Überleben hat, erscheint diese Deklaration ohne Sinn. Demokratiegeschichte – das ist die dritte These des Buches – ist wesentlich eine Geschichte des Körpers, seiner Misshandlung, seiner Pflege, seines Darbens – und seiner Würde.[19] Es ist eine politische Geschichte des Körpers, die analysiert, wie Erfahrungen mit dem Körper und Vorstellungen vom Leib Macht und Herrschaft durchdringen und verändern, wie sich Demokratisierung durch Körper und an Körpern zum Ausdruck bringt.[20] Bourdieu weist darauf hin, dass die Akzeptanz von Macht «nicht auf der freiwilligen Entscheidung eines aufgeklärten Bewusstseins beruht, sondern auf der unmittelbaren und vorreflexiven Unterwerfung der sozialisierten Körper».[21] Menschen, die nicht über ihren eigenen Körper herrschten, etwa Sklaven oder Frauen, wurden von Gleichheitsvorstellungen in der Regel ganz selbstverständlich ausgeschlossen.
Demokratiegeschichte ist damit auch eine Geschichte der Gefühle und der Vorstellungswelten: Warum begannen Menschen, dem Körper ihrer Mitmenschen Respekt entgegenzubringen und Folter oder Prangerstrafen nicht mehr als Unterhaltungsspektakel, sondern als widerlich, schließlich sogar als Skandal zu empfinden? Warum galt Hunger zunehmend als ein Missstand, der nicht nur gelindert, sondern strukturell bekämpft werden muss? Für die Internalisierung einer Vorstellung wie Gleichheit reicht eine abstrakte Idee nicht aus; damit die universale Gleichheit «self-evident» wurde, wie in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung festgehalten, musste sie inkorporiert und gefühlt werden. Diderot erklärte 1755, das für den Gleichheitsgedanken zentrale Naturrecht werde von allen als ein «sentiment intérieur» geteilt, als etwas, das jedem «évidemment» erscheine.[22] Meine These orientiert sich an der Forschung über den Zusammenhang von Menschenrechts- und Körpergeschichte, über die Verbindung von Gefühl und Recht, die in der Philosophie, der Germanistik und in der Rechts- und Politikwissenschaft diskutiert wird,[23] und sie knüpft an die historische Forschung über den engen Zusammenhang von Körper- und Gefühlsgeschichte an.[24] «Wenn Menschenrechte selbst-evident sind, müssen (und können) sie nicht gesondert begründet werden», erläutert die Germanistin Sigrid Köhler: «Das Gefühl, die Instanz, die im 18. Jahrhundert für das intuitive moralische (und rechtliche) Wissen zuständig ist, hat schon immer um sie gewusst.»[25] Dabei verstehe ich mit der Kulturanthropologin Catherine Lutz Gefühle als einen «kulturellen und zwischenmenschlichen Prozess», sie sind nichts Gegebenes und Festes, sondern etwas Gemachtes, oft etwas mit pädagogischem oder demagogischem Hintersinn Konstruiertes. Sie verändern sich, sie haben eine Geschichte, und sie machen Geschichte.[26] Das Mitleid beispielsweise wurde immer wieder von Interessengruppen geweckt und etwa im Kampf gegen Sklaverei systematisch gefördert. Wie jedes Gefühl hat Mitleid seine Konjunkturen, eine lag am Ende des 18. Jahrhunderts, während es beispielsweise in den 1970er Jahren in Misskredit geriet.
Keine Frage, die Geschichte der Demokratie ist auch Ideengeschichte, und sie ist Politik- und Parteiengeschichte. Doch der Fokus auf die Gefühlswelten und auf den Körper öffnet neu den Blick für die Komplexität der Demokratiegeschichte. Diese Perspektive schließt ökonomische und demographische Entwicklungen mit ein, die große Masse der Menschen wird sichtbarer, die hungernden Bauern etwa oder die schuftenden Frauen. Demokratiegeschichte ist damit auch klassische Sozialgeschichte, Geschlechtergeschichte und die Geschichte von Arbeiterinnen und Arbeitern. Als wesentlich erweist sich zudem die Mediengeschichte. Das Aufkommen von Zeitungen und die dichter werdende Kommunikation erst ermöglichten Demokratie. Medien griffen immer wieder Gefühle auf, teilweise schufen sie diese erst. Entscheidend für die Demokratiegeschichte war auch deren Fähigkeit zur Skandalisierung: dass Armut nicht mehr als gottgegeben und unvermeidbar galt etwa, dass Foltern und Quälen Gefühle der Abscheu hervorriefen, dass Ungleichheit als Unrecht empfunden wurde.[27] Demokratie lebt immer wieder von Affären, von Empörung, von Kritik, vom Willen zur Veränderung.
Dabei wird schnell klar, dass die nationalen Erzählungen nicht ausreichen, denn die Entfaltung neuer Gefühlswelten erstreckte sich ebenso wie ökonomische Entwicklungen, Handel, Hunger oder Ernteausfälle über Ländergrenzen hinweg. Demokratiegeschichte, das ist die vierte These, ist eine internationale Geschichte; und zwar eine Geschichte des nordatlantischen Raums, in dem die moderne Demokratie entstand. Nicht zuletzt durch die Frage nach der Sklaverei in den Kolonien war von Anfang an der globale Horizont präsent.
Dass Demokratie eigentlich nur international verstanden werden kann, ist eine alte Einsicht.[28] Doch während soziologische oder politikwissenschaftliche Theorien wie selbstverständlich von dieser Internationalität ausgehen,[29] tendiert die Geschichtswissenschaft dazu, Demokratie national zu erzählen.[30] Und tatsächlich bedarf Demokratie – weltweit – des nationalen Rahmens. Der Nationalgedanke war für die Popularisierung der Gleichheitsidee entscheidend, und seit Demokratie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum globalen Heilsversprechen geworden ist, bildet sie den Kern nationaler Identitäten. Die meisten Staaten erzählen ihre Geschichte als nationale Demokratiewerdung in enger Verbindung mit nationalen Schlüsselereignissen und Mythen. Speziell für Deutschland wird dieses Paradox deutlich. Tatsächlich war Demokratie immer auch eine deutsche Angelegenheit. Wie andere Nationen haben sich Deutsche ihren eigenen Reim auf dieses beunruhigende Phänomen gemacht. Und auch die Deutschen waren sich selten einig darüber, wie Demokratie zu verstehen, zu praktizieren oder zu bekämpfen sei. Wie andere Nationen hat Deutschland seine ganz besondere Geschichte mit der Demokratie.
Dieses Buch reiht sich in die neuere Demokratieforschung ein, die Demokratie in einen weiten begrifflichen, einen großen historischen und in einen internationalen Rahmen stellt.[31] Die Transnationalität von Demokratie und die Einbettung Deutschlands in diese Geschichte wird an dem Diktum deutlich, das der amerikanische Präsident Abraham Lincoln 1863 aufgegriffen hat und das bis heute als prägnante Formel von Demokratie gilt: «government of the people, by the people, and for the people». Ernst Moritz Arndt, der zu den vielen Intellektuellen gehörte, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Zukunft in der «Demokratie» sahen,[32] hatte schon 1814 erklärt: «Die besten Kaiser und Könige und alle edlen Menschen haben ja auch immer nur bekannt, daß sie für das Volk da sind und für das Volk und mit dem Volke regieren.»[33] Doch Arndt hatte damit an die 1791 von Claude Fauchet geprägte Sentenz angeschlossen: «Tout pour le peuple, tout par le peuple, tout au peuple.»[34] Vermutlich stammt die Wendung aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts aus der Monarchomachischen Tradition, die ein Recht zur Bekämpfung der Tyrannen aus dem Alten Testament ableitet. In dem Traktat Strafgericht wider die Tyrannen (Vindicae contra tyrannos) heißt es 1575: «Rex per populum et propter populum existat, nec absque Populo consistere possit.»[35] Die Berufung auf die Bibel ist ein Hinweis auf die religiösen Wurzeln der Demokratie.[36]
Der Historiker Edmund S. Morgan aber mahnt zur nüchternen Analyse und schreibt über diese Grundformel der Demokratie: «Nüchtern betrachtet ist es ohnehin klar, dass alle Regierungen vom Volk sind, dass alle behaupten, für das Volk da zu sein, und dass keine buchstäblich durch das Volk regieren kann.»[37] Tatsächlich haben Intellektuelle und Wissenschaftler immer wieder auf den utopischen und fiktiven Charakter von Demokratie hingewiesen.[38] Denn wie können viele Millionen die Herrschaft innehaben – und wie soll es funktionieren, dass es zugleich Herrschaft und Gleichheit geben soll, obwohl Herrschaft Asymmetrie voraussetzt?
Demokratie ist eine Utopie. Dass Demokratie nicht nur in Deutschland, aber natürlich besonders dort, auch eine Geschichte mit viel Glück ist, das soll in diesem Buch deutlich werden. Mit ihrer identitätsstiftenden Funktion führt gerade Demokratiegeschichte vor Augen, dass auch historische Darstellungen Erzählungen sind, für die wir einen Plot wählen und in denen wir Bösewichte und Heldinnen auftreten lassen; wir setzen einen Anfang und schreiben auf ein Ende hin – ein geglücktes oder ein böses, in diesem Fall ein offenes.
Für historische Darstellungen bildet die Chronologie einen angemessenen Rahmen. Chronologisches Erzählen beruht letztlich auf dem Glauben, dass – bei aller unbestrittenen Bedeutung der Kontingenz – Dinge aufeinander aufbauen, nicht alles dem Zufall anheimgestellt bleibt und es Prozesse gibt, dass unter Umständen Menschen lernen und dass Kausalitäten – wenn auch meistens nur undeutlich erkennbar – sinnvoll erzählt werden können. In fünf Kapiteln soll sich der chronologische Erzählplot entfalten und dabei immer die vier Thesen im Blick haben: erstens den demokratischen Impuls, der auch von Eliten ausgehen kann und vielfach durch Reformen befördert wurde, zweitens die Einschränkungen, mit denen Demokratiegeschichte stets einherging, drittens die zentrale Rolle der Gefühle und des Körpers und viertens den internationalen Blick.
Den Auftakt bildet das erste Kapitel mit den Gleichheitsideen der Aufklärer, der Ächtung der Folter, mit der Französischen Revolution, die das Gleichheitsversprechen in die Politik und in die Welt brachte, mit den Anfängen einer weiten Partizipation, die um 1800 vor allem den Eliten, weniger jedoch den wahlberechtigten Männern einleuchtete. Das zweite Kapitel setzt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts an und erzählt von der Skandalisierung der Armut und von der Idee der «Nation», die Menschen zunehmend faszinierte und solidarische Gefühle weckte. Die große Reformzeit um 1900 bildet das dritte Kapitel. Es ist die Zeit der Massenpolitisierung, die sich im ganzen nordatlantischen Raum um 1870 Bahn gebrochen hatte, in der entscheidende Grundlagen der heutigen Demokratie gelegt wurden. Es kommt zu einer Konvergenz demokratischer Praktiken, weswegen es sinnvoll ist, bis ins dritte Kapitel einen genaueren Blick auf andere Länder und die unterschiedlichen Vorstellungen von Partizipation zu werfen, die sich um 1900 einander annähern. In dieser Zeit gleicht sich das Wahlverfahren international an, auch ein starkes Parlament wird Konsens, und selbst die seit den 1920er Jahren aufkommenden Diktaturen können diese massenpartizipative Übereinkunft nicht grundsätzlich ignorieren, sondern müssen sie integrieren. Die Jahrhundertwende ist zudem die Zeit, in der die Forderung nach der Befreiung der Frau erstmals hörbar in die Politik hineingetragen wurde und der Sozialstaat ein immer festeres Fundament erhielt.
Das vierte Kapitel gilt dem Zeitalter der Extreme mit der millionenfachen Zerstörung von Körpern, mit der Kriegs- und Friedenspolitik der Massen, den großartigen Aufbrüchen in der Zwischenkriegszeit und schließlich mit dem Nationalsozialismus und seiner totalen Demokratie, wie die Faschisten es nannten. Das Kapitel handelt vom Ende der Menschenwürde. Im fünften und letzten Kapitel geht es um die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in der lernbereite Menschen einer internationalen Gemeinschaft Institutionen zur Friedenssicherung schufen, die Menschenwürde in internationalen Abkommen festschrieben und in der immer mehr Staaten demokratische Herrschaft und sozialstaatliche Fürsorge einführten. Es ist zugleich die Zeit des drohenden Atomkriegs, des Ost-West-Konflikts mit Panik, Kriegen und Menschenrechtsverletzungen, die Zeit der massiv verschärften planetaren Zerstörung durch die fossilen Energien, die die demokratischen Freiheiten zugleich doch erst möglich gemacht haben. Es ist aber auch die Zeit, in der Bürgerinnen und Bürger gezielt patriarchale Strukturen aufbrachen. Geht man davon aus, dass Geschichte zuweilen prozesshaft abläuft und in ihr nicht nur eine dunkle Kontingenz waltet, wird eines der wichtigsten Ereignisse der Demokratiegeschichte erkennbar, das vielleicht sogar die großartigste Errungenschaft von Demokratie überhaupt ist: die Emanzipation der Frau. Auch sie ist eine unabgeschlossene Geschichte.
Diese Geschichte präsentiert die Affäre der deutschen Demokratie als eine Serie – mit allen menschlichen Abgründen. Sie ist eine Modernisierungserzählung, deren Stoff Fiktionen, Wahrheiten und auch Zufälle sind. Sie ist eine leidenschaftliche, optimistische Chronologie von Fehlern und Lernprozessen, in deren Herz der Zivilisationsbruch des Holocaust steckt. Es ist keine geradlinige Geschichte, deren Ende feststeht. Ganz im Gegenteil. Die Affäre geht weiter. Die nächste Staffel folgt.
1. ELITEN UND VOLK
Ideen von Gleichheit
Im Sommer des Jahres 1766 wurde der zwanzigjährige François-Jean Lefebvre de la Barre in der nordfranzösischen Stadt Abbeville wegen «Gottlosigkeit, schändlicher und abscheulicher Blasphemien und Sakrilegien» hingerichtet.[1] Das Spektakel begann am frühen Morgen des 1. Juli mit der Folter: Über eine Stunde lang zerschlugen die Henker dem jungen Mann die Knochen. Am Nachmittag brachte man La Barre zum Hinrichtungsplatz, auf dem Rücken trug er das Schild «Gotteslästerer und schändlicher Frevler». Die Totenglocken läuteten. Als der Scharfrichter den Kopf des Verurteilten abschlug, spritzte das Blut «wie aus mehreren Fontänen», so ein Beobachter. Danach verbrannte man den Leichnam zusammen mit einem Exemplar von Voltaires Philosophischem Wörterbuch, dessen Besitz zu den Straftaten des jungen Adligen gehörte.[2] Die Asche wurde ins Wasser der Somme geworfen.
Doch der spektakuläre Tod des François-Jean Lefebvre de la Barre ereignete sich in einer Zeit, in der die Folter fragwürdig geworden war. Zunehmend galt die Misshandlung des Körpers durch die Obrigkeit als Skandal. Preußen hatte 1755 als einer der ersten Staaten die «Tortur» offiziell abgeschafft. Und im Jahr 1764 war der italienische Philosoph und Reformer Cesare Beccaria mit seinem aufklärerischen Werk über das Strafrecht an die Öffentlichkeit getreten, das scharfsinnig die Argumente gegen die Folter entfaltete. Kritik an der Folter gab es schon lange, doch blieb sie nun keine Einzelmeinung mehr, sondern dominierte in ganz Europa die sich entfaltende Öffentlichkeit. Kurz nach ihrem Erscheinen übersetzten europäische Gelehrte Beccarias Schrift in zahlreiche Sprachen, allein auf Deutsch erschien Von den Verbrechen und von den Strafen mehrfach innerhalb weniger Jahre.
Allmählich änderte sich der Charakter der Kritik, und diese Transformation sollte sich für die Diskreditierung von Folter als entscheidend erweisen. Die Argumentation bewegte sich zunehmend auf der Ebene des «natürlichen» Empfindens und der Gefühle – des Mitleids und des Mitgefühls gegenüber den Mitmenschen. Das Strafrecht sollte nach Ansicht des englischen Juristen William Blackstone vom «Gefühl der Humanität» geleitet sein.[3] Folter galt bei ihren Kritikern nicht länger lediglich als unvernünftig, als abträglich für einen ordentlichen Gerichtsprozess, Folter wurde zum Skandal. In seinem Philosophischen Wörterbuch hielt es Voltaire beim Eintrag «Folter» von 1769 für überflüssig, rationale Argumente anzuführen, weil für ihn die Ablehnung der Folter selbstverständlich war. Wie viele andere Aufklärer hielt er dies für eine der offensichtlichen Wahrheiten, der «self-evident truths», wie es dann 1776 in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung im Hinblick auf die Gleichheit und Freiheit heißen würde.[4] Voltaire eröffnete daher seinen Artikel mit dem sarkastischen Hinweis: «Die Römer haben nur Sklaven der Folter unterworfen, aber Sklaven zählten ja auch nicht als Menschen.»[5] Hier wird der intellektuelle Horizont eröffnet, in dem sich die neuen Ideale von Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit mit dem Körperkonzept und mit den Gefühlen verbanden – und dadurch «self-evidence» gewinnen konnten. Sklaven galten nicht als Menschen, weil sie nicht Herren ihrer Körper waren. Wer physisch gepeinigt werden darf und nicht über seinen Körper bestimmt, kann nicht als gleichberechtigtes Subjekt gelten. Nun, mit dem naturrechtlich begründeten Anspruch auf Gleichheit für alle, auf Universalität, konnte dieser körperliche Akt der Entmenschlichung augenscheinlich nicht mehr als gerechtfertigt gelten.
Mitleid als demokratisierende Kraft
Stand nicht am Anfang das Mitleid? Das Gefühl für die Würde des Mitmenschen, Empathie angesichts seines Schmerzes, die Empörung gegen seine Misshandlung und sein elendes Leben – der Respekt für den Körper? Mitleid war ein Kind der Aufklärung und entfaltete sich zu einer mächtigen Idee. Rousseau galt das Mitleid als eine universelle, eine natürliche Kraft, als die Grundlage jeder Tugend und des menschlichen Zusammenlebens.[6] Mitleid blieb nicht im Ungefähren und wurde, wie bei Schiller, konkret mit den Bedürfnissen des Körpers verbunden: «Würde des Menschen./Nichts mehr davon, ich bitt euch. Zu essen gebt ihm, zu wohnen/Habt ihr die Blöße bedeckt, giebt sich die Würde von selbst.»[7] Lässt sich die Mitleidstheorie des 18. Jahrhunderts, so fragt der Germanist Hans-Jürgen Schings, womöglich als ein Signal für den bürgerlichen Ausgang aus theologischer und politischer Unmündigkeit verstehen? Vieles spricht dafür, womit sie eine Voraussetzung für die moderne Demokratie wäre.[8]
Die Kraft des Mitleids – oder auch der Sympathie, der Menschenliebe, Geselligkeit, Rührung, Zärtlichkeit, Empfindsamkeit – erwies sich gerade für diejenigen, die praktisch das Elend der Welt bekämpfen wollten, als entscheidend: «Brüderlichkeit war das Zauberwort», fasst die Philosophin Martha Nussbaum den Politikwandel in Europa um 1800 zusammen.[9] Der Hofrat Carl Friedrich Pockels ließ in seiner Anthropologie des Mannes von 1805 keinen Zweifel daran, dass Revolution schändlich sei, weil sie das Mitgefühl ablehne; er verbindet die Hartherzigkeit mit Männlichkeit, denn wegen ihrer emotionalen und körperlichen Unempfindlichkeit fänden sich nur bei Männern «Mord und Verwüstung predigende Revolutionäre».[10]
Mitleid nährte die Idee der Gleichheit. Mit empathischen Gefühlen konnte die Selbstverständlichkeit zum Tragen kommen, die für die Gleichheitsideale so wichtig ist, denn «self-evident truths» können sich nicht rein durch den Verstand und mit rationalen Argumenten durchsetzen und behaupten. Gefühle wie das Mitleid funktionieren als sanfte Macht, unmittelbar, vorreflexiv, ohne die Möglichkeit, durch Egoismus korrumpiert zu werden, davon waren viele Aufklärer überzeugt.[11] «Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch, zu allen gesellschaftlichen Tugenden, zu allen Arten der Großmuth der aufgelegteste», so Lessing.[12] Immer wieder haben Intellektuelle auf die Bedeutung von Gefühlen für die Gesellschaft hingewiesen, in der Gerechtigkeit und Gleichheit praktiziert werden konnten: von Rousseau und Johann Gottfried Herder über Louise Otto-Peters, John Stuart Mill und Walt Whitman bis hin zu John Rawls. Wenn eine demokratische Gesellschaft stabil sein soll, dann müssen die Grundprinzipien auf eine engagierte Zustimmung stoßen, sie benötigen emotionale Unterstützung.[13] Viele dieser Gefühle der Liebe und Empathie sollten sich an die aufkommende Idee des Nationalstaates binden.
Ob die grundlegenden Ideen von Demokratie Erfolg haben würden, hing also davon ab, ob sie mit neuen Gefühlen und mit einem neuen Umgang mit dem Körper einhergingen. Herrschaftsverhältnisse sind zutiefst in Körper eingeschrieben.[14] Wer geschlagen werden darf, wer nicht seinen eigenen Körper besitzt und ihn zu beherrschen vermag, der kann auch nicht als mündiges Subjekt angesehen werden. Daher war es zunächst für die allermeisten Menschen schlicht undenkbar, Frauen, Leibeigene oder besitzlose Bauern als Gleichberechtigte und mündige Bürger anzuerkennen. Daraus erklärt sich auch Voltaires Überlegung: Die Römer folterten nur deshalb, weil sie die Betroffenen, die Sklaven, nicht für vollgültige Menschen hielten. Auch hier wirkten Gefühle viel stärker als rationale Argumente. Die Gegnerinnen und Gegner der Sklaverei nutzten eher das Gefühl der Empörung als rationale Argumente. Die Berichte von körperlichen Misshandlungen, zunehmend auch Bilder von Versklavten offenbarten die Ungerechtigkeit am deutlichsten und riefen weltweite Empörung hervor.[15] Sklaverei stand wie Folter für «Barbarei»: der Begriff für einen beklagenswerten Zustand, der in den Augen der Zeitgenossen die schmerzliche Rückständigkeit innerhalb eines aufklärerischen Entwicklungsprozesses hin zur «Zivilisation» markiert. Dieses über den Körper und am Körper sich ausbildende Mitleid wurde zu einer Grundlage des neuen Rechtsempfindens: das Gefühl für ein Recht darauf, Rechte zu haben.[16]
Absage an Gewalt
Mitleid bedeutet aber noch mehr. Die aufklärerischen und gelehrten Ideen um das Mitleid bargen eine Absage an Gewalt. Die große Enttäuschung der europäischen Intellektuellen gegenüber der Französischen Revolution, der die anfängliche Euphorie wich, speiste sich nicht nur aus den Gewaltexzessen des Terrors von 1793 und 1794, sondern auch aus der – wie man empfand – Kriegslüsternheit des revolutionären Heeres. Als der Dichter Klopstock 1790 die Revolution im Nachbarland begeistert begrüßte, betonte er: «Sogar das gräßlichste aller Ungeheuer, der Krieg, wird an die Kette gelegt!»[17] Den Krieg sahen viele als Privatvergnügen der Fürsten. Kant spottete über «die Staatsoberhäupter, die des Krieges nie satt werden können».[18] Doch bedauerlicherweise galt das auch für die Häupter der Revolution, denen zudem die gewaltbereiten Massen willig zur Verfügung standen. Kants Schrift Zum Ewigen Frieden von 1795 ist nicht zuletzt eine rigorose Schmähung aller «Gräuel der Gewalttätigkeit» und ein Nachweis für die Unvereinbarkeit von republikanischen Utopien mit physischer Gewalt und Krieg.[19] Herders Briefe zur Beförderung der Humanität (1793–1797) offenbaren die gleiche Sehnsucht nach Frieden, deren Grundlage die Liebe zum Vaterland sei. Der Krieg sei «ein unmenschliches, ärger als tierisches Beginnen». Herder empfiehlt als Gegenmittel Gefühle: «Alle edle Menschen sollten diese Gesinnung mit warmem Menschengefühl ausbreiten.» Auch bei ihm sind die Völker die Opfer der Kriege, die von der «Grille des Monarchen, aus einer niedrigen Kabale des Ministers» entstehen.[20] Herder verbindet in seiner Argumentation Frieden mit Weiblichkeit und sieht in den Frauen das versöhnende, friedensstiftende Moment.
Denn der Träger der Gewalt war der Mann, darüber herrschte kaum ein Zweifel. «Man kann gewiss sein, dass die Welt längst zur großen menschenleeren Wüste geworden wäre, wenn bloß Männer darauf gesetzt worden wären», erläuterte etwa Jakob Sprengel 1798 in seinem Buch Das andere Geschlecht das Bessere Geschlecht. Männer «würden unfehlbar in Kurzem sich alle einander ermordet haben. Die Welt weiß nicht, wie viel sie in dieser Hinsicht dem andern Geschlechte zu danken hat.»[21] Die Arbeit an einem neuen Körper- und Gefühlsregime verband sich in der Moderne von Anfang an mit einer Kritik an Männlichkeit.[22] Es war aber keine Kritik am Mann an sich, sondern an der ungezähmten Männlichkeit, der ein neues Ideal des gezähmten Bürgers entgegengestellt wurde.
Öffnung des Gleichheitshorizonts für die Geschlechter
Männer wurden als das prekäre Geschlecht präsentiert, das seinen Gelüsten und seinem Vergnügen an Gewalt willenlos ausgeliefert sei. Spiegelbildlich dazu kam es zur Aufwertung der Frau und ihrem Lobpreis. Frauen wurden als heiles, ganzes, mitfühlendes, selbstloses Pendant zum Mann angesehen. Seit der Aufklärung galt der Respekt vor der Frau als Nachweis einer besonders zivilisierten Kultur.[23] Gerade die (stets vorausgesetzte) Schwäche der Frauen wurde nun als eine schützenswerte Stärke interpretiert. Es entwickelte sich ein regelrechter Kult des Schwachen: Durch ihre körperliche Fragilität hätten Frauen erfindungsreicher sein müssen, klüger, umsichtiger – sie seien daher die eigentliche Triebkraft des Fortschritts gewesen, erklärte beispielsweise der Publizist Theodor Gottlieb von Hippel.[24] Hippels Freund Kant, sonst für misogyne Vorurteile bekannt, erklärte, die «Schwächen» des Weiblichen erst bewirkten «die Kultur der Gesellschaft und die Verfeinerung derselben».[25] In Kulturstaaten, so eine häufige Argumentation, werde das Geschlechterverhältnis nicht mehr durch rohe Gewalt, sondern durch Vernunft geregelt.[26] Die Historikerin Sylvana Tomaselli spricht von einem «enlightenment consensus» darüber, dass der tyrannische Mann die Frau im Naturzustand brutal versklavt habe und Zivilisation daher die Wertschätzung der Frau bedeute.[27] Die häusliche Frauensphäre entwickelte sich in der aufkommenden Industrialisierung zu der Vorstellung vom trauten Heim als einer Insel der Ruhe und der zeitlosen Glückseligkeit.[28]
Die aufklärerische Kritik am Mann trug dazu bei, dass die Höherwertung des Mannes gegenüber der Frau, aber auch die Gleichsetzung von Mann und Mensch brüchig wurden. Diese Umstellung hatte für das Geschlechterverhältnis schwerwiegende Folgen: Die Ungleichheit der Frau verlor ihre Selbstverständlichkeit. Denn Frauen hatten in der Vormoderne keineswegs als gleich gegolten.[29] Der Historiker John Tosh verweist auf die Langlebigkeit und Zähigkeit der Unterdrückung von Frauen und spricht von einer «gender longue durée».[30] Wie Kinder waren Frauen in besonderem Maß der alltäglichen Gewalt ausgesetzt.[31] Der Haushalt stellte sich seit Jahrhunderten als hierarchischer Ort dar, die Gehorsamspflicht der Frau, das Recht des Mannes auf häusliche Gewalt, die relative Rechtlosigkeit der Frau im Hinblick auf ihr Eigentum und ihren Körper gehörten überall in Europa lange vor dem 19. Jahrhundert in die festen Ordnungsvorstellungen.[32] Auch die Abdrängung der Frau aus der Öffentlichkeit war keine Neuerfindung der Moderne. Der französische Staatstheoretiker Jean Bodin wollte 1586 über die Frauen «nur das eine» sagen: Sie «sollten von allen Magistratsämtern, Befehlsfunktionen […] und öffentlichen Ratsversammlungen so weit wie möglich ferngehalten werden, damit sie sich mit Hingabe ihren Aufgaben als Gattinnen und Hausfrauen widmen».[33] Das Schicksal der Frau hing zwar wesentlich von ihrem Stand ab, dennoch taugte der Tagelöhner und Knecht vor Gericht als Rechtsperson, während das für Frauen unabhängig von ihrer Standeszugehörigkeit nur bedingt der Fall war.[34]
Gleichwohl erwies sich die scharfe Betonung der Zweigeschlechtlichkeit seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert als neu, ihre detaillierte Ausformulierung in allen Bereichen des Lebens, in der Familie, in der Moral, im Recht und zunehmend auch in der Wissenschaft und im Körper. Wie lässt sich das erklären? Zum einen wurde die Geschlechterordnung umso wichtiger, als alte Systeme wie die Ständeordnung oder auch die Religion an Bedeutung verloren.[35] Sie war altbekannt und damit unmittelbar einleuchtend. Daher würde Männlichkeit weiterhin als Legitimationsmittel und als Nachweis für das «Richtige» dienen. Die Beharrungskraft von Geschlechtervorstellungen ist überaus zäh. Zum anderen aber bot die dichotomische Geschlechterordnung eine Lösung für das Dilemma, dass der Mann zwar abgewertet wurde, aber doch der Frau weiterhin in fast allen Bereichen übergeordnet blieb. Die streng dichotomische Geschlechterordnung bot eine Begründung für die anhaltende Ungleichheit der Geschlechter angesichts der universalen Gleichheitsforderung. Die anschwellenden biologischen Ungleichheitsdiskurse im 19. Jahrhundert sollten also nicht nur als eine diskriminierende Festschreibung dieser Ungleichheit gesehen werden, sondern auch als eine Rechtfertigung, warum die Frau, die doch in vielerlei Hinsicht ein moralisch höheres Wesen sei, in so vielerlei Hinsicht weiterhin benachteiligt wurde. Kurz: Die Ungleichheit war nicht mehr selbstverständlich wie zuvor, sondern musste begründet werden.
Der neue Gleichheitshorizont ist folglich weniger paradox, als es bei dem modernen auf Abgrenzung zielenden Geschlechtermodell auf den ersten Blick erscheinen mag. Zudem beruhte die Ordnung nicht mehr ausschließlich auf einem hierarchischen Konzept, in dem die Frau unten und der Mann oben stand.
Allerdings war die Aufwertung der Frau vorerst ein feinsinniger Gelehrtendiskurs. Noch war der Alltag der allermeisten Frauen beherrscht von Gewalt und von ihrem tief verwurzelten Status als Minderwertige.
Die Weckung des Mitleids durch Skandalisierung und Kunst
Doch der Stachel der «Universalität» blieb nicht ohne Wirkung. Auch das Mitleid, das den Frauen in besonderer Weise zugeschrieben wurde, gewann seinen Neuigkeitswert vor allem aus dem Anspruch auf Universalität. Der Fall des jungen Folteropfers La Barre wurde zu einer internationalen Affäre, und in ganz Europa machte sich Empörung breit. Mitleid kannte ebenso wenig Grenzen wie die Diskurse um «Zivilisation» und «Barbarei». Demokratiegeschichte ist von ihren ersten Anfängen an eine internationale und transnationale Geschichte. Der Vergleich der «Nationen», bei dem deren Zivilisationsgrad bewertet wurde, gehörte zum gelehrten Austausch im 18. Jahrhundert. In seinem Folter-Artikel höhnte Voltaire, dass Frankreich sich selbst für zivil halte, aber mit der Folter vor aller Welt offenbare, wie «barbarisch» es sei. Erst später diente das Konzept von Nation dazu, Gleichheit verständlich zu machen und Solidarität zu ermöglichen.
Doch wie konnte sich in einer Zeit extremer Ungerechtigkeiten die Idee von einem allumfassenden Mitleid durchsetzen – als Menschen hungerten, immer noch gefoltert wurden, als in der jungen Republik der Vereinigten Staaten die Sklaverei blühte? Warum fanden diese Änderungen ausgerechnet in dieser Zeit statt? Gewiss führten zahlreiche und ganz unterschiedliche Faktoren zu dem Aufbruch. Bürger fühlten sich ermächtigt, sie begannen seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, sich in Clubs, Vereinen oder Freimaurerlogen zu organisieren. Als wesentlich erwies sich ein verändertes Zeitverständnis. Ereignisse wie die Französische Revolution stellten traditionelle Ordnungen infrage und zeigten, dass Geschichte wandelbar und Zukunft gestaltbar war. Überhaupt, dass die Revolution in Frankreich die Welt auf den Kopf gestellt hatte, daran konnte niemand zweifeln. Politik hatte sich von den Fürstenhöfen aufgemacht und die Herzen der Bürger und Bürgerinnen erreicht. Auch wenn das Bürgertum nur einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung ausmachte, war Politik nun keine Sache unter Fürsten mehr. Neue Ideen drangen in die Vorstellungswelten ein, etwa die Frage, warum menschliches Leid als unveränderbar akzeptiert und nicht als vermeidbar bekämpft werden sollte.[36] Die wachsenden Mitleidsdiskurse verbanden sich mit dem neuen Machbarkeitsgefühl: Mitleid ruft zum Handeln auf.[37] Die Menschen entwickelten die Fähigkeit, über die eigene Familie, den eigenen Klan und das eigene Dorf hinaus Mitleid zu empfinden.
Ein wichtiger Motor für die Verbreitung des Mitleids war die Literatur. Die Aufklärer sprachen von der moralischen Aufgabe der schönen Künste: «Das Trauerspiel soll bessern», erklärte Lessing.[38] In den neuartigen Romanen erlebten die Leserinnen und Leser das Schicksal einer anderen Person hautnah mit, die Texte weiteten den Horizont über das eigene, physisch stark beschränkte Leben hinaus. Es wurde so viel gelesen wie noch nie.[39] Auch die Zeitungen trugen dazu bei; sie berichteten in einem beachtlichen Ausmaß vom Schicksal anderer Menschen in fremden Ländern. Auf die Ermächtigung durch die Lesefähigkeit und ihre demokratisierende Kraft werden wir noch öfter zu sprechen kommen – auch auf den Anspruch des Staates, alle zu alphabetisieren.
Ein ganzer Strauß an neumodischen Gefühlen bot sich dar: Bildungshunger, Empfindsamkeit, Entsetzen über das Leid, der Wille zur Veränderung und das Gefühl, Rechte zu haben. Hier entfaltet sich also die faszinierende Geschichte der Moderne und der demokratischen Werte. Doch gerade eine Geschichte der Ermächtigung der Menschen, eine Geschichte der Demokratie, verdeutlicht, dass das Licht der Erkenntnis im 18. Jahrhundert keineswegs universal allen Menschen leuchtete. Auch wenn nahezu alle Daten und überlieferten Diskurse den tiefen Umbruch zeigen, mit denen die Jahrzehnte um 1800 die Welt veränderten, so sind die Kontinuitätslinien nicht zu übersehen. Physische Gewalt gehörte nach wie vor selbstverständlich zum Alltag. Zwar schwand die Folter, doch körperliche Strafen blieben bis weit ins 19., vielfach bis ins 20. Jahrhundert in großer Vielfalt erhalten, und das Volk spielte weiterhin begeistert mit und strömte zusammen, um das Leid des Mitmenschen zu bejubeln.[40] Die Zurschaustellung der Körperstrafen bedurfte der Anteilnahme des Volkes: Die Menschen begleiteten die Missetäter auf ihrem Weg zum Schafott mit Schmährufen, beschimpften und bespuckten die Verurteilten und bewarfen sie mit Kot und Steinen. Der Pranger ergab ohne den Hohn und ohne das Geschrei des Volkes wenig Sinn. Als der Terror der Französischen Revolution ausbrach, spielte die Menschenmenge ihre Rolle weiter und jubelte den Henkern an der Guillotine zu. In der Neuen Welt sah es nicht wesentlich anders aus. In Massachusetts verhängten die Gerichte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch in jedem dritten Fall Strafen, die mit einer öffentlichen körperlichen Demütigung einhergingen: vom Ohrabschneiden über das Brandmarken mit glühendem Eisen bis zum Auspeitschen.[41] Sklavinnen und Sklaven in Nordamerika waren rechtlos oder durften mit dem offiziellen Segen des Gesetzes verstümmelt, gefoltert, vergewaltigt werden.[42]
Physische Misshandlungen blieben in der Moderne in vielfältiger Form Bestandteil des Lebens. Von einem Stuttgarter Waisenheim wurde 1761 berichtet, wie der Aufseher Kinder über Stunden in verrenkte Körperpositionen sperrte, wenn sie nicht ihr Arbeitssoll erfüllten.[43] Zwangsarbeit hielt in Europa oft bis weit ins 19. Jahrhundert an. Zwar wurden die Normen einer freien Lohnarbeit immer häufiger propagiert, doch die Praxis folgte oft erst Jahrzehnte später.[44] Gefühle der Gleichheit und Empathie sollten erst im Laufe des 19. Jahrhunderts die breite Masse der Menschen erfassen.
Der Traum vom mündigen Bürger
Im deutschsprachigen Raum gab es neben antiliberalen Traditionen eine etablierte Denkweise, die staatsbürgerliche Gleichberechtigung mit Freiheit, Menschenrechten und Formen des Republikanismus verband. «Die gesetzgebende Gewalt kann nur dem vereinigten Willen des Volkes zukommen», und: «Nur die Fähigkeit zur Stimmgebung macht die Qualifikation zum Staatsbürger aus», erklärte Kant 1797.[45] «Politische und bürgerliche Freiheit bleibt immer und ewig das heiligste aller Güter», schrieb Schiller 1793. Auch Schiller war der Meinung, dass es dafür der «Gefühle» und der «Wärme» bedürfe, die durch die Künste geschult werden müssten.[46] «Die Poesie ist eine republikanische Rede; eine Rede, die ihr eigenes Gesetz und ihr eigener Zweck ist, wo alle Teile freie Bürger sind, und mitstimmen dürfen», gab Friedrich Schlegel zu bedenken.[47] Die Germanophilie der Spätaufklärung verband ihre nostalgische Liebe zu den vermeintlichen Vorfahren mit neuen Ideen von Gleichheit und Menschlichkeit. Patriotismus galt vielen als urdeutsches Phänomen und Demokratie als eine deutsche Angelegenheit.[48] Auch angesichts der Enttäuschungen durch das plündernde französische Revolutionsheer entwickelte sich der Begriff der deutschen «Kulturnation», denn in der Kunst und in der Schönheit sollten die Träume von Freiheit und Republik leben; Hölderlin hoffte 1797 auf eine «künftige Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten»,[49] er beschwor die «Freiheit, aufzubrechen»,[50] und Hegel forderte wenig später, etwas nüchterner, «dass die Magistrate von den Bürgern gewählt werden müssen».[51]
Weitere Wortführer im deutschsprachigen Raum, neben Schlegel etwa Ernst Moritz Arndt, Joseph Görres oder Karl Heinrich Ludwig Pölitz, sprachen sich ebenfalls für «Demokratie» aus, womit sie die verschiedensten Vorstellungen verbanden.[52] Ihre Ideen fielen häufig bei Monarchen und – was oft noch wichtiger war – bei deren Staatsmännern und Beratern auf fruchtbaren Boden. Es gehe bei den Wahlen darum, das Volk zu «bürgerlicher Freiheit, zur lebendigsten Bewegung innerhalb der Gesetze, zur Theilnahme an den wichtigsten Rechten zu erziehen und zu erheben», hieß es Anfang des 19. Jahrhunderts in einer von der preußischen Regierung lancierten Broschüre.[53]
Wirksamkeit der Partizipation
Die Haltung des Konservatismus, der sich in dieser Zeit in Gegnerschaft zur egalisierenden Moderne herausbildete, verdeutlichte die Tiefenwirkung der neuen Ideen. Die Schriften des Juristen und Staatsmanns Justus Möser lassen sich nicht nur als Verteidigung der alten Ständeordnung lesen, sondern auch als zutiefst infiziert mit aufklärerischen Ideen. Möser beschwor einen quasidemokratischen Zustand, in dem jeder Bürger gründlich über die Staatsgeschäfte informiert werden solle – und in dem der Gedanke und das Gefühl der menschlichen Würde aufgegriffen wird.[54] «Jeder Landmann», so der Osnabrücker Jurist 1775, solle «mit dem Gefühl seiner eignen Würde auch einen hohen Grad von Patriotismus bekommen; jeder Hofgesessener sollte glauben, die öffentlichen Anstalten würden auch seinem Urteil vorgelegt». Die Bildung des Mannes im Verbund mit seiner Würde sollte den Sinn für die Nation wecken und der Stärkung des Staates dienen.[55]
Hier wird eine der neuen Staatsideen deutlich, die um 1800 der gelehrten Welt und zunehmend auch den Regierenden einleuchtete: Herrschaft musste in Zusammenarbeit mit den ermächtigten Individuen stattfinden – eine der grundlegenden Ideen von Demokratie wurde auch in Deutschland propagiert. Demokratische Ideen überquerten den Atlantik. Die Beherrschten sollten zum Wohle aller, insbesondere zur Stabilität des Staates, integriert werden. «Es schien mir nicht genug, daß ein Land mit Macht und Ordnung beherrschet wird, sondern es sollte dieser große Zweck auch mit der möglichsten Zufriedenheit aller derjenigen, um derentwillen Macht und Ordnung eingeführt sind, erreichet werden», so Möser.[56] Dazu gehörte auch die Einsicht, dass moderne Herrschaft weit mehr noch als früher reziprok ist und von der Öffentlichkeit, von der Zustimmung, vom Legitimationsglauben der Beherrschten lebt. In den folgenden Jahrzehnten festigte sich dieses Wissen, und in der Schrift eines preußischen Beamten, die von der Verwaltung verbreitet wurde, hieß es 1832: «Du musst bedenken, dass niemand mächtig ist auf der Erde, als durch Andere und durch die Gewalt ihrer Meinung; dass der Mächtigste zurücksinkt zur Ohnmacht, sobald Aller Meinung sich gegen ihn kehrt.»[57]
Wie ließen sich diese Ideen konkretisieren, wie schaffte man Öffentlichkeit und führte die Bürger zur aktiven Mitarbeit? Thomas Jefferson erklärte 1801 über die bürgerliche Mitbestimmung, sie sei die einzige Regierungsform, die jedermann dazu bringe, sich an das Gesetz zu halten und «Übergriffe gegen die öffentliche Ordnung als seine persönliche Angelegenheit» anzusehen.[58] Diese neue Idee von der Inklusion durch Partizipation setzte sich in den kommenden Jahrzehnten weitgehend durch.[59] Alexis de Tocqueville resümierte 1836: «Das mächtigste und vielleicht einzige verbleibende Mittel, die Menschen für das Schicksal ihres Vaterlandes zu erwärmen, besteht darin, sie an der Regierung teilhaben zu lassen.»[60]
Gewöhnung an die Égalité
Gerade in Preußen gab es vielfältige Gründe für die Verantwortlichen, auf die neuen Herrschaftskonzepte zurückzugreifen. «Demokratische Grundsätze in einer monarchischen Regierung: dieses scheint mir die angemessene Form für den gegenwärtigen Zeitgeist», schrieb der preußische Politiker Karl August von Hardenberg 1807.[61] Die Lage Preußens war ein Desaster. Durch den harschen Frieden von Tilsit, den Napoleon 1807 Preußen aufgezwungen hatte, waren Territorium und Einwohnerzahl halbiert worden. Wie so häufig bei der Entwicklung moderner Staaten erwiesen sich die Finanzprobleme als entscheidend. Die Französische Revolution hatte sich wesentlich an den maroden Staatsfinanzen Frankreichs entzündet.[62] Auch in Preußen waren die öffentlichen Schulden in einem bisher nicht gekannten Ausmaß angestiegen, weil im Zuge des Staatsbildungsprozesses die gesamtstaatlichen Aufgaben umfangreicher geworden waren und immer neue Ausgaben erforderlich machten. Die Kosten für die Kriege gegen Napoleon hatten die Situation zusätzlich verschärft.[63] Die anhaltende französische Besatzung im besiegten Preußen hemmte die staatliche Initiativkraft. Erst Ende 1808 zog das französische Militär ab. Nun galt es, das Gemeinwesen zu ordnen, die Steuerfähigkeit des Landes zu erhöhen und ein schlagkräftiges Heer aufzubauen.
Eines ergab sich aus dem anderen: Die Bewältigung dieser Aufgaben bedurfte der Mitverantwortung der Menschen und einer leistungsorientierten Gesellschaft. In Preußen nahmen einige Dutzend aufgeklärte Männer die Reformen in die Hand. Auch wenn es erhebliche Unterschiede zwischen diesen Reformern gab, so gehörten die meisten zur Beamtenschaft und hatten an den reformerischen Universitäten Göttingen oder Königsberg studiert, wo sie mit den Ideen Kants oder Adam Smiths in Berührung gekommen waren.[64] Sie glichen damit den aufgeklärten Beamten in den süddeutschen Staaten, die den Neuanfang durch Napoleon nutzten und ebenfalls Reformen durchführten, die sie teilweise selbst längst erhofft hatten.[65] Allen gemeinsam war das Projekt Staat: Sie wollten einen modernen, das hieß konsistenten, effektiven, territorial homogenen Herrschaftsbereich – mit dem Monopol einer legitimen Staatsgewalt.[66] Das bedeutete zum einen, dass religiöse Toleranz gelten sollte; Religion hatte spätestens seit dem Dreißigjährigen Krieg so viel von ihrer gesellschaftlichen Integrationskraft verloren, dass sie nicht mehr als homogenisierendes Herrschaftsinstrument taugte, und die Regierenden wollten keinesfalls mehr – Seelenheil hin, Seelenheil her – durch religiöse Komplikationen und Idiosynkrasien in ihrer Regierungsarbeit gestört werden.[67] Zum anderen bedeutete das Vorhaben des modernen Staates, dass das Volk beteiligt werden musste – wie auch immer man es bezeichnete und wie auch immer das vonstattenging. Im Bau des modernen Staates also liegen wesentliche Wurzeln der Demokratie. Dass ein Monarch an der Spitze stand, änderte nichts an diesem Prozess. Der württembergische Fürst – seit 1806 durch Napoleons Gnaden König Friedrich I. von Württemberg – bildete mit seinem absolutistischen Stil eine kuriose Ausnahme, über die sich schon die Zeitgenossen wunderten. Doch selbst er führte die zeitüblichen Reformen durch und erließ 1819 eine liberale Verfassung, durch die rund 17 Prozent der Gesamtbevölkerung ein Wahlrecht für das Parlament erhielten.[68]
Die Gesellschaft war in Bewegung, Vernunft und Leistung sollten nach dem Verständnis vieler Zeitgenossen die Dinge lenken. Und so fanden sich immer mehr Bürgerliche in den Regierungsgeschäften, und unter den einflussreichen preußischen Reformern kamen einige sogar aus einfachen Verhältnissen, wie etwa Christian Scharnweber oder Christian Rother. Der bayerische Reformer Maximilian von Montgelas drängte in seinem großen Reformprogramm von 1796 darauf, mit der Beteiligung von Bürgern in den Regierungsgeschäften das Leistungsprinzip zu stärken.[69] Der konservative ostpreußische Kammerherr Ernst Ahasver Graf von Lehndorff beschrieb den säkularen Prozess der Verbürgerlichung in seinem Tagebuch: «Wenn ich die heutige Situation mit der Zeit meiner Jugend vergleiche, in der wir, die man zum Hochadel rechnet, niemals einem Bürgerlichen Zutritt zu unserer Gesellschaft gewährt hätten, während man nun dem Reichtum […] seine Achtung erweist, so sehe ich ein, dass man vom hohen Ross herunter steigen muss.» Bei Tisch überlasse er die Ehrenplätze den Bürgerlichen, um sich selbst «an die ‹Égalité› zu gewöhnen».[70]
Gewiss, viele der Reformen zum friedlichen Bau eines modernen Staates ließen sich nicht so schnell wie gewünscht oder auch gar nicht umsetzen, und wie in Frankreich brach mit der Restaurationszeit ab 1815 der reformerische Impuls in vielerlei Hinsicht ab.[71] Dennoch wurde die Neuerungsdynamik nicht einfach gestoppt. Die Veränderungen waren Teil eines langfristigen Prozesses: Die meisten europäischen Staaten hatten im 18. Jahrhundert längst mit einer umfassenden Regierungs- und Verwaltungsreform begonnen und sich um eine Neuordnung des Rechts- und Bildungswesens bemüht. 1786 war in Österreich das Josephinische Zivilgesetzbuch in Kraft getreten, 1794 das Allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten – beide Kodifikationswerke waren machtvoller Ausdruck eines modernen Reformwillens, der sich schon vor der Französischen Revolution herausgebildet hatte.
So stellte die «Modernisierungselite» zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Weichen neu.[72] Die Historikerin Barbara Vogel hat mit der Bezeichnung der Reformen als «bürokratischer Revolution» wohl die beste Umschreibung für den Aufbruch gefunden.[73] Die «Revolution von oben» war dabei keineswegs ein typisch deutscher Kurs, sondern vielmehr der gängige europäische Weg. Auch in Großbritannien, Schweden oder Österreich nahmen um 1800 aufgeklärte Eliten Staatsreformen in Angrif f. Demokratie begann in aller Regel als staatliches, bürokratisches Eliten- und Reformprojekt. Blutige Revolutionen waren nicht die Norm, sondern die Ausnahme. Die entscheidenden Akteure handelten aber in dem Bewusstsein des Neuen – die Zeiten änderten sich, die Erwartungen weiteten sich. «Revolution» und «Evolution» wurden synonym verwendet, meinten aber beide: Hier entsteht eine neue Welt![74] Für viele Staaten bedeutete das einen Bruch mit dem Vorherigen. «Über den Süden brach nun urplötzlich und mit der Rohheit einer revolutionären Macht der moderne Staat herein», beurteilte Heinrich von Treitschke die Situation der süddeutschen Staaten zu Beginn des 19. Jahrhunderts, ein Urteil, das bis heute als angemessen gilt.[75]
Gleichheit und körperliche Freiheit
Eine wesentliche Quelle für Ungleichheit war jedoch kaum wegzudenken: die Ungleichheit zwischen den Städtern und den Menschen auf dem Land. Sosehr sich das Leben von Stadt zu Stadt unterschied und der ländliche Raum in seiner Vielfalt sich schwerlich auf einen Punkt bringen lässt,[76] so ist die Unterscheidung zwischen beiden Sphären doch sinnvoll, schon allein deshalb, weil sie für die Zeitgenossen grundlegend war. «Der Bauer» galt als depriviert und war verachtet.[77] Recht betrüblich sei «der Anblick der politischen Zustände» auf dem Land, so der schwäbische Ökonom Friedrich List im Jahr 1842. Die Kleinbauern seien angesichts ihrer Unbildung und der verarmten Lebensumstände schlicht nicht in der Lage, «vollwichtige Staatsbürger» zu sein, also gültige, gleichberechtigte Bürger.[78] Menschen in ländlichen Räumen besaßen meistens weniger Rechte und blieben häufig ohne Wahl: im Hinblick auf ihr Essen, ihre Kleidung, ihren Beruf, ihre Lebensweise; selbst die Heirat mussten diese Frauen und Männer häufig erst genehmigen lassen. Sie führten ein Leben «unter der Würde des Menschen», wie Philipp Lindemann 1832 kritisch notierte.[79] Die Durchsetzung der Lesefähigkeit wurde dann vor allem eine Frage der Durchdringung des ländlichen Raums. Der «Landmann» war ein Analphabet, der ums blanke Überleben kämpfen musste, der sein Dasein in der Peripherie fristete, abseits der Stadt, in der die relevante Politik spielte und in der sich die Magistrate und Parlamente trafen. Diese Zuschreibungen durch die Zeitgenossen führten ganz selbstverständlich zu seinem Ausschluss aus allen politischen Wahlen. Allein die Frage, wie der Landmann zur nächsten Stadt hätte gelangen können, war vor Beginn des großen Straßen- und Eisenbahnbaus nicht ganz einfach und ließ häufig seine Inklusion gar nicht erst denkbar erscheinen.
Die Bauernbefreiung, wie der lange Prozess zur Abschaffung unterschiedlichster Abhängigkeiten und körperlicher Unfreiheiten vereinfachend genannt wird, war ein Herzstück der Reformen um 1800. Das «Land» war die dominierende ökonomische und soziale Wirklichkeit. Hier lebten in Europa – mit starken Varianten – rund vier Fünftel der Bevölkerung. Die Bauernbefreiung wurde daher auch als «die große und fundamentale Reform der Gesellschaft überhaupt» bezeichnet, die Reform, «die das bürgerliche Zeitalter eröffnet».[80] Denn es ging – idealtypisch gesprochen – darum, der Mehrheit der Bevölkerung individuelle Würde zu verleihen, die Hemmnisse gegen die Gleichheitsvorstellungen auch hier zu durchbrechen – und zwar auf Kosten des Adels, dessen Rechte und hierarchische Logik dadurch eine massive Einbuße erfuhren. Auch wenn die Bauernbefreiung für viele zunächst verwirrend war und neue Probleme und neues Elend für die Betroffenen schuf, so bedeutete sie doch einen wesentlichen Bruch mit der Ständegesellschaft. Hardenberg forderte in der Rigaer Denkschrift: «Der zahlreichste und wichtigste, bisher allerdings am mehrsten vernachlässigte und gedrückte Stand im Staat, der Bauernstand, muß notwendig ein vorzüglicher Gegenstand seiner Sorgfalt werden.»[81]
Wie die Folter galten auch die Leibeigenschaft und die Sklaverei im öffentlichen Diskurs als nicht «zivilisiert». Trotz der Verschiedenartigkeit von außereuropäischer Sklaverei und bäuerlicher Unfreiheit wurden beide Formen immer wieder – wie zunehmend auch die Ungleichheit der Frauen – als «Sklaverei» bezeichnet. Die Installierung «leibhaftiger Freiheit» (Peter Blickle) war denn auch generell ein entscheidender Schritt zur Installierung eines Körperregimes, das egalitäre Vorstellungen ermöglichte.[82] Das war keine Geschichte des sukzessiven Fortschritts. In Amerika erließ die gesetzgebende Versammlung Pennsylvanias 1780 das erste Gesetz in der westlichen Welt zur Abschaffung der Sklaverei. Und zumindest einem Teil der Gründungsväter war schon früh klar, dass Sklaverei gegen alles stand, wofür sie kämpften. Doch durch die Unabhängigkeit gewannen die US-Sklavenhalter an Macht, und die Sklaverei blieb noch fast hundert Jahre bestehen.[83] In der französischen Kolonie Saint-Domingue kam es, inspiriert durch die Revolution, zu einem Sklavenaufstand unter dem lesekundigen einstigen Sklaven Toussaint L’Ouverture, wodurch sich der französische Konvent 1794 genötigt sah, die Sklaverei abzuschaffen. Doch Napoleon führte sie bereits 1802 auf Drängen der Briten wieder ein – die allerdings aufgrund des massiven Drucks vor allem frommer Protestantinnen und Protestanten die Sklaverei 1807 selbst verboten. Erst 1848 wurde in Frankreich die Sklaverei endgültig abgeschafft.[84]
Gleichheit für Sklaven war kein Ziel der französischen Revolutionäre. Gleichheit für Frauen ebenfalls nicht. Als Olympe de Gouges (1748–1793) die Égalité beim Namen nannte, war sie zur Erfolglosigkeit verdammt. «Die Frau wird frei geboren und bleibt dem Mann an Rechten gleich», schrieb sie in einem als Bittschrift an die Königin gekleideten Aufruf «Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne». Die Autorin sah ihren Appell als Gegenstück zur Menschenrechtserklärung von 1789, der «Déclaration des droits de l’homme et du citoyen». Mittlerweile ist die Streit- und Bittschrift berühmt. Doch ihr Appell scherte die Revolutionäre wenig. 1793 wurde die bekennende Royalistin und Gegnerin der Todesstrafe, die öffentlich den Terror der Revolutionäre verurteilt und Mitleid für den König gefordert hatte, guillotiniert. Die Gleichheit der Frauen war noch weniger vorstellbar als die versklavter schwarzer Männer. Ihre Körper blieben, wie im Code Civil 1804 besiegelt wurde, selbstverständlich Eigentum der Männer.
Unterschiedliches Maß an Gleichheit: Toussaint L’Ouverture, Olympe de Gouges und ein französischer Citoyen
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: