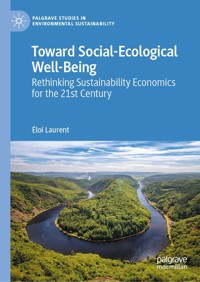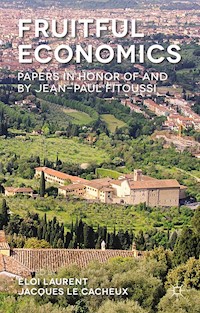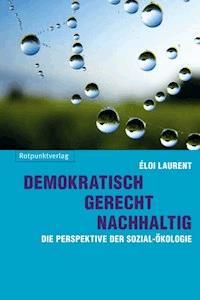
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
"Die Sozial-Ökologie bringt eine großartige Hoffnungsbotschaft mit sich: Unsere Gesellschaften werden gerechter sein, wenn sie nachhaltiger sind, und nachhaltiger, wenn sie gerechter sind." Ökologische Fragen, meint der französische Wirtschaftswissenschaftler Éloi Laurent, seien immer auch soziale Fragen, und deshalb könnten Umweltprobleme in Zukunft nur noch mittels einschneidender gesellschaftlicher Veränderungen gelöst werden. Die Gesellschaften der einzelnen Länder, Europas und der ganzen Welt sind längst im Zerreißen begriffen und die sich weiter öffnende Reichtumsschere spielt in den ökologischen Krisen der Gegenwart eine immer gewichtigere Rolle. Deshalb hält Laurent die Aufwertung demokratischer Rechte für das wichtigste Mittel, um gegen ökologische Katastrophen anzukämpfen. Kenntnis- und faktenreich setzt sich Laurent mit den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und den jüngsten "Umweltkatastrophen" auseinander: die Erdbeben in Sichuan und Haiti, Hurrikan Katrina. Und er zeigt anhand von Beispielen aus der Vergangenheit und Gegenwart auf - UdSSR, USA, China -, wie eng Demokratisierung und Nachhaltigkeit aufeinander wirken (könnten).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Éloi Laurent
Demokratisch – gerecht – nachhaltig
Éloi Laurent
Demokratischgerechtnachhaltig
Die Perspektive der Sozial-Ökologie
Aus dem Französischenvon Monika Noll und Rolf Schubert
Für Sylvie, ohne die dieses Buch nicht entstanden wäre
Die Originalausgabe unter dem Titel Social-Écologie erschien 2011 bei Flammarion, Paris.
© Flammarion, 2011
© 2012 Rotpunktverlag (deutsche Ausgabe)
www.rotpunktverlag.ch
Umschlagfoto: photocase.com/jarts
1. Auflage 2012
ISBN 978-3-85869-501-7
eISBN 978-3-85869-502-4
Zweifellos sind wir es nicht gewohnt,uns selbst als Agens unserer Naturordnung zu begreifen.Dennoch ist sie unsere Kunst, wie wir die ihre sind.
Serge Moscovici, Versuch über die menschliche Geschichte der Natur
Inhalt
Einleitung
Für eine Steuerung der zweiten Natur
I Für einen Entwurf der Sozial-Ökologie
1 Jenseits des Ökonomismus
Welche Freiheit bleibt den kommenden Generationen? Worum es geht: Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit Die drei Wege der Sozial-Ökologie: Gedächtnis, Erfahrung, Handeln
2 Warum die heutigen Ungleichheiten unhaltbar sind
Armut als ökologisches Verhängnis Mehr produzieren, um weniger zu verschmutzen? Wir brauchen zukunftsfähige Institutionen Die falsche Tugend der Reichen Das Zeitalter der ökologischen Ungleichheiten
3 Sichuan, Katrina, Haiti: Den Zorn der Götter gibt es nicht
Das Schulbeispiel für Erdbeben Ansätze zu einer Theorie der sozial-ökologischen Katastrophe Ungleichheit, die Achillesferse der reichen Länder
II Für eine Umsetzung der Sozial-Ökologie
4 Das Trugbild der grünen Diktatur
Demokratie als Prozess Demokratie ist ein System der ökologischen Wachsamkeit Vom Ökologenkönig zum aufgeklärten Bürger Verteidigung und Lob der Demokratie: China, die Vereinigten Staaten und die anderen
5 Ansätze zu einer sozial-ökologischen Politik
Für den Aufbau sozial-ökologischer Resilienz Für den Schutz der globalen Identität Für die Umweltgerechtigkeit in Europa und Frankreich Für eine Erweiterung der »grünen Ökonomie«
Schlussbemerkungen
Sozial-Ökologie im demokratischen Gemeinwesen
Dank
Anmerkungen
Einleitung
Für eine Steuerung1 der zweiten Natur
Je mehr sich die großen Umweltkrisen der Gegenwart – Klimawandel, Zerstörung der biologischen Vielfalt, Verfall der Ökosysteme, Wasserverknappung und -verschmutzung – zuspitzen, umso fruchtloser wird jeder Versuch, uns Menschen als etwas vom Naturzusammenhang Gesondertes zu betrachten. Auf die Natur sind wir angewiesen, wenn wir unser Überleben und unser Wohlergehen sichern wollen. Bei einer Erderwärmung von mehr als zwei Grad Celsius wird uns das Leben schwer werden; bei mehr als sechs Grad Erwärmung wird der Planet Erde unbewohnbar sein. Trotz all unserer Intelligenz wird es uns nicht gelingen, für die freiwilligen Dienste von Ökosystemen, deren großzügige Gaben zur Neige gehen, künstlichen Ersatz zu schaffen, um unsere elementaren Bedürfnisse – atmen, trinken, essen, anschauen – befriedigen zu können. Ohne die reiche Vielfalt an Lebensformen, die nicht nur Quelle materiellen Wohlstands, sondern auch Wissensspeicher ist, werden wir biologisch verarmen und geistig verkümmern. Unsere Abhängigkeit von der Natur ist daher ganz real, und wenn wir das nicht begreifen, schaden wir uns mit der üblen Behandlung der Letzteren im Grunde nur selbst. Den allgemeinen Rahmen dieses Buches bildet also nicht das Verhältnis zwischen Mensch und Natur; es geht vielmehr um die Beziehung des Menschen zur restlichen Natur.
Mittlerweile gilt nämlich, und das ist das grundsätzlich Neue an unserer Epoche, das Abhängigkeitsverhältnis auch umgekehrt: Die restliche Natur – so, wie sie uns heute, nach Milliarden von Evolutionsjahren, umgibt – ist abhängig von uns Menschen. Genau dies bedeutet der Eintritt ins Anthropozän, in jenes neue Erdzeitalter, in dem der Mensch zur wichtigsten geologischen Kraft unseres Planeten wird, zum König der Elemente. Ohne das geringste Bewusstsein von der eigenen Macht bringt der blutjunge Herr über die Biosphäre die etwa eineinhalb Millionen Arten von Lebewesen an den Rand des sechsten großen Aussterbens2 – in der Nachfolge jenes anderen, dem vor 65 Millionen Jahren die Dinosaurier zum Opfer fielen und von dem wir mit fast hundertprozentiger Sicherheit wissen, dass es durch den Einschlag eines Meteoriten ausgelöst wurde. Unsere heutige Macht ist diesem verheerenden Asteroiden durchaus vergleichbar: Hunderte Millionen von sogenannten wilden Arten werden uns entweder ihr Überleben oder ihr Verschwinden zu »verdanken« haben.
Kurz gesagt, »erste Natur« im Sinne des alten Cicero gibt es nicht mehr. Die frühe, vormenschliche Welt der Natur, die selbstverständlich ihre eigene Evolution durchlaufen hat, ist – so weit das Auge reicht – ein für alle Mal verändert und verwandelt, ganz so, wie es Serge Moscovici, einer der Pioniere der politischen Ökologie in Frankreich, vor vierzig Jahren vorausgesehen hat. Was wir »Umwelt« nennen, ist heute ununterscheidbar eins mit der »zweiten Natur«3, die der Mensch wenn schon nicht nach seinem Bilde, so doch wenigstens für seine Zwecke geformt hat. Nach neueren Berechnungen haben die Menschen bis zum Jahr 1700 nur 5 Prozent des Bodens in der Biosphäre für ihr eingreifendes Tun beansprucht (Landwirtschaft, Städte); 45 Prozent blieben damals noch in einem halb natürlichen Zustand und 50 Prozent ganz und gar unberührt. Im Jahr 2000 dagegen beansprucht der Mensch für sein Eingreifen 55 Prozent des Bodens, während 20 Prozent im halb natürlichen Zustand und 25 Prozent unberührt bleiben.4 »Der Mensch ist gleichermaßen Geschöpf und Schöpfer seiner Umwelt«, mahnte schon 1972 die Konferenz von Stockholm in ihrer Schlussdeklaration. Um zum Kern unserer Sache vorzustoßen, wollen wir noch einen Schritt weiterdenken: Wenn es stimmt, dass heute die gesamte Natur abhängig von uns Menschen ist, dann wird für die Entwicklung der Ökosysteme und der in ihnen beheimateten Arten entscheidend sein, wie wir unsere Gesellschaften organisieren. Mit anderen Worten, aus den ökologischen sind soziale Probleme geworden.
Wie lässt sich ein Begriff von den komplizierten Beziehungen zwischen Sozial- und Ökosystemen gewinnen? Die Letzteren bilden den oftmals unsichtbaren Hintergrund der menschlichen Gesellschaften. Außerdem hat man sie hier und da als Metapher, ja als Modell für Gesellschaftssysteme verwendet, nicht selten allerdings im Dienst gefährlicher5 oder dubioser6 Ideologien und fast immer zum Zweck einer Naturalisierung gesellschaftlicher Probleme7. Aber da wir vermehrt in umgekehrter Richtung denken müssen, gilt es zu begreifen, wie sich die Evolution der Gesellschaftssysteme auf die Dynamik der Ökosysteme auswirkt. Dass uns diese Frage unter den Nägeln brennt, steht außer Zweifel: Wir müssen uns, ob wir wollen oder nicht, mit einer Reihe ernsthafter Probleme befassen, die wir ebenso sehr geschaffen haben, wie wir von ihnen heimgesucht werden, und die daher in keiner Weise »natürlich« sind, weder was ihre Ursachen noch was ihre Folgen angeht.
Im derzeit üblichen Diskurs verbirgt sich jedoch ein irritierendes Paradox: Je mehr der Menschheit, ganz zu Recht, die Beschleunigung der heutigen Umweltkrisen zur Last gelegt wird, umso pessimistischer wird das Urteil über ihre Fähigkeit, diese Krisen zu lösen. Zutiefst ernüchtert, konstatierten unlängst einige hochrangige Wissenschaftler, zwar habe die menschliche Erkenntnis der Ökosysteme in den vergangenen Jahrzehnten rasante Fortschritte gemacht, aber gleichwohl sei die Lage dieser Systeme schlimmer als je zuvor.8 Es empfiehlt sich also, zwei zentrale Fragen noch einmal neu zu stellen: Wie konnte der Funktionsmechanismus der menschlichen Gesellschaften solche reellen und potenziellen Katastrophen hervorbringen? Und wie kann er ihre fatalen Folgen abschwächen? Für eine offene Auseinandersetzung mit diesen Fragen spielen die Sozialwissenschaften, die ja das Verständnis menschlicher Gesellschaften zum Ziel haben, im Gegensatz zu den strengen (Natur-)Wissenschaften eine alles andere als marginale Rolle. Ganz im Gegenteil, sie rücken wieder ins Zentrum: Mit ihrer Hilfe nämlich können wir uns einen gangbaren Entwicklungspfad durch das – wie es der Harvard-Biologe Edward O. Wilson genannt hat – »Jahrhundert der Umwelt« ausdenken.
Genau dies hatte Darwin schon frühzeitig begriffen, als er in der Einleitung zu seinem Buch Über die Entstehung der Arten (1859) Worte der Anerkennung sowohl für seinen Kollegen und Konkurrenten Alfred Russel Wallace wie auch für Reverend Malthus fand. Für Wallace deshalb, weil dieser – ganz nach dem Prinzip der Mehrfachentdeckung – kurze Zeit nach Darwin und unabhängig von ihm auf das Gesetz der natürlichen Auslese gestoßen war und Darwin gewissermaßen gezwungen hat, die Vaterschaft dafür zu übernehmen und sein zwanzig Jahre zuvor konzipiertes Hauptwerk endlich zu veröffentlichen. Und für Malthus, weil seine Abhandlung über das Bevölkerungsgesetz (1798) Darwin vermutlich auf den Gedanken gebracht hat, dass zwischen den am besten angepassten Einzelwesen ein Kampf stattfindet, der im Verein mit anderen Faktoren zur Evolution der Arten beiträgt.9 Am Beginn der modernen Biologie stünde demnach ein Gesellschafts-»Modell«.
Schon die Entstehung des Begriffs »Ökologie«, die viel weniger weit zurückliegt, als man gemeinhin annimmt, zeugt nicht nur von der Schicksalsgemeinschaft zwischen Menschheit und Natur, sondern auch vom Stellenwert, den die Sozialwissenschaften für das Verständnis dieser Gemeinschaft besitzen. Wie ein Hauswesen, ein autonomes und geschlossenes Ganzes, konzipiert Ernst Haeckel die Welt der Natur, als er in den 1860er-Jahren unter Rückgriff auf den griechischen Wortstamm oikos die Ökologie als Wissenschaft von den Beziehungen der lebenden Organismen zu ihrer organischen und anorganischen Umwelt definiert. Damals wird die Ökologie zur Wissenschaft von der wechselseitigen Abhängigkeit alles Lebendigen. Gebildet ist das Wort in Anlehnung an die Ökonomie, weil die Natur wie eine große Hauswirtschaft erscheint. Auch hier dient also das Verständnis des Gesellschaftlichen als Schlüssel zum Verständnis des Lebendigen. Bevor wir aber der Verschränkung zwischen natürlicher und sozialer Welt im Einzelnen nachgehen, müssen wir uns mit deren Interdependenz befassen.
In dem begrenzten Raum, den – wie die Biologen Paul und Anne Ehrlich von der Stanford University festhalten10 – die Biosphäre darstellt und wo es noch in mehreren Kilometern Tiefe unter der Erdoberfläche und in einer über den Mount Everest hinausreichenden Höhe Leben gibt, partizipieren wir an den Ökosystemen und interagieren mit anderen Formen des Lebens, indem wir sie verzehren (Pflanzen, Samen, Fleisch), von ihnen verzehrt werden (weißer Hai, Mücken, Malariaerreger) oder mit ihnen kooperieren (Bakterien im menschlichen Körper, Jagdhunde, andere Menschen). Jeder Versuch, den Menschen als etwas vom Naturzusammenhang Gesondertes zu betrachten, und das heißt, der Natur ein An-sich zuzuschreiben, dürfte also per se problematisch sein. Ebenso problematisch wie die These, dass die Natur nur dazu da ist, uns zu dienen. Das Naturreich darf weder sakralisiert noch instrumentalisiert werden: Es geht um die Abhängigkeit zwischen sämtlichen Arten, die es bevölkern. Deren Zusammenhalt wird mit der Vereinheitlichung der ökologischen Zeit noch zusätzlich verstärkt.
In seinem Buch Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps II. vertritt Fernand Braudel die These, die geografische Dauer, nämlich »eine gleichsam unbewegte Geschichte [...], die des Menschen in seinen Beziehungen zum umgebenden Milieu«11, lasse sich sowohl von der sozialen Zeit (den ökonomischen und sozialen Zyklen) als auch von der individuellen Zeit unterscheiden. Da die menschliche Geschichte sich im Laufe des 20. Jahrhunderts drastisch beschleunigt hat, hält man diese drei Zeiten – die geografische, soziale und individuelle – immer weniger klar auseinander. Heute müssen wir erkennen, dass sie sich berühren, einander entsprechen und sich überschneiden. Die Geschichte der Beziehungen der Menschheit zu ihrer Lebenswelt, eine »träge dahinfließende Geschichte, die nur langsame Wandlungen kennt«, wird quasi in einen Strudel hineingerissen. John Muir, in den 1870er- und 80er-Jahren zum Vater der ersten Nationalparks der Vereinigten Staaten geworden, hat einmal gesagt, wann immer er sich bewusst machen wolle, was aktuell geschehe, gehe er in die Berge. Seinen Zeitgenossen wollte er damit bedeuten, dass es an ihrer Moderne nichts eigentlich Neues gebe und nur die Anschauung der Natur seiner Seele echte Erneuerung bringe. Heute finden wir das Aktuellste tatsächlich in den Bergen: Auf dem schrumpfenden Chagrinleder der Gletscher ist unsere Zukunft zu lesen.
Vereinheitlichung der ökologischen Zeit – die noch zusätzlich befördert wird durch die allmähliche Verschmelzung von Biologie und Geologie zu einer globalen »Wissenschaft von der Erde« –, aber Unterscheidung zwischen Dynamik der Natur und Dynamik des Menschen. Die Auslese der am besten angepassten Einzelwesen und Arten gehört zu den Instrumenten der natürlichen Evolution. Kulturelle Evolution hingegen ist nicht darwinistisch: Diktiert wird sie nicht, wie es mehr oder weniger jeder Rassismus behauptet, von der natürlichen Auslese, sondern von der Evolution des menschlichen Geistes samt seinen Werten, die sich in Institutionen verkörpern, deren Bestimmung es ist, zur Erleichterung der gesellschaftlichen Kooperation durch die Zeiten hindurch Bestand zu haben.
Dies ist ein wichtiger Punkt, auf den wir noch im Einzelnen zurückkommen werden, der aber schon jetzt Erwähnung verdient. Nicht menschliche Evolution verläuft vor allem über die natürliche Auslese der Einzelwesen und der Arten nach dem Kriterium der Anpassung an die Lebenswelt. Menschliche Evolution dagegen verläuft, und zwar seit mindestens 12 000 Jahren und seit der Erfindung des Ackerbaus, über Anpassung der Lebenswelt und soziale Differenzierung, die beide wiederum Einfluss auf die biologische Evolution nehmen. Anders gesagt, der Mensch errichtet Institutionen, mit deren Hilfe er hier und jetzt das Leben verändern und sich zum Herrn über einen Teil seiner Evolution machen kann. Man denke nur an die Rolle, die der Sozial- oder Wohlfahrtsstaat im 20. Jahrhundert für die Fortschritte der menschlichen Organismen gespielt hat. Tiere und Pflanzen überleben, weil sie an die Vorgaben ihrer Umwelt angepasst sind. Uns Menschen dagegen geht es gut auf der Erde, weil wir die Umwelt an unsere Bedürfnisse und Wünsche anpassen. Unsere Evolution ist so angelegt, dass unsere Institutionen – und im weiteren Sinne unsere Kultur (als Summe oder vielmehr Produkt unserer Verhaltensnormen, Institutionen und Technologien) – nicht genetisch, sondern durch Lernen, also Erziehung, weitergegeben werden. Politische Institutionen spielen also eine zentrale Rolle in der Evolution jener kulturellen Systeme, die den Rahmen für die menschliche Evolution abgeben.
Wie stark diese kulturellen Systeme sind, veranschaulicht ein Gegenwartsphänomen, das für die Entschärfung unserer Umweltkrisen entscheidend sein wird: die demografische Dynamik. Im Zentrum des Umweltbewusstseins der 1960er- und 1970er-Jahre stand die Angst vor der Überbevölkerung; davon zeugten die Reaktionen auf das 1968 publizierte Buch von Paul R. Ehrlich, in dem er die unmittelbar bevorstehende Explosion der »Bevölkerungsbombe« ankündigte. Aber die »Bombe« wurde, wie der Autor heute einräumt, partiell entschärft durch sinkende Geburtenraten in den Entwicklungsländern, für die heute als stärkste Triebkraft die Bildung der Frauen verantwortlich ist. Mitte der 1960er-Jahre, etwa zu der Zeit, als das Buch erschien, hat die jährliche Wachstumsrate der Weltbevölkerung ihr Maximum (etwa 2,2 Prozent) erreicht; seither ist sie nahezu halbiert worden (auf etwa 1,1 Prozent), zugleich allerdings auch die Sterblichkeitsrate. Die Geburtenzahl ist von fast fünf auf zweieinhalb Kinder pro Frau gesunken – eher moderat in den wirtschaftlich am weitesten entwickelten Regionen (von 2,6 auf 1,6), aber erheblich in den am wenigsten entwickelten Regionen (von 6 auf 2,6).12 Die schwierige Übergangszeit von heute bis 2050 (mehr als zwei Milliarden Menschen zusätzlich in den Entwicklungsländern), auf die vermutlich ein allgemeiner Rückgang des Bevölkerungswachstums folgen wird, erfordert umso dringlicher weitere Fortschritte in unseren kulturellen Systemen.
Zusammenhalt in der Welt der Natur, Vereinheitlichung der ökologischen Zeit, Einzigartigkeit der menschlichen Evolution, entscheidender Einfluss der kulturellen Systeme des Menschen auf die restliche Natur: In Zukunft wird die ökologische Frage dort entschieden, wo sie sich mit der sozialen Frage berührt. Aber warum sollte es so dringend erforderlich sein, den Zusammenhang beider zu denken? Weil unsere krankhafte und durch die derzeitige »große« Krise noch zugespitzte Fixierung auf das Kurzfristige die beiden Sphären tendenziell zu unversöhnlichen Feinden macht. Wenn wir annehmen, wir könnten zwischen dem sozialen und dem ökologischen Imperativ wählen, verschärfen wir nur die Ungerechtigkeit und beschleunigen die Katastrophen. Die von mir so genannte Sozial-Ökologie bringt, wenn man sie richtig versteht, eine großartige Hoffnungsbotschaft mit sich: Unsere Gesellschaften werden gerechter sein, wenn sie nachhaltiger sind, und nachhaltiger, wenn sie gerechter sind.
Zusammenhang zwischen sozialer Gerechtigkeit und Ökologie meint etwas ganz Bestimmtes: Soziale Ungleichheiten gehören zu den wichtigsten Ursachen der aktuellen Umweltprobleme, und die gegenwärtigen Umweltkrisen treffen, heute und in Zukunft, am härtesten die Mittellosen, und zwar in den reichen Ländern nicht anders als in den armen. Eben dies war der große analytische Neuansatz, dem der Brundtland-Bericht von 1987 gefolgt ist. Er wurde vorbereitet durch die Weltumweltkonferenz von Stockholm, die 1972 in ihrer Schlussdeklaration formulierte: »In den Entwicklungsländern werden die meisten Umweltprobleme durch Unterentwicklung verursacht.« Eine vorschnelle Interpretation dieser beiden für unsere Moderne so grundlegenden Texte könnte zu dem Schluss verleiten, wirtschaftliche Entwicklung sei das Allheilmittel für Umweltprobleme und es erübrige sich, sie zusätzlich mit – hier und da so genannter – sozialer »Seele« auszustatten. Das ist ein Irrtum.
Das vorliegende Buch will sich dezidiert von diesem versöhnlerischen Bild verabschieden und den Beweis für die folgende These antreten: Demokratie ist als Ergebnis der kulturellen Evolution des Menschen genau dasjenige, was für die Entschärfung unserer heutigen Umweltkrisen am dringendsten gebraucht wird, weil nur sie die Einkommens- und Machtunterschiede abzubauen vermag. Seit zwei Jahrhunderten bewegen sich die modernen Gesellschaften, wenn auch zu langsam und etwas ungeordnet, auf ein Mehr an Gerechtigkeit zu. Dieses Gerechtigkeitserbe ist für die Auseinandersetzung mit den schwerwiegenden Problemen, die auf uns zukommen, umso wertvoller, als die Gesetze der natürlichen Anpassung auf das rasante Tempo des weltweiten ökologischen Wandels ganz und gar nicht vorbereitet sind. So wird es zum Beispiel lange Zeit brauchen, bis der menschliche Körper sich biologisch an die Klimastörungen angepasst hat. Bis dahin muss die Aufgabe der Anpassung des Menschen von den kulturellen Systemen – und den Institutionen, in denen sie sich verkörpern – übernommen werden. Und im Zentrum dieser Systeme muss das Gerechtigkeitsprinzip stehen.
Die internationalen Verhandlungen zum Klimawandel, die in Kopenhagen (Dezember 2009) scheiterten und in Cancún (Dezember 2010) sowie in Durban (Dezember 2011) nur minimale Fortschritte machten, haben der Weltöffentlichkeit vor Augen geführt, dass die Lösung sämtlicher Umweltdebatten in nichts anderem besteht als in der Gerechtigkeit unter den Menschen, und das gilt für jedes einzelne Land ganz ebenso wie für die Welt insgesamt. Genau dies ist der Kernpunkt des Streits zwischen armen und reichen Ländern, bei dem es um die historische Verantwortung der Letzteren und die voraussehbaren Folgen des Klimawandels für die Ersteren geht. Um Gerechtigkeit geht es auch bei dem im Oktober 2010 in Nagoya geschlossenen ehrgeizigen Abkommen über die gerechte Verteilung der genetischen Weltressourcen im Zusammenhang mit dem Kampf um die Bewahrung der Ökosysteme und der biologischen Vielfalt. Zur Aufklärung dieses Themenkomplexes verhilft die »neue politische Ökologie«13 mit ihrem zweifachen Ansatz: Zunächst verknüpft sie wirtschaftliche Entwicklung und ökologische Zwänge miteinander und schließt daraus auf die Notwendigkeit einer Ökonomie, die sich für demokratische Vorgaben »öffnet«. Dann weist sie anhand der Ungleichheitsprobleme nach, welch zentrale Rolle für Umweltfragen das Gerechtigkeitsprinzip spielt, und stützt sich dabei auf den viel gescholtenen Begriff der nachhaltigen Entwicklung. Den zweiten Teil dieser Analyse will ich im vorliegenden Buch weiter ausführen.14
In der nachhaltigen Entwicklung verbinden sich drei verschiedene Gerechtigkeitsentwürfe: die Beziehung zwischen den Menschen der Gegenwart (synchroner Zusammenhalt); die Beziehung zwischen Menschen und restlicher Natur (Zusammenhalt zwischen natürlichen Lebewesen); und die Beziehung zwischen den Menschen der Gegenwart und der Zukunft (diachroner Zusammenhalt). Die Rede von nachhaltiger Entwicklung zielt also insbesondere auf die Frage nach der Verteilung der Umweltressourcen in Raum und Zeit und damit auf die Erkenntnis, dass beide Aufgaben – Gerechtigkeit innerhalb einer Generation und Gerechtigkeit zwischen den Generationen – eng ineinandergreifen.
Der Gedanke der Nachhaltigkeit ist mehrfach theoretisch präzisiert worden,15 auch wenn es noch immer schwerfällt, ihn praktisch umzusetzen.16 So definiert etwa der Ökonom Robert Solow vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) Nachhaltigkeit als das Bemühen, »eine allgemeine Fähigkeit zur Erzeugung wirtschaftlichen Wohlstands« durch die Zeiten hindurch zu erhalten und, genauer gesagt, »die künftigen Generationen mit allem zu versorgen, was sie brauchen, um einen mit unserem zumindest vergleichbaren Lebensstandard zu erreichen und in gleicher Weise für die Bedürfnisse der Folgegeneration vorzusorgen«.17 Sein Schluss lautet: »Wir dürfen das (im weiteren Sinn gemeinte) Kapital der Menschheit nicht einfach konsumieren.« Amartya Sen zufolge liegt der Reiz des von Solow Gesagten darin, dass es rekursiv angelegt ist; gleichwohl hat er eine substanzielle Verbesserung im Sinn. Zu diesem Zweck greift er auf die bekannte Definition aus dem Brundtland-Bericht zurück und erweitert sie, indem er »Bedürfnisse« durch »Befähigungen« (capabilities) ersetzt. Nachhaltige Entwicklung heißt für Sen: Bewahrung und Ausbau der Grundfreiheiten unserer heutigen Generation, ohne diejenigen der künftigen Generationen zu gefährden.18
Es ist also falsch zu behaupten (wie es nur allzu oft getan wird), nachhaltige Entwicklung sei zwar eine sympathische Vorstellung, aber derart verschwommen, dass sich damit nicht arbeiten lasse. Und man tut unrecht daran, sie zum bloßen Deckmantel für hemmungsloses Wachstum umzufunktionieren. Gleichwohl muss man sich eingestehen – weil es schwerlich zu leugnen ist –, dass der Gedanke der nachhaltigen Entwicklung selbst in einer Krise steckt. Die immer schnellere weltweite Wirtschaftsentwicklung in den letzten dreißig Jahren hat, fast überall zur selben Zeit, die Ungleichheiten verschärft und die Umweltschäden verschlimmert. Dabei geht es um eine kollektive Niederlage, an der auch die Umweltbewegung, die Nichtregierungsorganisationen und die internationalen Institutionen beteiligt sind. Die erträumte Dreieckskonstellation (wirtschaftlich, sozial, ökologisch) ist auf einen einzigen Fluchtpunkt zusammengeschrumpft: das im Laufe der 2000er-Jahre explodierende Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Daher die immer größere Versuchung, die ökonomische Entwicklung immer weiter voranzutreiben, um im selben Zuge, so hofft man, die soziale und die ökologische Krise zu lösen. Es gelte also, die Fata Morgana der nachhaltigen Entwicklung zurückzuweisen und bei der Tatsachenfeststellung zu bleiben: In den zwei Jahrzehnten, seit der Gedanke der nachhaltigen Entwicklung erstmals aufgetaucht ist, hat sich die Welt in eine Richtung entwickelt, die den mit ihm verbundenen Empfehlungen direkt zuwiderläuft, denn zu vermehrten Ungleichheiten sind weitere Umweltschäden hinzugekommen.19
Mein eigener Beitrag zu dieser Debatte besteht darin, dass ich in der aktuellen Konstellation von ökologischer und sozialer Krise eher die Bestätigung dafür sehe, wie sehr der Ansatz der nachhaltigen Entwicklung ins Schwarze trifft und wie wenig man von hoffnungslosem Versagen sprechen kann. Dieser Ansatz, der die Umweltdebatte um das Thema Ungleichheiten erweitert, bietet nach wie vor starke Argumente, wenn wir unsere sozial und ökologisch gefährdete Welt denken wollen. Vor allem kann von hier aus die Ökologie politisiert und konkretisiert werden. Solange wir nämlich den Umweltfragen nicht systematisch – unter dem Blickwinkel der Gerechtigkeit ebenso wie im Zusammenhang mit sozialen Verhältnissen und vor allem mit Ungleichheiten – nachgehen, bleiben sie für die Mehrzahl der Bürger eine Sache der Außenpolitik. Denn, um es mit einem Begriff von Thomas Kuhn zu sagen, das ökologische »Paradigma«, dessen Wahrheit viele erkennen, hat noch keine feste Gestalt angenommen. Mehr noch: Vor uns liegt eine Welt, in der es – hoffentlich nur für einige Jahrzehnte – einen permanenten Umweltnotstand geben wird. Mit ihren Überschwemmungen und Waldbränden, Dürreperioden und Schneestürmen, Ölhavarien und Rohstoffkrisen bilden die letzten Jahre den unheilvollen Prolog zu dieser neuen Welt der Umweltängste. Wenn es dem gesellschaftlichen Diskurs nicht gelingt, diese allgegenwärtige Bedrohung einzudämmen, wird die Umweltbewegung zu einer furchterregenden und letztlich unerträglichen »Katastrophenpartei« herabsinken.
Wie also lässt sich der genaue Zusammenhang zwischen Umweltkrisen, Ungleichheit und Demokratie denken? Man kann etwa meinen, Ungleichheit müsse dem ökologischen Gleichgewicht nicht unbedingt immer zum Verhängnis werden; schließlich sind ja die Reichsten zugleich diejenigen, die sich am meisten Gedanken über den Umweltschutz machen. Man kann auch die These vertreten, Demokratie sei für die Erhaltung der natürlichen Ressourcen grundsätzlich von Übel, weil sie der großen Mehrheit Zugang zu diesen Ressourcen verschafft, sich zugleich aber als unfähig erweist, diesen Zugang auf lange Sicht zu regulieren. Und schließlich kann man, folgt man der Logik der sogenannten Humanökologie, zu dem Schluss kommen, Verteilungs-, Gleichheitsoder Demokratieprobleme seien in jedem Fall zweitrangig gegenüber der ungesunden Wirtschaftsentwicklung, denn diese beruht auf einer unwiderstehlichen Innovationstendenz und einer politischen Ökonomie des Kapitalismus, die uns Menschen – ungeachtet aller womöglich guten Absichten der jeweils Regierenden – zum Raubbau an der Umwelt verdammt.20
Gegen diese drei Thesen wendet sich mein Buch, gestützt auf Studien und Datenmaterial, mit aller Entschiedenheit. Die Ungleichverteilung von Einkommen und Macht bildet eine grundlegende – und vielleicht die wichtigste – Ursache der gegenwärtigen Umweltprobleme, und zwar nicht nur im übertragenen Sinn »à la Veblen«21. Ganz und gar buchstäblich verschmutzt sie unseren Planeten. Ohne Frage ist exzessiver Reichtum verantwortlich für fortschreitenden ökologischen Verfall, aber dasselbe gilt für extreme Armut und, allgemeiner gefasst, für die vielfache Ungleichheit zwischen Arm und Reich.
Welcher Art sind diese Ungleichheiten? In unserer Welt haben sie mindestens drei Dimensionen. Zum einen gibt es sie als absolute Ungleichheit wie etwa Armut oder als relative Ungleichheit wie die Einkommenskluft zwischen Reichen und Armen. Im ersten Fall führt wirtschaftlicher Mangel aufgrund fehlender Alternativen zur Schädigung des Naturkapitals; im zweiten wird die Tatsache, dass die Reichen den Ärmsten die ökologischen Kosten ihres Verhaltens aufzwingen können, zum Auslöser der Umweltkrise. Die zweite Dimension wären Kaufkraft- oder Machtunterschiede. Dass zum Beispiel die Unterprivilegierten von Umweltentscheidungen ausgeschlossen sind, hängt nicht unmittelbar mit ihrem Einkommensniveau zusammen; dennoch muss man hier gegensteuern, und zwar im Namen ebenso der Gerechtigkeit wie der Effizienz. All diese Ungleichheiten – das wäre die dritte Dimension – entstehen entweder intranational, also zwischen Individuen beziehungsweise Gruppen innerhalb einer Gesellschaft, oder international; diese Unterscheidung erweist sich als sinnvoll, wenn man Umweltprobleme nach einzelnen Typen – regionale (ein verschmutzter See) oder globale (Klimawandel) – sortieren, aber auch wenn man begreifen will, wie sich absolute und relative Ungleichheit gegenseitig beeinflussen (etwa im Fall der Abholzung von Wäldern).
Die genannten Ungleichheiten sind – jede auf ihre Weise und manchmal alle zusammen – hauptverantwortlich für den fortschreitenden ökologischen Verfall und für unsere Umweltkrisen: Sie führen zu unnötigem Raubbau am Naturkapital, zu sinnlosem Einsatz seltener und kostbarer Ressourcen, zu einem Absinken des allgemeinen Lebensstandards aufgrund schlechter Umweltverhältnisse sowie zur Vervielfachung der durch ökologische Schocks verursachten sozialen Schäden. Darüber hinaus blockieren sie die dringend notwendige institutionelle und politische Weiterentwicklung, den vom Ernst der Lage eigentlich geforderten »ökologischen Übergang«. Diese Ungleichheiten, die seit zwei bis drei Jahrzehnten produziert und reproduziert werden, sind mittlerweile zu einem echten politischen Bremsklotz geworden, weil sie die Erstarrung der sozialen Positionen und der Denkschemata zu verantworten haben. Kurz, wenn die heutige Forschung überzeugend nachweist, dass soziale Ungleichheit allem, was förderlich ist, Schaden und allem, was gut ist, Böses antut,22 dann gilt das auch für die Umwelt. Es gibt viele gute Gründe, unsere Demokratien vor der Zersetzung durch Ungleichheit zu bewahren; die Sorge um die Umwelt ist nur ein Grund mehr und vielleicht der allerwichtigste.
Ausgehend von der allgemeinen Feststellung, dass die Natur mittlerweile menschliche Natur geworden ist, will ich im Folgenden zunächst darlegen, wie die Beziehung zwischen Gerechtigkeit und Ökologie aussieht. Im Anschluss versuche ich, theoretisch und empirisch zu belegen, dass Umweltprobleme zu einem Großteil von der Einkommensverteilung abhängen, was nichts anderes heißt, als dass ich Fragen, die man gemeinhin auf die Natur bezieht, in soziale Fragen verwandle. Immerhin kommt es ja in unseren Gesellschaften zu regelrechten »ökologischen Ungleichheiten«, die folglich durch »ökologische Gerechtigkeit« entschärft werden müssen. Der Abbau dieser vielfachen Ungleichheit ist ein wichtiges Instrument im Kampf gegen Umweltschäden und bei der Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger »sozial-ökologischer Katastrophen«, die gleichfalls nur zum kleineren Teil »Naturkatastrophen« sind.
Sobald wir unsere sozial-ökologische Wirklichkeit ins Auge gefasst haben, geht es um das Problem, wie wir sie in bewusste Regie nehmen können. Ins Zentrum rückt nun das Thema Demokratie samt der Frage, inwieweit sie in der Lage ist, Ungleichheit abzubauen. Fördert sie ökologische Nachhaltigkeit? Mit welchen theoretischen und empirischen Argumenten lässt sich darauf eine Antwort geben? Im zweiten Teil dieses Buches wird sich die Demokratie, anders als gemeinhin angenommen, als die Staatsform par excellence erweisen, die für Nachhaltigkeit steht; aber dazu muss man im Einzelnen klären, wie sie mit der Wirtschaftsentwicklung zusammenhängt, und erkennen, dass sie nur dann sie selbst ist, wenn sie zu einer permanenten Diskussion über Gleichheitsnormen führt, das heißt die Ausbildung und Reproduktion von Einkommens- und Machtunterschieden verhindert. Dennoch: Mit demokratischen Vorgaben allein, so unerlässlich sie sind, wird man nicht zu einer echten sozial-ökologischen Politik kommen; das gelingt vielmehr nur, wenn man über die Anpassung an Umweltprobleme nachdenkt und eine wirkliche »sozial-ökologische Resilienz« aufbaut – also die Fähigkeit entwickelt, massive Störungen aufzufangen – und sowohl im eigenen Land als auch in Europa und anderswo globale Gerechtigkeit und »ökologische Gleichheit« voranbringt. Dann, und nur dann, besteht Aussicht, dass aus der Sozial-Ökologie mehr wird als eine neue Richtschnur zur Erklärung unserer Welt und dass sie als neue politische Perspektive die Nachfolge der Sozial-Demokratie antritt.
Die heutigen Zeiten sind trügerisch: Einerseits stehen wir am Kulminationspunkt einer »großen Beschleunigung« unserer Entwicklung, die vor fünfzig Jahren begann und uns heute zwingt, die Frage nach unserer Nachhaltigkeit als Gattung zu stellen; andererseits sitzen wir seit Ende 2008 tief in einer »großen Rezession«, die unsere gesamte Perspektive verkürzt. Daher die besorgte Frage, die auch auf den folgenden Seiten zum Ausdruck kommt: Wie schaffen wir es, in einer an die Leiden der Gegenwart gefesselten Gesellschaft den Sinn für das Langfristige zu neuem Leben zu erwecken? Wie können wir vermeiden, dass die aktuelle Krise wieder einmal die Aussicht auf den ökologischen Übergang, ohne den es soziale Gerechtigkeit nicht geben wird, in weite Ferne rückt? Wie verscheuchen wir endlich die Wahnvorstellung von einem unüberwindbaren Gegensatz zwischen sozialer und ökologischer Frage?
In diesem Buch äußert sich ebenso viel Sorge wie Hoffnung. Zwar tragen wir Menschen noch weit mehr Verantwortung für die Umweltbedrohung, als wir wahrhaben möchten, aber wir haben unser (gesellschaftliches) Schicksal auch weit mehr im Griff, als wir zu glauben bereit sind. Mein Ansatz ist weniger idealistisch als pragmatisch. Wir erfreuen uns zweier Gemeingüter, eines kulturellen (Demokratie) und eines natürlichen (Umwelt). Beide können wir entweder verlieren, wenn wir das eine wie das andere verkommen lassen, oder bewahren, wenn wir uns die Mühe machen, ihre Abhängigkeit voneinander zur Kenntnis zu nehmen. Die Thesen, die ich im Folgenden vertrete, gehen aus von einer Verschränkung zwischen Sozial- und Ökosystemen, die unserem spontanen Wissen widerstreben mag. Von Darwin haben wir ja nicht nur gelernt, dass alle Lebewesen eng zusammengehören, sondern auch, dass die Fülle des Naturreichs aus der Differenzierung der Arten und Individuen entspringt. Gleichwohl ist die Bewahrung der natürlichen Vielfalt unserer Welt in erheblichem Maße angewiesen auf die Wiederherstellung sozialer Homogenität. In der im April 2010 formulierten Erklärung von Cochabamba23 heißt es dazu: »Um zum Gleichgewicht mit der Natur zu kommen, muss man erst einmal Gerechtigkeit unter den Menschen schaffen.« Gerade der Blick auf Ungleichheiten hilft uns, die widerstreitenden Imperative Fortschritt und Bewahrung miteinander zu versöhnen. Eine solche Perspektive hat positive und normative Auswirkungen auf die Umweltproblematik, weil man mit ihrer Hilfe die Letztere besser begreifen und besser in Regie nehmen kann. Unsere Umweltkrisen werden die Stunde der Wahrheit für unsere Demokratien sein. Sie sind es schon heute.
I
Für einen Entwurfder Sozial-Ökologie
1 Jenseits des Ökonomismus
Die weltweite Finanzkrise, die im Herbst 2008 mit einem Schlag unübersehbar wurde, ist nicht nur eine ökonomische Krise, sondern zugleich eine Krise der Ökonomie. Sie offenbart endgültig den Konkurs jener – schon früher kritisierten1 – Modelle und Theorien, die seit Mitte der 1970er-Jahre im akademischen Milieu auf ganzer Linie den Ton angeben und große Teile der übrigen Sozialwissenschaften, der Politikerkreise und der öffentlichen Auseinandersetzung infiltriert, um nicht zu sagen kontaminiert haben. Es bedarf also einer Neubegründung der ökonomischen Analyse. Nicht mehr und nicht weniger. Auf keinen Fall aber darf man sich in der Diagnose irren, denn es wäre verheerend, wenn das alte, löchrig gewordene Paradigma nur durch ein neues, gleichermaßen falsches verdrängt würde.
Vorneweg sei gesagt, dass diese »große« Finanz- und Wirtschaftskrise nicht einfach das Ergebnis eines unbedeutenden Regulierungs- oder Überwachungsausfalls, sondern das Symptom einer tief greifenden sozialen Krise ist, in deren Zentrum die Auflösung der Lohnarbeitsgesellschaft steht. Aber die soziale Krise ist ihrerseits eine Metapher. Sie verweist auf die schon jetzt auf dem Vormarsch befindliche Umweltkrise (oder besser: die Umweltkrisen). Zahlreiche Beobachter haben mittlerweile begriffen, dass die in den vergangenen Jahren auf den Finanzmärkten geforderten exorbitanten Gewinne die für die Finanzierung der Wirtschaft