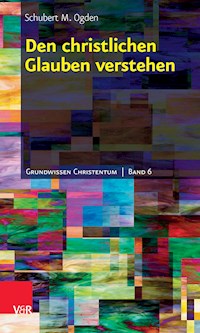
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Grundwissen Christentum
- Sprache: Deutsch
As an introduction to Christian systematic theology, this volume treats of the main theological topics – from God to last things – seeking to explicate critically the understanding of them implicit in Christian faith itself in terms at once appropriate to Jesus Christ and credible to human existence. Its criteria, accordingly, are the ultimate criteria of, on the one hand, specifically Christian experience of Jesus as expressed by the apostolic witness, and, on the other hand, generically human experience of existence as expressed by a sound philosophy. And, as befits an introduction, it employs these same criteria to clarify the process of actually doing Christian systematic theology. Thus it begins by explaining both what such a theology has to do and how it is to do it, and ends by considering what it means to do theology as a Christian calling, particularly as a professional theologian.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Grundwissen Christentum
Herausgegeben von Markus Mühling
Band 6
Schubert M. Ogden
Den christlichen Glaubenverstehen
Übersetzt vonRegine Kather
Vandenhoeck & Ruprecht
Copyright der englischen Originalausgabe:Schubert M. Ogden, The understanding of Christian faith.Eugene OR: Cascade Books 2010.Mit freundlicher Genehmigung von Wipf & Stock.www.wipfandstock.com
Umschlagabbildung: © www.shutterstock.com, multicolored glass background, Dominique Landau
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-525-59361-5
eISBN 978-3-647-99591-5
Weitere Ausgaben und Online-Angebote sind erhältlich unter: www.v-r.de
© 2014, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A.www.v-r.deAlle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: Konrad Triltsch Print und digitale Medien GmbH, OchsenfurtDruck und Bindung: Hubert & Co, Göttingen
Meinen Studentinnen und Studenten
Echte Treue zur Tradition besteht nicht in der Kanonisierung eines bestimmten Stadiums der Geschichte. Sie ist freilich immer Kritik der Gegenwart vor dem Forum der Tradition; sie ist aber ebenso auch Kritik der Tradition vor dem Forum der Gegenwart. Echte Treue ist nicht Wiederholung, sondern Weiterführung.
Echte Treue ist nie repristinierende ¸Wiederholung‘, sondern allein kritische Aneignung, die sich die legitimen Anliegen der Tradition zu eigen macht und sie in neuer Gestalt zur Geltung bringt.
Rudolf Bultmann
Inhalt
Vorwort des Herausgebers
Vorwort
1. Prolegomena: Über Theologie
1.0 Einleitende Bemerkungen
1.1 Theologie im Allgemeinen
1.2 Die christliche Theologie im Besonderen
1.3 Christliche systematische Theologie
1.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerung
2. Über Gott
2.0 Einleitende Bemerkungen
2.1 Die Frage nach Gott
2.2 Gott, der uns durch unseren Herrn Jesus Christus siegen lässt
2.3 Der dreieinige Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist
3. Über die Schöpfung
3.1 Die Bedeutung des Begriffs „Schöpfung“
3.2 Die Schöpfung und ihre Befreiung
3.3 Die Frage nach dem Bösen
3.4 Die menschliche Existenz
4. Über Jesus Christus
4.0 Einleitende Bemerkungen
4.1 Die konstitutive christologische Behauptung
4.2 Jesus, der der Christus genannt wird
4.3 Zur Freiheit hat uns Christus befreit
5. Über den Heiligen Geist
5.1 Benötigen wir eine „Theologie des Heiligen Geistes“?
5.2 Der Heilige Geist im christlichen Glauben und in der christlichen Erfahrung
5.3 Der Herr als Lebensspender
5.4 Leben im Geiste
6. Über die Kirche
6.0 Einleitende Bemerkungen
6.1 Die Konstitution der Kirche
6.2 Die charakteristische Aufgabe der Kirche
6.3 Die Verpflichtungen kirchlicher Mitgliedschaft
6.4 Die Mittel zur Durchführung der kirchlichen Aufgabe
7. Über Erlösung
7.0 Einleitende Bemerkungen
7.1 Die Sünde, von der wir erlöst sind
7.2 Die Erlösung von der Sünde aus Gnade allein durch den Glauben
7.3 Einige Probleme bei der Entwicklung der Erlösungslehre
8. Über die letzten Dinge
8.1 Die „letzten Dinge“ in der protestantischen orthodoxen Theologie
8.2 Die Bedeutung christlicher Hoffnung
8.3. Die Überwindung einiger Antithesen der herkömmlichen Eschatologie
9. Epilegomena: Über Theologie als christliche Berufung
9.0 Einleitende Bemerkungen
9.1 Die verschiedenen Bedeutungen von „Berufung“
9.2 Theologie als christliche Berufung
9.3 Weitere Merkmale christlicher Berufungen
9.4 Zusammenfassung
Bibliographie
Index der Bibelzitate
Sach- und Namensregister
Vorwort des Herausgebers
Mit „Den christlichen Glauben verstehen“ von Schubert Ogden erscheint hier der sechste und letzte Band der Reihe Grundwissen Christentum und damit zugleich einer ihrer wichtigsten, steht die Reihe doch in der Tradition Luthers, nach der ein Christ Kenntnis dessen besitzen sollte, was zum Leben und Sterben nötig ist. Diese Kenntnis ist aber keineswegs ein Wissen, das man auswendig lernen könnte, sondern es handelt sich darum, in der eigenen Lebenswelt den christlichen Glauben denkerisch verantworten zu können. Diese Aufgabe ist nur z.T. an Theologen delegierbar, nämlich insofern sie methodisch kontrolliert und im Gespräch mit denjenigen Wissenschaften geschieht, die nicht wie die Theologie auf das Ganze der Wirklichkeit, sondern auf Teilbereiche gerichtet ist. Derjenige Teil der denkerischen Verantwortung des eigenen Glaubens, der sich auf die eigene Lebenswelt, die heute zum größten Teil eine pluralistische Lebenswelt ist, bezieht, ist hingegen nicht delegierbar. Dies bezieht sich streng genommen nicht nur auf den christlichen Glauben, sondern auf jegliches Wirklichkeitsverständnis. Damit ist letztlich jeder – entgegen des allfälligen Missverständnisses, Glaube sei Privatsache und gehe daher niemanden etwas an – auskunftspflichtig über sein Wirklichkeitsverständnis, das sein Handeln motiviert und steuert. Allerdings setzt dies auch voraus, dass man verantwortungsfähig ist und für die Perspektive des christlichen Glaubens will diese Reihe zur Bildung an deren Verantwortungsfähigkeit beitragen.
Deren wichtigste Aufgabe besteht darin, Glaubensfragen und -probleme zu stellen, miteinander und der Lebenswelt in Bezug zu setzen, Problemlösungen zu kennen und selbst aufgrund bestimmter Kriterien im Zusammenhang beantworten zu können. Es geht also mehr um eine Fähigkeit, die man nur durch Übung und in Ausein andersetzung mit einer Position erlangen kann. Dafür liefert Schubert Ogdens Buch aus mindestens drei Gründen ganz hervorragende Voraussetzungen:
1. Ogden versteht Theologie als die kritische Aneignung und Überprüfung der Geltungsansprüche des christlichen Zeugnisses, ob sich dies nun explizit oder implizit ereignet und zeigt exemplarisch, wie eine solche kritische Aneignung und Überprüfung auch ohne jahrelanges Fachstudium gelingen kann.
2. Ogden nimmt zu diesem Zweck eine eigene Position ein, an der die Leserin und der Leser ihre eigenen Fähigkeiten, den Glauben zu verantworten, üben können. Nicht immer mag man seinen Lösungen zustimmen. Aber selbst wo man dies nicht tun mag, legt er seine Gründe und die Gegengründe doch so offen, dass deutlich ist, dass es sich um Sachentscheidungen und nicht um Geschmacksfragen handelt.
3. Schubert Ogden ist in seiner Theologie sowohl von einem bedeutenden Zweig der deutschsprachigen Theologiegeschichte des 20. Jh. als auch von der angloamerikanischen theologischen und philosophischen Tradition beeinflusst – vor allem von der Tradition Rudolf Bultmanns und der prozessphilosophischen Tradition – und zeigt so zweierlei: Theologie ist erstens nicht an Schulmeinungen gebunden und bewegt sich nicht in geschlossenen idiosynkratischen Systemen, sondern es geht ihr um Kommunikationsfähigkeit. Zweitens zeigt sich diese Kommunikationsfähigkeit auch darin, dass auch in Zeiten der Verselbständigung sowohl der Kontinentaleuropäischen als auch der angloamerikanischen Tradition fruchtbare Kommunikationen selbstverständlich sein sollten.
Ogdens Buch kann daher für zwei Leserkreise geeignet sein: zum einen für jede und jeden Gebildeten, die oder der dieser nicht-delegierbaren Aufgabe der Verantwortung des Glaubens und seines Zeugnisses nachkommen will, sei es dass er damit beginnen oder seine Fähigkeiten steigern will. Zum anderen aber auch für jede und jeden, die oder der sich darauf vorbereitet, dass es seine oder ihre berufliche Hauptaufgabe sein wird, den christlichen Glauben vor einem spezifischen Forum, sei es das der Gemeinde oder das der Schule, professionell zu verantworten, d.h. die Theologiestudierende oder den Theologiestudierenden, vornehmlich am Anfang ihres oder seines Studiums. Für diesen Leserkreis war Ogdens Buch ursprünglich konzipiert. Es ist dabei klar, dass für diesen Leserkreis dieses Buch nicht die vielfältigen Kenntnisse, die es gilt, in Systematischer Theologie zu erwerben, ersetzen kann. Aber gerade zu Beginn des Studiums kann es zur freudigen Motivation beitragen, wie es auch die Christin oder den Christen allgemein motivieren kann, die denkerische Dimension des Glaubens zu entdecken oder zu vertiefen. Letztlich ist der mögliche Leserkreis nicht einmal auf Christinnen und Christen beschränkt, denn auch jede und jeder Andersglaubende wird, wenn er sich über das Christentum wirklich informieren will, letztlich nur aus dem kritischen, wenn auch hypothetischen Mitvollzug der kritischen Überprüfung des Zeugnisses Gewinn schöpfen, und nicht aus rein lexikalischem Wissen.
Fliegenberg, 28.4.2014
Markus Mühling
Vorwort
Auf Vorschlag des Verlags unterscheidet sich der Titel dieser deutschen Übersetzung meines Buches von der englischen Originalausgabe (The Understanding of Christian Faith – Das Verständnis des christlichen Glaubens). So sehr ich den neuen deutschen Titel begrüße, weil er wirkungsvoll den Zweck benennt, den mein Buch, so hoffe ich, erfüllt, so will ich auch, dass meine deutschen Leser verstehen, warum ich das Buch ursprünglich benannte, wie ich es tat. Der Originaltitel wurde aufgrund seiner Zweideutigkeit gewählt: Durch den Genitiv gewinnt der Satz „das Verständnis des christlichen Glaubens“ zwei unterschiedliche Bedeutungen: Er kann sich auf ein Verständnis beziehen, bei dem der christliche Glaube das Subjekt ist, mithin auf das, was dessen eigentlichen Inhalt als christlicher Glaube ausmacht; oder er erscheint grammatikalisch als Objekt und wird damit zum Gegenstand einer kritischen Aneignung des Inhalts, die meines Erachtens die genuine Aufgabe der christlichen systematischen Theologie ist. Ich hoffe, dass die Leser beide Möglichkeiten im Blick behalten, wenn sie sich mit meinen Argumenten auseinandersetzen.
Außerdem sollten sie mein Buch als das nehmen, was es ist und nicht etwas in ihm sehen, was es nicht ist: Es ist mehr als ein Essay, eine Studie oder Aufsatzsammlung, und es ist weniger als eine vielbändige systematisch-theologische Abhandlung, wie man sie von Theologen wie mir durchaus erwarten könnte. Reichweite, Niveau und Umfang der Argumente gleichen eher denen der Einführungsveranstaltungen, die ich während meiner vierzigjährigen Lehrtätigkeit in christlicher systematischer Theologie meistens gehalten habe. Tatsächlich verdankt es seinen Ursprung den Vorlesungen, die ich für diese Kurse geschrieben und immer wieder überarbeitet habe. Die Leser, die ich beim Schreiben vor allem vor Augen hatte, waren daher Theologiestudentinnen und -studenten, die denen gleichen, denen ich dieses Buch widmen möchte. Um es noch einmal in anderen Worten zu sagen: Das Buch, das ich versucht habe zu schreiben, gleicht dem, das ich mir selbst am Anfang meiner Ausbildung zu einem Berufstheologen gewünscht hätte.
Noch besser wäre es natürlich, wenn es auch für andere Leser hilfreich wäre, vor allem für die zahlreichen Laientheologen, mit denen ich während meiner Lehrtätigkeit zusammen arbeiten durfte. Ich weiß aus eigener langjähriger Erfahrung, dass es innerhalb wie außerhalb der Kirchen viel mehr Menschen gibt, die imstande und willens sind, Theologie zu betreiben als nur die, die aufgrund ihrer theologischen Bildung dazu befähigt wären.
Ich würde gerne drei weitere Aspekte betonen, die für meine Leser hoffentlich hilfreich sein werden. Erstens: Neben den Schriften des Neuen Testaments und dem theologischen Werk einiger weniger Zeitgenossen wurde die Struktur meines theologischen Denkens vor allem durch die orthodoxe protestantische Theologie geprägt. Mit „Struktur“ meine ich hier vor allem die grundlegenden Fragen oder Themen, mit denen ich mich als christlicher systematischer Theologe auseinandersetzen musste. Ich meine aber auch das kritisch-reflexive Vorgehen, das die Art und Weise bestimmte, wie ich mich mit ihnen zu befassen hatte. Es legt großen Wert auf die Klärung von Begriffen, indem notwendige Voraussetzungen und Implikationen analysiert und vor allem die Argumente entwickelt und beurteilt werden, die erforderlich sind, um Schlussfolgerungen zu untermauern. Zum Verständnis, wie und warum ich etwas so behandle, wie ich es tue, trägt trotz des enormen Unterschieds im Inhalt zwischen der protestantischen Orthodoxie und meiner Form der liberalen – oder, wie ich lieber sage, revisionistischen1 – Theologie, nichts mehr bei als die Kenntnis folgender Bücher: Heinrich Heppe: Die Dogmatik der Evangelisch-Reformierten Kirche (1861) und insbesondere Heinrich Schmid: Die Dogmatik der Evangelisch-Lutherischen Kirche (1843). Mehr noch: Meiner Meinung nach leistet kaum etwas einen größeren Beitrag zu einer soliden Ausbildung eines systematischen Theologen als die Kenntnis derart griffiger Zusammenfassungen des klassischen christlichen Denkens.
Ergänzen möchte ich außerdem, dass seit dem Beginn meiner Karriere als Theologe meine Zustimmung zu der Aussage eines Anglikanischen Bischofs aus dem 17. Jahrhundert immer mehr gewachsen ist. Voller Weisheit bemerkte er, dass „das nützlichste aller Bücher in der Theologie das mit dem Titel De Paucitate Credendorum, von den wenigen Dingen, die ein Mensch glauben müsse,“2 sei. Natürlich wäre ein Buch noch hilfreicher, das das Versprechen dieses Titels auch einlösen würde. In diesem Buch habe ich auf jeden Fall mein Möglichstes getan, um zu zeigen, dass, obwohl es viele verschiedene christliche Glaubenswahrheiten gibt, sie letztlich allesamt Ausdrucksformen ein und derselben christlichen Glaubenswahrheit sind, ihnen also dasselbe Verständnis des letzten Sinns der menschlichen Existenz zugrunde liegt. Deshalb werde ich nur dann zufrieden sein, wenn meinen Lesern schließlich die grundlegende Einfachheit des christlichen Glaubensverständnisses klar wird – und nicht nur die meines armseligen Versuches, es zu verstehen.
Der dritte Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte, ist, dass das in diesem Buch dargelegte Verständnis des christlichen Glaubens (gen. obj.) in allen wesentlichen Aspekten mit der Position übereinstimmt, von der aus und auf die hin ich bereits in meinen früheren Büchern und anderen veröffentlichten Schriften argumentiert habe. In ihnen werden daher die Leserinnen und Leser zu vielen der in den folgenden Kapiteln behandelten oder berührten Themen und Fragen weiterführende und mehr ins Detail gehende Erörterungen finden. Das gilt vor allem für die grundlegenden Themen über Gott und Jesus Christus, die in meinen Büchern The Reality of God (Deutsch: Die Realität Gottes) und The Point of Christology thematisiert werden. Vermutlich würden zumindest einige Leser eine weiterführende Diskussion eines wichtigen Themas begrüßen, das nicht in dieses Buch aufgenommen wurde: Es handelt sich um das Problem des christlichen Verständnisses nicht-christlicher Religionen, das ich in einer gewissen Ausführlichkeit in meinem Buch Is There Only One True Religion or Are There Many? untersucht habe.
Nun bleibt mir nur noch die freudige Pflicht, an all jene zu erinnern, die mir bei der Abfassung des Buches in besonderem Maß geholfen haben. Danken möchte ich vor allem drei engen Kollegen und Freunden, die meine Arbeit gut kennen und bereit waren, das gesamte Typoskript zu lesen und mir eine kritische Rückmeldung zu geben: Philip E. Devenish, Franklin I. Gamwell und Andrew D. Scrimgeour. Obwohl ich nicht alle Vorschläge berücksichtigt habe, ist mir bewusst, dass das Buch nun viel besser geworden ist als das ohne ihre hilfreiche Kritik der Fall gewesen wäre und dass ich allein für die verbleibenden Unzulänglichkeiten verantwortlich bin. Jedem von ihnen danke ich von ganzem Herzen für diesen erneuten Beweis ihrer langjährigen und beständigen Unterstützung und Zuneigung.
Meine deutschen Leser sollten außerdem wissen, warum meine ursprüngliche Widmung des Buches an meine Studenten jetzt eine neue Bedeutung für mich bekommen hat. Denn es ist dank der Großzügigkeit einiger von ihnen, dass diese deutsche Übersetzung möglich wurde. Ihnen allen, besonders Philip Devenish, der in ihrem Auftrag handelte, meine tiefempfundene Dankbarkeit.
Danken möchte ich auch meiner Übersetzerin Regine Kather und meiner Lektorin Silke Hartmann, sowie dem Herausgeber des Union Seminary Quarterly Review, der mir erlaubt hat, das Material eines meiner Essays zu benutzen, der dort ursprünglich mit dem Titel „The Meaning of Christian Hope“ (1975) publiziert wurde.
Rollinsville, Colorado, November 2013
Schubert M. Ogden
1 Anm. d. Übers.: Das Wort ¸revisionistisch‘ bezieht sich hier und im Folgenden auf den englischen Terminus ¸revisionary‘ und nicht auf ¸revisionist‘.
2 Zit. in: Inge, Things New and Old, 48.
1. Prolegomena: Über Theologie
1.0 Einleitende Bemerkungen
Eines der bestimmenden Merkmale der Theologie, das sie mit der Philosophie, im Unterschied zu den Einzelwissenschaften wie Biologie oder Physik, teilt, ist, dass sie zwangsläufig eine Reflexion auf sich und die eigenen Möglichkeitsbedingungen in Form einer kritischen Reflexion beinhaltet. Die Frage „Was ist Theologie?“ ist somit ihrerseits bereits eine theologische Frage, deren Antwort denselben Adäquatheitsbedingungen untersteht wie jede andere theologische Antwort. Das Verfahren sogenannter Prolegomena, in denen Theologen gemeinhin versucht haben, diese Frage zu beantworten, gehört, gemeinsam mit einem Bündel eng verknüpfter Fragen, demnach bereits zur Theologie und nicht zu einem anderen Gebiet oder einer anderen Disziplin, etwa der Philosophie, auf die man sich zuerst einlassen muss, bevor man sich der eigentlichen Theologie zuwenden kann. Ich stimme vollständig mit Karl Barth überein, dass sich das Wort „Prolegomena“ nicht auf die Dinge bezieht, die gesagt werden, bevor man sich mit Theologie befasst, sondern nur auf die, die zuerst gesagt werden, wenn man bereits Theologie treibt.
Natürlich muss das, was man in einer formalen Darstellung wie dieser zuerst sagt, nicht das sein, was man zuerst tut. Für gewöhnlich sind wir damit beschäftigt, etwas Bestimmtes zu tun, lange bevor wir ausdrücklich die Frage stellen und beantworten: „Was tue ich da eigentlich genau?“oder „Was bedeutet es, das zu tun?“ Wenn jedoch die Frage „Was heißt es, Theologie zu treiben?“ ihrerseits bereits eine theologische Frage ist, können wir nur klären, was es heißt, diese Frage zu stellen, indem wir sie beantworten; und wir können sie möglicherweise nur beantworten, wenn wir genau das tun, wonach sie fragt. Wir müssen Theologie treiben, wenn wir im theologischen Sinn danach fragen, was es bedeutet, genau dies zu tun.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























