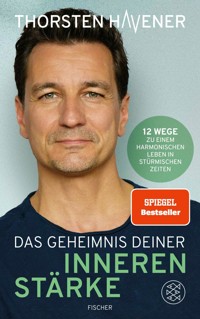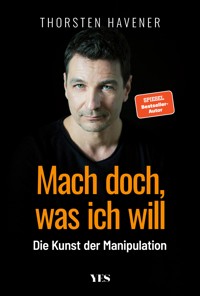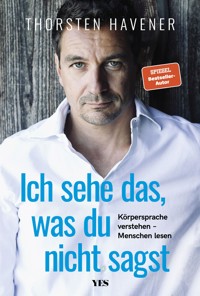9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Warum tun wir immer wieder Dinge, ohne es wirklich zu wollen? Ob beim Einkaufen, während der Arbeit oder in der Liebe – überall werden unsere Gedanken beeinflusst: durch Sprache, Gestik und Mimik unseres Umfelds. Anhand persönlicher Erfahrungen, anschaulicher Beispiele, verblüffender Effekte und wissenschaftlicher Experimente stellt Thorsten Havener die kleinen Tricks und Methoden vor, mit denen wir täglich gedanklich manipuliert werden – mit überraschend großer Wirkung. Darüber hinaus zeigt er, wie wir in Gesichtern Emotionen lesen und Lügen erkennen können. Humorvoll und charmant nimmt er uns mit auf eine spannende Reise in die magische Welt der Suggestion, Beobachtung und Wahrnehmung. Denn die alles bestimmende Frage ist: Sind unsere Gedanken frei? Vielleicht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Thorsten Havener
Denk doch, was du willst
Die Freiheit der Gedanken
Über dieses Buch
Warum tun wir immer wieder Dinge, ohne es wirklich zu wollen? Ob beim Einkaufen, während der Arbeit oder in der Liebe – überall werden unsere Gedanken beeinflusst: durch Sprache, Gestik und Mimik unseres Umfelds. Anhand persönlicher Erfahrungen, anschaulicher Beispiele, verblüffender Effekte und wissenschaftlicher Experimente stellt Thorsten Havener die kleinen Tricks und Methoden vor, mit denen wir täglich gedanklich manipuliert werden – mit überraschend großer Wirkung.
Darüber hinaus zeigt er, wie wir in Gesichtern Emotionen lesen und Lügen erkennen können. Humorvoll und charmant nimmt er uns mit auf eine spannende Reise in die magische Welt der Suggestion, Beobachtung und Wahrnehmung. Denn die alles bestimmende Frage ist: Sind unsere Gedanken frei? Vielleicht …
Vita
Thorsten Havener absolvierte ein Studium zum Diplom-Übersetzer für Englisch und Französisch an den Universitäten Saarbrücken und Moneterey, Kalifornien. Heute ist er Deutschlands bekanntester Gedankenleser und begeistert das Publikum mit seinem neuen Programm «Denken und andere Randsportarten», mit dem er zurzeit auf Tour ist. Neben seiner Bühnenshow hält er auch Vorträge und gibt Tagesseminare. Er lebt zusammen mit seiner Familie in der Nähe von München. Mehr über den Autor erfahren Sie unter www.thorsten-havener.com.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2011
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München, nach einem Entwurf der Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Armin Zedler
ISBN 978-3-644-20851-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Liebe Leserin, lieber Leser,
wie soll ich Sie eigentlich ansprechen? Soll ich immer die maskuline und feminine Form der Anrede benutzen? Ich habe genau das ein paar Seiten lang versucht und nach kurzer Zeit verworfen. Ich fand diesen Ansatz einfach nicht elegant. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, nur die männliche Form zu wählen. Ich tue das in dem Wissen, bestimmten feministischen Forderungen nicht zu entsprechen. Dennoch achte ich Frauen sehr, allein fünf leben in meiner engeren Umgebung, das muss als Beweis genügen. Ich hoffe, Sie und auch Alice Schwarzer werden mir diese Vereinfachung nachsehen. Schließlich habe ich mir Unterstützung von dem Sprachexperten Wolf Schneider geholt. «Zu welch lächerlicher Umständlichkeit es führen kann, wenn wir die feministische Forderung konsequent erfüllen, dafür hat die Arbeitsplatzbeschreibung im Norddeutschen Rundfunk ein schönes Beispiel geliefert. Die geht nämlich so: ‹Der Intendant bzw. die Intendantin ernennt seinen Stellvertreter bzw. seine Stellvertreterin bzw. ihren Stellvertreter bzw. ihre Stellvertreterin.›»
Ich hoffe auf Ihr Verständnis, vielen Dank.
Ein bisschen mehr Herz
von Enno Bunger
Wenn man mal so betrachtet
und sich die Menschen ansieht,
wie sie sich selbst verachten,
was für Mienen sie zieh’n,
wovon sind sie so müde,
was nimmt sie so aus,
warum seh’n sie so trübe und unglücklich aus?
Wo sind die guten Gedanken,
die Hoffnung auf mehr,
warum machen wir uns unser Leben so schwer?
Ist es wirklich unmöglich,
sich selbst zu lieben,
ist es wirklich nötig, sich selbst zu verbiegen?
Auch mitten im Frühling siehst du nur den Herbst.
Alles, was du bräuchtest: ein bisschen mehr Herz,
ein bisschen mehr Herz.
Ein bisschen mehr Herz.
Das Leben ist ein Geschenk,
komm, pack es ein und aus,
warum probierst du nicht täglich
was völlig Neues aus?
Wieder Kind sein zu dürfen,
über Schatten zu springen,
ein paar Bäume umarmen,
tanzen, lachen und singen.
Verlier nicht die Hoffnung,
bitte gib dich nicht auf!
Hör nicht auf zu tanzen,
halt den Himmel nicht auf.
Erfüll deine Träume,
musst du durch dick und dünn,
über Stacheldrahtzäune,
durch Wellen und Wind.
Alles, was wir bräuchten: nur ein bisschen mehr Herz.
Alles, was wir bräuchten: nur ein bisschen mehr Herz.
Alles, was wir bräuchten: nur ein bisschen mehr Herz.
Alles, was wir bräuchten: nur ein bisschen mehr Herz.
Ein bisschen mehr Herz.
Einige warme Worte zur Entschleunigung
Dieses Mal fängt alles in Würzburg an. Ein Zufall. Ich habe das Szenario nicht bewusst herbeigeführt. Ich sitze nun mal gerade im Zug nach München und fahre nach kurzem Zugstopp weiter bis zu meinem Ziel. Am Tag zuvor habe ich einen Auftritt in Hannover hinter mich gebracht. Jetzt lehne ich mich entspannt zurück und lasse meine Gedanken schweifen.
Schon seit Wochen versuchte ich, etwas für mein Buchmanuskript zu Papier zu bringen, aber ich konnte nicht anfangen zu schreiben, obwohl ich merkte, dass ich zeitlich langsam in Zugzwang geriet. (Das Wortspiel an dieser Stelle ist auch nicht beabsichtigt, passt aber gerade wunderbar. Erst wollte ich es rausnehmen, aber nach dem zweiten Lesen kam es wieder rein. Automatisch. Weil’s einfach doch so schön ist.) Der Anfang ist immer das Schwerste. Ich fand einfach nicht den richtigen Einstieg – und gerade der ist doch besonders wichtig. Jeder Autor hat geradezu panische Angst, seine Leser schon gleich am Anfang zu enttäuschen. Jetzt, auf der Fahrt von Hannover nach München – kurz vor Würzburg –, kam der Geistesblitz, um das zu verhindern. Endlich. Der entscheidende Dreh. Völlig aus dem Nichts. Wobei, so ganz stimmt das auch nicht. Mein Blitz wurde durch ein Lied ausgelöst. Das machte nur klar, was mich gerade am meisten bewegte. Es war nicht irgendein Lied, das das bewirkte, sondern eines meiner absoluten Lieblingslieder: Es ist ein Song von Jason Mraz.
Wie dem auch sei, ich hörte die Musik, schaute in die mir mittlerweile sehr vertraute Landschaft. Ich glaube, ich kenne inzwischen jeden Baum, der an deutschen Bahnlinien steht. Wie so oft hänge ich meinen Gedanken nach. Dieses Mal denke ich an meinen letzten Geburtstag, den siebenunddreißigsten. Es war kein allzu schöner Geburtstag: Ich musste morgens wegen Herzrasen zum Arzt. Siebenunddreißig ist, wie ich finde, zu früh, um mit so was zum Doktor zu kommen. Mein Hausarzt untersuchte mich und stellte fest, dass ich körperlich ansonsten in bester Verfassung war. Mein Problem habe seinen Ursprung in meinem Kopf, meinte er nur. Das alles sei nur deshalb passiert. Und das bei mir! Und wo gerade ich doch der Experte dafür bin und wissen sollte, was sich in den Köpfen so abspielt, auch in meinem.
Ich glaube, es war der Schriftsteller Michael Ende, der einmal gesagt hat, der Wegweiser weise nur den Weg, er müsse ihn allerdings nicht selbst gehen. Ich dachte immer, ich hätte meine Gedanken sehr gut im Griff, sei Herr der Lage und wisse alles über mich. Und jetzt das.
Mein Hausarzt fragte mich, ob ich derzeit viel unterwegs sei. Ich erklärte ihm daraufhin, dass ich gerade eine Tournee absolviere, viele Vorträge halte und über lange Zeit immer nur ein oder zwei Tage am Stück zu Hause verbracht hätte. Danach fragte er mich, ob ich nachts durchschlafe. «Ich habe drei Kinder», antwortete ich nur, «und wenn ich auf Tour bin, bin ich oft bis spät in die Nacht beschäftigt.»
Daraufhin grinste er mich an und erzählte mir folgende Geschichte: «Bei einer Himalaja-Expedition weigerten sich nach drei Tagen die Sherpas wie aus heiterem Himmel weiterzulaufen. Die britischen Auftraggeber waren sehr aufgebracht darüber. Denn die Gruppe war schneller vorangekommen als ursprünglich geplant, und die Briten wollten diesen Vorsprung weiter ausbauen. Dennoch beharrten die Sherpas darauf und bewegten sich keinen Zentimeter mehr. Sie saßen da und lehnten es ab. Ohne Angabe von Gründen.
Die Auftraggeber versuchten es mit gutem Zureden und zahllosen Argumenten. «Seid ihr zu müde zum Weiterlaufen?» – «Nein.» – «Habt ihr körperliche Probleme? Ist das Gepäck zu schwer?» – «Nein.» – «Wollt ihr mehr Geld? Wir zahlen euch eine Belohnung, wenn ihr nur weiterlauft!» – «Nein danke.» Die Sherpas blieben sitzen und tranken ihren Tee. Dann endlich ihre Erklärung: «Wir sind eine Strecke, die wir normalerweise in fünf Tagen zurücklegen, in nur drei Tagen gelaufen – unsere Körper sind jetzt zwar hier, wir müssen aber eine Pause machen, damit unsere Seelen nachkommen können!»
Ein schlauer Mann, mein Arzt. Er gab mir keine Medikamente, sondern nur diese Geschichte mit auf den Weg. Sie war eines meiner schönsten Geburtstagsgeschenke. Und sie hat mich verändert. Mir wurde Folgendes klar: Auch die besten Gedanken und alles Wissen, das man sich darüber aneignen kann, all das bringt uns nicht wirklich weiter, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, es auch wirken zu lassen. Ich saß da also beim Arzt, und obwohl ich den schönsten Beruf der Welt habe, eine Familie, die mich immer auffängt, in allem unterstützt, und obwohl ich mich bislang bester Gesundheit erfreute, ging es mir nicht gut. Ein einziger Faktor stimmte nicht in meinem Leben, aber der hatte Gewicht: Ich war nicht mehr Herr meiner Zeit. Ich war Opfer meiner Anforderungen geworden und nicht mehr der Handelnde, sondern der Getriebene.
Ein weiteres Mal fragte ich mich, wie äußere Einflüsse uns dazu bringen können, Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Ich kenne nun wirklich viele Methoden, um die Gedanken anderer und auch meine eigenen zu beeinflussen. Wieso griff das gerade nicht? Und dennoch: Ich glaube, nur deshalb konnte ich überhaupt die Reißleine im richtigen Moment ziehen. Über eine lange Zeit hatte ich ja zu Vorhaben gesagt, die ich eigentlich nicht tun wollte, und nicht bemerkt, in welchen Teufelskreis ich geriet. Diese Frage brachte mich dann auch zum Thema dieses Buchs – dem hoffentlich fulminanten Abschluss meiner Denktrilogie – und zu den zentralen Aspekten: Welche Methoden beeinflussen uns? Wie beeinflussen wir andere, und wie können wir uns vor Manipulationsversuchen unserer Mitmenschen schützen?
Ich mache jetzt etwas, was ich noch nie zuvor getan habe: Ich verrate Ihnen einen Zaubertrick. Einen ziemlich guten sogar. Mit diesem Kniff hat es ein Jugendfreizeitleiter einmal geschafft, mir schlaflose Nächte zu bereiten. Das war im Sommer 1986. Kurz zuvor war mein Bruder verstorben. Es war eigentlich gerade keine schöne Zeit. Vielleicht waren gerade deshalb meine Ferien mit ihm in den französischen Sevennen so wichtig für mich und – wie sich sehr viel später noch zeigen sollte – für meinen gesamten Lebensweg.
Ich begeisterte mich zu dieser Zeit mehr und mehr für die Zauberei. Umso größer war meine Freude, als ich ihn, einen Könner in Sachen Kartentricks, kennenlernte. Er hatte so richtig gute drauf. Sein Name ist Jörg Roth. Ich habe seit über zwanzig Jahren nichts mehr von ihm gehört. Trotzdem denke ich oft an die gemeinsamen Wochen und ein besonders schönes Erlebnis.
In den Trick, mit dem er mich am besten getäuscht hat, möchte ich Sie einweihen. Vielleicht haben Sie Lust, ihn einzuüben und irgendjemanden damit genauso zu verblüffen wie er mich damals.
Der ultimative Kartentrick, hier ist er: Es war an einem schönen sonnigen Sommermorgen im Zeltlager. Wir saßen nach dem Frühstück unter einem Baum und spielten Karten. Plötzlich sagte Jörg zu mir: «Nimm doch einfach mal eine Karte aus dem Kartenspiel und schau sie dir genau an.» Es war die Herz-Sieben. Danach sollte ich den vor mir liegenden Spielkartenstapel irgendwo abheben, meine Karte auf den abgehobenen Teil obendrauf legen und den Rest des Spiels daraufsetzen. Jetzt durfte ich die Spielkarten mischen. Nachdem ich damit fertig war, sah er mich ernst an. «Ich habe keine Ahnung, welche Karte du gewählt hast, und ich weiß auch nicht, wo deine Karte im Stapel liegt. Die richtige Karte zu finden ist wirklich schwierig, nicht wahr? Aus diesem Grund habe ich drei Versuche frei, einverstanden?» – «Na klar», antwortete ich.
Er fächerte das Spiel vor sich auf, hob ab und zeigte mir die unterste Karte. Sie war es nicht. Er nahm die Karte aus dem Spiel und legte sie mit der Rückseite nach oben auf den Boden vor mir hin. «Gut, ich habe ja noch zwei Versuche.» Wieder schaute er sich die Spielkarten an. Zweimal hintereinander zeigte er mir falsche Karten. Schließlich lagen vor mir auf dem Boden auf einem kleinen Stapel drei Karten. Die Herz-Sieben war nicht dabei.
Nochmals zeigte er mir nacheinander die drei Karten auf dem Boden und legte sie in einer Reihe vor mir aus. Jetzt durfte ich aus den dreien eine auswählen. Er schob sie verschwörerisch zu den anderen. Er sah mich konzentriert an und sagte, ich habe die Herz-Sieben gewählt. Hammer! Dann bat er mich, die Karte vor mir umzudrehen. Ich flippte aus. Die Karte hatte sich verwandelt: Es war meine Herz-Sieben.
Wow, das war ein Hammer. Ich war selten zuvor derart angenehm hinters Licht geführt worden. Wie hatte er das nur gemacht? Ein paar Monate später verriet er mir den Trick. Er ist ein Paradebeispiel für die Kunst der Beeinflussung. Sie brauchen dafür nur ein Kartenspiel und einen Mitspieler. Den brauchen Sie beim Zaubern übrigens immer! Man kann sich nur so schwer selbst verblüffen.
Lassen Sie das Kartenspiel vor dem Trick, wie es ist, oder mischen Sie die Karten, wenn Sie wollen. Nehmen Sie sie dann wieder an sich, fächern Sie sie mit der Rückseite nach oben liegend auf und bitten Sie Ihr Gegenüber, eine Karte zu wählen. Stellen Sie sicher, dass es sich die Karte auch merkt! Unterschätzen Sie diesen Rat nicht. Es gibt nichts Blöderes, als wenn der Mitspieler am Schluss nicht mehr weiß, welche Karte er hatte. Ich spreche aus Erfahrung. Da arbeitet man minutenlang hart auf den krönenden Abschluss hin und fragt: «Welche Karte haben Sie gewählt?» Die Antwort: «Ehm … äh …?»
Während sich Ihr Zuschauer seine Karte anschaut, legen Sie alle restlichen mit der Rückseite nach oben in Ihre linke Hand. Sobald er fertig ist und Sie wieder anschaut, heben Sie mit Ihrer rechten Hand vom Stapel in der linken Hand ungefähr die Hälfte ab. Halten Sie diese Karten mit dem Daumen an der einen schmalen Kante und mit Mittelfinger und Ringfinger an der anderen. Die Karten in der linken Hand zeigen Sie Ihrem Zuschauer. Jetzt kommt der erste Trick: Drehen Sie Ihre rechte Hand leicht im Handgelenk und zeigen Sie mit Ihrem rechten Zeigefinger auf die Karten in der linken Hand und bitten Sie: «Leg deine Karte hierhin zurück.» Bei dieser Geste und diesen Worten schauen Sie auf die Karten in der rechten Hand. Dabei sehen Sie die unterste Karte im Stapel Ihrer rechten Hand, sie springt Ihnen so regelrecht ins Auge. Wenn Sie die Bewegung beiläufig machen, wird kein Mensch bemerken, dass Sie sich gerade die unterste Karte angeschaut haben.
Hat Ihr Zuschauer jetzt seine Karte auf den Stapel in der linken Hand gelegt, positionieren Sie die Karten aus Ihrer rechten Hand auch auf den Stapel. Damit haben Sie schon einen großen Vorsprung, Sie kennen nämlich die Karte über der ausgewählten. Man nennt sie auch Leitkarte. Eine feine Sache, leider ist die Strategie aber schon recht bekannt. Aus diesem Grund bedienen Sie sich jetzt einer superguten Finte: Sie drücken das Kartenspiel Ihrem Zuschauer in die Hand und lassen ihn mischen. Das war mein Ernst. Jetzt bitte nur die Ruhe bewahren. Sie müssen allerdings sicherstellen, dass Ihr Mitspieler das Kartenspiel nicht so perfekt wie ein amerikanischer Pokerprofi mischt, sondern wie ein mittelmäßiger bayerischer Schafkopfspieler. Im Fachjargon: Es darf kein Riffelmischen werden, sondern man muss beim Überhandmischen bleiben. Das können Sie dadurch erreichen, dass Sie die Mischbewegung mit Ihren Händen vormachen, während Sie ihn bitten, es Ihnen gleichzutun. Falls Sie dem Braten nicht trauen, mischen Sie einfach selbst. Die Wahrscheinlichkeit, dass Leitkarte und gewählte Karte beim Überhandmischen voneinander getrennt werden, ist sehr gering. Es besteht zwar ein kleines Risiko – aber gerade das macht die Sache ja erst so richtig spannend, nicht wahr?
Jetzt nehmen Sie die Karten wieder an sich und schauen sie in aller Ruhe durch. Fächern Sie die Karten vor sich auf und suchen Sie Ihre Leitkarte. Die Karte darunter ist die gewählte. Die nehmen Sie aber noch nicht aus dem Spiel. Sie nehmen irgendeine andere, legen sie als unterste Karte in das Spiel und zeigen die Ihrem Zuschauer. Er wird natürlich sagen, dass das nicht seine Karte ist. Drehen Sie die Karten jetzt einfach nach unten – die Rückseite zeigt nach oben –, ziehen Sie die unterste Karte ab und legen Sie sie auf den Tisch.
Jetzt fächern Sie die Karten erneut vor sich auf und suchen gezielt nach der gewählten Karte, also die unter Ihrer Leitkarte. Wenn Sie die gewählte Karte gefunden haben, legen Sie noch eine weitere Karte darauf und heben die Karten so ab, dass die des Zuschauers als zweite von unten im Spiel liegt. Vor der gewählten Karte liegt irgendeine andere. Das Spiel sollten Sie jetzt in der linken Hand halten. Drehen Sie das Ganze mit der Bildseite, der Vorderseite, zu Ihrem Zuschauer hin und fragen sie ihn, ob die eben gezeigte Karte seine gewesen ist. Natürlich wird er das verneinen. Seine Karte liegt ja auch genau unter der Karte, die Sie ihm gerade gezeigt haben. Jetzt drehen Sie das Spiel mit der linken Hand parallel zum Tisch. Nun passieren zwei Sachen gleichzeitig: Zunächst nähert sich Ihre rechte Hand Ihrer linken Hand. Im selben Moment ziehen Mittelfinger und Ringfinger der linken Hand die unterste Karte ein paar Millimeter nach hinten. Von oben ist diese Bewegung nicht zu sehen. Wenn Ihre rechte Hand bei den Karten in der linken angekommen ist, zieht sie dann nicht die unterste Karte, sondern die zweitunterste nach vorne aus dem Spiel und legt sie verdeckt auf den Tisch, genau auf die Karte, die dort schon liegt.
Vor den Augen Ihres Zuschauers haben Sie nun seine gewählte Karte verdeckt auf den Tisch gelegt. Er hat allerdings keinen Schimmer davon. Diesen Griff nennt man im Fachjargon auch Schleifen. Das Schöne daran: Ihr Mitspieler denkt, Sie würden seine Karte noch nicht kennen. Sie wissen aber sowohl um die Karte als auch um deren Position – mehr noch, Sie haben sie bereits vor seinen Augen auf den Tisch gelegt. Dabei schauen Sie so unschuldig wie ein Rehlein – ich liebe solche Momente. Als Letztes legen Sie wieder irgendeine Karte aus dem Spiel nach unten, zeigen sie vor und legen sie auf die anderen beiden Karten, die sich schon auf dem Tisch befinden. Die anderen Spielkarten können Sie jetzt weglegen.
Fassen wir nochmal zusammen: Auf dem Tisch liegen aufeinander drei Karten mit der Rückseite nach oben. Die mittlere ist die des Mitspielers, was der aber nicht weiß, da Sie ein ausgefuchstes Schlitzohr sind, womit er nicht rechnet.
Jetzt kommt die Finte, die mich damals im Zeltlager komplett weggebeamt hat: Sie nehmen die drei Karten vom Tisch mit der Rückseite nach oben in Ihre linke Hand. Die Finger greifen das Spiel an den Längsseiten, gegenüber liegt der Daumen. Jetzt zeigen Sie kurz die unterste Karte vor – betonen Sie, es sei nicht die Karte des Mitspielers – und legen sie – das geben Sie jedenfalls vor – mit der Bildseite nach unten auf den Tisch.
Achtung: Dabei wieder schleifen. Das bedeutet, Sie legen nicht wirklich die gezeigte Karte auf den Tisch, sondern die des Zuschauers! Jetzt nehmen Sie von den beiden verbleibenden Karten in Ihrer linken Hand eine in die rechte. Die andere bleibt in der linken. Als Nächstes zeigen Sie kurz gleichzeitig beide Karten vor. Dabei sagen Sie scheinheilig: «Und die war’s nicht und die auch nicht, oder?» Schauen Sie dabei nicht auf die Karten, sondern Ihrem Mitspieler in die Augen. Glauben Sie mir: Wenn Sie das geschickt und mit Unschuldsmiene machen, wird keiner bemerken, dass Sie eine Karte zweimal vorgezeigt haben! Es hilft zusätzlich, möglichst Karten mit Zahlen dafür auszuwählen. Bildkarten und Asse sind zu auffällig. Nehmen Sie besser Sechsen, Vierer oder Achter.
Auf dem Tisch liegen jetzt drei Karten in einer Reihe. Die mittlere ist die des Zuschauers. Der denkt allerdings, Sie seien auf dem Holzweg, und hat keinen Schimmer von dem, was hier wirklich abläuft. Jetzt kommt die nächste Finte: Sie geben Ihrem Zuschauer das Gefühl, frei wählen zu können. In Wirklichkeit reagieren Sie aber nur immer auf das, was er macht. Ich zeige Ihnen, was ich meine.
Lassen Sie Ihren Zuschauer auf zwei Karten auf dem Tisch zeigen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Er weist auf die beiden äußeren. Bingo! In dem Fall legen Sie die beiden einfach weg. Die mittlere Karte – seine gewählte – bleibt übrig. Er zeigt auf eine der beiden äußeren Karten und dann auf die mittlere. Macht auch nichts. Jetzt legen Sie die Karte, die übrig bleibt, weg, also die äußere. Dann bitten Sie ihn, Ihnen eine Karte zuzuschieben. Falls das jetzt die gewählte Karte ist, kommt die andere weg. Sollte er Ihnen die nicht gewählte Karte entgegenschieben, dann nehmen Sie seelenruhig genau die hoch und legen sie weg.
Merken Sie, was hier gerade läuft? Genau: Egal, was der Zuschauer macht, Sie handeln, als wäre genau das Teil Ihres Auswahlverfahrens und machen in der Art weiter, sodass Sie zu Ihrem Ziel kommen. Seien Sie dabei ganz locker und flexibel. Die Methode ist sehr einfach. Um sie allerdings unauffällig anzuwenden, muss die Präsentation geübt werden und wie geölt ablaufen. Sie können übrigens Ihre Chancen auf einen direkten Treffer erhöhen, wenn Sie bei der Aufforderung, zwei Karten zu zeigen, selbst auf die beiden äußeren Karten weisen.
Wie dem auch sei: Auf dem Tisch liegt nach dieser Prozedur jetzt noch eine einzige Karte, nämlich die Ihres Mitspielers. Bitten Sie ihn, Ihnen tief in die Augen zu schauen und an seine Karte zu denken. Nachdem Sie ihn konzentriert fixiert haben, nennen Sie ihm die richtige Karte. Ich sagte Ihnen doch bereits, dass Sie sich die richtige Karte bis zum Schluss merken müssen, oder? Nach dem ersten verblüfften Blick bitten Sie ihn, die Karte auf dem Tisch umzudrehen … Halten Sie ein Glas Wasser – oder auch einen Cognac – bereit, Ihr Zuschauer wird das eine oder das andere jetzt brauchen.
Sollten Sie sich jetzt fragen, warum ich diesen Trick schon im Vorwort erkläre: Ganz einfach – ich will diejenigen belohnen, die sich die Mühe machen, es zu lesen. Das machen nämlich nur die wenigsten. Dabei steht gerade im Vorwort viel Wertvolles. Übrigens, die Idee, eine kleine Perle schon im Vorwort zu verstecken, stammt vom englischen Kartenkünstler Guy Hollingworth. Er hat das in seinem Buch «Drawing Room Deceptions» auch so gemacht. Ich fand den Einfall wunderbar.
Damit nur ja niemand, der das Vorwort eigentlich überspringen wollte, beim flüchtigen letzten Blick darauf über meine schöne geklaute Idee stolpert – das wäre ja dann unfair den Fleißigen gegenüber –, lasse ich zum Verwirren der Faulen noch ein wenig Text folgen, irgendwas aus «Wikipedia» wörtlich zitiert und wunderbar langweilig wie sonst die Vorreden immer. Sind Sie ein ehrlicher Vorwortleser gewesen, dann können Sie hier aufhören und mit dem ersten Kapitel beginnen. Ihnen herzlichen Dank. Wirklich, hier kommt nichts mehr. Das ist kein blöder Trick. Versprochen.
«Gemäß der klassischen Analyse des Spiels ist im nur einmal gespielten Gefangenendilemma die einzig rationale Strategie für einen am eigenen Wohl interessierten Spieler, zu gestehen und den Mitgefangenen damit zu verraten. Denn durch seine Entscheidung kann er das Verhalten des Mitspielers nicht beeinflussen, und unabhängig von der Entscheidung des Mitspielers stellt er sich immer besser, wenn er selbst nicht mit dem Mitgefangenen kooperiert. Diese Analyse setzt voraus, dass die Spieler nur einmal aufeinandertreffen und ihre Entscheidungen keinen Einfluss auf spätere Interaktionen haben können. Da es sich um ein echtes Dilemma handelt, folgt aus dieser Analyse aber keine eindeutige Handlungsanweisung (präskriptive Aussage) für reale Interaktionen, die einem Gefangenendilemma entsprechen.»
Ich lade Sie ein, dieses Buch als Ihre Auszeit und Möglichkeit, einmal aus dem Alltag auszubrechen, zu nutzen. Ziehen Sie sich damit zurück in Ihre eigene Welt – und vor allem: Nehmen Sie sich ausreichend für alles Zeit!
Manipulation an der Haustür
Schon mit achtzehn Jahre, wohnte ich allein in einer eigenen Wohnung. Eines Tages klingelte es an der Haustür, und ein Mann von Mitte zwanzig stand davor. Er fragte, ob ich ihm einige Fragen beantworten würde, es dauere auch nicht lange. Ich willigte ein, und er begann mir etwas zu erzählen und fragte dann: «Würden Sie einem ehemaligen Straftäter helfen, wenn er sicher geläutert wäre?» – «Selbstverständlich würde ich das tun!» – Er wollte dann wissen, ob ich etwas gegen Ostdeutsche hätte. – «Wie kommt man denn auf so was? Alle Menschen sind gleich», war meine spontane Antwort. Ob ich interessiert sei am aktuellen Geschehen in der Welt. «Natürlich, schließlich bin ich ja ein aufgeschlossener Bürger.» Ob ich ebenso interessiert sei an den unterschiedlichsten Berichterstattungen. «Na klar, man kann sich ja nicht genug weiterbilden.»
Bis jetzt hatte er bereits vier Fallen aufgestellt und schon scharfgemacht. Ich hatte keine Ahnung, was tatsächlich abging, und war völlig unvorbereitet auf seine abschließenden Worte. «Ich komme aus den neuen Bundesländern. Ich bin ein ehemaliger Straftäter. Ich habe meine Haft verbüßt und bereue meine Taten zutiefst.» Er sei gerade auf dem Weg, sich am eigenen Haarschopf aus dem Schlamassel zu ziehen, um auf den rechten Weg zurückzufinden. Hierbei könne ich ihm wirklich helfen, versicherte er. Er verkaufte Abonnements von zahlreichen Illustrierten. Da ich ja offensichtlich sehr interessiert sei am Weltgeschehen und auch äußerst hilfsbereit wäre, würde ich ihm sicherlich, ohne zu zögern, helfen und ihm ein Abonnement abkaufen. Die Falle schnappte zu, ich hatte im Handumdrehen den Stern, die Hörzu und den Spiegel abonniert. Ich hatte sogar sekundenlang ein gutes Gefühl dabei. Erst einen Tag später wurde mir klar, dass ich manipuliert worden war. Dieser Hund kam wahrscheinlich noch nicht mal aus Ostdeutschland, und ob er wirklich ein Straftäter gewesen ist, der verurteilt worden war, würde ich nie erfahren. Ich fühlte mich einerseits benutzt, andererseits war ich fasziniert davon, wie dreist ich manipuliert worden war. Heute manipuliere ich selbst Menschen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, allerdings sind die Betroffenen danach immer besser gelaunt als vorher und wissen, was mit ihnen geschieht.
Letzten Endes wurde ich einfach durch eine Handvoll gutfunktionierender psychologischer Tricks dazu gebracht, etwas zu tun, was mir ungefragt von außen diktiert worden war. Ich wurde beeinflusst, ja geradewegs manipuliert. Das Perfide daran: Ich hatte keine Ahnung, was in diesem Moment passiert. Das ist eines der typischen Merkmale dieser simplen Manipulationstechniken. Hier geht es nicht nur darum, Menschen zu beeinflussen, es geht auch darum, dass die betreffenden Personen durch Tricks unbemerkt zu etwas gezwungen werden. Genau das macht diese Methode auch so unheimlich. Ich habe mich fast mein Leben lang mit Tricks befasst. Und trotzdem bin ich auf den Hausierer reingefallen. Gut, ich war jung, und er brauchte das Geld.
Was war hier genau passiert? Wie hatte er das gemacht? Wie gehen Manipulateure heute überhaupt vor, um ihr Ziel zu erreichen? Und welche verschiedenen Methoden gibt es, um andere zu veranlassen zu tun, was man selbst will? Diese Fragen fand ich so spannend, dass ich als Neunzehnjähriger sogar eine Kaffeefahrt mit meinen Schulfreunden machte, um zu sehen, wie perfekte Manipulationen in der Praxis aussehen. Wir hatten uns als «Kegelklub alle Neune» angemeldet, um bis zur Abfahrt möglichst undercover zu bleiben. Dieser Tag war ein Erlebnis, von dem ich heute noch zehre. Mein Fazit: Jeder von uns ist bereits mannigfaltig zu seinen Ungunsten beeinflusst worden. Mit welchen Mitteln das geht und in welchen Bereichen besonders manipuliert wird – davon handelt dieses Buch.
Manipulation ist den meisten von uns deshalb so unheimlich, weil sie sich anschleicht wie eine krankmachende Strahlung. Selbst wenn man von ihrer Existenz weiß und sie definieren kann – sich dagegen zu wehren fällt oft schwer. Fest steht: Manipulation ist immer auch eine Suggestion. Suggestion ist meiner Meinung nach eine unglaublich starke, aber neutrale Kraft. Sie ist weder gut noch schlecht. Es liegt dabei immer an demjenigen, der sie beherrscht, und es ist wichtig, wie er sie nutzt. Der Manipulateur hat sich für die dunkle Seite der Suggestion entschieden und nutzt sie ausschließlich zu seinem eigenen Vorteil, egal, was seine Handlung für den anderen bedeutet. Wäre das anders, dann könnte der Manipulateur auch mit offenen Karten spielen, oder? Das macht er aber natürlich nicht. Er nutzt seine Methoden im Verborgenen. Wie ein Zauberkünstler übrigens auch. Der sagt seinem Publikum allerdings gleich, dass es ein Geheimnis gibt.
Welche Methoden aber hat mein Hausierer genutzt? Nun, das werden Sie in diesem Buch noch ganz genau erfahren. Weiterhin lernen Sie auf dem Weg zur letzten Seite des Buchs noch jede Menge anderer Suggestions- und Manipulationsmethoden kennen, denn ich beleuchte die Phänome «Manipulation» und «Suggestion» aus vielen verschiedenen Blickwinkeln.
Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal: «Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen nicht zurande.» Fangen wir also ganz von vorne an.
Rapport, die schönste Verbindung der Welt
Sie schauen also gerade in dieses Buch und wollen etwas über Rapport lesen? Und darum beginne ich das Kapitel mit genau diesen Worten der Überschrift – ganz einfach, weil sie den von mir hier beabsichtigten Zweck vollkommen erfüllen. So kann ich über das Medium «Buch» eine Verbindung zu Ihnen aufbauen. Ich hole Sie genau dort ab, wo Sie gerade sind. Und – egal, was Sie denken, egal, wie alt oder jung Sie sind, ob männlich, weiblich, groß, klein, wie auch immer – an einer einzigen Sache gibt es überhaupt keinen Zweifel: Sie schauen gerade in dieses Buch und lesen. Mein erster Versuch der Kontaktaufnahme war also erfolgreich. Ich könnte es auch in den Worten von Henry Ford ausdrücken: «Um Erfolg zu haben, musst du den Standpunkt des anderen annehmen und die Dinge mit seinen Augen betrachten.» Und langsam kann ich damit beginnen, Sie mit auf meine Reise zu nehmen.
Wie wichtig es ist, die Welt mit den Augen der anderen zu sehen, zeigt eine schöne Geschichte, in der genau das so ziemlich in die Hose gegangen ist. Ich habe sie bei einer Vorlesung an der Universität gehört. Sie diente als ein gutes Beispiel für tiefe kulturelle Unterschiede.
In den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts startete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Pakistan eine großangelegte Werbekampagne, um die Mütter neugeborener Babys dazu zu bewegen, ihren Säuglingen Milch zu verabreichen. Weil in diesem Land sehr viele Sprachen und Dialekte gesprochen werden, entschieden sich die Verantwortlichen, ihre Botschaft mit drei Bildern deutlich zu machen: Auf dem ersten Bild, dem linken, wurde ein weinendes, krankes Baby abgebildet. Auf dem mittleren Foto wurde ein Kind, das aus einem Fläschchen Milch trinkt, gezeigt, und ganz rechts sah man dann, dass es einem satten Säugling richtig gutging, weil der wirklich proper aussah. Er strahlte den Betrachter fröhlich an. Sehr dumm war allerdings die Tatsache, dass die Menschen in Pakistan von rechts nach links lesen. Daran hatte man einfach nicht gedacht. Betrachtet man also die Werbung mit den Augen einer pakistanischen Mutter, dann sieht man das genaue Gegenteil von dem, was ein Mensch in Europa sieht. Die Botschaft lautet für einen Pakistani: Wenn du ein gesundes Kind hast und gibst ihm Milch, dann wird es krank werden. Die Welt ist das, wofür wir sie halten. Sie kennen diese Formel bereits aus den anderen Büchern. Sie gilt hier einmal mehr.
Dass man die Welt mit den Augen des anderen sehen soll, erweist sich also in vielen Fällen als unverzichtbar. Diese Tatsache bildet die Grundlage jeder erfolgreichen Kontaktaufnahme und Kommunikation, und sie hat auch einen Namen: Rapport. Das Wort hat in diesem Kontext nichts mit einer militärischen Meldung oder einem allgemeinen Bericht zu tun. Es wird hier in einem anderen Sinn verwendet, in seinem ursprünglichen, denn es kommt aus dem Französischen und bedeutet «Beziehung» oder auch «Verhältnis». Es hat allerdings keine sexuelle Anmutung, sondern es bezeichnet eine Beziehung oder ein Verhältnis ganz allgemein. Das heißt: Sie müssen immer einen Rapport, eine Beziehung, zu einem anderen aufbauen, bevor Sie davon ausgehen können, dass er Ihnen überhaupt zuhören will. Glücklicherweise geht das in aller Regel sehr einfach. Unbewusst machen Sie es sofort und jedes Mal, wenn Sie mit einer Person sprechen und sich mit ihr auf einer Wellenlänge fühlen.
Angenommen, Sie kommen mit einer Ihnen sofort sehr sympathischen Person in Kontakt. Die drückt sich besonders distinguiert aus. Das beeindruckt Sie. Und ob Sie es glauben oder nicht, innerhalb kürzester Zeit gleichen Sie Ihre Ausdrucksweise der Person an, die bei Ihnen so gut rüberkommt. Das funktioniert auch in die andere Richtung. Wenn Ihr Gegenüber ständig flucht, beginnen Sie ebenfalls, Ihr Sprachniveau runterzuschrauben. Da aber auch der andere sich Ihrem Sprachniveau ebenfalls anpassen will, treffen sich die Sprachebenen irgendwann ungefähr in der Mitte. Bestenfalls, wenn beide sehr gut harmonieren. Oder es endet alles in einem kleinen Spielchen von Macht und Einfluss.
Seit ich das weiß, wundert es mich überhaupt nicht mehr, dass meine Kinder fluchen, nachdem sie mich dabei beobachteten, wie ich eine Lampe aufhängte oder einen Schrank aus einem schwedischen Möbelhaus aufzubauen versuchte. Das Phänomen wurde 2002 von den Professoren Kate G. Niederhoffer und James W. Pennebaker an der University of Texas in Austin mit Hilfe einer großangelegten Studie untersucht. Sie gaben ihr den Namen «Linguistic Style Matching» oder auch «LSM», sie nannten es also «Anpassung der Sprachniveaus». Niederhoffer und Pennebaker behaupteten sogar: «Wenn zwei Menschen eine Konversation beginnen, sprechen sie innerhalb weniger Sekunden gleich.» Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, wurden ausführliche Experimente mit Studenten durchgeführt. Wurde die Aufgabe sehr förmlich formuliert, fiel die Antwort ebenfalls förmlich aus. Wurde die Aufgabe umgangssprachlich gestellt, fanden sich in den Ausführungen der Studenten auch lockere Formulierungen. Interessanterweise waren die besonders gut benoteten Antworten, die von Frauen und die von Studenten mit hohem sozioökonomischem Status, besonders stark angepasst.