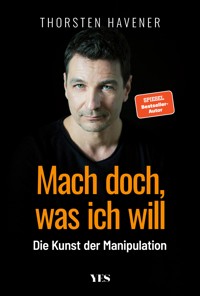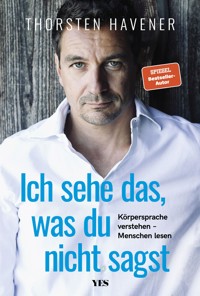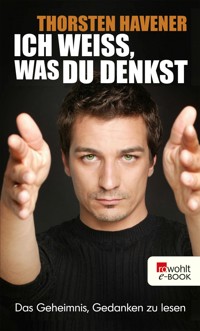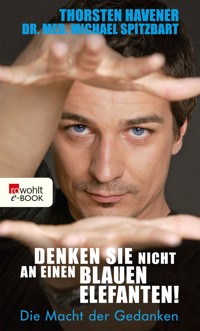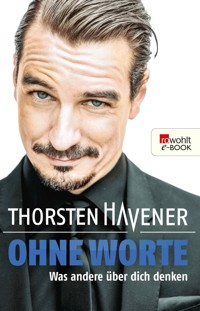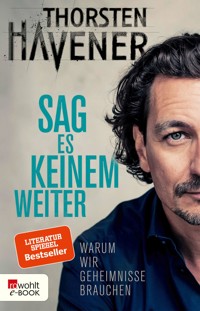
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Thorsten Havener taucht ein in die faszinierende Welt der Geheimnisse. Ein Plädoyer für die Wichtigkeit von Geheimnissen. Verraten Sie niemandem, was in diesem Buch steht. Und? Neugierig geworden? Nur wenig ist reizvoller als die Aussicht, Mitwisser eines Geheimnisses zu werden. Ob Bankgeheimnis, ärztliche Schweigepflicht oder eine verdächtige SMS – wir sind umgeben von Geheimnissen. Aber was ist das überhaupt, ein Geheimnis? Wie kann man es bewahren, und warum gelingt uns das häufig nicht? Thorsten Havener ist als Zauberkünstler Experte für das Geheimnisvolle. Er erklärt, wie Geheimnisse uns prägen, wie sie uns belasten oder unser Leben spannender machen, wie die Aufdeckung uns befreien oder in Schwierigkeiten bringen kann. Nicht zuletzt stellt er eindrucksvoll dar, warum wir Geheimnisse brauchen – gerade in Zeiten von Big Data, Facebook und Co.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Thorsten Havener
Sag es keinem weiter!
Warum wir Geheimnisse brauchen
Über dieses Buch
Verraten Sie niemandem, was in diesem Buch steht!
Und? Neugierig geworden? Nur wenig ist reizvoller als die Aussicht, Mitwisser eines Geheimnisses zu werden. Ob Bankgeheimnis, ärztliche Schweigepflicht oder eine verdächtige SMS – wir sind umgeben von Geheimnissen. Aber was ist das überhaupt, ein Geheimnis? Wie kann man es bewahren, und warum gelingt uns das häufig nicht? Thorsten Havener ist als Zauberkünstler Experte für das Geheimnisvolle. Er erklärt, wie Geheimnisse uns prägen, wie sie uns belasten oder unser Leben spannender machen, wie die Aufdeckung uns befreien oder in Schwierigkeiten bringen kann. Nicht zuletzt stellt er eindrucksvoll dar, warum wir Geheimnisse brauchen – gerade in Zeiten von Big Data, Facebook und Co.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung ANY. Konzept und Design
Umschlagabbildung Thorsten Wulff
ISBN 978-3-644-40074-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Clara – aus Gründen, die nur sie kennt
«Und das Geheimnisvolle hat nun mal das, worauf es ankommt, will sagen den Charme.»
Theodor Fontane
Teil 1Achtung! Geheimnis nicht verraten!
Christian
Mein Bruder lächelte wissend. Langsam stapelte er einige Münzen auf dem Tisch übereinander. Danach stülpte er eine kleine, ganz genau passende Messingröhre über den Münzstapel. Sein Lächeln wurde immer hintergründiger. Er gab mir eine weitere kleine Messingröhre, die ich nach Herzenslust untersuchen und danach vor mir auf dem Tisch abstellen sollte.
Nachdem ich das getan hatte, machte er eine geheimnisvolle Bewegung, hob die eine Messingröhre an – und die Münzen waren verschwunden. Dann bat er mich, unter der anderen nachzuschauen, und tatsächlich: Der Münzstapel fand sich nun unter dieser wieder.
Ich war damals sieben Jahre alt, und das war meine erste direkte Begegnung mit der Zauberkunst. In genau diesem Moment entstand eine Liebe und Hingabe zur Zauberei, die mein Leben lang anhalten sollte. Mein Bruder hat mir gezeigt, wie berührend und wundervoll es sein kann, wenn man etwas Geheimnisvollem beiwohnt, einen magischen Moment erlebt. Wie in aller Welt konnten diese Münzen wandern? Es war rätselhaft und wunderbar zugleich. Und ich genoss es.
Erst viele Jahrzehnte später wurde mir bewusst, was der Ursprung dieses Gefühls war. Was hat diesen Moment zu einer meiner stärksten Kindheitserinnerungen werden lassen? Was war der Kern dieses Gefühls – was war sein Ursprung, seine Tiefe?
Es war das Geheimnis!
Gerade die Tatsache, dass ich nicht wusste, wie mein Bruder dieses Kunststück vollbracht hatte, gab diesem Moment die Kraft. Hätte er es mir verraten – und ich habe gebettelt, wie nur Siebenjährige es können – der Zauber wäre für immer verflogen gewesen. Das Mysterium wäre entschlüsselt, ein tief emotionaler Augenblick nachträglich zu einem gelösten Rätsel verkommen. Der Zauber des Geheimnisvollen ist sehr zerbrechlich. Nur das bewahrte Geheimnis gibt ihm Kraft.
Es sollte noch sieben Jahre dauern, das zu erkennen – und zeitgleich doch hinter das Geheimnis der wandernden Münzen zu kommen. Ich entschlüsselte es erst nach dem Tod meines Bruders.
Manchmal liegt guter Rat nicht daneben
Als Christian zu zaubern begonnen hatte, war er schwerkrank. Er hatte Leukämie. Um sich die endlosen Tage im Krankenhaus zu vertreiben, lernte er Zaubertricks. Kotzen und zaubern, so ließ sich sein Krankenhausalltag wohl am präzisesten zusammenfassen. Ich durfte ihn damals nur selten besuchen – zu groß war die Gefahr, dass ich irgendwelche Bakterien auf ihn übertrug. Wenn überhaupt, war es mir nur erlaubt, über die geschlossene Balkontür des Krankenzimmers mit ihm zu reden. Auch das ist eine Erinnerung, die sich unauslöschlich in mir festgeschrieben hat: mein Bruder ohne Haare, gezeichnet von Chemotherapie und Kortison hinter einer Glastür. Auf der anderen Seite der Tür stand ich, ein siebenjähriger Bub, der seinen eigenen Bruder nicht mehr erkannte. Noch beim Schreiben dieser Zeilen greift die Erinnerung nach mir, selbst so viele Jahre später bekomme ich Gänsehaut und zittere leicht. Diese Momente hatten nichts Geheimnisvolles an sich, sie waren real, schonungslos und hart.
Um der Krankenhauswelt gedanklich zu entkommen, träumte sich Christian mit den Zaubertricks in eine Parallelwelt, in der das Unmögliche möglich zu sein schien. Er beschäftigte sich so intensiv mit der Zauberkunst, dass er, als er die Klinik verlassen durfte, ein ansehnliches Arsenal lässiger Tricks auf Lager hatte, mit denen er in unserem Wohnzimmer und auf Familienfeiern seine Mitmenschen verblüffte. Das Münzmysterium war nur eine Nummer von vielen. Er schluckte Rasierklingen und einen Faden – um anschließend die Rasierklingen säuberlich aufgefädelt wieder aus seinem Mund zu ziehen. Er ließ gefüllte Gläser aus einem leeren Beutel erscheinen, er zerschnitt ein Seil in mehrere Teile – und fügte es am Ende wieder zusammen.
Und nicht einen Trick hat er mir verraten!
Die Zauberkarriere meines Bruders war intensiv, aber kurz. Sie half ihm, den Krebs zu bekämpfen und ihn letztlich auch zu besiegen. Nach seiner Entlassung zauberte er zwar noch ein paar Monate, widmete sich dann aber anderen Hobbys. Da er im Krankenhaus viel hatte entbehren müssen und es als anderer Mensch verließ, als er es betreten hatte, wollte er das verlorene positive Lebensgefühl wieder einfangen. Er fuhr Moped und dann Motorrad. Er fing an zu tauchen. Und er begann, Fallschirm zu springen. Schnell musste alles sein – und tief. Das ging auch ein paar Jahre lang gut, bis er im April 1986 beim Fallschirmspringen einen tödlichen Fehler machte. Das Leben ist nicht fair. Warum es einem Jungen alles abverlangt und ihn den Krebs besiegen lässt, um ihn dann vier Jahre später beim Fallschirmspringen aus dem Leben zu reißen, wird für mich immer ein nicht zu entschlüsselndes Geheimnis bleiben.
Mit seinem Tod habe ich eine wichtige Konstante in meinem Leben verloren. Immer hatte ich sein wollen wie mein Bruder. Was macht man als junger Bub, wenn man plötzlich sein Vorbild verliert?
Ich habe mich entschlossen, dort weiterzumachen, wo er es nicht mehr konnte. Allerdings ohne Motorräder, Taucherflaschen oder Fallschirme. Davon hatte ich die Nase voll.
Ein paar Tage nach seinem Tod bin ich in sein Zimmer geschlichen und habe den alten Lederkoffer mit seinen Zauberrequisiten gesucht. Er lag im obersten Fach seines Regals, gut versteckt hinter einem Malefiz-Spiel, einer Spiegelreflex-Kamera, einem Fotoalbum und einer Gitarre. Das alte Leder roch nach Geschichten. So viele Geheimnisse hielt dieser ranzige Lederkoffer verborgen. Ich musste ihn nur öffnen, um sie zu lüften.
Ich habe mich zunächst nicht getraut.
Tagelang lag der Koffer herausfordernd in meinem Zimmer. Ich wusste, dass die Erklärung für die wandernden Münzen direkt vor mir lag. Und noch viel mehr Geheimnisse befanden sich in diesem Koffer. Aber was war, wenn ich ihn öffnete? Wäre ich nicht vielleicht ent-täuscht? Diese Geheimnisse gehörten ja eigentlich nicht mir, sondern meinem Bruder. Aber den konnte ich nun nicht mehr um Rat fragen. Schließlich habe ich den Koffer doch geöffnet – und wenn ich nach dem Verlust meines Bruders die Welt nur noch in Grautönen gesehen habe, so hat das Öffnen dieses Koffers dafür gesorgt, dass ich sie plötzlich wieder in zarten Farben wahrnahm. Allein das Berühren der Requisiten war wie ein kurzes Gespräch mit ihm.
Ich habe nicht nur erfahren, wie vor vielen Jahren die Münzen zu mir gewandert waren, sondern auch, wie der Trick eigentlich hieß. Ganz einfach und ganz knapp: «Super-Trick, das beste Münzkunststück der Welt.» Ja, das war er für mich damals – und auch weit über dreißig Jahre später ist er das für mich noch immer.
Aber im Koffer waren ja noch viel mehr Geheimnisse, die ich ergründen wollte. Viel Zeit habe ich mir genommen, die einzelnen Tricks zu studieren. In jede Anleitung habe ich mich vertieft und sie verinnerlicht. Meist umfasste sie pro Trick nur eine blasse Seite, mit Schreibmaschine eng beschrieben. Und alle endeten sie mit den Worten:
«Wichtig! Geheimnis nie verraten.»
Die vier Wörter waren jedes Mal abgesetzt, extragroß und mit einem schönen Rahmen versehen, wie auf einem Spiegel geschrieben. Mit diesem Imperativ endeten sämtliche Trickanleitungen; wie eine Beschwörung kam er mir vor: «Wichtig! Geheimnis nie verraten.» Christian hatte diese Worte immer mir gegenüber benutzt – jetzt wurde mir klar, woher er sie hatte.
Die alten, vergilbten Zettel liegen gerade vor mir, versehen mit Notizen meines Bruders, und auch in meiner eigenen blassblauen Kinderschrift stehen dort Tipps zur richtigen Vorführung.
Jedes Detail aus dem Sommer 1986 taucht beim Auffalten der Trickbeschreibungen wieder in meiner Erinnerung auf.
Christian hatte sich eisern daran gehalten, hatte die Worte ernst genommen, in dem Wissen, dass der Zauber brechen würde, hätte er das Geheimnis preisgegeben. Längst hätte ich nicht mehr an die Münzen gedacht, hätte sie zu den vielen anderen Kindheitserinnerungen gepackt, die in mir vergraben sind. Also machte auch ich diese Formel zu meinem Mantra. Meinem Bruder war es verwehrt gewesen, mich eines Tages vielleicht doch in seine geheime Kunst einzuweihen – ich wäre gern sein Zauberlehrling geworden. Nun lag es an mir, eigenständig in seine Fußstapfen zu treten.
Ohne dass es mir zunächst bewusst war, nahmen Geheimnisse einen sehr großen Platz in meinem Leben ein – und mit ihnen der Grundsatz aus vier Wörtern, der sich unsichtbar durch mein gesamtes Berufsleben, durch jede Vorführung, jeden Vortrag und jedes Interview gezogen hat.
Mittlerweile kenne ich die meisten von Christians geheimen Zaubertricks. Ich habe sie weiterentwickelt, modernisiert und auf große Bühnen gebracht, nur um ihm näher zu sein. Aber teilen konnte ich sie mit ihm nie.
Inzwischen bin ich sehr viel älter als mein großer Bruder. Ich habe eine eigene Familie. Als meine drei Kinder so alt waren wie ich damals beim Bestaunen des «besten Münzkunststücks der Welt», schenkte ich ihnen jeweils eine moderne Version des Tricks. An die benötigten Utensilien zu gelangen war nicht schwer, meine Frau ist die Tochter eines Händlers für Zauberrequisiten. Ich habe meinen drei Kindern eine eigene Anleitung geschrieben und ihnen erzählt, warum genau dieses Kunststück mich so berührt. Die Beschreibung endete mit vier Wörtern, hübsch umrandet:
«Wichtig! Geheimnis nie verraten.»
Geheimnisse sind für mich in erster Linie etwas, das diese Welt bereichert. Mich haben Geheimnisse meist beflügelt, sie gaben mir Kraft, haben es mir ermöglicht, Probleme zu überwinden und zu verarbeiten.
Ich liebe Geheimnisse.
Teil 2Pssst!
Alles zu wissen ist langweilig
«Größe braucht Mysterium», sagte einmal der französische Präsident Charles de Gaulle. Man kann es auch schlichter formulieren, weniger heroisch, mehr demokratisch: Wir brauchen Geheimnisse. Die Kunstform, die ich öffentlich vor Menschen ausübe, lebt vom Geheimnis und vom Geheimnisvollen. Gäbe es nichts Verborgenes, ich könnte einpacken: Niemand würde sich meine Shows anschauen. Ohne das Geheimnisvolle, Mystische und Rätselhafte wären meine Bühnenprogramme fad und farblos. Denn das Faszinierende ist ja gerade, dass man nicht hinter ihr Geheimnis kommt. Klar, das Publikum würde zu gerne wissen, wie das alles funktioniert. Seit vielen Jahren höre ich den Satz: «Bitte verrate mir doch, wie du das gemacht hast!» Ich ziehe es jedoch vor, das nicht zu tun.
Ich genieße es, auf der Bühne zu stehen und mehr zu wissen, als das Auge des Publikums sieht. Eine ganze Menge ist das übrigens. Ich finde es spannend, in den Köpfen der Zuschauer eine verblüffende und magische Welt entstehen zu lassen, die sie zum Wundern und Nachdenken anregt, über das Alltägliche hinaus. Durch bestimmte Methoden sind wir Zauberer in der Lage, Illusionen entstehen zu lassen. Und je mehr jemand bereit ist, sich einer solchen Illusion hinzugeben, sich auf sie einzulassen, umso größer kann sie sein. Und, für mich nicht erstaunlich: Nur wenige Menschen lehnen eine solche Verzauberung ab.
Umso länger ich mich mit Tricks und Kniffen beschäftigte, mit Wahrnehmungstäuschung und dem Entziffern dessen, was jemand eigentlich nicht preisgeben will und dann doch über sich verrät, desto mehr interessierte mich die Psychologie von Geheimnissen und die Frage, was eigentlich ein Geheimnis ist. Mir reichte es nicht mehr aus, die einzelnen Techniken der Täuschung perfekt zu beherrschen, sondern ich wollte mehr erfahren, über die Geheimnisse der alten Zauberer und Priester, über das anvertraute Geheimnis von Freunden, die typischen Geheimnisse von Kindern, das gut gehütete Familiengeheimnis, Geheimnisse in der Partnerschaft, unter Kollegen – streng genommen kann man sich ein Leben ohne Geheimnisse eigentlich gar nicht vorstellen. Wir alle hüten das eine oder andere Geheimnis, behalten lieber etwas für uns, als es anderen zu erzählen.
Aber warum ist das so? Und warum haben Geheimnisse oft einen so schlechten Ruf? Warum wird ein Geheimnis oft mit einer Lüge verbunden? Manchmal scheint dieser Zusammenhang nahezu unausweichlich zu sein. Weil ein Geheimnis in einer Partnerschaft mit Fremdgehen verknüpft wird? Weil es belastet, etwas für sich zu behalten und zu verbergen? Doch stimmt das überhaupt – so pauschal? Kann es nicht auch sein, dass Geheimnisse etwas sehr Positives sein können, dass sie zu den großen Errungenschaften der Menschheit gehören und sie uns dazu gebracht haben, uns selbst zu entwickeln und unsere Autonomie zu bewahren? Ist es nicht auch denkbar, dass wir durch Geheimnisse neugierig werden, die Welt entdecken wollen, so wie ich nie aufgegeben hatte, hinter den Münztrick meines Bruders zu kommen, koste es, was es wolle?
Der Wunsch, Geheimnisse zu enthüllen und hinter das Offensichtliche zu schauen, sich mit dem, was man sieht, nicht zufriedenzugeben, treibt die Menschen seit jeher um.
Sicher, wenn man Geheimnisse damit gleichsetzt, sich selbst und andere absichtlich zu belügen, kann man sie als Betrug auffassen, als Verrat ansehen – und das kann wiederum zu seelischen und körperlichen Problemen führen, zu Depressionen, Herzerkrankungen, zu Angst, Schuldgefühlen. In solchen Fällen kann Wohlbefinden nur erreicht werden, wenn man eine andere Person einweiht, ein Geständnis macht, sein Geheimnis preisgibt – auf diese Aspekte werde ich später noch eingehen.
Aber um solche dunklen, belastenden Geheimnisse und um deren negative Auswirkungen soll es nur am Rande gehen. Es geht mir nicht um Affären, nicht um Diebstahl, Erpressung oder sonstige kriminelle Machenschaften. Nicht um das, was auf der Couch eines Psychiaters zur Sprache kommt. Und auch nicht um geheime politische Absprachen. Vielmehr möchte ich den Blick auf die positive, sinn- und identitätsstiftende Seite von Geheimnissen richten.
Das klingt zunächst vielleicht überraschend, aber Sie werden im Verlauf des Buchs sehen, wie sehr wir von Geheimnissen profitieren können.
Denken Sie doch nur mal daran, wenn Ihr Arzt, Ihr Anwalt, Ihr Psychologe, Ihr Beichtvater offen mit anderen darüber sprechen würde, was er alles über Sie weiß!
Wir Menschen, das ist die These meines Buchs, brauchen Geheimnisse – und sie und das Geheimnisvolle, das sie umgibt, haben uns schon immer fasziniert.
Nur Illusion?!
Ich hatte als Dreizehnjähriger das Geheimnis gebraucht, um für mich einen Weg zu finden, mit dem Tod meines Bruders umzugehen, und fing im Laufe der Zeit an, mich mit den Ursprüngen der Zauberkunst zu beschäftigen. Wenn sie für mich so bedeutsam ist, ist sie es vielleicht auch für andere? Wenn mich das Geheimnisumwitterte so fasziniert, dann übt sie diese Faszination vielleicht auch für andere aus?
Ein Blick in die Geschichte bestätigt das: Die erste schriftlich festgehaltene Überlieferung über das Wirken eines Zauberers stammt bereits aus der Zeit um 1800 vor Christus – ist also schon fast 4000 Jahre alt: der Westcar-Papyrus. Er erzählt davon, wie der Pharao Cheops, der noch heute durch den Bau der Cheops-Pyramide bekannt ist, den Magier Dedi zu sich rufen ließ. Diesen umgaben sagenhafte Geschichten: Er sei 110 Jahre alt, esse pro Tag 500 Brotlaibe sowie eine komplette Rinderschulter. Weiterhin trinke er täglich 100 Kelche Bier, sei in der Lage, wilden Tieren seinen Willen aufzuzwingen und: Er könne abgetrennte Köpfe wieder anbringen! Davon wollte sich Cheops der Legende nach selbst überzeugen und bot dem Magier einen verurteilten Häftling an. Aber Dedi weigerte sich, einen Menschen zu enthaupten. Stattdessen, so der Papyrus, nahm er eine Gans aus der Menagerie des ägyptischen Königs. Dann riss er dem armen Tier den Kopf ab und legte den leblosen Körper des Vogels auf den Boden, ein paar Schritte weiter den Kopf. Nachdem sich jeder Kopf und Körper angeschaut hatte, hob der Magier den Körper auf, ging zum Kopf und nahm ihn ebenfalls in die Hand. Ganz langsam drückte er den Kopf an den Körper der Gans. Die begann plötzlich zu zappeln und zu schnattern, war wieder voller Leben und lief munter davon. Der Pharao war begeistert und wollte dieses Wunder ein weiteres Mal sehen. Also köpfte Dedi einen Pelikan und erweckte ihn wieder zum Leben. Die Legende sagt weiter, Dedi habe obendrein einen Löwen hypnotisiert, der ihm daraufhin fügsam folgte und plötzlich zahm war wie eine Hauskatze.
Unglaublich! Und auch wenn die Erzählung ganz offensichtlich an der einen oder anderen Stelle mit reichlich Phantasie ausgeschmückt worden ist: Dedi muss über eine unglaubliche Gabe verfügt haben, sein Publikum in den Bann zu ziehen und bei ihm Illusionen entstehen zu lassen. Die Aura des Geheimnisvollen – und damit des Machtvollen! – fasziniert noch heute Zauberer weltweit. Warum? Wie Dedi seine «Enthauptungen» vollbracht hatte, blieb ein Geheimnis; es wurde gehütet und nie verraten. Zahlreiche Menschen haben seither versucht, ihm auf den Grund zu gehen – und daran zeigt sich ein weiteres Spezifikum von Geheimnissen: Sie sind vielschichtig und können für neue Gedanken sorgen, weil sie zu Nachforschungen anregen. Bewusstseinserweiterung ganz ohne Drogen.
Doch kehren wir in die Geschichte zurück. Jochen Zmeck berichtet in seinem Handbuch der Magie – ein Klassiker unter Zauberern und auch eines meiner ersten Zauberbücher – von Hero von Alexandria. Er war Ingenieur und Mathematiker, der Anfang des zweiten Jahrhunderts lebte. Hero von Alexandria entwickelte eine geheime hydraulische Mechanik, die dafür sorgte, dass sich die Türen eines Tempels beim Entzünden des Opferfeuers wie von Zauberhand öffneten. Zeitgleich floss Wein in die Opferschale. Der Hohepriester des Tempels nutzte die Kraft dieses Geheimnisses und täuschte damit höhere Kräfte vor. Das Volk war gebannt, wie konnte es auch anders sein – und konnte so im Sinne der Hohen Priester gelenkt werden.
Hier zeigt sich ein weiterer Aspekt von Geheimnissen: Wer Geheimnisträger ist, hat einen Wissensvorsprung und kann diesen für sich und seine Zwecke nutzen (bleibt zu hoffen, dass es gute Zwecke sind).
Geheimnisse sind so alt wie die Menschheit
Früher lebten die Menschen eng in Familienverbänden, Stämmen und Dorfgemeinschaften zusammen. Zur Abgrenzung, aber ebenso zum Schutz vor Eindringlingen entwickelten sich Geheimriten und Rituale. Das fing schon im kleinsten Bestandteil der Gemeinschaft an, der Familie. Sie ist die Zelle der Gesellschaft. Was hier passierte, blieb auch hier. Krankheiten, Geldnöte, Streitigkeiten – kurzum alles, was sich innerhalb der Familie ereignete und nur für ihre Augen und Ohren bestimmt war, drang auch nicht nach draußen. Es war geheim.
Auch in der Berufswelt, in bestimmten Ständen und Berufsgruppen gab es schon immer Geheimwissen, das nur vom Meister auf auserwählte Schüler übertragen wurde. Die Aufnahme in bestimmte Berufe wurde mit geheimen Bräuchen ritualisiert. Geheimrezepte, Kampftechniken, Medizin – fast jeder Beruf hat in seiner Entstehungsgeschichte exklusives Fachwissen gesammelt. Insbesondere die Kenntnisse der Heiler, weisen Kräuterfrauen und Magier wurden lange Zeit streng geheim gehalten und sollten unter keinen Umständen der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.
Als Künstler sich im Mittelalter zu Gilden zusammenschlossen, bezeichnete man ihre jeweiligen Fertigkeiten als ihr «Geheimnis». Die Tradition hält sich bis heute. Wir verraten unsere Betriebsgeheimnisse nicht. Es sind geschützte Informationen, genau wie das Rezept von Coca-Cola oder der Algorithmus von Facebook. Die Exklusivität dieses Geheimwissens erfüllte damals wie heute eine einfache Aufgabe: Die Geheimnisse reduzierten die Konkurrenz. Im Falle von Heilmitteln gab es einen zusätzlichen Nutzen, denn deren Wirksamkeit wurde oftmals durch das Geheimnis um die Inhalte und die Riten der Herstellung sogar gesteigert.
Allerdings konnte solches Geheimwissen auch schnell gefährlich werden: Es gab immer Strömungen, im Mittelalter vor allem innerhalb der Kirche mit der Inquisition, die eine Gefahr in Heilern, Kräuterfrauen oder Menschen mit «magischen» Kräften sahen: Gefahr deshalb, weil sie durch sie die Deutungshoheit über «Wunder» und damit an Einfluss zu verlieren glaubten und keine Konkurrenz zur christlichen Weltsicht zulassen wollten. Wer unbequem wurde oder der Kirche im Weg stand, der wurde beschuldigt, mit dunklen Mächten in Verbindung zu stehen. Das ist der Grund, warum die Gaukler und Taschenspieler die Ersten waren, die zugaben, dass sie mit Tricks arbeiteten.
Die Gefahr der Verfolgung war dennoch sehr groß. 1487 veröffentlichten die Dominikaner Jakob Sprenger und Heinrich Kramer das Buch der «teuflischen Künste», den Hexenhammer (lateinisch Malleus maleficarum). In diesem Buch beschreiben sie, anhand welcher Prüfungen man eine Hexe erkennen kann, nach welchen Regeln man ihr den Prozess macht – und wie man foltert.
Laut Kramer und Sprenger sind Frauen grundsätzlich für alles verantwortlich, was sich an Schlechtem in der Menschheit ereignet hat. Schon bei der Schöpfung benachteiligt, seien sie generell anfällig für schwarze Magie und ein Übel der Natur. Ich schwöre Ihnen, das erfinde ich nicht gerade, das steht da wirklich!
Kein Wunder, dass Frauen die Schuld für so ziemlich alles in die Schuhe geschoben wurde, was gerade schieflief. Und das war Ende des 15. Jahrhunderts eine Menge: Extrem kalte Winter verursachten Ernteausfälle und führten in weiten Teilen der Bevölkerung zu Hunger. Und dann kam auch noch die Pest über die Menschen. Nach der perversen Logik der Autoren waren «Hexen» mit ihrem «Schadenszauber» für diese Katastrophen verantwortlich.
Der Hexenhammer sorgte am Ende dafür, dass in ganz Europa die Scheiterhaufen brannten. Es konnte nahezu jeden treffen.
Gnadenlose Inquisitoren zogen folternd und mordend durch die Lande, im Namen Gottes. Alleine die im Hexenhammer beschriebenen «Hexenproben» sind an Perversion nicht zu überbieten. Bei der Feuerprobe musste die Angeklagte beispielsweise ihre Hand ins Feuer stecken. Einige Tage später wurde die Hand dann untersucht. War sie unverletzt, war die Angeklagte unschuldig. Bei Brandverletzungen war die Schuld bewiesen, «Gottesurteil» nannte man das. Daher stammt übrigens die Redewendung: «Für den lege ich meine Hand ins Feuer.»
Eine andere Probe war die Nadelprobe. Hierzu schor man den Kopf der Angeklagten, anschließend wurde sie nackt vor den Scharfrichter geführt. Ein Gehilfe suchte den Körper nach Muttermalen, Leberflecken oder Warzen ab. Wurde ein solches Mal gefunden, stach der Scharfrichter mit einer Nadel hinein. Zeigte die Gestochene keine Anzeichen von Schmerz oder blutete die Stichwunde nicht, so behauptete man, ein «Hexenmal» entdeckt zu haben. Die Person endete auf dem Scheiterhaufen.
Einige der verwendeten Nadeln sind noch heute erhalten. Bei ihrer Untersuchung machte man eine unglaubliche Entdeckung: Die Spitze ist im Griff versenkbar! Drückte man mit einer solchen Nadel in ein «Hexenmal», passierte natürlich nichts. Kein Schmerz und kein Blut. Ein Beweis dafür, dass auch die Kirche mit Tricks arbeitete.
Der Engländer Reginald Scot wollte diesem Treiben nicht mehr tatenlos zusehen. Scot, Schriftsteller und Arzt, veröffentlichte 1584 das Buch The Discoverie of Witchcraft. Scot erklärt darin die Tricks der Taschenspieler und zeigt, dass man für vermeintliche Wunder nicht mit dem Teufel in Verbindung stehen muss, sondern dass es auch andere Erklärungen gibt. Damit ist Scot einer der ersten Whistleblower der Geschichte.
Geheimnisse gibt es also, seit es die Menschheit gibt. Sie sind gebunden an Gesellschaften, in denen sie entwickelt worden sind, mit Intentionen, die dem einen gelegen kommen, einem anderen womöglich nicht. Wir finden sie überall und in unterschiedlichen Formen. Egal ob in der Familie, in Freundschaften, bei der Arbeit, in der Politik oder in den Shows moderner Magier. Ganz gleich ob in der Liebe oder in unseren Hoffnungen und Träumen – überall sind Geheimnisse mit im Spiel. Wir sind umgeben von Codes, Geheimnummern, PINs, Rätseln und Chiffren.
Geheimnisse scheinen tatsächlich eine grundlegende Funktion für unser Menschsein zu haben – das möchte ich in den folgenden Kapiteln noch einmal näher untersuchen.
Ralph Waldo Emerson, ein US-amerikanischer Philosoph, der die Natur vergötterte und Präsident Abraham Lincoln eine moralische Stütze war, sagte einmal etwas, das mir gut gefällt: «Mir ist lieber, in einer von Geheimnissen umgebenen Welt zu leben, als in einer, die so klein ist, dass mein Verstand sie begreift.»
Gar nicht geheim – was ist eigentlich ein Geheimnis?
Jetzt haben wir so viel über Geheimnisse in den unterschiedlichsten Zusammenhängen gesprochen, und man merkt: Die Angelegenheit ist komplex. Deshalb sollten wir uns zunächst vielleicht erst mal mit der Frage beschäftigen: Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Geheimnisse reden? Was charakterisiert sie?
Früher sprach man in diesem Zusammenhang auch von Mystik, von einem Mysterium. Das Wort «Mysterium» (volkstümlich abgeleitet von myo, «den Mund schließen») verweist schon auf ein Geheimnis. Hier ist allerdings keine verschwiegene Information gemeint, sondern eher etwas, das sich der Erklärbarkeit prinzipiell entzieht, ein Ereignis, dem man mit logischem Denken nicht auf den Grund gehen kann.
Der Reformator Martin Luther benutzte das Wort «Geheimnis» im Jahr 1521 als Erster, um den Ausdruck «Mysterium» ins Deutsche zu übersetzen. Und «geheim» bedeutete nach Luther «zum Heim gehörend» beziehungsweise «vertraut». Was zu unserem Haus gehört und in ihm passiert, ist uns vertraut. Es findet in unserer geschützten Umgebung statt. Außenstehende bekommen davon nichts mit, sie sind, was das Private betrifft, unwissend. Im Gegensatz dazu steht das Wort «unheimlich», das auf das Fremde und Bedrohliche verweist.
Der Münchner Dichter Christian Morgenstern sagte einmal: «Es gibt kein Geheimnis an sich, es gibt nur Uneingeweihte aller Grade.» Dieser Satz gefällt mir wohl auch deshalb so gut, weil dieser Versuch einer Definition von «Geheimnis» an sich schon wieder geheimnisvoll klingt. Wer sind die Uneingeweihten? Bin ich der Eingeweihte und Sie nicht? Ist Ihr Nachbar uneingeweihter als Sie, weil Sie gerade dieses Buch lesen?
Und wie ist die Formulierung «aller Grade» zu verstehen? Um ihr nachzugehen, könnte man zum Beispiel mit unterschiedlichen beruflichen Graden anfangen, denn es könnte ja sein, wenn man sich dem Geheimnis nähern möchte, dass es darauf ankommt, wen das Geheimnis betrifft. Ein Jurist wird ein Geheimnis zwangsläufig anders erklären und werten als ein Therapeut, ein Soziologe oder ein Künstler. Ein Rechtsanwalt denkt womöglich sofort an seine Verschwiegenheitspflicht, an die rechtliche Verpflichtung bestimmter Berufsgruppen, ihnen anvertraute Geheimnisse nicht weiterzugeben. Denn laut Strafrecht sind Geheimnisse «Tatsachen, die nur einem beschränkten Personenkreis bekannt sind und an deren Geheimhaltung der Geschützte ein sachlich begründetes Interesse hat». Es macht also einen erheblichen Unterschied, wer ein Geheimnis definiert, von welcher Seite es beleuchtet wird.
Gail Saltz, Professorin an der Cornell School of Medicine in New York, nimmt in ihrem 2006 erschienenen Buch The Anatomy of a Secret Life Luthers Geheimnis-Definition auf, geht aber noch einen Schritt weiter. Ihrer Meinung nach geben uns Geheimnisse «einen sicheren Hafen, der uns die Freiheit gibt, herauszufinden, wer wir sind». Da ist sie wieder, die eigene Entwicklung, die Autonomie, die jeder benötigt, um sich seiner selbst bewusst zu werden. Um sich selbst kennenzulernen. Saltz zufolge sind Geheimnisse Teil eines jeden Lebens.
Und meine Definition von Geheimnis, die Definition eines Zauberkünstlers? Sie wechselt, doch mit der Formel, die ich im Koffer meines Bruders gefunden habe: «Wichtig! Geheimnis nie verraten» – nähere ich mich einer Definition an. Für mich ist alles, was ich bewusst bei mir behalten und nicht mitteilen will, zunächst mein Geheimnis. Immerhin gibt es eine kleine Übereinstimmung mit der strafrechtlichen Definition, nach der ein Geheimnis ja nur einem kleinen Personenkreis bekannt ist. In meinem Beruf sind es vor allem nur Kollegen, die mit den Tricks und Rätseln vertraut sind. Da passt es, was der niederländische Psychologe Andreas Wismeijer über Geheimnisse zu sagen hat: Er ist der Ansicht, dass ein Geheimnis dann vorliegt, wenn ein Sachverhalt absichtsvoll vor anderen geheim gehalten wird. Während das bei mir als Künstler bestimmte Techniken und Methoden sind, beinhalten Geheimnisse bei Wismeijer Fakten, Emotionen und Leidenschaften. Aber auch Gegenstände können ein Geheimnis sein oder in sich bergen: ein versiegeltes Tagebuch, der alte verschlossene Koffer auf dem Dachboden, ein Ring, dessen Bedeutung nur zwei Liebende kennen. Wen hat es nicht schon in den Fingern gekribbelt, ein Tagebuch verbotenerweise zu lesen oder ein Schloss aufzubrechen, um zu erfahren, was einem vorenthalten wird? Fallen Begriffe wie «Bernsteinzimmer», «Nibelungenhort» oder «Atlantis», beflügeln sie augenblicklich unsere Phantasie.
Geheimnisse sind nicht nur zurückgehaltene Informationen, sie beinhalten auch eine Sphäre, die als geheimnisvoll erlebt wird. Jeder von uns hat als Kind den Zauber bestimmter Orte erlebt: eine Höhle im Gebüsch, den Dachboden bei den Großeltern. Diese Geheimnisse bestehen nicht aus fassbaren Inhalten, die vor anderen verborgen werden, sondern aus faszinierender Atmosphäre.
Mit der zunehmenden Entzauberung unseres Alltags und dem Wissen der Naturwissenschaften erscheint im ersten Moment alles erklärbar, doch auch wir Erwachsene spüren immer wieder dieses atmosphärische Geheimnisvolle.
Sie mögen mir meine Schwärmerei verzeihen, aber ich finde, sehr viele Geheimnisse haben eine innewohnende Schönheit. Mit dieser Schönheit ist nichts Esoterisches gemeint, auch nichts, was Modemagazine interessieren könnte, es betrifft etwas ganz Konkretes. Sie alle kennen die Verwandlung einer Raupe in einen Schmetterling. Ein unglaublicher Vorgang. Verzauberung pur. Wie ist das möglich? Was im Innern des Kokons passiert, fasziniert uns vor allem aus dem Grund, dass wir den Prozess der Veränderung nicht nachverfolgen, nicht beobachten können. Er entzieht sich unseren Blicken. So hässlich die kleine dicke Raupe zunächst daherkommt, so unfassbar strahlend, filigran und wohlgestaltet erscheint uns später der herumflatternde Schmetterling. Wie findet seine Transformation statt?
Was wir nicht genau sehen können, was uns verborgen bleibt, zieht uns in seinen Bann. Das beginnt bei der Wundertüte und dem Überraschungsei und endet noch längst nicht bei unseren Tagebüchern: Wir sind umgeben von Geheimnissen, wohin wir blicken. Geheimnisse geben uns zu verstehen, dass es ziemlich langweilig mit uns wäre, wenn es nicht diesen geheimnisumwitterten Kokon gäbe.
Ich persönlich liebe deshalb Gegenstände, die mit einem Geheimnis verbunden sind. Zur Taufe unseres Sohnes Vincent hatte sein Pate die Idee, ihm eine Art Schatztruhe in Miniaturausgabe