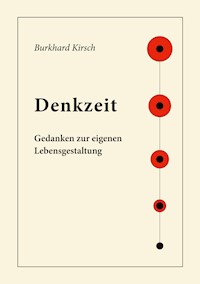
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Zeit zum Denken Positive Gedanken regen mich zu weiteren Taten an Kaum zu glauben: Du hast nur einmal Zeit Fang` jetzt an zu leben und warte nicht auf morgen Grundlage jeder Ethik ist der gute Wille Es gibt keine Kraft, die stärker ist als eine große Portion Liebe
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 78
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Einleitung
DENKZEIT ist der Versuch, eine Gemeinsamkeit im Miteinander des täglichen Lebens zu erreichen. Kommt doch das Denken bei allen Völkern in unterschiedlicher Weise vor. Wir denken immer, ohne darüber nachzudenken.
Worüber sich nicht alle Menschen Gedanken machen ist die Zeit. Allein das Bewusstsein dazu geht Vielen verloren. Schon der Gedanke, dass die Zeit, die vergangen ist, nie wieder kommt und auch nicht mehr veränderbar ist, hat selten in Diskussionen Platz. Deshalb gehört heute das ziel- und zeitbewusste Arbeiten zu einer Selbstverständlichkeit.
Ähnlich sieht es bei dem Thema Ethik aus. Hier haben sich durch die Jahrtausende Verhalten entwickelt und geprägt. Dabei spielt die Vorbildfunktion ein große Rolle. Nicht nur im Beruf sondern auch in der Familie. Und der Wille zu einem Dazulernen, wenn neue Wege eingeschlagen werden sollen. Es ist unvorstellbar anzunehmen, dass alle Menschen dieser Erde nach den gleichen Regeln leben könnten.
Burkhard Kirsch, Studium der Volkswirtschaft, Philosophie und Germanistik, war Geschäftsführer des Instituts für Kommunikation und Betriebsführung in Dielheim bei Heidelberg. Er beschreibt die Themen Denken, Zeit und Ethik aus seiner Erfahrung als Personalentwickler heraus bewusst sehr intensiv. Mit dieser Art der praxisbezogenen Darstellung animiert er seine Leser dazu, sich mit dem Text auseinander zu setzen.
Inhaltverzeichnis
Grundgedanken
Die Gesamtheit unseres Denkens
Unser Gedächtnis
Selbstverantwortung
Erwartungen - Enttäuschungen
Die Kunst Zeit zu haben
Du hast nur einmal Zeit
Sich Zeit nehmen
Pareto und die 80/20 Formel
Nachdenken über die eigene Zeit
Ethik – eine Lebenswissenschaft
Die wichtigsten Zweige der Ethik
Wo fängt die Ethik an?
Die moralischen Grundwerte des Lebens
Die sieben Tugenden - Todsünden
Denkmal
Gedanken rund ums Denken
Es ist nicht leicht sich vorzustellen, dass wir denken können, ohne zu merken, dass wir denken. Wir müssen uns ein Wesen vorstellen, das zwar denkt, aber nichts davon weiß, dass es denkt und das nicht merkt, dass es denkt. Das bedeutet nicht, dass wir Tag und Nacht, ob unbewusst oder bewusst, nur denken. Unbemerkt ist der richtige Ausdruck. Wie ergeht es mir, wenn ich einen Menschen zum ersten Mal sehe? In Bruchteilen von Sekunden fälle ich über ihn ein Urteil, indem ich unbewusst über ihn nachgedacht habe.
Was der Mensch denkt und empfindet, bestimmt sein Handeln, durch das er sein Leben und die Welt gestaltet. Die Folgen des Handelns sind Folgen des Denkens. Wie es uns und anderen ergeht, ist uns sehr wichtig. Oft vergessen wir, wie sehr so ein Zustand bereits in den Gedanken vorbereitet lag, die wir uns einmal gemacht haben. Der Mensch wird zum Beispiel darauf aufmerksam, dass Glück und Unglück im Denken beginnen, Kriege und Gewalt in den Köpfen von Menschen entstehen und erst dann grausame Wirklichkeit werden. Erfüllungen und Gelingen oft nur deshalb eintreten konnten, weil sie ursprünglich schon vorstellbar waren und solche Gedanken auch riskiert wurden. Erst dann wird die Wichtigkeit des Nachdenkens für das Leben deutlich. Denn in allem Nachdenken liegt bereits ein Vordenken für die Zukunft.
Unsere Welt ist so eng wie es unser Denkvermögen ist. Für uns Undenkbares können wir nur schwer begreifen, und Unvorstellbares können wir kaum mitgestalten. Der Reichtum unseres Erlebens und Erkennens, die Größe der Möglichkeiten, das Befriedigende unseres Lebens, alles das beginnt mit der Weite oder Enge unseres Denkens und mit dem Umfang dessen, was für uns vorstellbar ist. Das Unvorstellbare entzieht sich uns allzu leicht. Wo es das nicht tut, werden wir davon überrascht. Es ist schon eine lohnende und notwendige Aufgabe, viele Denkweisen einzunehmen. Wer gelernt hat, Ungewöhnliches klar zu erfassen, kann auf eine Zukunft mit vielen Möglichkeiten hoffen. Sonst ist die Gefahr groß, an sich selbst vorbei zu leben.
Indem wir mitdenken lernen und uns dabei vor dem öden Streit aller rechthaberischen Ansichten hüten, erweitern wir unsere Zukunftsaussichten und steigern unsere Möglichkeiten.
Wenn wir ein Stück der Gedankenwege der großen Philosophen wie Platon, Aristoteles, Plotin, Thomas von Aquin, Descartes, Kant, Nietzsche und Heidegger mitgehen lernen, werden wir geschulter für die Zukunft und lernen, unseren Erfahrungen besser zu begegnen. Denken zu können besiegt die Furcht vor dem Unbekannten und schließt uns für das Neue auf.
Wenn Platon das Denken als einen „Dialog der Seele mit sich selbst“ bezeichnete, so meint er, dass das Denken ein Prozess des Fragens und Antwortens ist. Kant sagte, dass es den Weisen auszeichne zu wissen, welche Fragen man sinnvoll stellen sollte, und forderte eine Logik von Frage und Antwort. Wie steht es eigentlich um unser Denken? Denken gilt in der europäischen Geschichte als eine außergewöhnliche Fähigkeit des Menschen, um zu Wissen zu kommen. Die europäische Tradition hat das Denken von Sachverhalten als das Erkennen und die Bestimmung des Handelns durch das Denken als Wollen1 formuliert. Und dieses Erkennen ist auf Wahrheit und das Handeln ist auf das Gute,2 auf moralische und sittliche Grundwerte ausgerichtet. Denken kann allerdings auch anders gedacht werden und zum Beispiel auf Macht oder Nutzen orientiert sein.
Im alltäglichen Verständnis enthält es eine Vielzahl von ineinander greifenden Handlungen, wie an etwas denken (sich erinnern), denken, dass sich etwas so und so verhält (glauben, meinen), denken, etwas zu tun (eine Absicht haben), bedenken (etwas in einen Plan miteinbeziehen), sich in etwas hineindenken (sich etwas klar machen und es in seinem Zusammenhang zu verstehen versuchen), nachdenken (sich besinnen), etwas denken (Vorstellungen und Begriffe bilden), sich etwas so und so denken (reflektieren), etwas durchdenken (einen Zusammenhang schrittweise erfassen), weiter denken (Schlussfolgerungen für die Zukunft ziehen), etwas überdenken (bereits Gedachtes überprüfen), sich etwas ausdenken (Alternativen entwerfen, erfinden). So ist es eben unsere menschliche Fähigkeit, Erkenntnis zu haben und darüber zu urteilen. Denken ist Handeln im Kopf. Verstehen heißt denken.
So einfach soll das sein? Etwas, was Menschen seit Jahrtausenden jeden Tag, jede Minute tun, ohne es meistens bewusst zu merken. Soll das alles sein? Mitdenken, nachdenken, durchdenken, vordenken, gedenken sind nur einige Begriffe, mit denen wir täglich zu tun haben. Etwa vergleichbare Leistungen werden auch von einigen Tieren erreicht. Manche können auch von Maschinen übernommen werden. (Computer, Rechner) In der Vielfalt ist jedoch nur der Mensch in der Lage dazu.
Die Denkpsychologie teilt unser Denken in vorsprachliches, bildhaft anschauliches und abstraktes Denken ein. In der ersten Denkstufe werden Sinneseindrücke und bereits erworbene Handlungsmuster, unter dem Druck der Bedürfnisse in einer ganz konkreten Situation, in einen Zusammenhang gebracht. Diese vorsprachliche Art des Denkens wies Wolfgang Köhler, ein amerikanisch-deutscher Psychologe, mit seinem bekannten Schimpansen-Experiment nach: die Tiere mussten Kisten übereinander stapeln und Stöcke zusammen bringen, damit sie dann an eine Banane herankamen. Allein Schimpansen haben 90 Prozent des genetischen Aufbaus wie wir Menschen. Die Anatomie ihres Gehirns und des zentralen Nervensystems gleicht dem unsrigen. Tiere haben ein ausgeprägtes Erinnerungssystem. Sie erinnern sich an Orte, an Klänge, an Gerüche und sie erinnern sich mit ihrem Feingefühl an Freundschaften. 3
Das bildhaft-anschauliche Denken löst sich vom direkten Handlungsablauf und benutzt konkrete Vorstellungen (Bilder, Geräusche, Gerüche usw.) als Denkelemente, um diese mit einander zu verknüpfen. Erst durch das symbolhafte, abstrakte Denken wird unser Denken wirtschaftlich und wirkungsvoll. Mit der Verwendung von Symbolen, Begriffen, Formeln usw., die der Mensch erlernt hat und selbst verarbeiten kann, ist das abstrakte Denken sehr beweglich. Es kann mehrere Lösungswege schnell durchspielen und kommt auf diese Weise zu neuen und weiterführenden Ergebnissen. Zum Beispiel kann durch eine abstrakte und symbolhafte Information die Bildung von Gruppen, Klassen, Kategorien und Regeln dargestellt werden. Bei allen drei Arten unseres Denkens werden die Richtungen jeweils durch Ziele bestimmt.
Denken erlaubt, Etwas als Etwas zu sehen, Wahrgenommenem Bedeutung und/oder Sinn zu geben, über den man sich unabhängig von weiterem Wahrgenommenen mit anderen verständigen kann, um dann in Dialoge, Diskurse und Argumentationen einzutreten.
Denken kann sich selbst zum Gegenstand machen und sich Spielregeln geben, nach denen es zielgerecht zu Ergebnissen kommen kann. Die dann aus dem Denken zu begründenden Entscheidungen können für ein bestimmtes Handeln genutzt werden.
„Denkste“ ist ein oft gehörter Ausspruch, der der Schadenfreude entspringt. Dabei steckt doch mehr dahinter, als nur schadenfroh zu spötteln. Ist es nicht auch der geheime Vorwurf, bei anderen an deren Denken zu zweifeln? Und was bringt uns Menschen eigentlich zum Denken? Was passiert eigentlich in unserem Kopf?
1 Das Wollen ist die Zielrichtung eines bestimmten Denkens oder Handelns. Dem Wollen liegen bewusste Entscheidungen zugrunde, die durch den Willen bestimmt werden.
2 In der Sprache der Philosophie kann man zwischen einer absoluten und einer relativen Bedeutung dieses Begriffs unterscheiden. Das Gute wird einmal als Eigenschaft eines Gegenstandes, Zustandes, Ereignisses, einer Handlung verstanden, die diesen an sich zukommt. Als gut wird auch noch bezeichnet, was gut zu oder für etwas anderes ist. Das Gute meint dann die funktionale Brauchbarkeit von Gegenständen, Tieren und Menschen zu einem bestimmten Zweck. Die von Aristoteles begründete praktische Philosophie behandelt das menschlich Gute als letzten Willen menschlichen Wollens und Tuns, das allein um seiner selbst erstrebt wird.
3 Der Tierforscher und Psychologe Duane Rumbaugh von der Georgia State University konnte in seinem Experiment für die NASA beweisen, dass zwei Rhesusaffen nach drei Monaten Lernen Computerspiele mit dem Joystick beherrschten.
Grundgedanken dazu:
Die Gesamtheit des Denkens bezieht alles ein,
in dem Denken in Denkbereichen geschieht,
das durch Denkgrundsätze,
die als Logik bezeichnet werden, geregelt wird.
Aus dem Denken,
in dem viele Gedanken enthalten sind,
entstehen Ideen, die Bilder sind,
die sich der Geist von einer Sache macht.
Ich denke etwas. Weiß ich auch,
ob der andere das gleiche denkt?
In der Annahme, dass ich das glaube,
entstehen Fehler in der Kommunikation miteinander.
Erst im logischen Sinn des Zustimmens





























